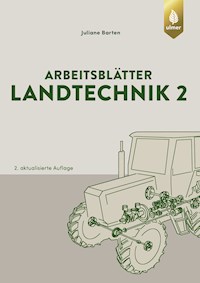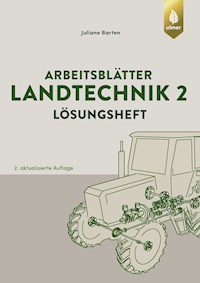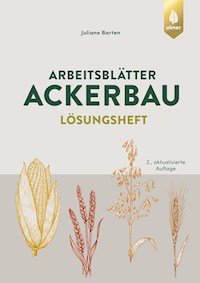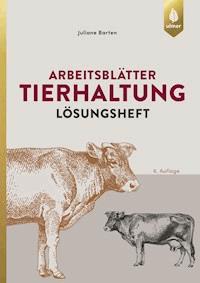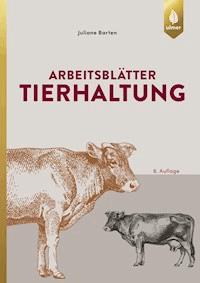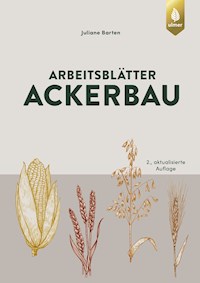
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Eugen Ulmer
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Die Arbeitsblätter Ackerbau können Sie vielseitig einsetzen - als Lernkontrolle, Lernhilfe und Unterrichtsmittel. Egal ob Schüler oder Lehrer - mit den Arbeitsblättern können Sie gezielt Ihr Wissen vertiefen, Erlerntes wiederholen oder kontrollieren. Viele Tabellen und Abbildungen zum Thema ermöglichen ein abwechslungsreiches und ganzheitliches Lernen zu den Themen: Standortfaktoren, Pflanzenernährung und Düngung; Unkrautbekämpfung und Pflanzenschutz; Anbau von Getreide, Raps, Mais und Hackfrüchten; Feldfutterbau und Futterkonservierung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 67
Ähnliche
Juliane Barten
Arbeitsblätter
Ackerbau
2., aktualisierte Auflage
138 Abbildungen
39 Tabellen
Die in diesem Buch enthaltenen Empfehlungen und Angaben sind von der Autorin mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft worden. Eine Garantie für die Richtigkeit der Angaben kann aber nicht gegeben werden. Autorin und Verlag übernehmen keinerlei Haftung für Schäden und Unfälle.
Bitte setzen Sie bei der Anwendung der in diesem Buch enthaltenen Empfehlungen Ihr persönliches Urteilsvermögen ein.
Der Verlag Eugen Ulmer ist nicht verantwortlich für die Inhalte der im Buch genannten Websites.
Abbildungsverzeichnis:
Die hier angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf das gedruckte Buch.
Titelbild: Bodor Tivadar/Shutterstock.com
Flubacher, Helmut: S. 39 u., 132 o.
Piestricow, Artur: S. 11, 12, 15 u. re., 16, 17,18, 19, 20 u., 21, 22, 23, 24, 29, 36 o., 40, 42, 43, 49, 62, 71 u., 72, 83, 89, 93, 96, 97 u., 110, 114, 116, 132 u., 135
Die übrigen Abbildungen stammen aus dem Archiv des Ulmer Verlags.
Lösungsheft: ISBN: 978-3-8186-1038-8, als e-book erhältlich
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© 2010, 2019 Eugen Ulmer KG
Wollgrasweg 41, 70599 Stuttgart (Hohenheim)
E-Mail: [email protected]
Internet: www.ulmer.de
Lektorat: Pia Fehrenbach
Herstellung: Isabell Scherrieble
Umschlaggestaltung: Atelier Reichert, Stuttgart
Satz: r&p digitale medien, Echterdingen
Produktion: Zeilenwert GmbH | v1
ISBN 978-3-8186-1001-2 (ePub)
1Standortfaktoren
1.1Wetter und Klima
Einflüsse auf die Landwirtschaft
1.2Boden
Kreislauf der Gesteine
Exkurs Gesteinsarten
Entstehung des Bodens (Verwitterung)
Bodenbestandteile
Bodenart
Bodenschätzung
Bodengefüge (Bodenstruktur)
Bodenwasser
Bodenluft
Bodenwärme
Bodengare
Bodenreaktion
Bedeutung von Kalk für den Boden
Bodenlebewesen
Humus
Bodentypen
§ Bundesbodenschutzgesetz
2Pflanzenernährung und Düngung
Aufnahme der Nährstoffe
Aufgabe der Nährstoffe
Nährstoffvorrat
Stickstoff und Stickstoffdünger
Phosphor und Phosphatdünger
Kalium und Kalidünger
Wirtschaftsdünger
Festmist
Flüssigmist
Lagerung und Anwendung
Gründüngung
Strohdüngung
Klärschlamm
§ Klärschlamm Verordnung
§ Düngeverordnung
Berechnung der Grunddüngung
3Unkrautbekämpfung
Unkrautdeckungsgrad und Schadensschwelle
Herbizide, Auflagen
§ Pflanzenschutzgesetz
4Pflanzenzucht und Saatgutvermehrung
§ Sortenschutzgesetz und Saatgut Verkehrsgesetz
5Getreideanbau
Getreidepflanze
Entwicklungsstadien
N-Düngung
Saat- und Saarmenge
Saatbett
Sortenwahl
Krankheiten
Schädlinge
Unkrautbekämpfung
Getreideernte
Kornbergung
Getreidekonservierung und -Lagerung
Trocknungssysteme
6Maisanbau
Maispflanze
Entwicklungsstadien
Klima
Düngung
Sorten
Saat- und Saatmenge
Schädlinge Krankheiten
Pflege und Unkrautbekämpfung
Ernte
7Rapsanbau
Entwicklungsstadien
Sorten
Düngung
Saat
Krankheiten
Schädlinge
Exkurs: Resistenzbildung
Unkrautbekämpfung
Ernte
8Kartoffelanbau
Kartoffelpflanze
Entwicklungsstadien
Exkurs: Metamorphosen
Sortenwahl
Pflanzung
Düngung
Pilzkrankheiten
Exkurs: Pilzkrankheiten
Viruskrankheiten
Schädlinge
Unkrautbekämpfung
Ernte
Lagerung
9Zuckerrübenanbau
Sortenwahl
Saatgut
Saatbett
Düngung
Krankheiten
Schädlinge
Pflege und Unkrautbekämpfung
Ernte
Futterrüben
10Fruchtfolge
11Feldfutterbau und Zwischenfrucht
Mehrjährige Futterpflanzen
Einjährige Futterpflanzen
Zwischenfrüchte
12Dauergrünland
Pflanzenbestand Grünland
Zusammensetzung
Gräser
Obergräser
Untergräser
Leguminosen
Kräuter
Bewertung und Pflege von Grünland
Düngung
Nutzung
Weideformen
Weideeinrichtungen
13Futterkonservierung
Gärfutterbereitung
Silierfähigkeit
Mikroorganismen
Gärverlauf
Silierzusätze
Siliertechnik
Bodentrocknung
Unterdachtrocknung
14Anhang
Tab. A1 Nährstoffentzüge (dt/ha) einiger Ackerkulturen in Erntegut und Ernterest bei unterschiedlicher Ertragserwartung
Tab. A2 Versorgungsbereiche der Bodennährstoffe und Düngungsempfehlungen
Tab. A3 Nährstoffentzüge des Dauergrünlandes in Abhängigkeit von Pflanzenbestand und Schnitthäufigkeit
Tab. A4 Mittlere Nährstoffgehalte organischer Dünger
1Standortfaktoren
1.1Wetter und Klima
Die Arbeit des Landwirts wird weitestgehend von Klima und Wetter beeinflusst.
Erklären Sie die Unterschiede zwischen Wetter und Klima.
Klima: ..........
Wetter: ..........
Nennen Sie die Faktoren, die das Wetter bzw. das Klima bestimmen.
..........
Zur Messung der Lufttemperatur wird .......... verwendet.
Der Luftdruck wird mit .......... gemessen.
Diese Faktoren wiederum stehen in engem Zusammenhang mit der geographischen Breite, der Höhe über dem Meeresspiegel, der Lage zum Meer sowie der Morphologie. Erklären Sie die Zusammenhänge.
Geographische Breite: ..........
Höhe über dem Meeresspiegel: ..........
Lage zum Meer: ..........
Morphologie: ..........
Beschreiben Sie die Lage Ihres Betriebes im Zusammenhang mit den Faktoren.
..........
Über dem Meeresspiegel (NN) beträgt der Luftdruck: ..........
Mit zunehmender Höhenlage ..........
Gemessen wird der Luftdruck mit einem ..........
Steigender Luftdruck bedeutet: ..........
Die Wetterämter messen den Luftdruck jeden Tag an vielen Orten der Erde. Die Ergebnisse werden in Wetterkarten zusammengetragen. In den Wetterkarten werden Orte mit dem gleichen Luftdruck durch Linien verbunden.
Diese Linien werden .......... genannt.
Erklären Sie die Ausdrücke:
Tiefdruckgebiet: ..........
Hochdruckgebiet: ..........
Tiefdruckgebiete entstehen häufig: ..........
Und wandern nach ..........
Sie bringen ..........
Hochdruckgebiete entstehen häufig ..........
Sie bedeuten meistens ..........
Erklären Sie die Entstehung von Winden und tragen Sie in die Abbildung ein, welche Winde warme, kalte, feuchte und trockene Witterung bringen:
..........
Die Luft enthält Wasser in Form von ..........
Mit Luftfeuchtigkeit gesättigte Luft enthält je m3 g H2O. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?
..........
Erklären Sie den Ausdruck relative Luftfeuchtigkeit.
..........
Gemessen wird die relative Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer.
Wie hoch ist die relative Luftfeuchtigkeit, wenn morgens bei 10 °C und 9 g H2O die Luft gesättigt ist und sich die Temperatur bis Mittag auf 25 °C erhöht?..........
Welche Folgen hat die Übersättigung der Luft mit Wasserdampf?
..........
Beschreiben Sie den Vorgang
a) der Wolkenbildung:
..........
b) der Wolkenauflösung:
..........
Erläutern Sie die Tagestemperaturkurve im Sommer.
..........
Unser Wettergeschehen wird hauptsächlich von Warm- und Kaltluftströmungen bestimmt. Erklären Sie die Zeichen: Bestimmen Sie die Wetterverhältnisse an der Erdoberfläche und tragen Sie die Namen der Wolkenformen ein.
Temperatur
..........
..........
..........
Luftdruck
..........
..........
..........
Feuchtigkeit
..........
..........
..........
Wolkenform
..........
..........
..........
Durch starke Abkühlung kann es in klaren Nächten zur Bildung von Kaltluftseen kommen. Wo entstehen sie?
..........
In welchen Lagen besteht Nachtfrostgefahr?
..........
Welche Pflanzen sind besonders gefährdet?
..........
Für das Geländeklima sind entscheidend:
a) Einfallswinkel der Sonne: ..........
b) folgende Faktoren: ..........
Einflüsse auf die Landwirtschaft
Die Witterungsumstände sind für den Landwirt in vielerlei Hinsicht von Bedeutung. Wichtig sind Sie besonders zur Vorhersage und Einschätzung bei der Ausbreitung von Krankheiten und Schädlingen. Aber auch das Verhalten von Pflanzenschutzmitteln sowie die Düngung werden von den Witterungsumständen beeinflusst.
Nennen Sie drei wichtige Schadpilze sowie die für deren epidemische Vermehrung notwendigen Witterungsvoraussetzungen.
..........
Welchen Einfluss hat die Witterung auf die Düngung?
..........
Die Witterung beeinflusst ebenfalls das Verhalten von Pflanzenschutzmitteln. Erklären Sie die Zusammenhänge.
..........
1.2Boden
Die Grundlage der landwirtschaftlichen Produktion ist der Boden. Zusammensetzung und Qualität beeinflussen die Ertragsfähigkeit und die Ertragssicherheit wesentlich. Entscheidend dafür ist vor allem das Ausgangsgestein.
Verbreitung der Ausgangsgesteine wichtiger Bodenbildung:
Berichten Sie über das Ausgangsgestein am Standort Ihres Betriebes.
..........
Kreislauf der Gesteine
Auch die Gesteine unterliegen einem Kreislauf, an dem eine große Zahl von Prozessen beteiligt ist. Beschreiben Sie den Kreislauf anhand der Abbildung und nennen Sie die Prozesse.
..........
Exkurs: Gesteinsarten
Die Gesteine werden in drei Gesteinsarten unterteilt. Nennen Sie Beispiele und ergänzen Sie:
1. Magmatite
Plutonite (Tiefengestein)
..........
verwittern leichter als die feinkörnige Ergussgesteine
→verwittern zu Sand oder sandigem Lehm
Vulkanite (Ergussgestein)
..........
→verwittern zu steinigem bis tonigem Lehm
Jeder Vulkanit hat als chemisches Gegenstück einen Plutonit. Sie gleichen sich in der chemischen Zusammensetzung, unterscheiden sich jedoch aufgrund der Kristallisation.
2. Sedimentgesteine
TrümmergesteineLockersedimentewird durch Diagenese zuFestsediment..........
..........
Biogene Sedimente
Entstanden aus Skelett- und Schalenresten von Tieren
→z. B. ..........
Chemische Sedimente
leichtlösliche Salze, die wieder ausgefällt werden, Entstehung von Salzlagern
→z. B. ..........
Organische Sedimente
aus organischen Rückständen von Tieren und Pflanzen entstanden
→z. B. ..........
3. Metamorphite
Ausgangsgesteinwird durch Metamorphose zuUmwandlungsgestein..........
..........
Entstehung des Bodens – Verwitterung
Die Entstehung der Böden vollzog sich in Millionen von Jahren. Bezeichnen Sie die wirksamen Kräfte der Bodenbildung:
..........
..........
..........
..........
..........
Die Verwitterung setzt sich auch auf unseren Böden ständig fort. Die Verwitterungsprodukte bleiben nicht an Ort und Stelle. Sie werden von verschiedenen Naturkräften abgetragen und an andere Standorte umgelagert.
Unterschieden wird in:
Ortsböden
Umgelagerte Böden
Bodenbildende Gesteine:
Transportierende Kräfte
es entstehen:
..........
..........
..........
Nach Art der Verwitterung wird unterschieden in physikalische, chemische und biologische Verwitterung.
Beschreiben Sie die Verwitterungsarten und nennen Sie Beispiele:
physikalische Verwitterung:..........
chemische Verwitterung:..........
biologische Verwitterung:..........
Welche Maßnahmen dienen der Verhinderung der Bodenabtragung?
..........
Bodenbestandteile
Der Boden setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen. Nennen Sie diese.
..........
Durch die Verwitterung des Ausgangsgesteins entsteht ein Gemisch aus unterschiedlichen Korngrößen. Ergänzen Sie die Größenangaben.
Beurteilen Sie die Zusammensetzung der Böden in Ihrem Betrieb. Machen Sie hierzu
a) eine Fingerprobe. Wie erkennen Sie die mineralischen Bodenbestandteile?