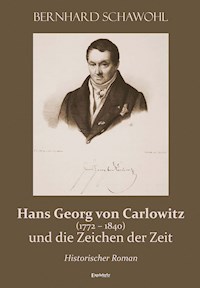Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Dieses Buch wendet sich an jüngere Leser, aber auch an die »Generation Woodstock«. Es ist Essay, erzählte Geschichte »oral history« auf der einen, Sammlung historischer Fakten auf der anderen Seite. Das Buch berichtet von den 30 Jahren in der neuen Republik, vom Weg Dresdens zu einer blühenden und politisch lebendigen Landschaft. Aber es erzählt auch von den durch den Autor bewusst erlebten 30 Jahren davor. Politische und berufliche Zäsuren, die sein Leben nachhaltig beeinflussten, werden thematisiert: Die kubanische Revolution 1959, die Niederschlagung des Prager Frühlings 1968, die Herbstrevolution 1989 und der Niedergang unseres demokratischen Systems in der Gegenwart. Ohne nostalgische Verklärung wird an verschiedene Konzepte erinnert, die auf dem Weg zum Sozialismus entwickelt und, soweit der Arm Moskaus reichte, verhindert worden sind. Bis nach Jugoslawien, China und Italien reichte er nicht. Davon wird hier erzählt. Im Mittelpunkt stehen aber der Sozialismus in den »Farben der DDR« vor 1971 und der »Sozialismus mit menschlichem Antlitz«. Von letzterem, entwickelt in Prag 1968, ging der Impuls des »Dritten Weges« aus, der weltweit ausstrahlte. Besonders der europäischen Sozialdemokratie wurde er bis zur Jahrtausendwende zur Richtschnur. Die Industrialisierung der Landwirtschaft in der DDR hat der Autor genauso hautnah erlebt, wie den Aufbruch der Geisteswissenschaften in den 80er Jahren. In seinem Resümee stellt der Autor Thesen auf, in denen er die Neue Chinesische Seidenstraße als das hoffnungsvollste Friedensprojekt der jüngeren Geschichte bezeichnet. Weitere Thesen befassen sich mit dem dringend notwendigen Umbau unserer Demokratie – bei Strafe ihres Untergangs. Ein Literaturverzeichnis und ein Personenregister finden sich im Anhang.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ich möchte gern
was auf der Erden und im Himmel ist
erfassen
die Wissenschaft und die Natur
Wie alles sich zum Ganzen webt
eins in dem andern wirkt und lebt!
Daß ich erkenne
was die Welt im Innersten zusammenhält
Das ist der Weisheit letzter Schluß:
Nur der verdient sich
Freiheit wie das Leben
der täglich sie erobern muß!
Goethe
Foto: Timm Stütz 2018
Als erster von drei Söhnen der damaligen Schneiderin Christine und des Medizinstudenten Peter wurde Bernhard Schawohl 1950 geboren. So studierte er schon vor der Öffnung der Berliner Mauer Agrarwissenschaften, Arbeitsökonomie, Philosophie und Kulturwissenschaften. Im Hause der Großeltern und Eltern wurde er schon in früher Jugend mit den Problemen der Zeit vertraut gemacht. Dazu trug auch der links-intellektuelle Freundeskreis der Eltern bei. Mit dem Besuch der Bezirksparteischule 1972/73 begann der Autor, sich für verschiedene Denkweisen und Philosophien, besonders die von Karl Marx, zu interessieren. Sein Hauptberuf, der eines „Kritischen Kritikers“, begleitete ihn während seines ganzen Berufslebens. Bis 1983 arbeitete er in der Landwirtschaft und war kurzzeitig Parteifunktionär. Mit seinem Wechsel in den Kulturbereich, dort tätig als Sekretär einer Forschungsgemeinschaft zur Kulturgeschichte und erster Redakteur der DRESDNER HEFTE, konnte auch er in den 80er Jahren zu jenem geistigkulturellen Klima beitragen, das zur Herbstrevolution 1989 führte. Seit dem 6.November 1989 ist Bernhard Schawohl parteilos. Obwohl vom Abbruch der Revolution enttäuscht, engagierte er sich in verschiedenen Gremien. 1992 schied er aus der aktiven Politik aus und arbeitet seit 1998 als freier Autor. Bernhard Schawohl ist Vater dreier Kinder und hat, in zweiter Ehe, drei Enkel und eine Urenkelin. Er lebt seit 1960 in Dresden.
Publikationen
•Diverse Aufsätze und Artikel in Zeitungen und Zeitschriften (1973 –2002)
•Wissenschaftliche Monografien (1976 – 2019)
•Redekonzepte für Politik, Wirtschaft und Kultur (1992 – 2001)
•Saxobold – ein Kindermagazin. Dresden-Verlag GmbH. Dresden 1990.
•Das Sparkassenhaus Dresden. Verlag WDS Pertermann Dresden 1994
•Von Linientreue und Marktdynamik – Geschichte der Verkehrsbetriebe Dresden seit der Wende. Verlag WDS Pertermann. Dresden 2002
•Es gibt kein richtiges Leben im falschen. Erinnerungen-Reflexionen 1957 – 2015. Weltbuch-Verlag. Dresden 2015
Bernhard Schawohl
AUCH IM FALSCHENGIBT ES EIN RICHTIGESLEBEN
Erinnerungen und Reflexionenaus sechs Jahrzehnten erlebter Geschichte 1957-2019
Ein Beitrag zum 30. Geburtstag der neuen BundesrepublikDeutschland am 3. Oktober 2020
Engelsdorfer VerlagLeipzig2019
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de/DE/Home/home_node.html abrufbar.
Copyright (2019) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Bernhard Schawohl + Gerberstraße 10 + 01257 Dresden
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2019
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Einladung
Statt eines Vorwortes
1989
Revolution ohne Kirchenglocken
Wie ich die Herbstrevolution und ihren Abbruch erlebte.
1957 – 1970
Ex oriente lux
Meine Einschulung. Wie ich ein Freund der Sowjetunion wurde.
Wie ich Ernst Thälmann an „die Russkis“ verkaupelte
Von einer alten Frau, die ihr „Russenkind“ nicht wollte.
Das optimistische Jahrzehnt
Ein kleines Denkmal für meine Lehrerin. Die „Golden Sixties“ meiner Generation. Sozialismus in den „Farben der DDR“.
Mirek schreibt nicht mehr
Der Prager Frühling 1968 und das Lehrstück „3.Weg“.
1970 – 1989
Antonio Gramsci + J.K
Wie mir die politische Philosophie des Mitbegründers der kommunistischen Partei Italiens und die meines verehrten Lehrers Jürgen Kuczynski zum Credo wurde. Über einen ausgefallenen Theaterskandal und die Folgen.
Industrielle Revolution auf dem Lande
Wie ich die zweite Umwälzung des bäuerlichen Lebens in den 70er Jahren erlebte.
Polenkönig
„Deine Polacken streiken schon wieder!"
Solidarność? Hier bitte nicht!
Meine Arbeit als Gewerkschaftsfunktionär und ihr schmähliches Ende.
Als Friedrich der Große geritten kam
Historiker entzünden in den 1980ern ein Feuerwerk. Meine Arbeit als Sekretär einer Forschungsgemeinschaft zur Kulturgeschichte und Redakteur der DRESDNER HEFTE
Von der Banalität des Bösen
Einblick in meine Stasi-Akte.
1990 – 2019
Der große Liquidator
Die Treuhand. Und wir?
Erste Reisen
„Kulturschocks“ im Westen – in Episoden erzählt.
Glückloser Akteur
Wie ich einen Verlag gründete und damit scheiterte
Erste freie Wahlen mit Pferdefuß
Auf den Knien und mit der weißen Fahne in der Hand.
Aufbau Ost
Die blühende Landschaft Dresden und ihre Gärtner. Wie frei ist die Presse als vierte Gewalt im Staate? Geschäftsführer des Stadtanzeigers Pirna. Pressearbeit bei der Stadtsparkasse Dresden.
Neue Begegnungen
Greta Wehner. Eine tiefe Freundschaft zur Witwe des „Zuchtmeisters der SPD“.
Bonn – Berlin in neuem Licht
Über den Dächern von Bonn. Ein Nachtgespräch mit dem Historiker Heinrich Potthoff.
Zwei Anwälte des Teufels?
Meine Begegnungen mit Wolfgang Vogel und Alexander Schalck-Golodkowski
Soziale Marktwirtschaft auf sozialistisch
Anfang vom Ende – der VIII. Parteitag der SED. Ein Rückblick.
Don Camillo und Peppone
Das Gespenst des Kommunismus schläft nicht. Italien. Jugoslawien. Österreich. China.
Krieg oder Frieden
Gegen den Mainstream: Gedanken zur „Neuen Seidenstraße“.
Demokratie Jetzt! Ein Umbau ist ohne Alternative
Laß' uns dir zum Guten dienen - Deutschland, einig Vaterland!
Thesen
Literatur
Personenregister
EINLADUNG
Statt eines Vorwortes
Welcher Autor lädt nicht gerne dazu ein, sein Buch zu lesen? Das vorliegende wird bei Ihnen – je nach Altersstufe und Himmelsrichtung – Erinnerungen wachrufen, Zustimmung finden, Widerspruch herausfordern, vielleicht sogar zu neuen Erkenntnissen führen. Die Jüngeren, von denen ich mir besonders viele interessierte Leser wünsche, sollen von einem Märchenland erfahren, in dem es für alle genügend süßen Brei zu essen gab. Gebratene Tauben, die den Leuten ins Maul flogen, wurden allerdings nicht gesichtet. Es war ein Land voller guter Ideen und kreativer Menschen, in dem es zugleich Finsternis und böse Kobolde gab. Ein Märchenland, das sich selbst täglich Märchen zur Selbstermutigung erzählte: Das Land ihrer Großeltern.
Das Land, in dem diese hofften und litten, das ihnen enge Heimat war und Enttäuschung zugleich. In dem sie sich geborgen fühlten und von der weiten Welt nur träumen konnten. In dem sie das Bild von einer lichten Zukunft hatten, die sich so schwer einstellen wollte und schließlich ganz abhandenkam…
Meine Hoffnung in die Generation der Enkel ist groß. Die Enkel fechten‘s besser aus, sagt man. Diese Generation wird, so hoffe ich, die sozialen Medien als asoziale erkennen. Denn sie behindern das persönliche Gespräch; verbreiten zunehmend Hasstiraden und Mobbing. Sie soll nicht jeden Pups via Facebook in alle Welt verbreiten. Und jeden Furz, der daher kommt, als bare Münze nehmen. Sie wird, so hoffe ich, der „Droge Netz“, die ihre Hirne unmerklich und mit Tücke krankhaft verformt, nicht verfallen sein. Sie wird, so hoffe ich, Neugier darauf entwickeln, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und ihre Neugier auch via Internet stillen, das einst als eine Revolution der Denkzeuge in die Welt gekommen ist.
Und sie wird auch, so hoffe ich, die alte Kunst des Disputierens, die heute verloren ist, neu erlernt haben. Dem Rate ihres Großvaters dabei folgend: „Einen hören ist keinen hören“. Und dem noch viel älteren Rat, welcher aus der merkenswerte Geschichte von Fausten spricht: Während des Osterspaziergangs mit seinem Assistenten Wagner fachsimpelt Faust mit ihm, während sich ein schwarzer Pudel zu ihnen gesellt. Der verhält sich auffällig und ungewöhnlich. Faust zu Wagner: „Bemerkst du, wie in weitem Schneckenkreise/Er um uns her und immer näher jagt?/Und irr ich nicht, so zieht ein Feuerstrudel/Auf seinen Pfaden hinterdrein.“ Im Studierzimmer angekommen, verwandelt sich der Pudel in Mephisto, den Teufel: „Das also war des Pudels Kern!“, entfährt es Faust.
Das Zentrum in unserem Haus bildet der Esstisch meiner Großeltern. Sie haben ihn in den zwanziger Jahren gekauft. So hat er schon tausend Gespräche über freudige Ereignisse und Kümmernisse in der Familie, über Gott und die Welt gehört. An ihm herrscht Handy-Verzicht. So kann er noch heute Diskussionen in sich aufnehmen und speichern. Sie gehen – wie in seinen jungen Jahren – oft um aktuelle Politik. Dass die Themen „Neue Chinesische Seidenstraße“ und „Bedingungsloses Grundeinkommen“ in dieses Buch aufgenommen wurden, verdanke ich solchen Gesprächen am runden Tisch und einer Anregung meiner Tochter Anne.
Eine letzte Hoffnung, die ich in Bezug auf unsere Enkel habe, ist die, dass sie dem Wahn stetigen Wachstums und maßlosen Konsums entsagt haben werden.
In ihrer Zeit wird ganz objektiv, völlig unabhängig von meiner Hoffnung, die ostdeutsche Spezies ausgestorben sein oder auf den Herbst ihres Lebens zugehen. Unsere Enkel wird es nur in den Exemplaren Nord- und Süddeutsche, Ost- und Westdeutsche geben.
Die Enkelgeneration hat schon damit begonnen, die Generation ihrer Eltern und Großeltern herauszufordern wie die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg: „Ich möchte nicht, dass ihr hoffnungsvoll seid. Ich möchte, dass ihr in Panik geratet!“ In Panik geratet, weil ihr die Grenzen des Wachstums, wie sie der Club of Rom schon vor einem halben Jahrhundert beschrieb, in maßloser Konsumgier missachtet. Der „Skolstreijk för Klimatet“ wird als Regelverstoß gegen die Schulpflicht, als Provokation gescholten. Zum Teil auch von jenen, deren Generation einst mit „Make love, not war!“, mit Sex, Drugs und Rock´n´Roll, die Welt von Amerika bis Tokio provozierten. Denen „I can´t get no satisfaction“ der Rolling Stones zur Hymne wurde. Deren Rebellion die Welt veränderte, sogar das Ende des Vietnam-Krieges erzwang.
Wir sollten die Enkel nicht schelten. Wir sollten unseren Enkeln ein Paket Stullen schmieren, und es ihnen zur Stärkung freitags mit auf den Weg geben. In den freitäglichen Schulstreiks, oder in der Aktion „Plant-for-the-planet“, bei der Jugendliche weltweit Bäume pflanzen, und bei vielen anderen Aktionen wird deutlich, dass die Generation unserer Enkel beginnt, sich ihrer geschichtlichen Aufgabe bewusst zu werden. Der Aufgabe nämlich, die Zukunft zu gestalten und dieses Gestalten selbstbewusst in die eigene Hand zu nehmen. Sie hat alle Chancen. Sie ist frei von historischen Lasten, die ihre Eltern und Großeltern noch zu tragen hatten.
Den heute 30- bis 50-jährigen, der „Wendegeneration“, sollte kein Vorwurf gemacht werden. Etwa der, schläfrig geworden zu sein; satt und zufrieden. Seine eigene und die der Kinder Existenz zu sichern, ist in heutigen Tagen keine kleine Leistung. Jene von ihnen, die noch in der DDR oder im Osten der neuen Republik geboren wurden, hatten das Trauma gebrochener Biografien, was tausende ihrer Eltern erfuhren, mit zu verkraften. Und sie hatten sich als Heranwachsende oder eben flügge Gewordene in einer Welt zu behaupten, in der sie sich weitgehend selbst orientieren mussten. Elterlicher Schutz und Rat in tausend Fragen des täglichen Lebens wurde ihnen nur spärlich oder gar nicht zuteil. Denn ihre Eltern kannten sich selbst noch nicht aus in der völlig neuen und fremden Welt, die über sie gekommen war.
Dieses Buch erzählt von den rund 60 Jahren, die ich als politisch denkender Mensch erlebt habe. In der ersten Hälfte meines bewussten Lebens war es die „Partei der Arbeiterklasse“, zu deren Politik es keine Alternative gab. „Die Partei, die Partei hat immer recht“, hieß es in einem Lied. In der zweiten Hälfte erlebte ich Kanzler, dann eine Bundeskanzlerin, die eine Reihe ihrer politischen Entscheidungen selbst als „alternativlos“ empfanden oder sogar direkt als solches bezeichneten. Wie lebensfremd, wie undialektisch, wie antidemokratisch, wie falsch!
So nimmt es nicht wunder, dass ich mir bei der ersten Ausgabe dieses Buches 2015 als Titel den berühmten Ausspruch Adornos lieh, um den er ein ganzes Gedankengebäude errichtete: „Es gibt kein richtiges Leben im falschen“. Falsches umgab und umgibt uns tagtäglich mehr, als ein zartes Gemüt ertragen kann. Wie wir heute erkannt haben, wurden viele Weichen, die von der großen Politik gestellt wurden, falsch gestellt. Und heute noch klagen wir zurecht über jede neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Nicht selten ist es gleich eine ganze Rotte. „Bitte keine Fehlerdiskussion!“ wurden wir einst in jeder SED-Parteiversammlung ermahnt. Und später wurden wir zum undankbaren „Jammer-Ossi“ gestempelt, wenn wir Enttäuschungen und Fehler beim Namen nannten.
Wer nicht bereit ist, aus seinen Fehlern zu lernen, ist auf die Länge zum Scheitern verurteilt. Dafür haben wir Ostdeutschen ein besonderes Gespür. Wenn es gelänge, anlässlich des schönen Jubiläums 2020 eine bundesweite „produktive Fehlerdiskussion“ zu führen – kultiviert, ohne Tabus, ohne Schuldzuweisungen – welch großen Schritt könnten wir in Richtung Vollendung der deutschen Einheit tun!
Seit 2015, seit Erscheinen meines Buches in seiner ersten Auflage, habe ich viel gelernt. Vieles neu durchdacht. Manches neu bewertet. Mit meinem Buch möchte ich Ihnen, lieber Leser (und damit meine ich jede Leseratte, gleich welchen Geschlechts), ein wenig Mut machen. Denn:
AUCH IM FALSCHEN GIBT ES EIN RICHTIGES LEBEN!
Mit dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums 1991 schien Francis Fukuyamas These vom „Ende der Geschichte“ bewiesen zu sein. Mit dem postulierten Sieg der liberalen Demokratie über autoritäre Systeme verschiedenster Ausprägung könne die US-amerikanische Wirklichkeit als Endpunkt der Geschichte, als Höchstform in der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft angesehen werden.
Der renommierte amerikanische Politikwissenschaftler irrte. Noch ist vieles offen. Noch ist nicht entschieden, ob die Welt ihre Balance durch ein neues Gleichgewicht des Schreckens, oder im friedlichen Handel rund um den Globus findet. Noch ist nicht entschieden, ob die weltweiten Entwicklungen, darunter die in Deutschland, innerhalb der drei Jahrzehnte nach Erscheinen Fukuyamas‘ Buches eher dem Gedanken Friedrich Wilhelm Nietzsches recht geben, nach dem die Geschichte die ewige Wiederkunft des Gleichen sei. Allein die weltweit entbrannten Kriege, der neuerliche feindselige Blick auf Russland und die damit verbundene Wiederaufrüstung, das Erodieren der Gesellschaften und das Erstarken von Nationalismus und rechtem Denken genügen, Nietzsches These als gräuliche Wahrheit zu empfinden.
Nur wenigen Generationen ist es wiederfahren, den Zusammenbruch eines Imperiums, das Ende einer Epoche zu erleben. In solchen Zeiten läuft die Geschichte Galopp. Sie wird zum Laboratorium, zum Prüfstein philosophischer, soziologischer, politischer Theorien. In unserem konkreten Fall hat sie uns gerade 18 Jahre Zeit gegeben, dem Scheitern einer Idee beizuwohnen – vom VIII. Parteitag der SED 1971 bis zur Maueröffnung 1989.
Marxens Aufforderung, die Welt zu verändern, statt sie immer nur zu interpretieren, muss, glaube ich, auf den Kopf gestellt werden. Veränderungen, die geistig längst nicht durchdrungen sind, hielten die letzten drei Jahrzehnte und hält die Gegenwart genug bereit.
„Was ist schief gelaufen bei der deutschen Wiedervereinigung?“ – unter dieser Überschrift wird heute, da wir auf den dreißigsten Jahrestag dieses Ereignisses zusteuern, leidenschaftlich debattiert, wissenschaftlich geforscht, Theater gespielt, Literatur geschrieben – kurz, es wird fleißig um Interpretation gerungen. Was soll schief gelaufen sein bei der deutschen Wiedervereinigung? Nichts ist schief gelaufen. Alles ist so gekommen, wie es die Mehrheit der Ostdeutschen wollte. Nur wussten sie nicht, was geschieht, wenn geschieht, was sie wollten. Manchem wird der Wahlabend vom 18. März 1990 noch in Erinnerung sein. Dem einen in guter. Dem anderen in bitterer. Otto Schily, der spätere Innenminister, hielt eine exotische Frucht in die Kamera. Die Leute hätten „Banane“ gewählt, kommentierte er.
Während ich hier sitze, um die zweite Auflage meiner „Erinnerungen und Reflexionen“ vorzubereiten, blicken wir auf die gewaltige Alpenkulisse am Gardasee. Der Campingplatz in Limone ist voller junger Familien aus allen deutschen Landen und Polen. Vor wenigen Jahren noch war der unsere vor allem von holländischen Campingwagen umringt… Es ist Mai 2019, der Kühlschrank voller Bananen. Uns geht es gut. Und doch lässt sich nicht leugnen, dass unsere Gesellschaft von einer unheimlichen Krankheit, einer nagenden Unzufriedenheit befallen scheint. Wer heilen will, muss sich zunächst um eine klare Diagnose bemühen. Die vorliegenden „Erinnerungen und Reflexionen“ wollen dazu einen Beitrag leisten.
Mein Leben als politisch denkender Mensch teilt sich annähernd genau zur Hälfte in ein Leben vor und ein Leben nach der Öffnung der Berliner Mauer. „Zusammenbruch eines maroden Kartenhauses“ namens DDR, „politische Wende“, „friedliche Revolution“ – bis heute gehen die wertenden Deutungen dieses weltpolitischen Ereignisses auseinander. Mit dem Thema „Zusammenbruch? Wende? Revolution?“ wird sich 2020 vermutlich eine Flut von Publikationen befassen.
Wenn auch ich mich anschicke, dem geneigten Publikum meine Gedanken zum Thema zu präsentieren, dann nicht ganz ohne wissenschaftlichen Anspruch. Vielleicht ist es aber eine Besonderheit des vorliegenden Buches, „kleine und große Welt“ miteinander zu verknüpfen. Es ist Essay, erzählte Geschichte „oral history“ auf der einen, Sammlung geschichtlicher Fakten auf der anderen Seite. Auch an Witzen und Liedern aus der DDR – für die Älteren vielleicht zum Mitsingen – fehlt es nicht. Allerdings muss ich Sie in diesem Falle um einen Aufruf der hörenswerten Lieder im Internet bitten. Denn die Texte durfte ich aus urheberrechtlichen Gründen nicht in den meinen aufnehmen.
Und eine zweite Besonderheit könnte sein, das es nicht nur von den 30 Jahren neuer Republik, sondern auch den von mir bewusst erlebten 30 Jahren davor erzählt.
Für die Zeit der DDR könnte gelten: Marx war die schöne Theorie, Murks die Praxis. Mit dem bekannten Bonmot ist vieles, aber längst nicht alles erklärt. In diesem Land DDR wurden uns Lieder gelehrt, die von einer kleinen weißen Friedenstaube erzählten, die allen Menschen Frieden bringt, von einem Land, das dem Volke gehört, von einer Jugend, die aufbaut und ein Ziel vor den Augen hat, damit sie sich in der Welt nicht irrt. Und auch das Lied „Druschba, Freundschaft!“ wurde gern gesungen.
„Sozialisation“ nennt man das, wie ich nach 1989 erfuhr. Natürlich war das heute aus der Mode gekommene Liedgut nur ein Teil dieses Prozesses. Prägend waren vor allem das Elternhaus und ein links-intellektueller Freundeskreis der Eltern, von dessen Einfluss auf mich hier erzählt wird. Prägend waren auch Lehrer, von denen die einen auf subtile Weise Wiederstand leisteten und meine Bewunderung erfuhren, und andere, die mir in ihrem dialektischen Denken zum Vorbild wurden.
Mit dem Besuch der Parteischule und einem späteren Studium der Philosophie durfte ich die Theorien vieler großer Denker kennenlernen. Keine, die vor oder nach Marx und Engels entwickelt wurden, haben mich so beeindruckt wie deren Weltsicht. Also wurde ich zu einem Anhänger marxistischen Denkens. Das erwies sich in der DDR als gravierender Nachteil. Zumindest dann, wenn man den Marxismus so versteht, wie ich ihn verstehe. Nämlich ganz im Sinne Marx‘, nach dem der Kommunismus keine dogmatische Lehre oder gar Handlungsanweisung ist, nach der sich die Wirklichkeit zu richten haben würde. Von einigen Konflikten, die sich daraus für mich entwickelt haben, erzählt dieses Buch.
Schon 1990 hatten meine Frau und ich das Glück, Greta Wehner kennenzulernen. Dank der Freundschaft zu ihr kamen wir mit Menschen wie Stina-Klara Hjulström, der Vorsitzenden des schwedischen Demenzverbundes, dem Vorsitzenden der SPD Franz Müntefering, dem SPD-Granden Hans-Jochen Vogel, dem renommierten Historiker Heinrich Potthof, oder dem „Advocatus Diaboli“ Wolfgang Vogel in Kontakt und ins Gespräch.
Eine große Zahl von Büchern, geschrieben von Akteuren der jüngsten Geschichte, kam hinzu. Auch Wahrheiten, die wie Peitschenhiebe schmerzten, und doch eine heilende Wirkung hatten:
Wer wusste schon von einem Hotel Lux in Moskau, das der kommunistischen Elite ganz Europas in Zeiten faschistischer Herrschaft zum Asyl und gleichzeitig zum gräulichen Gefängnis wurde?
Wer wusste von Katyn? Dem Ort, an dem tausende polnische Offiziere und Intellektuelle den stalinistischen Erschießungskommandos zum Opfer fielen?
Wer wusste von der Annexion großer Teile Polens durch Stalin, von seinem Teufelspakt mit Hitler?
Wer wusste von den Machtkämpfen innerhalb der SED in den 50er Jahren und danach?
Wer kannte die wahren Gründe, die zum Fortgang so vieler geliebter und für unser Land wichtiger Künstler führten?
Ich jedenfalls nichts.
Neue Begegnungen und ein Berg von „Nachwendeliteratur“ waren es in der Hauptsache, die mir halfen. Die mir halfen, mich in dem Laboratorium der Geschichte, in dem es bis heute stinkt und brodelt, zurechtzufinden.
Eine „zweite Sozialisation“ begann.
Auf Sie, lieber Leser, kommt also ein bunter Strauß von Episoden, Daten, Fakten und Zahlen zu, den ich für mich und für Sie zusammengetragen habe. Sie alle habe ich selbst erlebt und notiert. Wenn nicht, sind sie akribisch recherchiert. Viele Menschen werden Ihnen begegnen. Auch solche, deren Namen ich nicht nennen werde. Das hat seinen Grund. Die einen waren Opfer, die anderen Täter. Mir steht es fern, Kainsmale auf anderer Menschen Stirn zu schlagen.
Im Rahmen dieses Buches habe ich auf einen „wissenschaftlichen Apparat“ klassischer Art verzichtet, weise aber im Text stets auf die Quelle hin, auf die sich meine Aussage bezieht. Auch füge ich am Ende eine Auswahl von Büchern, die mir besonders wichtig waren, hinzu. Und – wie es sich gehört, finden Sie auch ein Personenregister.
Karol Czejarek und Timm Stütz haben mich ermuntert und ermutigt, dieses Buch zu schreiben. Beide traf ich bei deutsch-polnischen Begegnungen. Der eine ist emeritierter Professor an der Universität Warschau und verdienstvoller Übersetzer deutscher Literatur ins Polnische. Der andere ist vielseitiger Autor und Fotograf mit einem Auge, das in der kleinsten Straßenszene gleichsam ein Weltenschauspiel erkennt. Ihnen beiden danke ich sehr.
Dann danke ich meinem Verleger. Tino Hemmann hatte den Mut, einem nicht sehr bekannten Autor eine Chance zu geben. Und ich danke seinem Team, das die ordentliche Gestaltung meines Buches besorgte.
Nicht zuletzt gilt mein Dank Anja Fischer. Sie ist die Klassenlehrerin meiner Enkelin Pauline und unterrichtet sie in deutscher Sprache. Sie half mir, dieses Buch ordentlich korrigiert an den Leser zu bringen.
Besonders aber danke ich meiner Frau. Sie ertrug mit Geduld meine fast sechswöchige Abwesenheit vom Gardasee direkt am Gardasee. In Gedanken war ich nahezu ausschließlich bei meinem Buch. Zugleich empfand ich diese Zeit, geschützt vor den Pflichten des Alltags, als eine der intensivsten in unserem fast 40-jährigen Zusammenleben. Rita wurde zum kritischen Begleiter meiner Arbeit und gab mir eine Menge Anregungen.
Ist die Leimrute gelegt? Werden Sie kleben bleiben bis zum Ende des Buches? Wollen Sie mich mit Ihrer Kritik, Ihren Hinweisen, Ihrem Ärger oder Ihrer Freude zu meinem Text überschütten? Dann freue ich mich und bin Ihnen dankbar. Wie Sie mir diese Freude machen können, verrate ich mit Absicht erst am Schluss dieses Buches, wenn Sie sich bis dahin durchgeboxt haben. Denn es soll Ihnen nicht so gehen wie Angela Merkel. Die hatte einem Buch, das viele Wochen landauf und landab Gesprächsthema Nummer Eins gewesen ist, in aller Öffentlichkeit attestiert, es sei „wenig hilfreich“. Gelesen hatte sie es nicht.
Limone und Dresden, im Mai/Juli 2019
1989
REVOLUTION OHNE KIRCHENGLOCKEN
Wie ich die Herbstrevolution und ihren Abbruch erlebte.
Die vielleicht wichtigste Zäsur in meinem politischen Leben waren – wie für Millionen andere auch – die Oktobertage 1989. Sechs Tage vor meinem 39. Geburtstag, dem 9. Oktober, revoltierten 70.000 zweifellos todesmutige Bürger in Leipzig gegen die Sprachlosigkeit der SED und Regierung gegenüber den Entwicklungen in der DDR. Der Protest wandte sich zudem gegen die staatlichen Gewaltexzesse, vor allem die in Dresden am 3. Oktober. Aufgrund des irrsinnigen zentralen Beschlusses, die Sonderzüge mit Flüchtlingen aus der Prager Botschaft durch die DDR fahren zu lassen, war am Hauptbahnhof die Hölle los. Viele Dresdner waren gekommen, um ihren Landsleuten zum Abschied zu winken. Noch mehr waren gekommen, um auf die Züge, die gen Westen fuhren, aufzuspringen. Polizeieinheiten mit einer Ausrüstung, wie man sie nie zuvor sah, einschließlich Wasserwerfern, lieferten sich mit tausenden Dresdnern eine regelrechte Schlacht. Steine, Brand- und Säureflaschen flogen.
Schon zuvor rumorte es in der Stadt, als hundertfache „Zuführungen“ von „Staatsfeinden“ bekannt wurden. An verschiedenen Plätzen Dresdens wurden Demonstranten eingekesselt, auf Mannschaftswagen geladen und in Gewahrsam genommen. Dieser „Gewahrsam“, so berichteten Augenzeugen, erinnerte an schlimmste Zeiten der deutschen Geschichte.
In diesen Tagen habe ich so vollständig versagt, dass ich mich heute noch schäme. Nie zuvor und nie danach waren mein politisches Gespür und mein Verstand derart abwesend. Ich arbeitete zu dieser Zeit an der Kulturakademie Dresden. Heute würde man diese Einrichtung vielleicht „Landeszentrale für politische (Kultur-) Bildung“ nennen. Unter anderem hatte ich eine Dozentur für Ethik und Ästhetik an der Schwesternschule der Medizinischen Akademie „Carl Gustav Carus“, der heutigen Uni-Klinik, inne. Die jungen Frauen hatten für beide Fächer nicht allzu viel übrig, wollten sie doch „einfach nur“ Krankenschwestern werden. Immer wieder war es ihnen gelungen, mich vom tugendlichen Pfad des Lehrplanes abzubringen. Da ich mich bereit fand, mit ihnen über Gorbatschows Politik, über das Verbot des „Sputniks“ und andere in dieser Zeit „kniffligen Fragen“ zu diskutieren, hatte ich mir ihr Vertrauen erworben. Erich Honecker hielt nichts von Gorbatschows „Perestroika“ und „Glasnost“. Als das sowjetische, mit großem Interesse gelesene und von Hand zu Hand weitergereichte Bulletin „Sputnik“ im Herbst 1988 über die Verbrechen Stalins berichtete, riss ihm endgültig die Hutschnur. Höchst selbst verbot E.H. die weitere Verbreitung in der DDR.
Mit dem durch meine offene Diskussion erworbenen Vertrauen war schlagartig Schluss. „Herr Schawohl“, wurde ich gefragt, „was sagen sie denn zu den Verhaftungen und den Prügeleien hinter den Gefängnistüren?“ Ich stellte mich nicht ahnungslos. Ich war ahnungslos: „Woher haben sie denn solche Informationen? Ein Vorgehen dieser Art ist in unserem Lande völlig ausgeschlossen. Verbreiten sie bitte nicht solche Gräuelpropaganda!“ Das war es dann. An dieser Schule brauchte ich mich nicht mehr sehen zu lassen.
Konnte an dem, was die Mädchen berichtet hatten, etwas dran sein? Viele Dresdner wollten wissen, was sich zugetragen hatte. Aber Funk und Fernsehen schwiegen. Auch „vertrauliche Parteiinformationen“ waren nicht zu haben. Einzige Informationsquelle waren die Kirchen. Also besuchten meine Frau Rita und ich eines Tages, es war der 17. Oktober, die evangelische Christuskirche in Dresden-Strehlen. Sie war brechend voller Menschen. Es wurden „Gedächtnisprotokolle“ verlesen. In ihnen schilderten Betroffene, was sie erlebt hatten. Wir wollten unseren Ohren kaum trauen. Wie viel Mut diese von der Staatssicherheit zu absolutem Schweigen verdonnerten Menschen aufbrachten, überstieg den unseren bei Weitem. Der bestand aber immerhin darin, als Genossen in eine Kirche zu gehen, um sich zu informieren. Tags darauf wurden Rita und ich zu ihrem jeweiligen Parteisekretär beordert. Der wollte wissen, wo wir denn am gestrigen Tag, zu der und der Stunde, gewesen seien…
Demjenigen, der diese Protokolle gehört, und sich in der von Hannes Bahrmann und Christoph Links erstellten „Chronik der Wende“ über das ganze Ausmaß der – zum Teil beiderseitigen – Gewalt in der gesamten Republik informiert hat, kann das Wort von der Friedlichen Revolution nicht länger über die Lippen kommen. Andererseits stimmt: Sie verlief unblutig und blieb ohne Lynchjustiz.
Damit zurück zum 9. Oktober in Leipzig. Ein befehlender Stasi-General, wollte an diesem Tag dem „Spuk der Montagsdemonstrationen“ endgültig und mit allen Mitteln ein Ende bereiten. Alles war vorbereitet. Einheiten der Staatssicherheit, Polizei, der „Kampfgruppen der Arbeiterklasse“, ja sogar der Armee standen bereit. Medizinisches Personal war für die Spät- und Nachtschicht dienstverpflichtet, zusätzliche Blutkonserven waren geordert worden. Zudem nährte eine in der „Leipziger Volkszeitung“ veröffentlichte Erklärung die Angst davor, dass es eine chinesische Lösung wie auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking im Juni geben könnte. Da hieß es nämlich: „Die Angehörigen der Kampfgruppenhundertschaft ‚Hans Geifert‘ verurteilen, was gewissenlose Elemente seit einiger Zeit in Leipzig veranstalten […] Wir sind bereit und Willens, das von unserer Hände Arbeit Geschaffene wirksam zu schützen, um diese konterrevolutionären Aktionen endgültig und wirksam zu unterbinden. Wenn es sein muss, mit der Waffe in der Hand.“
Und trotzdem gingen 70.000 Menschen auf die Straße! Generalleutnant Manfred Hummitzsch pfiff die bewaffneten Organe zurück und resignierte: „Auf alles waren wir vorbereitet, nur auf solche Menschenmassen mit Kerzen in der Hand nicht.“ Die Staatsmacht hatte also vor dem Protest des Volkes kapituliert. Insofern kommt dem 9. Oktober in der monatelangen Geschichte der republikweiten Demonstrationen vor und nach der Maueröffnung wohl eine besondere Bedeutung zu.
Der Schock, den mir meine angehenden Krankenschwestern verpasst hatten, saß tief. Was tun? Die Neigung, meinen Standpunkt auf der Straße zu demonstrieren, war und ist bis heute nicht sonderlich ausgeprägt. Aber irgendetwas musste ich doch tun! In der Schublade meines Redaktionstisches waren einige Manuskripte verborgen, die ich bisher nicht veröffentlichen konnte. Gedichte, Aphorismen, Kurzgeschichten. Als Redakteur der DRESDNER HEFTE – meiner zweiten Aufgabe bei der Kulturakademie – hatte ich bisher drei Anthologien veröffentlicht. Da der eine oder andere Autor auf der Beobachtungsliste der Staatssicherheit stand, war das Interesse der „Genossen auf dem Berg“, der Zentrale der Staatssicherheit, an diesen Publikationen entsprechend. Nach Aktenlage muss es der 28. Oktober 1985 gewesen sein, als sie in der Kulturakademie Erkundigungen einzogen. Wie es denn sein könne, dass die Staatsfeindin X und der Staatsfeind Y in den DRESDNER HEFTEN ein öffentliches Podium bekämen? Einer der Texte war ihnen besonders in die Nase gefahren: Ein Baugerüst in der Neustadt, das Passanten vor herabfallenden Brocken eines völlig heruntergekommenen Hauses schützen sollte, war eingestürzt und begrub eine Straßenbahn unter sich. Das Ereignis war Stadtgespräch. Einer meiner Autoren aus dem „Zirkel Schreibender Arbeiter“ machte daraus ein Gedicht. Es war eine überdeutliche Metapher auf die Zustände im Land.
Der Besuch der Genossen muss dem Direktor der Akademie einen furchtbaren Schreck eingejagt haben. Eilig gab er zu Protokoll, dass „… der Sch. als selbstbewußt, mit einem Hang zur Überheblichkeit…“ gelte und nicht selten „…eigenmächtig handelt.“ Die Sache hätte leicht ins Auge gehen können, wenn sich nicht Hans Modrow schützend eingeschaltet hätte. Dem 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED, der später, in den Oktobertagen 1989, als Hoffnungsträger und als „Gorbi von Sachsen“ galt und die Führung des Landes als Ministerpräsident der DDR übernahm, lagen die DRESDNER HEFTE sehr am Herzen.
So kam ich auf die Idee, in aller Eile eine vierte Anthologie zu produzieren, die ich dem Genossen Modrow auf offener Bühne einer Montagsdemonstration überreichen wollte. Sie zeigte auf dem Umschlag das Bild eines trotzigen Jungen, der eine Ähre Weizen – quasi wie ein Samenkorn, das in der Zukunft Früchte trägt – in der Hand hält. Das Heft trug den Titel: „Wir waren. Wir sind. Wir werden sein!“
Voller Tatendrang ging ich zur Montagsdemonstration. Wie ich der „Chronik der Wende“ entnehme, muss es der 27. November gewesen sein, als sich 50.000 Dresdner zu einer Kundgebung auf der „Cocker-Wiese“ versammelt hatten. Zwischen dem Hygienemuseum und dem Fučikplatz gelegen, trug sie ihren Namen seit einem Konzert, das der legendäre Joe Cocker dort gegeben hatte. Hans Modrow war, mit einem einfachen Handmegaphon ausgerüstet, auf einen LKW der Polizei geklettert, um den Massen Rede und Antwort zu stehen. Der ebenso energische wie schmächtige Mann kam gegen die Pfiffe und Sprechchöre nicht an. „Stasi in die Volkswirtschaft!“, „Schluss mit der Führung durch die SED!“ und „Deutschland einig Vaterland!“ wurde skandiert. Ich war bis ins Mark hinein erschüttert. „Sie wissen nicht, was sie tun“, dachte ich und trollte mich, meine Anthologie unterm Arm, deprimiert nach Hause.
Schon vorher hatte mein revolutionärer Elan eine Delle bekommen: Als die bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen um den Hauptbahnhof Anfang Oktober durch die beherzte „Gruppe der 20“ befriedet worden waren, zeigte sich Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer gesprächsbereit. Schon am 26. Oktober verkündete er den Beschluss der außerordentlichen Stadtratssitzung, dass alle Bürger Dresdens aufgerufen sind, die „Gruppe der 20“ in ihrer Arbeit bei der politischen Mitgestaltung zu unterstützen. 14 Arbeitsgruppen wurden gebildet, die ihre Ideen und Vorschläge zu den verschiedensten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens einbrachten. Eine davon, die „Arbeitsgruppe Medien“, wurde am 3. November gebildet. Wenn ich es richtig notiert habe, gehörten ihr der Liberaldemokrat Dr. Kirchberg, Dozent an der Hochschule für Bildende Künste, die Lektorin Birgit Tragsdorf (SED), die Journalisten Johannsen (NDPD) und Kelche vom Kulturbund, sowie Bernhard Schawohl (SED), Redakteur der DRESDNER HEFTE, an. Schawohl, Tragsdorf und Kelche machten es sich zur Aufgabe, einen Entwurf zu einem Mediengesetz für das im Entstehen begriffene Land Sachsen zu erarbeiten. Rolf Garmhausen, einen beliebten und mit der Materie sehr bewanderten Rundfunk-Moderator, riefen wir zu uns. Nächte voller Rauch aus den Köpfen und leerer Zigarettenschachteln vergingen, und wir konnten unseren Entwurf stolz präsentieren. Er bezog Regelungen ein, die von den bundesdeutschen nicht einfach abgeschrieben, aber doch inspiriert waren. Die Tinte unseres Papiers war noch nicht ganz trocken, da ließ Rudolf Mühlfenzl, der Rundfunkbeauftragte der Bundesregierung, wissen: Den Rauch, den wir gemacht hätten, fände er beachtlich. Doch einen Schall würde unser Papier nicht hinterlassen. Der erfahrene Medienmann, zu Hause beim Bayerischen Rundfunk, war einer der ersten von etwa 35.000 Bediensteten aus den „alten Ländern“, die auf den verschiedensten Gebieten im Osten tätig wurden. Angesichts der zunehmenden geistigen Armut allein unserer heutigen Fernsehprogramme bin ich immer noch in unseren Gesetzesentwurf von 1989 verliebt. Aber das ist sekundär. Primär bleibt mir durch dieses ganz persönliche Erlebnis in Erinnerung, dass der Westen schon Einfluss auf unsere Revolution nahm, als sie noch in vollem Gange war. Alexander Schalck-Golodkowski erinnert sich an das erste Telefonat, das er zwischen Kanzler Helmut Kohl und dem neuen ersten Mann in der DDR, Egon Krenz, organisiert hatte: „Als die beiden am 26. Oktober miteinander sprachen… tat sich etwas Entscheidendes: Bislang hatte die Bundesregierung die Geschehnisse in der DDR lediglich aufmerksam verfolgt, jetzt stellte Kohl zum ersten Mal Forderungen: die Neuregelung der Reisefreiheit, eine Amnestie für politische Straftäter und positive Lösungen für die ‚Botschaftsflüchtlinge‘.“ Und weiter: „Anfang November änderte sich die Tonlage in der Bundeshauptstadt drastisch… In Bonn begann die Bundesregierung damit, uns vorzuschreiben, was zu tun war… Wolfgang Schäuble stimmte neue Töne an. Freundlich, aber unmissverständlich machte er deutlich, dass eine finanzielle Unterstützung von der Zulassung oppositioneller Gruppen und der Zusage freier Wahlen abhinge. Die SED solle ihren Führungsanspruch aufgeben und Artikel 1 der DDR-Verfassung entsprechend ändern. Diplomatisch gesehen war das eine Ungeheuerlichkeit – eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der DDR. Historisch war es konsequent. Für die Bundesregierung gab es keine inneren Angelegenheiten der DDR mehr.“ Und Schalck resümiert: „Das (Gespräch Kohl-Krenz, B.S.), und nicht der 9. November, war für mich die Schlüsselsituation. Das war die Wende! […] Spätestens am 9. November wurde das dann für alle Welt sichtbar.“
Doch zurück zu unserer Revolution. Wann hatte sie eigentlich begonnen? Latent begleitete sie die DDR während ihrer ganzen 40 Jahre. In seiner vom Ch.Links Verlag herausgegebenen „Geschichte der Opposition in der DDR 1949 – 1989“ dokumentiert Ehrhart Neubert auf 903 eng bedruckten Seiten die Dialektik von Widerstand und Anpassung akribisch. In meinem persönlichen Erleben begann die Revolution Mitte der 80er Jahre, als Kunst- und Kulturschaffende sich lautstark mit dem „real existierenden Sozialismus“ auseinandersetzten. Höhepunkte dabei waren für mich die X. Kunstausstellung auf der Brühlschen Terrasse 1987/88 und die Uraufführung von Christoph Heins „Ritter der Tafelrunde“ am 12. April 1989 im Kleinen Haus. Nicht zu vergessen die großen Texte und Musiken der Gruppe Silly mit Tamara Danz oder die des widerborstigen Baggerfahrers Gerhard Gundermann. Kaum einer, der in der DDR bei „Albatros“ von Karat nicht mitsang: Ist der stolze und freie Vogel, „gefangen in armdicken Schlingen mit Tücke und List“, wird er Riegel und Schlösser sprengen und in die Freiheit stürmen, heißt es in dem Lied.
So offen wie in Heins Stück „Ritter der Tafelrunde“ war die greise Führungsriege in Berlin wohl noch nie angegriffen worden. Es hatte vor Augen geführt, dass „die Oben nicht mehr können“. So reihte es sich ein in den Chor der Fanfaren, die zum Aufbruch bliesen.
Nun gehört zu einer „revolutionären Situation“, so hatte ich gelernt, dass – zum zweiten – „die Unten nicht mehr wollen“. Tausende hatten das im Sommer 1989 gezeigt, als sie mit den Füßen abstimmten und gen Westen wanderten. Es brauchte noch einige Zeit, bis die Volksmassen unter der Losung „Wir bleiben hier“ die Initiative übernahmen und die Herbstrevolution begann.