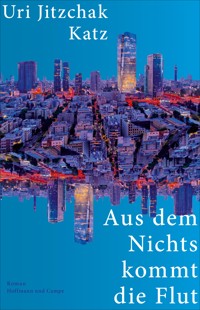
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Die Suche nach einer Novelle gerät zu einem Abenteuer der Extraklasse. Sie beginnt im Prag der 1920er Jahre, führt Mitte des 20. Jahrhunderts durch die umkämpften Hügel von Hebron und die Obstgärten um Jaffa und zurück in eine abgedrehte Zukunft wie aus Matrix – «Gib acht, was du träumst!» Alles beginnt mit der sagenhaften Geschichte des Mannes, dessen Gesicht in Grimm erstarrte. Zuerst hört Uri davon in Israel, von seiner Großmutter Zippora. Später schwärmt die heißgeliebte Julia davon. Als Zippora verstirbt und Julia auf rätselhafte Weise verschwindet, macht Uri sich auf die Suche nach der verschollenen Novelle, nach darin verborgenen Zeichen, weil er die Hoffnung nicht aufgibt, Julia wiederzufinden. Uris fieberhafte Besessenheit treibt ihn in wildem Zickzackkurs durch Zeiten und Welten, durch das alte Osteuropa, die Levante und das Internet bis an den Rand des Wahnsinns – hinein in ein zutiefst persönliches Geheimnis. Am Ende muss er sich eingestehen, dass zwar alles einen Sinn ergibt, aber nichts passt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 731
Ähnliche
Uri Jitzchak Katz
Aus dem Nichts kommt die Flut
Roman
Markus Lemke
Der Mann, dem das Gesicht in Grimm erstarrte
Von Pavel Klemczek
Aus dem Tschechischen von Jitzchak Jeschajahu Katz
23. des Monats Kislew, Samstag, 6. Dezember 1947
1. Kapitel
Die grimmige Miene erstarrt – Beim Arzt – Ein Dilemma
Die grimmige Miene erstarrt
Es geschah morgens um kurz nach zehn. Der leitende Direktor der »Staatlichen Fabrik für Bleistifte und Schreibwaren« saß in seinem Büro, als seine Sekretärin, die Frau Sopček, mit dem Zehn-Uhr-Kaffee hereinkam. Nicht genug, dass dieser mit Verspätung serviert wurde, zu allem Überfluss war er auch noch zu stark gesüßt. Er überlegte kurz, sie darauf hinzuweisen, doch da er, selbstverständlich unbeabsichtigt und ohne dem nachgeholfen zu haben, Kenntnis erlangt hatte von der kriselnden Ehe seiner Angestellten, allem Anschein nach wegen der notorischen Untreue ihres Gatten, beschloss er, seine unverlässliche Vorzimmerdame bei ihrem Abgang lediglich mit einem grimmigen Blick zu bedenken. Er kniff die Augenbrauen zusammen, verzog den linken Mundwinkel – und verharrte so. Frau Sopček hatte das Zimmer bereits verlassen, eine Entschuldigung murmelnd, jedoch ohne die Absicht, ihren Fehler durch die Zubereitung eines anständigen Kaffees wettzumachen. Wie groß ihre Abscheu gegen das männliche Geschlecht sein muss, dachte er bei sich, beschloss jedoch, aufgrund der neuen Umstände, seines in Grimm erstarrten Gesichtes nämlich, sich zu einem späteren Zeitpunkt mit ihr zu befassen.
Erst aber begab er sich in das private Waschkabinett seines Büros. Einer der Vorzüge einer Stellung als leitender Direktor bestand zweifellos in einem solchen privaten Waschkabinett, jedoch nicht als bloßer Luxus oder Vergünstigung, bestimmt, seinem Ego zu schmeicheln, sondern vielmehr als schlichte Notwendigkeit. Denn geradezu undenkbar wäre, würde er in einem Augenblick neben einem kleinen Angestellten urinieren und ebendiesen Mitarbeiter einen Augenblick später instruieren, denn sicher würde dieser, hatte er doch, da sie Seite an Seite am Urinal gestanden, einen verstohlenen Blick geworfen, nun seinen Anweisungen mit einem ironischen Lächeln auf den Lippen nachkommen, nur um später, nach Dienstschluss, mit den Kollegen noch auf ein Bier loszuziehen und Witzchen zu reißen, der große Chef sei in Wahrheit gar nicht so groß. Er wusste, wie die Dinge laufen, war schließlich nicht als leitender Direktor zur Welt gekommen. Auch er war einmal kleiner Angestellter und bekam die Scherze seiner Kollegen über Vorstände und Direktoren zu hören. Auch wenn er, im Gegensatz zu anderen, nicht gelacht und stattdessen auf derart üble Nachrede mit grimmiger Miene reagiert hatte, just wie die, die ihn auf seinem Gesicht erstarrt nun aus dem Spiegel über dem Waschbecken anschaute. Er spülte sich das Gesicht mit kaltem Wasser, doch die Miene blieb grimmig. Vielleicht war die gar nicht mehr erstarrt, dachte er, vielleicht verspürte er ja tatsächlich Ingrimm über diesen kleinen Angestellten mit seinem großen, schmutzigen Mundwerk, dessen Identität im Moment zwar noch nicht feststand, dessen Name aber eines Tages herauskommen würde. Und der dann flugs mit einem Verweis oder gar einer Kündigung zu rechnen hatte, wegen Verhöhnung eines leitenden Direktors und übler Nachrede in Dingen, von denen nur die Frau des leitenden Direktors und vielleicht noch dessen Privatarzt wussten … Zugleich begriff er, er durfte daran nicht denken, musste an Erquicklicheres denken, doch es gelang ihm nicht, seine Gedanken auf etwas Freudiges zu lenken. Was ihn noch mehr erzürnte. Freude lässt sich genauso schwer oktroyieren, wie ein falsches Lachen zustande zu bringen ist, während gespielte Wut ganz natürlich sich einstellt. Oder war das vielleicht nur bei ihm der Fall? Nein, sagte er sich, ein erfolgreicher leitender Direktor muss nun einmal resolut auftreten, und das grimmige Gesicht im Spiegel nickte ihm mit erzürnter Beipflichtung zu.
Er musste sich freudige Gedanken machen, musste vielleicht eine Erinnerung aus der Kindheit bemühen: Ferien in Apša1, ein Sommertag am See, blauer Himmel, ein hübsches, sommersprossiges Mädchen im grünen Kleid. Die Dorfkinder erklären dem Jungen aus der Stadt, bei ihnen gehe man nackt schwimmen, und alle springen ins Wasser, das herrlich kühl ist. Die älteren Mädchen in Sommerkleidern jagen Schmetterlingen nach, alle, bis auf das Mädchen mit den Sommersprossen, das am Seeufer in einem Buch liest und mit den Füßen im Wasser plantscht. Und es gibt keinen Grund, zornig zu werden, alles ist friedlich und leise, schrecklich leise indes, weil alle Kinder verschwunden sind und mit ihnen seine Kleider. Er kommt aus dem Wasser und verbirgt seine Blöße, und alle Mädchen hören auf, Schmetterlingen nachzujagen, und lachen über ihn, vielleicht auch das Mädchen mit den Sommersprossen, er wagt nicht, in ihre Richtung zu schauen, doch ein anderes Mädchen wirft ihm ihren Strohhut zu, und Scham und blinde Wut überkommen ihn, da er weinend den ganzen Weg zurück zur Villa rennt.
Er verließ sein privates Waschkabinett. Meinte, sein ganzes bisheriges Leben sei eine Abfolge zorniger Augenblicke gewesen, unterbrochen nur von kleinen Illusionen des Glücks, die den Schmerz, der sich hernach einstellte, bloß verstärken sollten. Vielleicht half ein Tee? Doch welcher Tee, davon verstand er nichts. Für gewöhnlich, wenn er es am Magen oder mit dem Kopf hatte, rief er nach der Frau Sopček, die ihm den passenden Tee brachte, ohne dass er je gefragt hätte, welchen genau. Also rief er nach seiner Sekretärin, doch da er sich schämte, sie um einen Tee gegen grimmige Miene zu bitten, erbat er einen gegen Kopfschmerz, und sei es nur, weil ihm ein solcher plausibler erschien als einer gegen Magenschmerzen.
Erst nach zwanzig Minuten und erst, nachdem der leitende Direktor gezwungen war, sie erneut zu erinnern, erschien Frau Sopček mit dem Tee. So groß war ihre Wut auf ihren untreuen Ehemann, dass sie es nicht einmal für nötig befand, sich zu entschuldigen. Der leitende Direktor schwankte, ob er es ihr diesmal durchgehen und sie ohne grimmigen Blick davonkommen lassen sollte, realisierte aber sogleich, diese Möglichkeit bestand ja nicht mehr. Mit einer in Grimm erstarrten Miene hat man zwar weniger Manövrierspielraum, doch Entscheidungen fällen sich leichter. Er probierte den Tee. Der schmeckte bitter. Er spürte, wie sich seine Miene noch mehr verdüsterte.
Den restlichen Morgen bis zum Mittag brachte er mit grimmiger Miene in seinem Büro herum. Um zwölf teilte ihm Frau Sopček über die interne Sprechröhre2 mit, sie gehe jetzt zu Tisch. Er wartete, dass sie ihn fragte, ob sie ihm etwas aus dem Café an der Ecke mitbringen solle, doch ausgerechnet heute überging sie die Frage. Vor Jahren, noch ehe der Herr Direktor zum leitenden Direktor geworden war, hatte seine Frau ihm jeden Tag eine leichte Mahlzeit zubereitet, die er mit ins Büro nahm. Mit den Jahren aber war diese Verpflegung immer seltener geworden, bis seine Gattin schließlich verkündet hatte, sie habe keine Zeit mehr, ihm überhaupt noch etwas zu machen. Der leitende Direktor fand, dies entbehre einer gewissen Ironie nicht. Als sie noch beinahe mittellos gewesen waren, hatte seine Frau sich selbst um den Haushalt gekümmert und geputzt, hatte Zeit gefunden, ihm zu Mittag etwas zu kochen, doch seit er aufgestiegen war und sich ihr Wohlstand derart gemehrt hatte, dass sie es sich leisten konnten, zwei Dienstmädchen und eine Köchin zu beschäftigen, hatte seine Gattin zunehmend weniger Freizeit, was sonderbar anmutete, da ihre ganze Beschäftigung darin bestand, loszugehen und einen Hut nach dem anderen zu kaufen. Wie viele Hüte braucht ein Mensch denn? Das fragte sich der leitende Direktor. Inzwischen war er bereits empfindlich hungrig. Hungrig und verstimmt. Aus einem Bauchgefühl heraus wusste er, Hunger ist nicht der geeignete Weg, eine erstarrte Miene zu lockern. Natürlich hätte er selbst rausgehen können, um irgendwo etwas zu essen, hatte jedoch Sorge, was sein würde, wenn auf dem Weg nach draußen Mostovitz zu ihm träte und ihm die Berichte früher als erwartet überreichte? Wie sollte er ihm dann seine grimmige Miene erklären? Ja, schlimmer noch, was würde geschehen, wenn ausgerechnet heute der Herr Generaldirektor ins Mittelgeschoss hinabgestiegen käme und ihn grüßte? Er konnte sich nicht erlauben, den Herrn Generaldirektor zu brüskieren. Es wurde Zeit, dies einzugestehen, er war nicht in der Position, den ganzen Tag mit grimmiger Miene herumlaufen zu können. Und angenommen, es sollte ihm gelingen, sich aus dem Büro zu stehlen, würde er dann eine ganze Mahlzeit lang im Kaffeehaus sitzen und dem Kellner grundlos seine grimmige Miene zur Schau stellen? Sicher würde man ihm künftig den so begehrten Ecktisch versagen und, wer weiß, vielleicht sogar in die Suppe spucken?
Auf dem Tisch, neben dem längst erkalteten Tee, wartete noch eine Zitronenscheibe, die Frau Sopček irrtümlich beigelegt hatte, obgleich eine solche überhaupt nicht zum Tee gegen Kopfschmerz passen wollte. Doch die Frau Sopček hatte ihr eigenes Kopfweh, und in nächster Zeit war wohl kein Verlass auf sie. Er biss in die Zitronenscheibe, die besonders bitter schmeckte, und sein Gesichtsausdruck veränderte sich nicht. Erst nach anderthalb Stunden kehrte seine Sekretärin aus der Mittagspause zurück, und er bat sie, Herrn Gugel in sein Büro zu bestellen.
Herr Gugel war ein einfacher Direktor, der unter ihm arbeitete. Ein aufgeräumter junger Mann, der umtriebig, gewandt und ein nicht eben kleiner Neuigkeitenkrämer war. Über ihn hatte der leitende Direktor auch von den Sorgen seiner Vorzimmerdame erfahren, selbstverständlich, dies noch einmal, ohne Entsprechendes verlangt zu haben. Herr Gugel hatte als Laufbursche der Poststelle bei der »Staatlichen Fabrik für Bleistifte und Schreibwaren« angefangen und nur acht Jahre gebraucht, um aufzusteigen und die Position eines Abteilungsleiters zu erreichen. Der leitende Direktor selbst hatte den jungen Gugel wiederholt befördert, bis dieser beinahe so etwas wie seine rechte Hand geworden war. Er erinnerte ihn an sich selbst, als er jung gewesen war, oder vielmehr an sein jüngeres Ich, wie er es gerne in Erinnerung hatte: intelligent, ordentlich, scharfsinnig und nicht gänzlich ohne persönlichen Charme. Stillschweigend hatte der leitende Direktor sich wiederholt schon eingestanden, dass seine Arbeit sehr viel leichter und fruchtbarer geworden war wegen Gugel, ja dass er dabei war, eine Abhängigkeit von seinem Untergebenen zu entwickeln. Aus ebendiesem Grund wollte er ihn auch nicht in die Sache mit der erstarrten Miene einbeziehen, doch inzwischen war es bereits zwei und sein Magen leer. Der leitende Direktor sah ein, einen Ausweg gab es nicht, Gugel würde gewiss schnell eine Antwort finden. Er würde ihm die Mühe und Diskretion allerdings entgelten müssen, was ein Problem für sich darstellte, da der leitende Direktor schon nichts mehr hatte, wohin er Herrn Gugel noch hätte befördern können. Die nächste Position nach der des einfachen Direktors war die eines leitenden, seine eigene mithin. Undenkbar, dass er ihn auf seine eigene Position beförderte. Zumal er nicht sicher war, ob dies überhaupt erlaubt war, und wenn ja, ob Gugel ihn dann herabstufen konnte, hatte er erst seine Stellung inne. Auch eine Gehaltserhöhung kam nicht infrage, aus eben demselben Grund. Ein einfacher Direktor konnte nicht das Gehalt eines leitenden beziehen. Vielleicht würde er gezwungen sein, diskret etwas von seinem eigenen Gehalt abzuzweigen, als Entgelt für die Wahrung der Diskretion?
Aber alldem, ebenso wie der nachlässigen Pflichterfüllung seiner Sekretärin, musste er sich später zuwenden. Die Stimme, die aus der Sprechröhre kam, teilte ihm mit, Herr Gugel befinde sich schon vor der Tür, und tatsächlich wartete der patente junge Herr eine Aufforderung gar nicht erst ab, sondern kam wie selbstverständlich mit breitem Lächeln herein. Doch als er die grimmige Miene vor sich sah, erstarrte er, und das Lächeln verschwand. Gleichwohl nahm sein Gesicht nicht den verwunderten Ausdruck eines Angestellten an, der nicht versteht, warum sein Chef ihm zürnt, nicht den Ausdruck von unschuldiger Ratlosigkeit. Im Gegenteil, den Ausdruck eines auf frischer Tat gefassten Diebes stellte sein Gesicht vor, als wappnete er sich und versuchte abzuschätzen, was der leitende Direktor wusste und wie schlimm seine Lage tatsächlich war. Gugel begann zu sprechen, in hektischem Stakkato: »Verehrter Herr leitender Direktor, sicher haben Sie aus wenig verlässlicher und auch nicht selbstloser Quelle von dem Mittagessen erfahren, das ich rein zufällig mit dem Herrn Generaldirektor hatte.« Der leitende Direktor der »Staatlichen Fabrik für Bleistifte und Schreibwaren« war verblüfft, nur dass anstelle eines Ausdrucks von Erstaunen jene grimmige Miene auf seinem Gesicht blieb, was Gugel dazu brachte, sich noch mehr zu verrennen. »Der Grund, weshalb ich Ihnen dies noch nicht angezeigt habe, ist der, dass ich gerade an einem ausführlichen Bericht arbeite, welcher den Hergang des Essens darlegen und alle gewünschten Informationen enthalten wird, angefangen mit allem, was gesagt wurde, und endend mit dem Geschmack des Desserts.« Der leitende Direktor dachte bei sich, in Zukunft müsse er sich nur unwirsch über seine Mitarbeiter zeigen, wollte er ihnen Informationen entlocken. Er teilte Gugel mit, nicht in dieser Angelegenheit habe man ihn gerufen. Jetzt, da er Kenntnis hatte von dem Treffen seines Untergebenen mit dem Herrn Generaldirektor, ein Schritt, der ohne weiteres als Intriganz ausgelegt werden mochte, fühlte sich der leitende Direktor sicher, Gugel die Sache mit der erstarrten Miene anzuvertrauen. Er erzählte ihm von den Ereignissen an diesem Morgen und von seinen Versuchen, die Misere aus der Welt zu schaffen. Er erwähnte den Tee gegen Kopfschmerz, der das Ganze noch verschlimmert hatte, und ließ auch den versäumten Mittagstisch nicht aus. Herr Gugel hörte ernst zu, betrachtete prüfend das Gesicht des leitenden Direktors, zog dann ein Notizbuch aus der Tasche und schrieb auf eine neue Seite:
Dringliche Aufgaben:
einen Arzt finden
etwas zu essen finden
Der leitende Direktor verspürte Erleichterung, kein Zweifel, der junge Gugel war aus Direktorenholz geschnitzt. Kaltschnäuzig und gegen Druck gefeit. Stolz erfüllte ihn, dass er es war, der ihn gefördert hatte. Vielleicht intrigierte Gugel auch gar nicht gegen ihn, vielleicht war er dem Herrn Generaldirektor tatsächlich nur zufällig im Kaffeehaus begegnet, und der Herr Generaldirektor hatte ihn der Form halber eingeladen, sich zu ihm an den Tisch zu setzen. Wer hätte da ablehnen können?
Gugel machte sich an die erste Aufgabe. Sie kamen überein, der leitende Direktor konnte nicht zu seinem Hausarzt gehen, zum einen wegen der Sache mit der Diskretion und zum anderen, weil es sich nicht um einen gewöhnlichen Fall handelte. Gugel erinnerte sich an einen entfernten Verwandten, von dem er meinte, er habe sich in eine Schabe verwandelt, und nachdem alle Ärzte nichts hatten ausrichten können, auch Nervenärzte aus Deutschland nicht, war er von einem auf chinesische Heilkunst spezialisierten Doktor namens Chen behandelt worden. Gugel schrieb in sein Notizbüchlein »Doktor Chen« und ging ab.
Im Nu war er mit Resultaten zurück, genauer: der Anschrift der Praxis von Doktor Chen. Auch hatte er bereits Zeit gefunden, den Laufburschen mit einem Telegramm loszuschicken, das den Arzt vom baldigen Eintreffen des leitenden Direktors in Kenntnis setzte und ihm die Art der Erkrankung erklärte. Nachdem er dem leitenden Direktor den Zettel mit der Anschrift überreicht hatte, schlug Gugel sein Notizbüchlein auf und strich »einen Arzt finden« sauber durch. Dann zog er eine eingerollte Serviette aus der Tasche, in der ein paar Hefestangen lagen. »Ich hebe mir vom Mittagstisch immer welche für den Kaffee um vier auf«, lächelte er. »Außerdem habe ich eine Sendung von Gebäck veranlasst, die in der nächsten Stunde hier sein sollte, damit sich Fälle wie dieser in Zukunft nicht wiederholen.« Er schlug sein Notizbuch auf und strich »etwas zu essen finden« durch.
Der leitende Direktor schaute seinen Untergebenen mit grimmiger Miene an, unter der sich eine noch grimmigere verbarg. Er hatte die Serviette wohl erkannt, in die die Hefestangen gewickelt waren und die nicht vom Kaffeehaus an der Ecke, sondern aus dem Rémy stammte. Vor acht Jahren, als er selbst noch einfacher Direktor gewesen war, hatte ihn der Herr Generaldirektor in das erlesene Restaurant eingeladen und ihm eröffnet, er werde ihn zum leitenden Direktor ernennen, anstelle seines ausscheidenden Vorgängers.
Dennoch verspeiste er die Hefestangen. Gugel drängte zur Eile, bis zur Praxis des Doktor Chen sei es ein ganzes Stück, und wer weiß, ob der Doktor ihn zu so später Stunde noch empfing, selbst wenn, wie in seinem Fall, von einem leitenden Direktor die Rede war, dessen Zustand keinen Aufschub duldete. Und sie dachten sich eine List aus: Der leitende Direktor sollte Gugel anschreien, denn so würde er sein Büro verlassen und den Hauptsaal mit den Schreibkräften und Angestellten mit grimmiger Miene durchqueren können, ohne Verdacht zu erregen. Gugel öffnete die Tür des Büros einen Spalt weit und bedeutete dem leitenden Direktor, er möge ihn anschreien. »Wer denken Sie denn, dass Sie sind …«, brachte der leitende Direktor in verhaltenem Ton zustande. Gugel signalisierte ihm, die Stimme zu heben. »Ein einfacher Direktor, der sich aufführt wie ein leitender? Ein Skandal ist das!« Die Bleistifte im Saal stellten das Schreiben ein, und der leitende Direktor gewann an Sicherheit. Er hob die Stimme noch mehr: »Eine Unverschämtheit ist das! Es vergehen noch hundert Jahre, bis Sie nur die Hälfte von dem gelernt haben, was ich weiß!« Gugel reckte anerkennend den Daumen in die Höhe. »Sie sind entlassen, Sie Lump!« Und ohne ihn eines weiteren Blickes zu würdigen, verließ der leitende Direktor sein Büro und stapfte mit grimmiger Miene durch den Saal.
Beim Arzt
Das Empfangszimmer des Doktor Chen war wie das Empfangszimmer jedes anderen Arztes. Die Wände waren cremefarben gestrichen und mit mehreren einigermaßen banalen Ölgemälden behängt, die Landschaften und Pferde zeigten. In einer Ecke stand ein Zeitungsständer. Abgesehen von einer kleinen Buddhastatue, die auf dem Tresen der Empfangsdame als Briefbeschwerer diente, erinnerte nichts im Raum an die chinesische Kultur. Die Empfangsdame selbst war eine stämmige Person, blond und mit zu blauen Augen. Sie trug ein gelbes Kleid und darüber einen weißen Laborkittel. Ein spitzes Geburtstagshütchen saß auf ihrem Kopf, gehalten von einem Band, das sich durch ihr Doppelkinn spannte. Sie lächelte dem leitenden Direktor zu und sagte mit schwerem deutschem Akzent: »Der Doktor hat heute Geburtstag.« Der leitende Direktor machte Anstalten, sich vorzustellen, doch die Person wusste bereits, worum es ging. Er entschuldigte sich, sich derart verspätet zu haben, offenbar seien die Droschkenkutscher nicht erpicht, grimmig dreinschauende Kundschaft zu bedienen. Die Dame am Empfang unterbrach ihn mit einem Lächeln, sagte, auch der Arzt sei heute ungewöhnlich spät dran, und bedeutete dem leitenden Direktor, doch auf dem Wartesofa Platz zu nehmen. Dort saß bereits ein Mann, in der Uniform eines Verkehrspolizisten, dessen Augen kolossal in Richtung Nase schielten. Der leitende Direktor nahm unbehaglich Platz, griff sich eine Zeitung aus dem Ständer und stellte fest, dass sie auf Deutsch war. Außer weiteren deutschen Zeitungen gab es nur noch eine auf Russisch. Eine tschechische Zeitung fand sich ebenso wenig wie eine auf Chinesisch. Der leitende Direktor legte die Zeitungen zurück und verschränkte lustlos die Arme.
»Ich habe Quatsch gemacht«, begann der Schielende. »Habe ein Schielgesicht gemacht, um die Kameraden auf dem Revier zum Lachen zu bringen, und das ist hängen geblieben.« Absoluter Leichtsinn sei das gewesen, denn mehrfach schon sei er gewarnt worden, eine solche Grimasse könne sich festsetzen, habe das aber abgetan. »Für einen Witz, für die Aussicht, jemanden zum Lachen zu bringen, kann man doch mal das Risiko eingehen, ist es nicht so?« Der leitende Direktor kam nicht dazu, etwas zu erwidern, denn der Schielende fuhr bereits fort: »Mein Name ist Pipkin, aber alle nennen mich Pip, denn wenn ich den Verkehr regle, bekommt man viele Pips zu hören. Wie die Hupen der Fahrräder und Automobile. Pip, pip, pip … Kurzum, Pip.« Er streckte die Hand aus, schätzte aber aufgrund seines Schielens die Entfernung nicht richtig ein und verpasste der Nase des leitenden Direktors einen leichten Stüber. »Oh, verzeihen Sie, mein Herr.« Der leitende Direktor erhob sich und verharrte vor einem der Gemälde, das eine Gruppe von Männern und Frauen in traditioneller bayerischer Tracht zeigte, offenbar bei einem Bierfest. Einige Leute saßen an langen Holztischen, andere tanzten im Kreis, und alle hielten sie große Bierkrüge in der Hand. Im Zentrum des Bildes stand mit einem Tablett voller Gläser vor der Brust eine bayerische Kellnerin, die der Empfangsdame wie aus dem Gesicht geschnitten war. Der leitende Direktor besah sie sich erneut, danach wieder die Kellnerin auf dem Bild, und kam zu dem Schluss, die Ähnlichkeit müsse mehr als rein zufällig sein. Er trat näher heran und inspizierte die Signatur auf dem Gemälde, »Boris 1871«, stand da. Abermals sah er zu der Empfangsdame, die ihm ein Lächeln schenkte. In seinem Rücken versuchte der Schielende, sich eine Zigarette anzuzünden, und versengte sich dabei fast die Augenbrauen. Der leitende Direktor fühlte, wie er zunehmend ärgerlicher wurde. Er trat zu der Rezeptionistin. »Wann ist denn mit dem Herrn Doktor zu rechnen?« Von der Toilette erschallte das Rauschen fließenden Wassers. »Schon sehr bald«, erwiderte die Empfangsdame, noch immer lächelnd. Die Tür des Kabinetts sprang auf, und heraus trat ein Mann in Arztkittel. »Doktor Chen, der leitende Direktor ist schon eine ganze Weile hier.« Der leitende Direktor drehte sich um und hatte für einen Moment das Gefühl, als wäre sein Gesichtsausdruck von Ingrimm zu Erstaunen gewechselt. Immerhin hatte er einen chinesischen Arzt erwartet, doch Doktor Chen war nicht im Entferntesten Chinese. Er war kahl und von kräftiger Statur, vielleicht fünfzig Jahre alt, hatte ebenfalls ein Geburtstagshütchen auf dem Schädel und eine Zeitung auf Tschechisch unter dem Arm. Er ließ die Zeitung unter den anderen Arm wandern und schüttelte dem leitenden Direktor die Hand. »Ich entschuldige mich für die Verspätung. Ich bin heute Morgen mit Kopfschmerzen aufgestanden und habe mir einen chinesischen Tee gemacht, bloß dass ich anstatt von Safran, welcher das Blut ins Hirn strömen lässt, Ingwer genommen habe, der die Darmtätigkeit anregt und, wie ich jetzt verstanden habe, auch die Beinmuskulatur kräftigt, da ich alle zwei Minuten zur Toilette muss.« Er lachte laut, und der Schielende schloss sich ihm mit dem ungestümen Wiehern eines Menschen an, der gerne lacht, unabhängig von der Beschaffenheit des Witzes oder dem eigenen Vermögen, diesen zu verstehen.
»Das ist nicht zum Spaßen«, sagte die Empfangsdame, noch immer lächelnd, »du bist schrecklich spät dran.« Der Arzt drehte sich zu dem leitenden Direktor. »Sie müssen meiner Frau Helena verzeihen. Sie ist Deutsche, und bei ihren Landsleuten gilt Unpünktlichkeit als ein Vergehen, auf das mindestens die Todesstrafe steht.« Der Schielende brüllte vor Lachen. »Siehst du, sogar Pip denkt, das ist ein Witz«, meinte der Arzt vorwurfsvoll zu seiner Empfangsdame, um sich sogleich dem Schielenden zuzuwenden: »Was soll nur werden, Pip? Hast wieder versucht, deine Kameraden auf der Arbeit zum Lachen zu bringen? Komm, auf ins Behandlungszimmer. Wir befreien dich von dem Schielen.« Der leitende Direktor versuchte zu protestieren: »Herr Doktor, darf ich Sie daran erinnern, dass ich trotz allem leitender Direktor der ›Staatlichen Fabrik für Bleistifte und Schreibwaren‹ bin, und man dort meiner baldigen Rückkehr harrt …«
»Sie mögen zwar ein leitender Direktor sein«, gab der Arzt zurück, »aber Pip hier regelt den Verkehr, und wenn er das tut, während er noch unter seinem Schielen leidet, sorgt das für großen Tumult in der Stadt. Leute würden mehr als zehn Minuten in ihren Droschken warten. Können Sie sich eine derartige Unannehmlichkeit vorstellen? Ja, vielleicht würde sogar die Droschke, in der Sie selbst sitzen, wegen des Schielens an einen anderen Ort dirigiert werden, und anstatt zur ›Staatlichen Fabrik für Bleistifte und Schreibwaren‹ zu gelangen, würden Sie sich vor der ›Internationalen Perückenmanufaktur‹ wiederfinden.«
Dieser Gedanke erschütterte den leitenden Direktor derart, dass er verstummte. Der Arzt aber winkte, noch immer lächelnd, Pip ins Behandlungszimmer, und der marschierte selbstgewiss und aufreizend geradewegs in die nächste Wand. Der Arzt nahm ihn bei der Hand, und beide verschwanden sie im Nebenraum. Der leitende Direktor aber ließ sich grimmig wieder auf das Sofa sinken.
Ein Dilemma
Gugel blieb minutenlang im Büro des leitenden Direktors stehen, das Gesicht zu einem Lächeln gefroren. Hatte er gerade seine Anstellung verloren? Wie war das möglich, dass er vor einer Stunde erst in Rémys Feinschmeckerrestaurant Hühnerkaumagen in Saft3 gegessen hatte mit dem Herrn Generaldirektor, der ihm unmissverständlich angedeutet hatte, man werde ihn anstelle des jetzigen zum leitenden Direktor ernennen, wenn dieser in den vorzeitigen Ruhestand ginge, und das alles in weniger als einem halben Jahr, und jetzt plötzlich war er entlassen. Aber war ihm tatsächlich gekündigt worden, oder war das nur eine Laune des leitenden Herrn Direktors gewesen, der sich zu sehr in ihr kleines Täuschungsmanöver hineingesteigert hatte? Doch auch wenn die Worte im Überschwang gesagt wurden, so waren sie doch gültig und – schlimmer noch – von allen gehört worden. Selbst wenn der leitende Herr Direktor gar nicht die Absicht gehabt hatte, ihn zu entlassen, wie sollte er jetzt einen Rückzieher machen können, da es derart viele Zeugen gab? Und welcher Vorwand würde eine Rücknahme der Kündigung rechtfertigen, ohne den Eindruck eines wankelmütigen Direktors zu erwecken? Vielleicht war das Ganze von Anfang an eine Intrige des leitenden Direktors und des Herrn Generaldirektors gewesen, um ihn, Gugel, loszuwerden. Vielleicht war die Geschichte mit dem grimmigen Gesicht nur ausgedacht gewesen, und jetzt saßen die beiden gewiss bei Rémy, erfreuten sich an Hühnerkaumagen in Saft und lachten auf seine Kosten. Gugel konnte spüren, wie seine Gedanken sich überschlugen. Er holte sein Notizbuch hervor, schlug eine neue Seite auf und schrieb:
Mögliche Vorgehensweisen:
Zur Allgemeinen Beamtenkammer4 gehen und mich als gekündigt registrieren lassen
Zurück an meinen Schreibtisch gehen und weiterarbeiten, als wäre nichts geschehen
Beim Herrn Generaldirektor um ein Gespräch ersuchen und ihm vom grimmigen Gesicht des leitenden Direktors erzählen
Hier im Kontor des leitenden Direktors bleiben, bis er zurückkommt
Mir das Leben nehmen
Überflüssig zu erwähnen, dass Gugel den Freitod nicht in Erwägung zog, sich jedoch verpflichtet fühlte, alle denkbaren Vorgehensweisen aufzuschreiben, und der Tod war nun einmal, ob er es wollte oder nicht, eine davon. Möglichkeit Nummer eins strich er als Erstes durch, da ihm diese nicht eine Vorgehensweise, sondern eine mögliche Folge zu sein schien, weshalb sie nichts auf einer Liste möglicher Schritte zu suchen hatte, wohl aber auf eine künftige Liste gehörte, die vielleicht mit »Was ist jetzt zu tun?« überschrieben wäre. Auch Möglichkeit Nummer zwei strich er aus. Arbeitete er weiter, als wäre nichts geschehen, würde er sich der Kündigung durch seinen Vorgesetzten widersetzen, was allein für sich genommen Grund genug für eine Kündigung wäre, sodass, auch wenn ihm in Wahrheit gar nicht gekündigt worden war, er auf der Stelle entlassen wäre. Möglichkeit drei strich er ebenfalls durch. Der Herr Generaldirektor würde ihm nicht helfen können, denn damit müsste er sich selbst inkriminieren, geplant zu haben, den leitenden Direktor durch einen Jüngeren zu ersetzen. Eine weitere Minute verging, und er strich auch Möglichkeit fünf aus, sich das Leben zu nehmen. Blieb nur noch Möglichkeit vier, hierzubleiben, bis der leitende Direktor zurück wäre. Plötzlich fühlte er sich sehr müde und nahm auf dem Besucherstuhl Platz. Sein Magen begann, absonderliche Geräusche von sich zu geben. Und er verspürte das Bedürfnis, die Toilette aufzusuchen, allem Anschein nach hatte der empfindliche Magen des jungen Abteilungsleiters Mühe mit Rémys Hühnerkaumägen. Er überlegte, auf die Privattoilette im Büro des leitenden Direktors zu gehen, fragte sich aber, was geschehen würde, wenn dieser ausgerechnet dann, nach erfolgreicher Behandlung, freudig und gut gelaunt zurückkäme und aus seinem Privat-WC wenig erquickliche Geräusche vernähme, für die niemand anders verantwortlich zeichnete als sein junger Schrägstrich entlassener Untergebener. Er warf einen Blick zur Uhr. Kurz nach drei. Auch wenn der leitende Direktor die Behandlung bereits hinter sich hatte, würden noch mindestens zwanzig Minuten vergehen, bis er zurück wäre. Dennoch und obwohl die Hühnerkaumägen sich erneut rührten, versagte sich Gugel die Benutzung der Toilette, denn ließ man dort das Wasser laufen5, war dies im ganzen Hauptsaal mit seinen Schreibkräften und Angestellten zu hören. Gugel selbst pflegte jedes Mal, wenn man im Saal das Wasser fließen hörte, für alle vernehmlich zu witzeln, »na bitte, der Herr Direktor hat eine weitere wichtige Sitzung beendet« oder »eine entscheidende Sitzung« oder »eine besonders langwierige Sitzung«. Ließe er jetzt das Wasser dort laufen, wüssten alle, dass er in Abwesenheit des leitenden Direktors dessen Privatklosett benutzte. Und nach erfolgter Benutzung nicht zu spülen kam selbstverständlich auch nicht infrage. Ehrlich gesagt wäre da sogar »mir das Leben nehmen« eine plausiblere Option.
Ein Autor sucht einen Stil, Vorwort des Lektors
oder: Lug und Trug, Literatur im Zeitalter des Internets und das Unvermögen eines Autors, die Verbrennung aller seiner Schriften zu veranlassen
An einem unaufdringlichen Sommermorgen rief mich der Cheflektor unseres Verlags an und fragte, ob ich wisse, wer Pavel Klemczek sei. Natürlich wusste ich das. Vor einiger Zeit hatte ich die Aufgabe übertragen bekommen, eine »Tschechische Reihe« herauszugeben, die dreizehn Werke der besten tschechischen Autoren durch alle Generationen umfassen sollte. Klemczek galt als Phantom, ein Schriftsteller, der von anderen tschechischen Autoren als Genius bezeichnet wurde, augenscheinlich aber sämtliche seiner Schriften verbrannt hatte, von denen nichts überdauert hatte. Manche behaupten gar, der Name sei ein Pseudonym Max Brods oder gar Kafkas selbst. »Ich weiß, wer Klemczek ist«, teilte ich dem Cheflektor mit.
»Kennst du auch einen Uri Katz?«, fragte er. Kannte ich nicht. »Ein Drehbuchautor. Behauptet, eine halbe Erzählung von Klemczek zu haben.«
Ich schluckte. Vor allem, weil solche Dinge immer seltener werden. Heutzutage ist es schwer, vergessene Geschichten zu finden, denn im Zeitalter des Internets scheint es beinahe unmöglich, etwas in Vergessenheit geraten zu lassen. Lebte Kafka heute, hätte er Mühe, seine Schriften von jemandem verbrennen zu lassen. Andererseits, auch zu seiner Zeit ging der Plan ja nicht wirklich auf.
Uri traf ich am nächsten Tag und verstand recht bald, die Geschichte, wie die Erzählung in seine Hände gelangt war, war nicht weniger spannend als die Novelle selbst. Zu dem Zeitpunkt wussten wir beide nicht, was das Ende der Geschichte sein würde und ob sie überhaupt ein Ende finden sollte. Die erste Aufgabe bestand in dem Versuch, den Rest der Erzählung zu finden. Wir hatten ein paar wenige Hinweise, Informationen aus dem Internet und den sozialen Netzwerken, die gerade Fahrt aufnahmen. Ein Post wurde in den entsprechenden Internetforen und Literaturblogs platziert, der jeden, der etwas von Klemczek wusste oder schon einmal auf eine Erzählung »Der Mann, dem das Gesicht in Grimm erstarrte« gestoßen war, aufforderte, in Kontakt mit uns zu treten. Die zweite Aufgabe, die ich Uri übertrug, war, ein Vorwort zu schreiben und darin zu berichten, wie er in Besitz gelangt war der ersten Hälfte der Erzählung, die von Hand auf Briefbögen des Kibbuz Kfar Etzion geschrieben war und vom 23. des Monats Kislew im Jahre 5708, Wochenabschnitt Wajechi, datierte, dem 6. Dezember 1947, rund eine Woche nach der UN-Resolution.6
Uri entpuppte sich als ein beinahe »tschechischer« Autor. Zynisch, voller Humor und dabei ein wenig zerstreut und ausschweifend, oder, wie er sich selbst definierte, ein manisch Depressiver, der auf die Manie wartet.
Nach etwa einem Monat erhielt ich eine E-Mail von ihm:
Hi,
habe angefangen zu schreiben. Weiß aber nicht, wie ausführlich es werden und was ich weglassen soll. Und der Stil? Eher literarisch, feuilletonistisch oder informativ? Hänge Datei an für einen ersten Eindruck.
Uri
Ich beschloss, seine Versuche, die eine Art von Making-of des Werkes darstellen, in das Buch mitaufzunehmen, neben einigen Anekdoten, die uns im Verlaufe unserer Arbeit zu Ohren kamen und sich als bedeutsam herausstellen sollten.
Auch wenn dies nicht unsere Intention war, wirft das Buch eine Reihe von Fragen auf hinsichtlich der Rolle des Lektorats in der modernen Literatur. Meiner Meinung nach ist auch der Nichteingriff durch das Lektorat eine verlegerische Entscheidung. Oder, wie es der spätberufene Autor tschechischer Provenienz formuliert: »Noch nie hat ein Lektor so viel Geld dafür bekommen, sich rauszuhalten.« Meiner wohlüberlegten und sehenden Auges getroffenen Entscheidung folgend, muss ich auch verletzenden Kommentaren dieser Art Raum geben. Einschränkend möchte ich aber darauf hinweisen, dass wir hier nicht von Unsummen sprechen. Es geht schließlich um Literatur, letztendlich.
Der Lektor
Vorwort von Uri Jitzchak Katz, schlanke Version
Den Namen Pavel Klemczek hörte ich zum ersten Mal 1991, als ich im Krankenhaus am Bett meiner Großmutter Zippora, Gott hab sie selig, saß und ihr von den Erlebnissen meiner Grundausbildung erzählte. [Groteske, aber amüsante Schilderung einer Grundausbildung in Kriegszeiten.] Meine Großmutter erwähnte Klemczek im Zusammenhang mit anderen tschechischen Autoren vom Anfang des Jahrhunderts, die wir beide liebten. Das zweite Mal, dass ich den Namen hörte, war Jahre später, als ich mir die Audiokassetten erneut anhörte, die sie vor ihrem Tod aufgenommen hatte und auf denen sie mit etwas monotoner Stimme ihr ganz und gar nicht monotones Leben Revue passieren ließ. Beim ersten Mal, da ich den Aufnahmen gelauscht hatte, war er mir entgangen, vielleicht, weil ich da erst dreiundzwanzig und ihr Tod noch zu präsent war, als dass ich auf Details hätte achten können. Als ich die Bänder Jahre später erneut abhörte, hoffte ich, eine unter den vielen Erinnerungen sich verbergende Geschichte zu finden, eine, die mir als Grundlage für einen Roman dienen könnte, wie noch keiner geschrieben worden war. Nie hätte ich mir vorstellen können, wie gut sie sich versteckt hielt.
Auf einer der Kassetten schilderte meine Großmutter eine Unterhaltung, die sie kurz vor der Staatsgründung mit angehört hatte, zwischen ihrem Schwiegervater, dem Schriftsteller Anschel Katz, und dem großen Literaten und späteren Nobelpreisträger Samuel Joseph Agnon. Meine Großmutter und ihre beiden kleinen Kinder waren gerade aus dem belagerten Kibbuz Kfar Etzion evakuiert worden, zusammen mit allen anderen Frauen und Kindern, und nach Jerusalem ins Kloster Ratisbonne gebracht worden. Großmutters Ehemann, Jitzchak, war mit den übrigen Männern geblieben, um den Etzion-Block zu verteidigen. [Anmerkung zur Absurdität, für einen »Haufen« zu sterben.]7 Eines Nachmittags, als Großmutter sich im Haus ihres Schwiegervaters aufhielt, traf dessen alter Freund Agnon ein, und die beiden Männer diskutierten (wie sie es für gewöhnlich taten, wenn sie sich trafen) über die Frage, wer denn der größte tschechische Autor aller Zeiten sei. Agnon sagte, das sei er ja wohl selbst, und Anschel, dem jeglicher Sinn für Humor fehlte, wenn es um Agnon ging, rief dem anderen in Erinnerung, er sei aber doch Galizier, worauf Agnon mokant abwinkte und sagte, er sei so brillant, dass seine Herkunft überhaupt keine Rolle spiele. Am Ende aber, als Agnon sah, dass Anschel die Geduld verlor, räumte er unwillig ein, der größte tschechische Schriftsteller von allen sei vermutlich Pavel Klemczek. »Wer?«, fragte Anschel ungläubig, und Agnon wiederholte: »Pavel Klemczek.« »Schon gut, schon gut«, sagte Anschel, der einfach nicht glauben konnte, dass dies Agnons Favorit war. »Pavel Klemczek«, meinte er verächtlich. »Nicht einmal in Theresienstadt hätten sie den genommen.« [Die Idee weiterentwickeln vom Getto Theresienstadt als Statussymbol und Qualitätssiegel für Intellektuelle.] Agnon erwiderte, er verstehe nicht, was das heißen solle, und dass Klemczek der Vater der tschechischen Literatur sei, der alle beeinflusst habe. Anschel beharrte, außer dieser einen Erzählung von der Schreibmaschine habe Klemczek nun wirklich nichts Nennenswertes zustande gebracht, worauf Agnon behauptete, Max Brod höchstpersönlich habe ihm gesagt, Klemczek sei der Autor, der Kafka am stärksten beeinflusst habe, und dass ohne diesen weder Die Verwandlung, Der Process noch Das Schloß geschrieben worden wären und auch nicht Amerika. »Ach, hör doch auf«, sagte Anschel abfällig. »Du hast ja keine Ahnung, wie wenig Ahnung du hast«, um noch hinzuzufügen, Amerika sei ohnehin ein Titel, den Max Brod sich ausgedacht habe, und dass Kafka den Roman ursprünglich »Der Verschollene« hatte nennen wollen. Agnon winkte seinerseits bloß ab, was Anschel noch mehr in Rage brachte, der drohte, seinem Freund »Maxi« einen Brief zu schicken, damit dieser den arroganten Autor in die Schranken wiese. Der Disput wurde nicht beigelegt an jenem Tag, und die Zankereien gingen weiter, bis es für Agnon Zeit wurde, sich zu verabschieden. »Als Agnon gegangen war, gestand ich Vater«, so nannte meine Großmutter ihren Schwiegervater, »dass, auch wenn ich nur von einer seiner Geschichten gehört hatte, ›Der Mann, dem das Gesicht in Grimm erstarrte‹ nämlich, Klemczek mein Lieblingsautor sei.« An dieser Stelle machte meine Großmutter eine Pause und nahm vielleicht einen Schluck von dem brühend heißen schwarzen Tee, den sie immer zu trinken pflegte. Dann fuhr sie fort: »Vater lächelte nur und sagte: ›Das ist wirklich eine famose Erzählung. Kaum zu glauben.‹ Aber er stellte klar, dass er das vor Agnon nicht hatte zugeben wollen, um dessen Arroganz nicht noch mehr Nahrung zu geben.« Großmutter gestand ihrem Schwiegervater zu, der hochgeschätzte Autor leide tatsächlich am Jerusalem-Syndrom, worauf Anschel lachte und sagte, Agnon sei der Einzige, der unter dem Jerusalem-Syndrom leide, auch wenn er in Tel Aviv sei. »Vater fürchtete, an dem Tag, an dem er einer Meinung wäre mit dem egozentrischen Autor, würde der aufhören, ihn zu besuchen«, erzählte meine Großmutter in trockenem Ton. Und wenige Monate später hörte Agnon tatsächlich auf, ihn zu besuchen, aber nicht, weil die beiden über dieses oder jenes einer Meinung gewesen wären, sondern weil Anschels Sohn Jitzchak, der Vater meines Vaters und Ehemann meiner Großmutter, bei den Kämpfen um Kfar Etzion getötet wurde. Und danach hörte Anschel auf, Gäste zu empfangen oder bei anderen zu Gast zu sein.
In jener Woche bekam ich den Namen Pavel Klemczek abermals zu hören, als ich in Tel Aviv in einem Pub saß und versuchte, eine tschechische Touristin namens Julia zu beeindrucken mit meinem Wissen über die Literatur ihres Landes. Ich war gerade dabei, ihr die größten tschechischen Autoren des 20. Jahrhunderts aufzuzählen, als sie mich unterbrach und sagte, ihr Lieblingsautor sei ohnehin Pavel Klemczek. »Ach«, sagte ich, »der, von dem ›Der Mann, dem das Gesicht in Grimm erstarrte‹ ist«, worauf Julia fast ohnmächtig wurde. Sie hätte nie geglaubt, dass jemand schon einmal von Klemczek gehört hätte, und hatte seinen Namen nur eingeworfen, weil sie sicher war, ich würde ihn nicht kennen, und mich loswerden wollte. Schließlich war sie eine wunderschöne junge Frau von höchstens Mitte zwanzig und ich beinahe doppelt so alt wie sie. Am Ende wurde sie mich nicht nur nicht los, sondern gab mir sogar ihre Telefonnummer und bat, ich solle sie am nächsten Tag gegen Abend anrufen. Ich hatte also etwas weniger als vierundzwanzig Stunden Zeit, um ein paar Informationen über Pavel Klemczek zusammenzutragen und die Inhaltsangabe von einem oder zwei seiner Bücher zu lesen. Wie schwierig sollte das sein im Zeitalter des Internets?
Ich fand rein gar nichts. Wikipedia lieferte eine einzige Zeile: »Pavel Klemczek, 1866–1936, tschechischer Schriftsteller und Dichter.« Ich nahm mir Großmutters Kassetten noch einmal vor, obwohl die Chance, in der kurzen Zeit etwas aus sechzig Stunden Audiomaterial zu filtern, gleich null war. [Bemerkung darüber, wie wir einst mit Medien ausgekommen sind, die keine Suchfunktion hatten.] Und tatsächlich fand ich keine weitere Erwähnung Klemczeks, vor allem jedoch weil ich die Kassetten nur flüchtig durchging, immer wieder vorspulte und versuchte, nicht an Julia in ihrem kurzen pinkfarbenen Kleid zu denken (das sie danach nie wieder tragen sollte), zusammen mit dem Bild meiner an den Dialyseapparat angeschlossenen Großmutter. Ich muss einräumen, dass zwischen ihnen eine gewisse Ähnlichkeit bestand, offenbar wegen ihrer Zugehörigkeit zur selben Nation. An jenem Abend, als ich mich mit Julia traf, gestand ich ihr, dass ich nichts über Klemczek wusste und nicht eines seiner Bücher gelesen hatte, einmal abgesehen von »Der Mann, dem das Gesicht in Grimm erstarrte«.
»Ich weiß«, sagte sie. »Ich auch nicht. Man bekommt sein Werk nicht. Offenbar ist es nie gedruckt worden.«
Die spärlichen Informationen, über die Julia verfügte, stammten von ihrem Urgroßvater, dessen Familie in einem Sommer ein Zimmer ihres Hauses im Dorf Karlovy Vary8 an Franz Kafka vermietet hatte. Der Untermieter erzählte Julias Urgroßvater, der damals noch ein kleiner Junge war, jeden Abend zum Einschlafen seine Lieblingsgeschichte, Pavel Klemczeks Erzählung vom »Mann, dem das Gesicht in Grimm erstarrte«. Und Jahre später pflegte der Urgroßvater seinem eigenen Sohn vor dem Schlafengehen eben dieselbe Geschichte zu erzählen, die dieser wiederum noch viel später seiner Enkelin erzählen würde, Julia.
Ich berichtete Julia, wie ich von Klemczek erfahren hatte, und überfiel sie dann mit einem Vorschlag, der zweifelsohne als der schlimmste Anmachspruch aller Zeiten in die Geschichte eingehen wird: »Hättest du Lust, noch mit zu mir zu kommen und dir die Kassetten meiner verstorbenen Großmutter anzuhören?«
Zu meiner hellen Begeisterung willigte Julia ein, und als wir das Restaurant verließen und uns auf den Weg zu meiner Wohnung machten, versprachen wir einander, nicht zu ruhen, bis wir »Der Mann, dem das Gesicht in Grimm erstarrte« gefunden hätten. Schweigend gingen wir weiter, und nach einer Weile blieb sie plötzlich stehen und sah mich an, als begutachtete sie den Mann, den sie im Begriff war, in ihr Leben zu lassen. Auch ich blieb stehen.
An jenem Abend hörten wir uns Großmutters Kassetten nicht mehr an. Am nächsten Morgen bat ich Julia, bei Google den Titel von Klemczeks Erzählung auf Tschechisch einzugeben.
»Habe ich schon versucht«, sagte sie. »Weder zu ihm noch zu seiner Erzählung gibt es irgendwelche Suchergebnisse im Netz.«
»Bei Wikipedia findet man genau eine Zeile«, sagte ich.
»Ich weiß«, sie nickte. »Die ist von mir.«
In den darauffolgenden Monaten unternahm ich gelegentliche Versuche, die verlorene Erzählung Klemczeks zu finden, hauptsächlich weil ich spürte, das war der Faden, der mich mit Julia verband, die in der Zwischenzeit bei mir eingezogen war. Gleichzeitig wurde ich das traurige Gefühl nicht los, sobald ich die Geschichte gefunden hätte, würde Julia aus meinem Leben verschwinden. Dennoch entschied ich, ich durfte nicht aufgeben und musste die Geschichte finden. Zu dem Zeitpunkt war ich, wie schon erwähnt, verzweifelt auf der Suche nach der Idee für eine Geschichte, dem Ende eines Fadens, und der Gedanke, eine vergessene Geschichte aufzutun, sie ein bisschen zu adaptieren und zu modernisieren, erschien mir absolut vernünftig, wenn auch ethisch nicht ganz einwandfrei. Ich begann Tschechisch zu lernen, in Vorbereitung auf den Tag, an dem ich endlich auf die Erzählung stoßen sollte, die Agnon als die Wiege der modernen Literatur definiert hatte. Was sich selbstverständlich als überflüssig erweisen sollte, da Kafka ja auf Deutsch geschrieben hatte, wie mir der Lektor sehr viel später erklären würde. Julia ihrerseits begann, als Zeichen der Solidarität, Hebräisch zu lernen. Nur in Unterwäsche saß sie auf meinem Sofa und übte mit schwerem osteuropäischem Akzent die nicht jugendfreien Verwünschungen, die ich ihr aufgeschrieben hatte: »Kusheli rab rabak!«, »Imash’cha!«.
Dank des Internets gelang es mir, die E-Mail-Adresse des berühmtesten, inzwischen leider verstorbenen tschechischen Autors herauszubekommen, Milan Kundera. Ich schickte ihm eine Nachricht und fragte, ob er Klemczek kenne und wisse, wie man an dessen Schriften komme. Kunderas Antwort fiel einigermaßen lakonisch aus: »Hört auf, mir mit diesem Klemczek auf den Geist zu gehen! Der Mann existiert nicht und hat nie existiert. Das ist ein Legende, ein Mythos oder bloß ein wenig originelles Pseudonym.«
Monate vergingen, ohne dass sich etwas tat. Als wir im Winter nach Prag reisten, um mich Julias Familie vorzustellen, konnte ich mich schon einigermaßen stammelnd auf Tschechisch verständlich machen. Julias Großvater hatte nie eine schriftliche Fassung der Geschichte von dem »Mann, dem das Gesicht in Grimm erstarrte«, gesehen, bestätigte aber, diese sei ihm von seinem Vater erzählt worden, der seinerseits immer behauptet hatte, Kafka habe sie ihm als Kind erzählt. Julias Urgroßvater war schon lange tot, doch seine jüngere Schwester Júli lebte noch und bewies der ganzen Welt, dass man auch mit einhundertundvier Jahren, wenn man einen älteren Bruder gehabt hatte, noch immer »die kleine Schwester« sein konnte. Wir nahmen uns einen Leihwagen und fuhren in die Sudeten, zu ihrem Gehöft im Dorf Harrachov. [Landschaftsbeschreibung, Landschaftsbeschreibung, Landschaftsbeschreibung.] Urgroßtante Júli lebte dort schon gut sechzig Jahre, seit ihrer dritten Heirat. Und nur wenige Augenblicke am Tag war sie noch klar genug bei Verstand, um mit anderen kommunizieren zu können, doch in jenen Momenten erinnerte sie sich weder an Klemczek noch an seine Erzählung. Um ehrlich zu sein, sie erinnerte sich auch nicht mehr, wer Julia war, und hielt mich irrtümlich für ihren Gärtner. Erst als Kafkas Name fiel, hellte sich ihr Gesicht auf, und sie begann, in allen Einzelheiten dessen Zimmer zu beschreiben. Doch schon bald wurde sie müde und verstummte, nicht aber bevor sie mich gebeten hatte, die reifen Tomaten zu pflücken, damit diese nicht erfrören. Auf dem Rückweg zum Wagen wurden wir von Júlis Haushälterin angehalten, die uns erzählte, vor einigen Jahren (und mit einigen meinte sie fast vierzig) sei ein junger Mann namens Klemczek auf dem Hof aufgetaucht und habe Júli nach dem Verbleib eines Schlüssels zu einem Schließfach bei der Tschechischen Nationalbank in Prag ausgefragt.
»Pavel Klemczek?«, fragte Julia.
»Nein«, erwiderte die Haushälterin. »Er hieß Miloš Klemczek, stellte sich aber noch unter einem anderen Namen vor.«
»Franz Kafka?«, versuchte ich.
»Nein«, gab die Frau ohne ein Lächeln zurück. »Er nannte sich Anschel, Anschel Katz.«
Julias Eltern waren nur wenig älter als ich. In ihrer Gesellschaft fühlte ich mich wohl, auch wenn mich das wieder zu einem alten Mann werden ließ. Erst da verstand ich, wie sehr ich mich verändert hatte, seit ich ihre Tochter kannte. Als ich Julia sagte, sie mache, dass ich mich wieder jung fühle, sagte sie, das sei der greisenhafteste Satz, den sie je gehört habe. Ich ließ das unkommentiert, meinte stattdessen, die ganze Geschichte sei zweifelsohne noch einmal verworrener geworden. Warum ist mein Urgroßvater Anschel bei deiner Urgroßtante aufgekreuzt? Und warum hat er sich als Miloš Klemczek ausgegeben?
Wir saßen in der Hauptfiliale der Tschechischen Nationalbank in Prag und warteten auf den für das Archiv der Schließfächer zuständigen Mitarbeiter. Nach etwas weniger als einer Stunde erschien er. [Groteske Beschreibung eines alten Mannes, entstiegen einem vergessenen Jahrhundert und seiner Kultur.] Obwohl wir alles zweimal durchgingen, fanden wir kein Schließfach, das auf den Namen Klemczek eingetragen gewesen wäre, weder Pavel noch Miloš, und auch nicht auf Anschel Katz. Im Nationalen Zeitungsarchiv dagegen hatten wir mehr Glück und fanden drei Einträge, die sich auf Klemczek bezogen. Der erste war eine Anzeige des Staatlichen Patentamtes, in der dem Angestellten P. Klemczek zur Geburt seines Sohnes gratuliert wurde. Die zweite sprach von einem Schriftsteller namens Janusz Klemczek und dessen Buch König Mottel der Erste, das ins Tschechische übersetzt worden war. Ich nahm an, das erklärte sich aus einem Druckfehler und dass in Wahrheit von Janusz Korczak und seinem Kinderbuch König Matz der Erste die Rede war. Die dritte und interessanteste Referenz bezog sich auf die erste Nummer der Literaturzeitschrift Die Sargträger aus dem Jahre 1908, die ein Interview des Herausgebers Max Brod mit dem vielversprechenden jungen Autor Pavel Klemczek bot. Darin erzählte Klemczek von seinem Leben und seiner Arbeit als Angestellter des Patentamtes und erläuterte auch, was ihn bewogen hatte, die Erzählung »Der Mann, dem das Gesicht in Grimm erstarrte« zu schreiben. »Ich wollte eine Geschichte über die Erfindung der Schreibmaschine schreiben«, erzählte er Brod, der seinerseits nicht mit Lobeshymnen auf die Erzählung sparte und versprach, einen Auszug daraus in der nächsten Nummer der Zeitschrift zu veröffentlichen. Bedauerlicherweise aber sollte es für Die Sargträger zu keiner weiteren Ausgabe reichen. Die erste Nummer jedoch bot auch ein Foto, das mit »P. Klemczek und Arbeitskollegen« untertitelt war.
Als wir zurück in Israel waren, zeigte ich meinem Vater das Foto. Er betrachtete es ausgiebig, während Julia sich die Bilder auf seinem Schreibtisch ansah.
»Das ist meine große Schwester, das ist meine jüngere Schwester, und das ist mein Cousin Itzik, der nach unserem getöteten Großvater Jitzchak benannt ist.«
»Ich dachte, du wärst derjenige, der nach deinem Großvater benannt ist?«
»Bin ich auch. Aber es ist kompliziert … Und das ist meine Mutter, als sie ungefähr in deinem Alter war.«
Sie nahm Mutters Bild vom Schreibtisch, das sie rauchend in ihrer Krankenschwestertracht zeigte. »Dann ist sie also auch Krankenschwester.«
Ich sah Julia verständnislos an.
»Genau wie deine Großmutter.«
Und da ging mir zum ersten Mal auf, dass mein Vater eine Frau geheiratet hatte, die dieselbe Profession wie seine Mutter hatte. Doch diese semi-ödipale Entdeckung ließ meinen Vater unbeeindruckt. Er gab mir das Foto zurück. »Ich kann Klemczek darauf nicht erkennen«, sagte er. »Aber der hinter ihm ist ganz sicher Großvater Anschel.«
Ich sah erst ihn erstaunt an und dann Julia, die noch immer dabei war, die Fotos auf dem Schreibtisch zu studieren. »Interessant«, sagte sie zerstreut. Dann erhob sie sich, um zu signalisieren, was sie betraf, war der Besuch beendet.
Der Mann, dem das Gesicht in Grimm erstarrte
Von Pavel Klemczek
Aus dem Tschechischen von Jitzchak Jeschajahu Katz
Zweite Niederschrift – übergeben an Hamdha al-Husseini, am Ausgang des Schabbats, 13. Dezember 1947
2. Kapitel
Julias Geschichte
Julias Geschichte
Julia Sopček stand am Bahnsteig des Schnellzugs nach dem Sudentenland. Sie war zerstreut, wie man es durchaus von einer jungen Frau erwarten kann, die kurz zuvor mitten am Tag und, ohne ihrem Vorgesetzten ein Sterbenswörtchen zu sagen, den Arbeitsplatz verlassen hatte, zu Hause nur eben vorbeigeschaut hatte, um einen kleinen Koffer zu packen und ihrem Mann eine kurze Nachricht zu hinterlassen, und die jetzt allein auf dem Bahnsteig stand, mit einem Fahrschein einfache Fahrt. Wie sonderbar: Noch am Morgen war sie die Sekretärin eines leitenden Direktors der »Staatlichen Fabrik für Bleistifte und Schreibwaren« gewesen, frisch verheiratet mit einem Angestellten des Patentamtes, und jetzt war sie eine Reisende – ungebunden, spontan, abenteuerlustig und wagemutig, genau wie Rosa. Wie schade, dass Rosa sie jetzt nicht sehen konnte, und wie überrascht sie sein würde, wenn sie sie in kaum zwei Stunden sähe, am Bahnhof des Städtchens Harrachov stehend und nur auf sie wartend. Es fiel ihr schwer zu glauben, dass sie Rosa erst seit zehn Tagen kannte. Am letzten Tag des Jahrmarktes hatten sie sich getroffen. Julia und ihr Mann Jiří9 hatten geplant, einige der Aufführungen zu sehen und vielleicht sogar die neue Frucht zu probieren, von der alle Welt sprach, eine Köstlichkeit, die aus den Ländern Siam und Indien stammte, Ananas genannt wurde und süßer als Honig und Zucker zusammen schmecken sollte. Nach der Arbeit war sie zu Fuß zum Patentamt gegangen und hatte nicht die Droschke genommen, damit das Geld reichte für ein Stück Ananas für jeden von ihnen, doch als sie den Schreibsaal des Patentamtes betrat und Jiřís Gesicht sah, verstand sie, heute würde sie weder auf den Jahrmarkt gehen noch Ananas kosten.
Unmittelbar vor Schalterschluss war ein Ungar ins Patentamt gekommen, der einen Hut auf dem Kopf trug, welcher nicht die Form eines Zylinders, sondern eines Würfels hatte. Und obgleich es eigentlich schon zu spät war, um ein Patent anzumelden, entschied der Amtsleiter, eine Ausnahme zu machen und mit der Patenteintragung zu beginnen, da die Angelegenheit pressierte: Denn besagter Hut war ja für alle Welt sichtbar, sodass jeder, der den Hut sähe, bis zur Schalteröffnung am nächsten Morgen das Patent kopieren und es als das seine beanspruchen könnte. Den Amtsleiter zu überzeugen, half auch ein nicht zu schmales Bündel Geldscheine, das von einer ungarischen Hand in eine tschechische wanderte. Flugs wurde eine neue Akte angelegt, die den Titel »Würfelförmiger Zylinderhut« trug, und sämtliche einfachen Angestellten wurden angewiesen, zu bleiben und die revolutionäre Kopfbekleidung zu studieren, zu vermessen und zu katalogisieren. »Ich habe das Gefühl, der ungarische Würfel wird ein großer Schlager«, meinte der Amtsleiter servil zu dem aufgeregten Erfinder. »Jawohl, wir leben in historischen Zeiten«, fuhr er fort und schaute dabei, ohne einen Versuch, dies zu verbergen, Julia auf die Beine, die neben ihrem Mann stand und abzuschätzen versuchte, wie lang dessen Arbeit denn noch dauern würde. Jiří bekam gewiss mit, dass die Augen des Amtsleiters auf den Beinen seiner Frau ruhten, sagte jedoch nichts und blickte stattdessen zu Boden.
Julia überlegte, wie es wohl wäre, mit einem durchsetzungsfähigeren, impulsiveren oder einfach bloß eifersüchtigeren Mann zu leben. Sie hatten sich getroffen, als sie die höhere Sekretariatsschule besuchte. Einmal hatte die Schule einen Tagesausflug zum Patentamt organisiert, und dort bekamen die angehenden Sekretärinnen die Utensilien der Zukunft vorgeführt (natürlich nur die, die gezeigt werden konnten), Erfindungen, die die Welt des Sekretariatswesens verändern sollten. Ein lang aufgeschossener, ein wenig blässlicher junger Patentbeamter zeigte den Mädchen einen Bleistiftanspitzer, einen Tintenschaber10 und ein Gerät, das zwei Löcher in den Rand der Seite stanzte. Obwohl Julia nicht verstand, wozu man Löcher in die Bögen machen sollte, starrte sie den jungen Mann mit ihren großen, verträumten Augen an, bis dieser so durcheinandergeriet, dass er sich beinahe selbst zwei Löcher ins Ohrläppchen gemacht hätte. Julia fragte sich, was er wohl mit zwei Löchern in einem Ohr anfangen würde, stellte ihn sich vor mit einem Ohrring in jedem Loch und musste laut lachen. Der junge Beamte senkte die Augen. Noch in derselben Woche bekam sie einen Brief von Jiří. Damit sie wusste, wer er war, hatte er zwei Löcher in den Briefbogen gestanzt. Er erzählte ihr darin ein wenig von sich selbst und von seiner Familie und bat um Erlaubnis, ihr weiter zu schreiben. Eine Zeit lang erhielt Julia einmal in der Woche einen Brief mit zwei Löchern in jedem Bogen. In der letzten Woche vor ihrer Zulassung als Sekretärin erschien Julias Vater, um sie im Wohnheim der Mädchen zu besuchen. Er erzählte ihr, Jiří habe bei ihm um ihre Hand angehalten. Auch meinte er, er sei sehr überrascht gewesen, da er nicht gewusst habe, dass seine Tochter, die immer schüchtern gewesen war und sich nie etwas aus Männern gemacht hatte, ein solch geselliges Leben führe und Heiratsanträge erhalte. Dank seiner Kontakte habe er nun bei den Vorgesetzten Erkundigungen über diesen Jiří eingeholt und herausgefunden, dass, alles in allem, von einem anständigen, tüchtigen jungen Mann die Rede sei. Wenn Julia wolle, dann habe er, ihr Vater, keine Einwände und sie könne ihren Auserwählten heiraten. Julia willigte ein, und der Vater strahlte vor Freude.
Dem Anschein nach war es eine gute Ehe. Das junge Paar wohnte zur Miete in einer kleinen Wohnung, Jiří hatte nichts dagegen einzuwenden, dass auch seine Frau arbeitete, und wenigstens alle zwei Wochen gingen sie aus. Auch pflegte Jiří Julia von allerlei sonderlichen Erfindungen und Patenten zu erzählen: eine Falle nur für weiße Mäuse, mehrfach verwendbare Streichhölzer, Tinte, die gleichzeitig an zwei verschiedenen Orten schreibt. Julia mochte das Leben mit Jiří, hatte aber nichtsdestoweniger immer das Gefühl, es fehlte etwas, dass dies nicht ihr Leben war und sie bloß eine Hülle, in der eine ganz andere Frau lebte. Oft beschlich sie eine Ahnung, als stünde sie am Rand und schaue nur zu. Sie betrachtete sich selbst bei der Arbeit und an der Seite ihres Mannes und vermochte nicht zu verstehen, was sie tat und wie sie dorthin geraten war. Derlei war Julias Sinnen, als sie allein vom Patentamt nach Hause ging und mit einem Mal gedankenverloren in Richtung Jahrmarkt abbog. Sie lief zwischen den Attraktionen umher, bis sie plötzlich vor dem Obststand angelangt war, wo noch ein letztes Stück der exotischen Ananasfrucht übrig war. Julia war schon in Begriff, dem Verkäufer das Geld zu reichen, als sich zwei junge Burschen, Halbwüchsige noch, vordrängelten und ihm die Frucht abkauften. Enttäuscht wandte Julia sich ab und wäre beinahe mit einer schönen jungen Frau zusammengestoßen. Diese trug ein dünnes schwarzes Kleid, auf dem pechschwarzen Haar ein rotes Barett und Lippenstift, der nicht minder rot war. Sie lächelte Julia zu und sagte: »Pas encore terminé.«11 Mit einem Schritt war sie bei dem Jungen, der gerade von dem Stück Ananas abbeißen wollte, blieb vor ihm stehen, näherte ihr Gesicht bis auf wenige Zentimeter dem seinen, öffnete den Mund und schaute gebieterisch auf die Fruchtscheibe. Ein wenig überrascht schob er ihr den Ananasschnitz in den Mund. Sie lächelte, biss zu, sodass die Hälfte der Fruchtscheibe noch aus ihrem Mund ragte, und näherte sich damit noch ein wenig mehr dem Mund des Jungen. Doch in dem Moment, in dem er versuchte, davon abzubeißen, fuhr sie zu Julia herum und hielt das Ananasstück so nah vor deren Lippen, dass es sie fast berührte. Julia wich ein wenig zurück, als die junge Frau den Rest der Frucht herunterschluckte und sagte: »Diese Welt ist für Schnellentschlossene gemacht. Wer zaudert – der versäumt etwas.« Die Jungen lachten und trollten sich. »Ich bin Rosa«, sagte die Frau. »Komm, ich kenne den Lieferanten dieser Früchte.« Sie ergriff Julias Hand und zog sie hinter sich her.
Eine Stunde oder länger liefen sie durch die engen Gassen Prags, auf der Suche nach irgendeiner Adresse, bis sie schließlich einen kleinen, von Wohnhäusern eingefassten Platz erreichten, mit einem Springbrunnen in der Mitte. Rosa streifte die Schuhe ab, kletterte auf den Springbrunnen und schrie: »Wo ist der jämmerliche Stefan?«
»Hier gibt’s keinen Stefan!«, schallte es aus einem der Häuser zurück. »Geht schlafen, ihr weckt noch die Kinder!«
»Egal, sollen die kleinen Schädlinge doch aufwachen«, brüllte Rosa. »Wozu sind die denn gut, außer das Geld ihrer Eltern zu stehlen?«
»Gib sofort Ruhe, oder wir rufen die Polizei!«, meldete sich von einem anderen Balkon eine Stimme.
Julia zog Rosa von dem Springbrunnen und setzte sie auf eine nahe Bank. Sie war einigermaßen betrunken. »Wer ist dieser Stefan?«, fragte Julia.
»Der jämmerliche Stefan, er hat verkündet, bei ihm gäb’s eine Feier. Elender Lügner, ich sag’s dir, den Deutschen kann man nicht trauen«, erwiderte Rosa lallend, und schon war sie eingeschlafen.
Julia öffnete Rosas Handtasche und fand darin einen roten Lippenstift und die Karte einer Pension. Sie ging zum Springbrunnen, befeuchtete den Ärmel ihres Kleides und betupfte Rosas Gesicht. Rosa wachte auf und lächelte. Sie brauchten lange, bis sie die Hauptstraße erreicht hatten, wo es Julia gelang, eine Droschke anzuhalten und dem Kutscher die Adresse von Julias Pension zu geben. In letzter Sekunde zog sie einen Bleistift und ein Stück Papier aus der Tasche und schrieb:
Bitte nimm diesen Bleistift als Geschenk. Er ist in der »Staatlichen Fabrik für Bleistifte und Schreibwaren« hergestellt, wo ich arbeite.
Julia
Sie legte Bleistift und Zettel in Rosas Handtasche, zahlte den Kutscher mit dem Geld, von dem sie sich ein Stück Ananas hatte kaufen wollen, und ging zu Fuß nach Hause. Dort traf sie um kurz nach zehn ein. Jiří war noch nicht zurück von der Arbeit.
Am nächsten Tag erschien ein Botenjunge bei der »Staatlichen Fabrik für Bleistifte und Schreibwaren« und überreichte Julia einen Obstkorb, darin ein bleistiftgeschriebener Zettel.
Ananas hatten sie keine mehr, aber Äpfel sind auch nicht schlecht. Komm heute um sieben, um mich im Theater in der Pierre Ménard Nr. 6 auftreten zu sehen.
R.
Versiegelt war die Nachricht von Rosas Mund mit einem leuchtend roten Lippenstiftabdruck.
Julia spürte, wie sie errötete. Sie sah sich im Saal um, ob jemand es bemerkt hatte. Alle schienen beschäftigt, bis auf den Herrn Gugel, den sie bei sich immer »Gugel die Schlange« nannte und der jetzt auf sie zugekrochen kam. »Aha, die Frau Sopček hat also einen Obstkorb bekommen. Der ist ganz sicher nicht von einem heimlichen Verehrer, denn der wäre gewiss nicht so dumm, ihr ein Geschenk an den Arbeitsplatz zu schicken, wo jeder es sehen kann. Sicher ist das eine Aufmerksamkeit von dem Herrn Gemahl, dabei war doch ihr Geburtstag erst grad vor einem Monat. Ich erinnere mich sehr wohl, da sie ja darum bat, eine halbe Stunde vor Dienstende gehen zu dürfen, um es rechtzeitig ins Restaurant zu schaffen, wo das freudige Ereignis gefeiert werden sollte. Auch ihr Hochzeitstag jährt sich erst in drei Monaten, weshalb es sich zweifellos um ein Versöhnungsgeschenk handeln muss. Vermutlich ist es im Nest der Turteltäubchen zu einem Streit gekommen, und jetzt schickt ihr der Gatte einen Präsentkorb und bittet um Verzeihung. Bin ich nicht ein Meisterdetektiv? Es gibt nichts, was Gugel nicht weiß, habe ich recht? Sagen Sie mir, weshalb bittet er Sie um Entschuldigung? Hat er mit den Schuhen Dreck ins Haus getragen? Oder Ihnen keine Komplimente für ein neues Kleid gemacht? Was hat der Unhold getan?«
Ohne zweimal nachzudenken, erwiderte Julia: »Er hat mich mit einer Ausländerin betrogen, einer Französin.«
Gugel erstarrte. »Frau Sopček, sagen Sie dem Herrn leitenden Direktor, ich lege ihm die Berichte in einer Stunde vor. Danke.« Und schon eilte er davon.
Julia fragte sich, warum sie das gesagt hatte, aber der fassungslose Ausdruck auf Gugels Gesicht war es allemal wert gewesen.
Später am Abend fand sie sich in der Pierre Ménard Nr. 6 wieder, doch ein Theater gab es dort nicht. Sie folgte einem Pfad, der zu einem Innenhof führte, auf dem zwei dunkelhäutige Mädchen irgendein Spiel mit Pflaumenkernen spielten. Sie fragte nach dem Theater, und die beiden wiesen auf einen der Eingänge. Julia trat in einen überschaubar großen Raum, in dem etwa ein Dutzend Personen auf Strohmatten vor einem aufgehängten Laken saßen, das augenscheinlich als Vorhang diente. Nach einer ganzen Weile ging das Licht aus, der Vorhang öffnete sich, und dahinter hockte Rosa auf einem niedrigen Schemel, vollkommen nackt, und deklamierte einen Text auf Französisch. Von Zeit zu Zeit spreizte sie zum immer schnelleren Rhythmus afrikanischer Trommeln die Beine. Julia spürte, dass sie kaum noch Luft bekam.
Nach der Vorführung folgte Julia den anderen in eine winzige Kammer, die als Garderobe diente. Dort saß Rosa, von Männern umstanden. Als sie Julia sah, stieß sie alle beiseite, stürzte auf sie zu und umarmte sie. »Ich freue mich ja so, dass du gekommen bist, hatte schon Sorge, du hättest meine Nachricht nicht erhalten. Ich war nicht sicher, ob ich sie an die richtige Adresse geschickt hatte, denn außer der ›Staatlichen Fabrik für Bleistifte und Schreibwaren‹ gibt es auch noch eine ›Staatliche Fabrik für Schreibwaren und Tintenfedern‹, und das ist etwas ganz anderes. Aber du bist hier! Hat es dir gefallen? Peter hat Regie geführt, er ist Student am Experimentellen Theater und





























