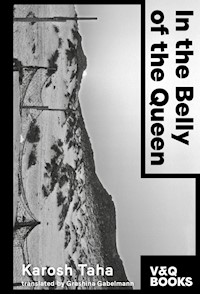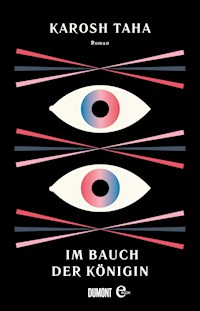8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Sanaa ist zweiundzwanzig. Sie studiert, hat einen Freund und einen Liebhaber, und sie hat Träume. Alles könnte gut sein, wäre da nicht die Realität, die sie immer wieder kneift, während sie träumt – kneift wie die Krabbe damals im Irak, als sie im Fluss badete. Die Realität, das sind: Sanaas Mutter Asija, die unter Depressionen leidet. Ihr Vater Nasser, der sich von seiner Familie entfremdet hat. Ihre Schwester Helin, wütend, orientierungslos. Und ihre Tante Khalida, die Tag für Tag Tabak rauchend auf dem Sofa der Familie sitzt und über alles wacht. Sanaa rebelliert gegen die Enge ihres Umfelds, ringt um Luft zum Atmen, um Freiheit. Doch sie kann der Verantwortung für ihre Familie nicht entfliehen. Also kümmert sie sich und versucht ihrer aller Wunden zu heilen. Bis plötzlich alles, was sie sich an Freiheit erkämpft hat, auf dem Spiel steht. Rauschhaft und kraftvoll, dann wieder unbeschwert und komisch erzählt Karosh Taha von einem Leben im Dazwischen: zwischen Freiheit und Verantwortung, Erinnerung und Zukunft, Mythos und Wirklichkeit. ›Beschreibung einer Krabbenwanderung‹ entwirft dabei Figuren, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen und denen man nichts mehr wünscht, als dass sie nach langer Reise endlich ankommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 333
Ähnliche
Sanaa ist zweiundzwanzig. Sie studiert, hat einen Freund und einen Liebhaber, und sie hat Träume.
Alles könnte gut sein, wäre da nicht die Realität, die sie immer wieder kneift, während sie träumt – kneift wie die Krabbe damals im Irak, als sie im Fluss badete.
Die Realität, das sind: Sanaas Mutter Asija, die unter Depressionen leidet. Ihr Vater Nasser, der sich von seiner Familie entfremdet hat. Ihre Schwester Helin, wütend, orientierungslos. Und ihre Tante Khalida, die Tag für Tag Tabak rauchend auf dem Sofa der Familie sitzt und über alles wacht. Sanaa rebelliert gegen die Enge ihres Umfelds, ringt um Luft zum Atmen, um Freiheit. Doch sie kann der Verantwortung für ihre Familie nicht entfliehen. Also kümmert sie sich und versucht ihrer aller Wunden zu heilen. Bis plötzlich alles, was sie sich an Freiheit erkämpft hat, auf dem Spiel steht.
Rauschhaft und kraftvoll, dann wieder unbeschwert und komisch erzählt Karosh Taha von einem Leben im Dazwischen: zwischen Freiheit und Verantwortung, Erinnerung und Zukunft, Mythos und Wirklichkeit. ›Beschreibung einer Krabbenwanderung‹ entwirft dabei Figuren, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen und denen man nichts mehr wünscht, als dass sie nach langer Reise endlich ankommen.
Credit: © Havin Al-Sindy
Karosh Taha wurde 1987 in der Kleinstadt Zaxo im Nordirak geboren. Seit 1997 lebt sie mit ihrer Familie im Ruhrgebiet und hat an der Universität Duisburg-Essen sowie in Kansas/USA Anglistik und Geschichte studiert. Für ihre Leistungen und ihr soziales Engagement erhielt Karosh Taha mehrere Stipendien, darunter das Studienstipendium der Heinrich-Böll-Stiftung. ›Beschreibung einer Krabbenwanderung‹ ist ihr erster Roman.
KAROSH TAHA
BESCHREIBUNG EINER KRABBENWANDERUNG
ROMAN
eBook 2018
© 2018 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung und -illustration: Nurten Zeren, www.zerendesign.com
Satz: Angelika Kudella, Köln
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-8999-0
»Diese Geschichte beruht auf tatsächlichen Begebenheiten in meiner Erinnerung.«
Während ich von einer roten Krabbe träume, die von einer roten Krabbe träumt, die von einer roten Krabbe träumt, die von einer roten Krabbe träumt, die von mir träumt, während ich von einer roten Krabbe träume. Ich wache verheult auf, und ein Riesenmond blendet mich, dass ich kaum die Augen öffnen kann.
Meine Schwester schläft, atmet unmerklich. Auf dem Balkon steht Asija in dürrer Gestalt. Ich schaue auf meinem Handy nach der Uhrzeit: drei Uhr morgens. Ich darf noch eine Weile schlafen. Nach fünf Minuten, vielleicht auch mehr, klingelt der Alarm meiner Schwester.
Ich wundere mich über die eingebrochene Helligkeit und weigere mich aufzustehen. Mein Kopf fühlt sich auf dem weichen Kissen an, als läge er zwischen den warmen Großmutterbrüsten. Ich drücke das Gesicht in den Stoff und rieche an ihrem hennageröteten Haar, das nach erdfarbener Kernseife duftet. Das Kissen ist feucht von den Tropfen, die von Großmutters Zöpfen regnen und auf meinen Wangen platzen, weil sie kurz zuvor gebadet hat. Vielleicht habe ich auch nur im Schlaf geweint. Ich kann kaum durch die Nase atmen und muss an die rote Krabbe denken. Sie kriecht unter den Sand und beim Rauskrabbeln sammeln sich Sandkörner in ihren Augen.
Ich will mich unter den Laken begraben, mich in die Matratze bohren, in meiner Großmutter wohnen, die mich niemals gebiert. Ich könnte mich von ihrer Leber ernähren und meine Füße an ihren Nieren wärmen. Die kalten Füße habe ich von Asija geerbt; sie wandert wie ein verirrter Geist mit einer Decke um die Schultern in der Wohnung umher. Nachmittags liegt sie eingerollt in ihrem Ehebett, abends betet sie auf dem Balkon einen Viertelmond an. Im Schein strahlt sie so schön wie eine verlorene Jungfrau. Letzte Nacht beobachtete ich sie: die fahlen Hände auf das Geländer gelegt – das Gesicht zum Vollmond gerichtet.
Früher, ganz früher, vor zweihundert Jahren vielleicht, da beteten wir gemeinsam den Mond an – da wohnten wir noch im Irak. Asija hob mich auf die Gartenmauer, sie selbst kletterte auf einen Kasten, damit ich mich gegen ihre Schulter lehnen konnte, und wir stierten durstig den Mond an. Sie benetzte ihre Fingerspitzen mit Spucke und rieb meine Hände damit ein, während sie die Namen aller heiligen Frauen flüsterte. Ich war mit meiner Nase ganz nah an ihrem Kopf, der nach Aleppo-Seife roch, und konzentrierte mich auf ihre Stimme. »Im Namen von Karima, der Großzügigen, Amina, der Treuen, Halima, der Milden, und Fatima, der Reinen. Im Namen von Mariam, der Unberührten, Asija, der Barmherzigen, und Aziza, der Mächtigen. Im Namen von Chadidscha, der Weisen, der ersten Muslimin und Gefährtin des Propheten. Gottes Lob und Friede seien auf ihnen.« Ich hatte am Tag zuvor mit erdfarbenen Kröten experimentiert, deswegen wuchsen Warzen an meinen Händen.
»Du darfst nicht mit Kröten spielen, verstanden?«
Ich winde mich zwischen den kalten Zöpfen der Großmutter. Mein Kissen ist durchtränkt von salzigem Wasser, dass ich glaube zu ertrinken, wenn ich nicht bald aufstehe.
Ich schaffe es, mich aus dem Bett zu hieven. So müssen sich fünfundsechzig Jahre anfühlen. Ob es gesund ist, sich mit zweiundzwanzig wie Mitte sechzig zu fühlen, glaube ich kaum. Es gibt einige Anzeichen dafür, dass ich doch keine fünfundsechzig bin: Auf dem Laken ist ein fetter Fleck in Form einer Wolke; es ist ein frisches Rot, als hätte man ein Rotkehlchen im Bett geköpft. Armer Vogel, denke ich. Den kleinen, warmen Körper würde ich in meine Hände gebettet zum Balkonkasten tragen, um ihn zwischen den Geranien zu begraben, wo ihm nach einem Jahr ein frischer Kopf wachsen kann. Aber wir haben keine Geranien.
Während ich von Rotkehlchen tagträume, wacht meine Schwester auf und reibt sich die Augen wie eine Siebenjährige. Zwischen ihren Beinen wächst ebenfalls eine rote Wolke. Irgendwann bemerkt sie die feuchte Stelle und stöhnt, dann schlendert sie hoffnungslos ins Bad. Ich wechsle unsere Laken schnell aus, denn die Wolken verformen sich zu scharfen Scheren.
Helin wundert sich, warum ich ihr Bett herrichte.
»Warum tust du das?«
»Weil du meine kleine Schwester bist«, sage ich und streiche ihr über das frisch gekämmte Haar, als wäre sie sechs. Sie runzelt die Stirn und glaubt, ich plane etwas, erlaubt mir keinen Moment der Zärtlichkeit. »Fass meine Haare nicht an.«
Ich plane zu duschen und in Adnans Armen zu liegen, der mich um die Mittagszeit erwartet: Wir frühstücken nie, wir essen gleich zu Mittag, dann liegen wir im Bett. Er erzählt mir von Dingen, auf die ich mich schwer konzentrieren kann, weil ich an eine rote Krabbe mit Sandkörnern in den Augen denken muss. Jedes Mal nehme ich mir vor, Adnans Erzählungen zu folgen, dann wandert mein Blick seine Wangen entlang, und ich befühle seinen warmen Nacken und rieche an seinem Hals, der nach gerösteten Maronen duftet. Er streichelt meinen Bauch, seine Hand gleitet tiefer und dann klingelt der Alarm: Adnan muss los. Ich bleibe eine Weile in seinem Bett liegen, fahre mit der Hand über die Matratze, um die Reste seiner Körperwärme zu ergattern.
Beim Duschen lasse ich heißes Wasser auf meinen Körper strömen, bis sich meine Haut rötet. Jemand klopft an die Tür, will mich draußen haben, Babu müsse duschen, sagt Helin. Und ich denke an Nasser und Asija; in meinem Kopf heißt mein Vater Nasser, und Asija heißt Asija, seit sie mir die Brust gegeben hat, seit sie mich in den Schlaf gewiegt hat, seit ich sprechen kann, nenne ich Asija Asija. Die Frau, die das Wort Uda, also »Mutter«, für sich beansprucht, ist meine Großmutter mit den warmen Brüsten.
Dampf steigt von meiner Haut auf, als ich nur mit einem Handtuch bekleidet aus dem Bad komme, weil Nasser es egal ist, wie viel Haut ich zeige. Das Bad liegt neben meinem Zimmer, in das ich flüchte. Meine Schwester schimpft: »Wieso brauchst du immer so lange zum Duschen, was machst du da drin?«
»Was soll ich schon machen, ich dusche.«
Sie glaubt mir nicht; sie schaut mich argwöhnisch an. »Aha.«
»Nicht ›aha‹. Kümmere dich um deinen eigenen Kram.«
Schließlich frage ich auch nicht, was sie in den Nächten unter der Decke treibt, wenn sie das Gesicht verzerrt: Sie winkelt immer das linke Bein an, damit keine verdächtige Wölbung untenherum entsteht. Sie denkt, ich schlafe, trotzdem schaut sie rüber zu mir, um sich zu vergewissern. Meine Augen sind offen, wie ein Uhu blicke ich ihr direkt ins lustverzerrte Gesicht; ich kann das, weil der Mond hinter meinem Rücken ins Zimmer scheint, mein Gesicht in seinem Schatten liegt und die Dunkelheit Helin das Schamgefühl erspart.
Mit ungeübten Händen fuchtelt sie an ihrer feuchten Muschi, die leise schmatzt. Immer wieder legt sie eine kleine Pause ein, um entweder den Orgasmus hinauszuzögern oder um sich zu erholen, weil es sie anstrengt. Dabei ist sie schon fünfzehn, nächste Woche wird sie sechzehn, und erst vor einem Monat hat sie mit dem Masturbieren angefangen.
Helin verstummt, als jemand unsere Zimmertür ungefragt öffnet: Da steht Asija mit einer dünnen Decke wie eine gebrechliche Großmutter. »Ich habe dir ein Ei gemacht.«
»Mir?«, frage ich erstaunt.
Sie nickt und geht, wartet nicht darauf zu hören, dass ich nie frühstücke. Meine Schwester schaut mich wieder an, als wäre ich ein Rätsel. Ich habe noch zwei Stunden, bis ich mit Adnan im gleichen Rhythmus atme; wie lange kann es dauern, ein Ei zu essen? Höchstens fünf Minuten. Wenn sie Chai gekocht hat, dann nur drei. Drei Minuten kann ich von meiner Zeit entbehren.
Meine Schwester reibt sich die rosafarbene Narbe an ihrer Wange mit Make-up heil. Wer sie nicht kennt, wird vermuten, sie verdecke damit einen Pickel.
»Was ist?«, fragt sie genervt. Ich wende mich ab.
Man sieht trotzdem eine kleine Erhebung, einen gewundenen Wurm oder ein Schneckenhaus, je nachdem, ob sie von der Seite angestarrt oder auf die Stirn geküsst wird. Schließlich packt sie ihre Schultasche, ohne den Blick von mir abzuwenden. Dabei kümmert es sie nicht, dass ich in Slip und BH von niemandem angeschaut werden will, der keinen Penis hat.
»Was ist?«, frage ich unnötig aggressiv.
Sie verschwindet mit der schweren Tasche um die Schulter. Ich wünschte, sie würde zurückblicken, um die Reue in meinem Blick zu sehen. Ich begutachte die junge Frau im Spiegel, ob etwas Wesentliches an ihr fehlt. Aber alles sitzt an seinem Platz, und es gibt keinen Grund, mich zu bestaunen, so gewöhnlich sehe ich aus. Ich gucke auf die Uhr und eile in Richtung Küche, bleibe im Wohnzimmer stehen.
Auf der Couch liegt mein Vater vor dem stumm geschalteten Fernseher, alt, obwohl erst Mitte vierzig, vielleicht auch Anfang vierzig, aber nicht gesund, die Arme weiß und brüchig wie Knoblauchhaut. Er kratzt sie, und ich höre, wie die Nägel seine trockene Haut aufreißen. Kurz bleibe ich stehen. Ein bisschen Spucke wird helfen. Er hat mich noch nicht bemerkt und schaut weiter fern, manchmal auch fern. Wenn Umm Kulthum singt, dann fließen die Tränen, als hätte seine Mutter Krebs. Aber heute liegt er nur auf der Couch und öffnet den Mund, die Lippen reißen auseinander, als hätte er seit fünfhundert Jahren kein Wort gesprochen, und bevor er etwas sagt, bewege ich mich von der Stelle und erinnere ihn: »Muss in die Uni, bin schon spät dran.« Er kratzt wieder seine Arme.
»Wenn du das nächste Mal duschst, dann nimm deine Haare aus dem Abflusssieb, das ist widerlich«, sagt er.
Ich laufe zurück und sage: »Ich habe keine Haare im Abflusssieb gelassen.«
»Doch, das sind deine Haare. Wenn ihr diese Wohnung so verdreckt, dann ist es kein Wunder, dass ich noch ganz krank werde.« Er kratzt die Haut rot.
Ein bisschen Spucke wird helfen, will ich sagen.
So wie er mir damals die Wade mit Spucke einrieb, als mich eine Krabbe im Chabur gekniffen hatte. Er nahm mich auf seinen Schoß, massierte mit einer Hand meine Wade, wischte mit der anderen meine Tränen weg, flüsterte tröstende Worte in mein Ohr: »Wein doch nicht, du bist ein kluges Mädchen, kluge Mädchen weinen nicht, nur dumme. Wenn du groß bist, wird die Krabbe Angst vor dir haben; du wirst sie zertrampeln.«
»Sie hat aber Scheren«, sagte ich und zog mich weiter in seinen Schoß zurück, entfernte mich vom Fluss.
»Das sind dann winzige Scheren, die können dir nichts anhaben.«
»Warum macht die das überhaupt?«
Er erzählte mir vom Krabbenvolk, das eines Tages beschloss, auszuwandern, und sie vergaßen in einer Höhle die kleinste Krabbe, weil diese geschlafen hatte. Als sie aufwachte, waren all ihre Freunde und Verwandten weg, sogar die Eltern, die Geschwisterchen, und die kleine Krabbe bewohnte seitdem allein den riesigen Strand. Sie irrte also im Chabur umher und kniff jedem in die Wade, der ihr zu nahe kam.
»Wann gehen wir weg?«, fragte ich Nasser.
»Sobald Asija verstanden hat, dass wir in Europa glücklicher sein werden.«
»Aber, Babu, was ist, wenn wir was vergessen?«
»Was sollen wir denn vergessen?«
»Ich weiß nicht, aber die kleine Krabbe wurde auch vergessen.«
»Du bist doch unsere kleine Krabbe, und dich werden wir niemals vergessen.« Er rieb seine stoppelige Wange an meiner, so lange, bis mir der Bauch vom Lachen wehtat.
Ich eile ins Bad und schaue mir das Sieb an, in dem sich lange schwarze Haare gesammelt haben. Ich klopfe es am Badewannenrand ab, bis sie als platter Haufen abfallen. Mit einem Taschentuch wische ich über den Rand und zerknülle es in meiner Hosentasche. Im Schlafzimmer verbrenne ich die Haare in einem Glas, damit sie nicht in die falschen Hände geraten. Als ich wieder im Wohnzimmer bin, ist Nasser entschwunden wie ein Bild aus einem Traum. Stattdessen steht Asija zwischen der offenen Küche und dem Wohnzimmer. Vor Jahren hat Asija das Kochen aufgegeben, deswegen verwundert mich ihr Anblick.
»Willst du dein Ei nicht essen?«, fragt sie, als wäre sie nicht Asija. Die dünne Decke hat sie gegen Kleidung ausgetauscht, die auch für draußen geeignet ist. Asija wartet auf eine Reaktion von mir. »Dein Chai ist auch ganz kalt geworden«, sagt sie, fast vorwurfsvoll. Ich habe kurz mit Nasser gesprochen, will ich ihr sagen, als müsste man sich vor Asija rechtfertigen.
Asija schüttet meinen Chai aus, als ich mich in der Küche auf einen der kahlen Holzstühle setze. Während sie mir schwarzen Tee in das Gläschen gießt, ihn mit heißem Wasser verdünnt und mit zwei Teelöffel Zucker versüßt, möchte ich sie fragen, was sie vorhat.
Sie spritzt etwas Zitrone in den Tee. »Das ist gut, um die Nase frei zu bekommen.«
Ich frage mich, woher sie von meiner verstopften Nase weiß. Asija nimmt nicht wahr, wenn die Stimme anders klingt, weil Schluchzer im Hals stecken, sie erkennt keine geröteten Augen als Ergebnis eines langen, erstickten Heulens im Bett.
»Wo ist Babu?«, frage ich.
»Er ist oben, bei Tante Khalida frühstücken.«
Ich tunke mein Fladenbrot in den weichen Dotter, der über das Eiweiß fließt.
»Und wohin gehst du?«
»Heute ist mein Termin beim Orthopäden, hast du’s denn vergessen?«
Bevor sie anfängt zu weinen, schüttele ich den Kopf: »Natürlich habe ich das nicht vergessen.« Ich wundere mich darüber, wie ich so etwas vergessen konnte.
Ich werde mich verspäten und nicht rechtzeitig bei Adnan sein, aber wir werden wenigstens Zeit finden, im Bett zu liegen.
»Worüber denkst du nach?«, fragt sie.
»Ach, gar nichts.« Ich versuche mich zu erinnern, wann sie das letzte Mal gefragt hat, worüber ich nachdenke, und es kann sein, dass es das erste Mal in zweiundzwanzig Jahren ist. Sie steht auf und verschwindet ins Schlafzimmer.
»Wollen wir jetzt nicht los?«, rufe ich ihr nach.
»Ich hole meine Tasche«, sagt sie mit zittriger Stimme, vielleicht bilde ich mir das auch ein, vielleicht hat sie es mit gewöhnlicher Stimme gesagt, und ich kann es nicht mehr unterscheiden, weil sie nie redet. Nach zehn Minuten klopfe ich an ihre Tür, die nachgibt und sich von selbst öffnet.
Asija ist die einzige Person, die mich verunsichert, weil ich sie nicht einschätzen kann. Zwischen Leben und Sterben gibt es noch einen Zustand; ich meine nicht Koma, ich meine die Weise, wie Asija unter uns weilt. Sie ist nicht ansprechbar, bis man sich ihr vorsichtig nähert, ihre Schulter berührt und »Asija« haucht. Sie erwacht dann und weint oder lächelt, als stünde ein alter Freund vor ihr.
Heute habe ich Pech: Sie weint.
»Willst du dich hinlegen?«, frage ich.
Ich habe gelernt, nicht mit Asija zu weinen. Wenn man mit ihr weint, verschlimmert sich die Situation. Also halte ich die Tränen zurück, denke an etwas anderes. Manchmal stelle ich mir vor, ich wäre eine Altenpflegerin und würde mich um die alten Mütter von vielbeschäftigten Frauen kümmern, und mein Sorgenkind unter den Patientinnen ist Asija, deren Knochen sich in Kalk verwandelt haben. Ich habe nur Patientinnen, weil ich mich ausschließlich um Mütter kümmere; um die Väter soll sich jemand anderes sorgen, ihre Pflege würde mich überfordern.
Früher heulte ich noch mit Asija, Helin tat es auch, wenn sie uns sah. Die tränenreichste Zeit erlebte Helin mit sechs; sie schluchzte mit zuckenden Schultern, weil sie nichts verstand, und Asija weinte, wenn sie Helins nasses Gesicht sah.
Wenn wir mitten in der Nacht von ihrem Weinen geweckt wurden, tapsten wir ins Wohnzimmer, beobachteten sie, um herauszufinden, was mit ihr nicht stimmte. Helin fing an zu weinen. Sie war zu jung, um zu verstehen, wie unnütz das Mitweinen war. Asija blickte auf, erschrak über unsere Anwesenheit. Im nächsten Moment beteuerte sie, sie spüre keine Schmerzen, wir sollten uns nicht um sie sorgen, und auf die Frage hin, warum sie dann weine, antwortete Asija nur: »Geht ins Bett, meine Hübschen.«
Am nächsten Morgen beschloss ich auf dem Schulweg, etwas zu unternehmen. Und auf dem Nachhauseweg überlegte ich, was ich tun konnte, um zu verhindern, dass ich Asija wimmernd auf dem Sofa vorfand. Zu Hause angekommen heulte Asija nicht auf dem Sofa, sondern am Küchentisch. Die Augen und die Nasenspitze gerötet, als hätte sie Zwiebeln frisch geschnitten. Es war nur Porree, den sie zerhackte und zusammen mit Fleisch in Teigtaschen füllen wollte. Aber der Teig war schon hart geworden an der Luft. Eine Hand bedeckte und stützte ihr Gesicht, damit es nicht in den geschnittenen Porree fiel; die andere hielt noch das Messer, das nur aus der Schneide zu bestehen schien. Der scharfe Geruch stach mir in die Augen, dass sie zu tränen anfingen. Ich schluckte schwer und verschluckte mich, weil mir der Hals zugeschnürt war.
Aus dem Drang heraus, etwas zu unternehmen, machte ich rückblickend wohl einen folgenschweren Fehler. Ich wählte die 112, da wir einen Notfall hatten, meine Mutter wollte keine gefüllten Teigtaschen mit Porree und Hackfleisch mehr braten, sondern saß heulend mit dem riesigen Küchenmesser da.
»Hallo. Meine Mutter ist verletzt.«
»Was genau ist passiert?«
»Ich weiß es nicht.«
»Blutet sie? Wie hat sie sich verletzt? Kann sie sich bewegen, kann sie reden?«
»Nein, sie kann nicht reden, vielleicht ist es eine Kopfverletzung. Aber es tut weh, Sie müssen sich beeilen.«
Sie beeilten sich auch, weil sie eine zittrige Mädchenstimme vernahmen.
Als sie dann vor der Wohnungstür standen – zwei weiß gekleidete Riesen –, bat ich sie in die Küche zu kommen, wo Asija verletzt saß.
Asija fragte – immer noch mit dem Messer in ihrer fragilen Hand –, was denn los sei, was diese Männer in unserer Küche zu suchen hätten, und verstand die Situation erst, als die Notrufmänner ihre Koffer mit den Utensilien auspackten und fragten, was genau passiert sei. Ich erzählte ihnen von Asijas Zustand, und dabei verzogen sie zornig die Gesichter und befahlen mir, den Notruf nicht ohne Grund zu wählen, man habe Wichtigeres zu tun, zum Beispiel Leben retten. Einer von ihnen drückte mir einen Zettel in die Hand – da könnten wir uns informieren. Sie gingen so schnell, wie sie gekommen waren. Ich beobachtete sie vom Balkon aus, wie sie in ihren orangefarbenen Wagen einstiegen, der mittlerweile eine Menschentraube angezogen hatte. Ein paar Leute blickten nach oben, zeigten auf unsere Etage, und ich verschwand in mein Schlafzimmer.
Es dauerte keine fünfzehn Minuten, bis Nassers ältere Schwester, Tante Khalida, über alles informiert war. Sie setzte sich auf unser Sofa, während ich vor ihr stand, meine Zehennägel beobachtend, und mich ausschimpfen ließ. Ein dummes Mädchen sei ich, was hätte ich mir dabei gedacht, die Aufmerksamkeit der Leute auf uns zu lenken. Ich hätte doch bestimmt schon Schamhaare, nächstes Jahr könnte ich schon heiraten und Kinder kriegen.
Schamgefühl erhitzte meine Brust und ließ meinen Rücken schwitzen. Ich konzentrierte mich auf den Nagellack an meinen Zehennägeln. Er war teilweise abgeblättert und erinnerte an Länderumrisse. Jeder Nagel war ein anderes Land, ein besserer Ort als unser Viertel.
Nach zehn Minuten trocknete ihr Hals aus, sie krächzte dann, die Hände erhoben: »Wasser!«
Ich brachte Wasser in einem ungewaschenen Glas, bitte schön, Tante. Sie mäßigte ihren Ton und sprach mit mir, als sei ich ihr kleines Mädchen, das erzogen werden müsse. Wenn meine Mutter zu schwach sei, dies zu bewerkstelligen, dann würde sie sich meiner annehmen, schließlich sei ich die Tochter ihres Bruders, also fühle sie sich verpflichtet, mich zu einer anständigen Frau zu erziehen.
Als sie nach Hause ging, sperrte ich mich ins Badezimmer ein und befühlte meine Schamlippen, an denen vereinzelt gekräuselte Härchen wuchsen. Im Spiegelschrank griff ich nach dem schwarzen Rasierer meines Vaters und fing an, mich zu rasieren.
Im Bett rollt Asija den Körper ein, dabei stechen Wirbelknochen scharf aus ihrem Rücken wie Stachel, damit niemand sich ihr nähern kann.
»Möchtest du etwas Wasser, Asija?«
Sie gibt keine Antwort.
»Möchtest du mir sagen, warum du weinst?«
Sie flennt leise, für sich, wie ein Kind, dem man verboten hat zu heulen. Dabei darf sie so laut weinen, wie sie möchte, niemand ist zu Hause außer uns beiden.
»Soll ich die Heizung aufdrehen?«, frage ich, weil ihr immer kalt ist, weil ihre Haut so dünn ist, dass ich ihre Adern sehe, weil ihr Gesicht immer nass ist, weil kaum Fleisch da ist, um die Knochen warm zu halten, weil …
»Nein, meine Hübsche«, sagt sie, obwohl ich nicht hübsch bin, aber sie ist meine Mutter. Ich verharre noch eine Weile auf der Bettkante, streichle über ihre Haut. Das scheint sie noch weiter aufzuregen, also lasse ich es. Sie schluchzt und dann sagt sie: »Ich weine, weil ich nicht weiß, was in deinem Kopf vorgeht, was du den ganzen Tag machst, wie du dein Ei magst.«
»Ich fand das Ei lecker, wirklich.«
»Und ich möchte dich nicht länger aufhalten, geh jetzt bitte zur Uni.«
»Aber ich kann doch jetzt nicht gehen.«
»Du musst gehen, sonst habe ich ein noch schlechteres Gewissen. Bitte, meine Hübsche, geh, konzentrier dich auf dein Studium.«
Ich schaue auf die Uhr; wenn ich mich jetzt beeile, schaffe ich es sogar zum Mittagessen mit Adnan. Obwohl ich keinen Appetit haben werde, wird er mich zwingen zu essen, weil er befürchtet, der Wind könnte mich irgendwann davontragen. Deswegen und wegen anderer Umstände schleppe ich immer das dickste Buch aus meinem Regal mit mir herum, russisch bevorzugt.
Im Aufzug hoffe ich, auf niemanden zu treffen, aber er hält auf der fünften Etage an und Baqqe und Herr Zakholy steigen ein, ein altes Ehepaar aus Zakho. Baqqe heißt eigentlich Frau Zakholy, aber weil sie wie ein Frosch aussieht, nenne ich sie »Baqqe«. Sie ist Tante Khalidas engste Vertraute und sicherste Quelle.
»Hallo, Hübsche, wie geht es dir?«
Ich antworte ihr, ohne sie anzuschauen, weil ihr neugieriger Mund mich verschlucken könnte.
»Wie geht es deiner armen Mutter?« Das Ehepaar wechselt Blicke, als wolle ihr Mann Baqqe sagen: Lass das Mädchen in Ruhe, du weißt, wie es der Mutter geht, du bist beinahe jeden Tag in ihrer Wohnung.
Und Baqqe antwortet ihm trotzig: Ich bin doch nur höflich, unter Nachbarn ist das so, und man weiß ja nie, wie es dieser komischen Frau geht, so labil ist die, wer weiß, vielleicht hat sie sich ja über Nacht vom Balkon gestürzt.
Dann wärst du aber die Erste, die davon erfährt, stichelt Herr Zakholy.
»Ihr geht es gut«, antworte ich.
»Und du gehst jetzt zur Uni, ja?«
Nein, zum Supermarkt, Kondome kaufen. Sie steigen aus und Baqqe hält mir die Tür auf, aber ich erkläre ihr, ich hätte oben etwas vergessen, worauf sie vielsagend schaut und schließlich die Aufzugtür zufallen lässt.
Ich eile in die Wohnung zurück, eile in Asijas Zimmer. »Komm, wir gehen zum Orthopäden.« Ich nehme ihre Tasche, kontrolliere, ob sie ihre Versichertenkarte dabeihat. »Komm schon, Asija.«
»Aber ich dachte, du musst –«
»Nee, ich kann auch später.« Ich reiche ihr ein Taschentuch.
Als wir draußen sind, sehe ich den mattweißen Volvo im Halteverbot parken, eine kantige Limousine, mehr ein Wrack aus den Achtzigern als ein Auto aus der Gegenwart. Vor einigen Wochen habe ich den Volvo zum ersten Mal an der Bushaltestelle bemerkt. Der Fahrer, ein Dicker um die dreißig, beobachtete mich verstohlen. Seine Haut ist bedeckt mit Haaren, dick wie Fliegenbeine, seine Körperbehaarung verrät sein Kurdensein. Jetzt ertappe ich ihn wieder beim Beobachten, und sofort suchen seine fleischigen Finger die Musikanlage, und er drückt fieberhaft auf Knöpfe. Laute Musik fängt an zu brummen, dass die ganze Straße guckt. Er schaltet das Radio wieder aus. Ich würde Asija gerne von ihm erzählen, fürchte aber ihre Reaktion. Während wir ihm näher kommen, startet er den Motor, setzt zurück, knallt beinahe gegen das Halteverbotsschild, und fährt mit quietschenden Reifen los. Wenn er nicht so furchtbar kurdisch aussehen würde, könnte ich ihm ein kopfschüttelndes Lächeln schenken.
Wir sitzen beim Orthopäden, denn Asijas Schultern schmerzen. Nach einer Weile flüstert sie, der Rücken fange auch manchmal an. Und dann: »Beim Gehen tun mir die Knie weh, oder wenn ich eine Treppe hochlaufe.«
Ich denke, alles tut weh und ist porös. Dann übersetze ich, weil Asijas Deutsch zum Einkaufen ausreicht, aber nicht für den Arzt.
Er empfiehlt Krankengymnastik. »Sie hat überhaupt keine Muskeln, ja, und wenn sie dann etwas Schweres trägt, dann geht das auf die Knochen, ja.« Jeden Satz beendet er mit einem Ja, um sich meine Zustimmung zu holen, ich nicke, ja. Zum Schluss meint er: »Wer rastet, der rostet.« Jaja.
Ich erzähle dem Doktor, wie das Meer eines Sturmtages einen Stein in Form einer gekrümmten Jungfrau ausspuckte. Die rote Krabbe, die am Strand Wache hielt, schleppte die Steinfrau in Sicherheit unter einen Felsvorsprung und verbrachte Wochen damit, diesen knochenweißen Stein zu beobachten, bis sie beschloss, die Frau aus ihrer Haltung zu befreien, weil ihr bestimmt die Beine schmerzten. Wer weiß, seit wie vielen Jahrhunderten sie schon so gekrümmt im tiefsten Grau des Meeres gelegen hat, dachte die Krabbe und fing am nächsten Morgen an zu schneiden und zu schleifen, bis ihr die Scheren schmerzten. Schließlich war die Frau gerettet, und so krabbelte die Krabbe um sie herum und führte mit ihr den Krabbentanz auf, jedenfalls träumte die Krabbe davon, denn die Frau war immer noch aus Stein und unbeweglich.
Wieso erzählen Sie mir das?, würde der Orthopäde fragen.
Wem soll ich es denn sonst erzählen?, würde ich antworten, wenn ich die Geschichte erzählt hätte.
Auf dem Marktplatz will Asija sich verabschieden.
»Ich geh noch einkaufen, geh du schnell in die Uni.«
»Nein, ich komme mit. Hast du den Arzt nicht gehört, du darfst kein schweres Zeug tragen.« Unterwegs erkläre ich Asija die Krankengymnastik.
Sie schüttelt den Kopf. »Jede Bewegung tut weh, und da soll ich mich noch mehr bewegen?« Ich erkläre ihr die Sache mit dem Rasten und Rosten, doch bevor ich zum Wesentlichen komme, werden wir unterbrochen. Meine Tante Khalida steht mit einer unbekannten Frau vor uns, die mich blöde anlächelt, als würden wir jeden Tag zusammen mindestens einen Chai trinken. Ihre Augenbrauen sind zusammengewachsen wie bei dem Dicken im Volvo. Sie begrüßen Asija, die zuerst erschrocken aufschaut und sich dann über den bekannten Anblick von Tante Khalida freut, bis ihr wieder einfällt, dass es Tante Khalida ist. Tante stellt die Frau als Dayka Idris vor, eine neue Nachbarin. Asija begrüßt sie wie alle anderen Nachbarinnen auch, mit dem kleinsten Lächeln der Welt.
»Ist das deine Tochter?«, fragt die fremde Frau, und Asija nickt.
»Wie hübsch sie ist. Ist sie verheiratet?«, fragt sie, und es klingt wie: »Was kostet das?«
Ich halte demonstrativ den russischen Roman vor meine Brust und schaue Asija an.
»Nein, sie studiert an der Universität. Sie studiert Jura.« Tante Khalida hebt eine Augenbraue, weil sie weiß, dass ich nicht Jura studiere, und gleichzeitig wundert sie sich über Asijas Fähigkeit zu lügen. Das ist doch mein Metier, würde sie gerne sagen. Die Fremde nickt anerkennend und glotzt weiter.
»Wir müssen in den Supermarkt«, sage ich, um mich von ihrem Blick zu lösen.
Wenn ich Asija sehe, dann denke ich an andere Frauen: Tante Khalida ohne Salzgeruch und mit Fleisch an den Hüften, auf denen Kleinkinder schläfrig geschaukelt werden könnten, während sie im Kochtopf rührt. An Jamila muss ich denken, die auf dem Balkon klatschnasse Jeanshosen an Wäscheständern aufhängt und sich über das Geländer lehnt, um das Treiben der Männer auf dem Marktplatz zu beobachten. An Karima denke ich, die beim Fensterputzen schaut, was die Jungen auf dem Weg von der Schule nach Hause anstellen. An Baqqe muss ich denken, die beim Rauchen auf dem Balkon sieht, wie das dürre Mädchen aus dem siebten Stock an der Bushaltestelle raucht, um dann zu Tante Khalida zu laufen. Das Mädchen raucht an der Bushaltestelle, weil Asija seine Mutter ist und weil Asija nur nachts auf den Balkon kommt, wenn alle Menschen schon zu Hause sind, nur noch ein paar libanesische Jugendliche an Ecken herumlungern, und sich dann fragt, wo die ganzen Menschen sind. Sie weint und geht um vier Uhr morgens ins Bett. Und die Frauen reden über Asija, wenn sie ihr Geheule hören. Wenn Tropfen an die Fenster klatschen und draußen gestöhnt wird, ist es nicht der Regen oder der Wind, dann ist es Asija. Und die Frauen reden, wenn sie im Supermarkt von ihr nicht gegrüßt werden. Asija bemerkt sie höchstens im Aufzug, wenn es unvermeidbar ist. Dann grüßt sie auch mal, lächelt dünnlippig.
Ich denke an diese Frauen, die reden, und ich sehe Asija, die ihren Kopf seit einer halben Stunde in die Tiefkühltruhe gesteckt hat und ihn nicht herausholen will. Es wäre nur halb so peinlich, wenn wir nicht in einem Supermarkt wären, wo die Mitarbeiter solch ein Verhalten merkwürdig finden. Sie kann sich einfach nicht zwischen Schokoladen- und Erdbeereis entscheiden, würde ich sagen, wenn Asija nicht meine Mutter, sondern irgendeine Verrückte im Supermarkt wäre. Die dickste Mitarbeiterin droht mit der Polizei. Und ich weiß keinen Ausweg mehr, weil in jedem Moment eine Jamila, eine Karima, eine Fatima auftauchen und uns ertappen könnte, und bis zum Abend wüsste das ganze Viertel Bescheid und schaute vom Marktplatz aus auf unseren Balkon. Deswegen frage ich Asija: »Wie war das eigentlich mit der Kugel in der Schulter?«
Sie hebt den Kopf, schaut mich an, wie keine Tochter auf der Welt angeschaut werden will.
Während des Ersten Golfkrieges schoss man auf meine Mutter.
Manchmal, wenn man mich fragt, wo ich herkomme, wo meine Wurzeln liegen – die Vorsichtigen fragen, wo meine Eltern herkommen –, dann sage ich: »Aus dem Irak.«
Und die nächste Frage ist dann, was ich über den Irakkrieg denke.
»Welchen?«, frage ich, um sie zu verwirren.
»2003.«
»Natürlich, man erinnert sich gar nicht mehr an die anderen«, sage ich, um Ahnung vorzutäuschen, und dann: »Während des Ersten Golfkrieges wurde meine Mutter angeschossen.« Ich lasse den Satz so stehen, und sie fragen nicht weiter.
Asija stellte sich schützend vor ihren kleinen Bruder, als der ältere, Onkel Abdul, der irre Abdul, ihn mit der Flinte erschießen wollte, weil sie sich um ein Stück Land, die Erbschaft der Großeltern, stritten. Die Kugel bohrte sich in Asijas rechte Schulter. Sie schluckte den Schrei, verlor aber das Bewusstsein. Man brachte sie nicht ins Krankenhaus, um den Nachbarn keinen unnötigen Gesprächsstoff zu liefern – wie Tante immer zu sagen pflegt: Lieber im Kanonenrohr als in fremden Mündern von Ohr zu Ohr.
Die Kugel blieb in Asijas Schulter, steckte in einem Knochen fest. Wenn sie drei Kilo Tomaten, einen Sonnenblumenölkanister oder ein Nachbarskind hob, schmerzte es; sie ließ sich nichts anmerken. Doch ab und an entfuhr ihr zwischen zusammengebissenen Zähnen ein gequältes Stöhnen. Ihre Familie quittierte es mit einem verlegenen Schweigen. Im Badezimmer begutachtete Asija jeden Freitag, am Badetag, die gut verheilte Wunde.
Mein Vater fragte sie in der zweiten Hochzeitsnacht, was es denn mit dieser Narbe auf sich habe, die ihre Schulter schmücke. Asija erzählte ein wenig stolz von der Kugel in ihrem Körper: »Die Narbe erinnert mich daran, dass selbst eine Kugel mich nicht einfach töten kann.«
Im Kopf meines Vaters fing es an zu rattern. Am nächsten Morgen hatte er bereits eine Entscheidung getroffen und den dazugehörigen Plan geschmiedet: Er wollte unbedingt nach Europa, nach Europa, nach Europa, wo jeder hinwanderte, weil es dort anscheinend etwas gab, was auf den anderen Erdteilen nicht existierte. Die Kugel in Asijas Schulter war ihr Flugticket nach Europa.
Seine Entscheidung teilte er Asija eine Woche später mit, doch diese weigerte sich mitzugehen. Was sollten sie bei dieser Fremden namens Europa machen, ganz ohne Familie und Verwandte, ohne die Sprache zu kennen, ohne irgendetwas in der Hand?
Nasser brauchte sieben Jahre, um Asija von seinen Plänen zu überzeugen. »Wir lernen die Sprache, die Kleine geht zur Schule. Meinst du, wir sind die einzigen Kurden dort? Du wirst schnell ein paar Freunde finden, ich gehe arbeiten und verdiene viel Geld.«
»Das können wir doch auch hier«, antwortete Asija wahrscheinlich.
»Hier? Geld verdienen? Du verstehst doch überhaupt nicht meine Situation, ich gehe kaputt von dieser Arbeit hier. Schau dir meine Hände an; als wäre ich fünfundsiebzig. Willst du mir das antun? Willst du, dass ich bis an mein Lebensende schufte und doch arm bleibe, willst du einen Mann mit kaputtem Rücken?«
Überzeugt war Asija nicht, eher ermattet von seinem Gerede und erdrückt von seiner ansteckenden Traurigkeit, deswegen willigte sie ein, ihr Gold und das kleine Haus zu verkaufen, um sich ein Leben in Europa aufzubauen. In der Türkei erzählte mein Vater dem zuständigen Flüchtlingshilfswerk von der Kugel in der Schulter seiner Frau. Sie schwebe in Lebensgefahr, es sei unmöglich, in ein irakisches Krankenhaus zu gehen, weil man seit Langem auf der Suche nach ihm sei. Ihre Rettung bedeute seinen Tod, deswegen gebe er sich und seine Familie in Europas Hände, werfe sich in ihren Schoß, er wisse sonst keinen Ausweg mehr.
Als sie der Behauptung mit der Kugel nachgingen, wurde Vaters Antrag auf Asyl sofort genehmigt, man wies uns Deutschland zu. Unser Anwalt empfahl Asija, schnellstens schwanger zu werden, um eine mögliche Abschiebung zu erschweren. Nachdem ihr die Kugel aus der Schulter operiert worden war, sah ich Asija das erste Mal weinen, und als wir ein Jahr später eine Aufenthaltsgenehmigung bekamen und Helin unterwegs war, lächelte sie dünnlippig.
Mit einer Hand halte ich Asijas Arm fest, um sie nach Hause zu bringen, mit der anderen mein Handy, um Adnan zu schreiben, dass ich ihn höchstens für eine Stunde sehen könnte, und das auch nur, wenn ich die Fähigkeit hätte, auf Wolken zu laufen. Von einer Wolke auf die andere springen, bis ich bei ihm wäre. Er schickt mir einen Smiley und schreibt: Ich warte auf dich. Der weiße Volvo fährt gemächlich an uns vorbei. Asija scheint ihn nicht zu bemerken, starrt geradeaus auf einen Punkt am Horizont. Die Erinnerung an die Kugel hat sie gelähmt, sodass ich sie widerstandslos aus dem Supermarkt führen konnte. Natürlich bemerkte ich die Blicke einiger kurdischer Frauen, ihr Wispern, ihr aufdringliches Mitleid mit mir. Warum fällt sie ihrer Tochter so zur Last, warum hört sie nicht einfach auf zu weinen, warum ist diese Frau so egoistisch, warum ernährt sie ihre Familie nicht?
Mein Handy vibriert in meiner Hosentasche. Dankbar greife ich nach der Ablenkung und lese die Nachricht von Omer: Sanaa, Sanaa, Sanaahäubchen. Lange nicht gefickt, wann bist du mal wieder bei mir? Hitze durchströmt meine Brust, ich lösche die Nachricht, bevor ich das Handy wieder in die Tasche stecke. »Lange nicht gefickt« vibriert als Gedanke in meinem Schädel, und ich drehe mich zum Volvomann um, weil ich befürchte, er könnte den Gedanken lesen. Ich ziehe Asija am Arm, um sie nach links zu bewegen, obwohl unser Weg so unnötig lang wird.
Aber wir werden den Volvomann los. Ich begleite Asija in die Wohnung; Tante Khalida sitzt mit Baqqe im Wohnzimmer. Sie trinken Chai und rauchen Zigaretten. Seit dem Notruf damals hat sich Tante Khalida angewöhnt, uns jeden Nachmittag zu besuchen, und weil Asija keine gute Gesprächspartnerin ist, lädt sie Baqqe ein.
»Oh, ich dachte, du wärst in der Uni«, sagt Baqqe breit grinsend, und Rauch steigt aus ihren Nüstern. Baqqe darf zu Hause nicht rauchen, weil Herr Zakholy Hustenanfälle davon bekommt.
»Ich habe meine Mutter zum Orthopäden gebracht.«
Ich schicke Asija ins Schlafzimmer und verspreche, ihr ein Glas Wasser zu bringen.
»Oh!«, ruft Baqqe glubschäugig und fasst sich an den Kugelbauch, weil sie anfängt zu lachen. Das Wohnzimmer ist ganz vernebelt. Sie will unbedingt etwas sagen, schafft es aber nicht, weil sie von einem Lachanfall gequält wird. »Was … was … was hat sie denn?« Die gespielte Naivität in Baqqes Stimme veranlasst meine Tante, kräftig gegen den Schenkel zu schlagen.
»Dayka Yahya, hör auf, hör bitte auf, das ist zu komisch. Ich bekomme noch ganz schlimme Bauchschmerzen.«
Dayka Yahya, die »Mutter von Yahya«, ist Baqqe, die kinderlose Baqqe. Tante Khalida scheint Baqqe daran erinnern zu wollen, dass in ihrer Gebärmutter nie ein Kind gewohnt hat, dass es nie einen Yahya gegeben hat. Wahrscheinlich hatte Baqqe meiner Tante in einem vertrauensseligen Moment, in bekifftem Zustand, erzählt, sie hätte ihrem Sohn den Namen Yahya gegeben. Meine Tante muss ihr in diesem Moment in ihre Froschaugen, die vor Traurigkeit größer erschienen als sonst, geschaut und verkündet haben: »Für mich bist du Dayka Yahya!« Dieser Moment muss vor Jahren passiert sein, jetzt klingt »Dayka Yahya« nach einer Stichelei. Trotzdem glaubt Baqqe, es sei eine respektvolle Anrede.
»Hat sie – hat sie denn Kopfschmerzen?«, fragt Tante Khalida ganz unschuldig.
Baqqe prustet wieder los, dass ihr die Froschschenkel in die Höhe fliegen, sie kippt um, und Tante Khalida hilft ihr mit Mühe auf. Das Marihuana in ihrem Tabak verwandelt sie mal in hemmungslose Mädchen, mal in weise Dorfälteste, aber nie sind sie gehässige Kurdinnen, wie ich sie sonst kenne, und deswegen mische ich ihnen so viel Marihuana in den Tabak, wie ich in die Finger kriege.
Auf die Idee kam ich, als Kemal die achte oder neunte Klasse besuchte und zu kiffen anfing. Weder die scharfsichtige Tante Khalida noch mein Onkel Agid bemerkten die Veränderungen an ihrem Sohn – egal, wie gerötet die Augen waren, wie langsam und entspannt er umherschlenderte oder wie abwesend er lächelte. Helin und ich schauten uns grinsend an, wenn Kemal samstagmorgens leicht bekifft und breit grinsend in unserem Zimmer saß und von seinen Kifferfreunden erzählte, von Jalal und Mahmut, der von allen »Mammut« genannt wurde. Er erzählte, wie sie mal versucht hätten, das Haar eines Obdachlosen anzuzünden, und wie Mammut dabei fast den Hund von Jalal in Flammen gesetzt hätte und wie er von Jalal brutalst verprügelt und vom Hund gebissen worden sei. Kemal lachte, als hätte er nie etwas Witzigeres gehört, und wir lachten, weil er lachte. Es war dann nicht mehr so witzig, wenn Kemal versuchte, uns beiden Marihuana zu verticken. »Okay, Kemal, du kannst jetzt abhauen«, sagte ich. Helin war damals zwölf, und ich war froh, sie unbekümmert und nicht mehr wegen Asija heulen zu sehen. Manchmal hätten wir Asija beinahe vergessen. Helin verbrachte die meiste Zeit bei Tante Khalida, weil sie mit Kemal abhing, weswegen Tante Khalida halb im Scherz meinte, sie würden auch später ein anständiges Paar abgeben. Kemal verstand nichts, Helin errötete, und Tante Khalida freute sich darüber, eine Sorge weniger zu haben. Zwei auf einen Streich sozusagen, sie hätte schon die Frau für ihren Sohn und bräuchte auch nichts mehr für ihre Nichte zu arrangieren.
Mich schaute Tante Khalida teils besorgt, teils hasserfüllt an und sagte: »Ich weiß nur nicht, was aus dir wird.«
Onkel Agid sagte: »Allah hat jedem ein Schicksal vorgesehen, ihr auch. Also lass sie in Ruhe.«
Tante Khalida nickte. »Natürlich. Gott ist groß, und ich bin nichts anderes als eine Dienerin Gottes, aber man muss trotzdem aufpassen, die eigenen Kinder keine dummen Fehler begehen zu lassen. Und Mädchen sind besonders anfällig für Dummheiten, weil sie so naiv sind.«
Ich wollte ihr sagen, dass ich nicht ihr Kind sei, und dachte an Asija und hasste Asija.
Aber ich möchte nicht daran denken, ich möchte nur zu Adnan. Und Adnan scheint der einzige Mensch zu sein, der dem Satz »Ich möchte« eine Bedeutung beimisst.