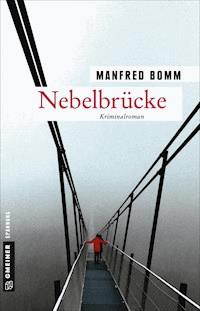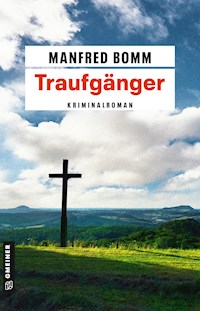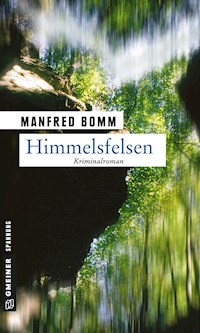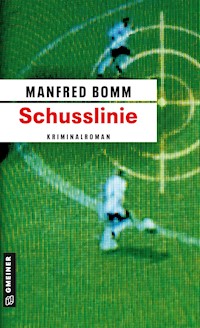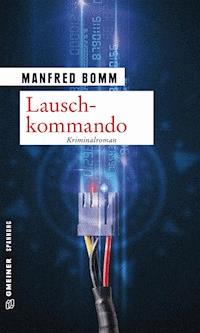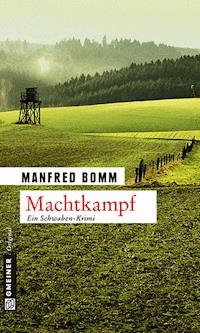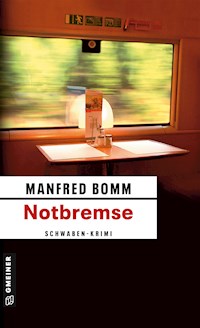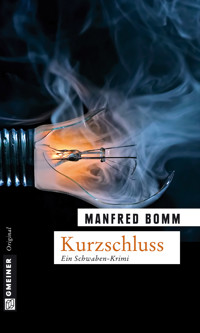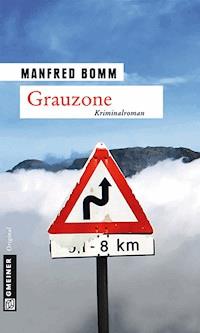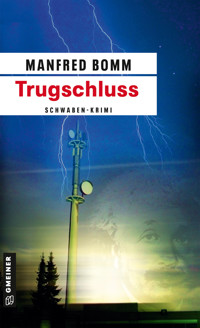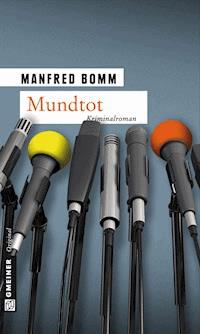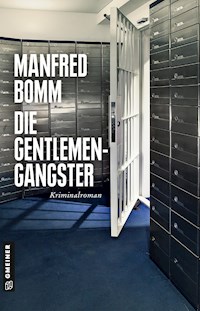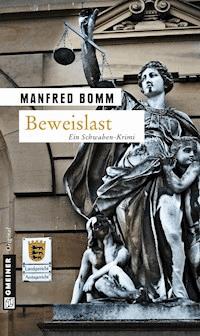
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar August Häberle
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
Kommissar Häberles neuer Fall scheint klar: Der in einem abgeschiedenen Tal am Rande der Schwäbischen Alb tot aufgefundene Berater der Agentur für Arbeit wurde von einem seiner »Kunden« ermordet. Eine ganze Reihe von Indizien, aber auch DNA-Spuren am Tatort, weisen zweifelsfrei auf Gerhard Ketschmar hin. Der 55-jährige Bauingenieur ist nach über einem Jahr erfolgloser Stellensuche psychisch und physisch am Ende und voller Hass, weil man ihn auf das Abstellgleis Hartz IV zu schieben droht. Doch während sein Prozess vor der Schwurgerichtskammer des Ulmer Landgerichts vorbereitet wird, kommen August Häberle erhebliche Zweifel. Wird möglicherweise ein Unschuldiger zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 544
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manfred Bomm
Beweislast
Der sechste Fall für August Häberle
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2007 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Dieses E-Book entspricht der aktuellen, 4. Auflage 2013
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Manfred Bomm
ISBN 978-3-8392-3298-9
Widmung und Vorrede
Gewidmet allen, die zu ermessen vermögen,
dass der Mensch mehr ist, als nur ein Kostenfaktor –
und dass Großes nur zu schaffen ist,
wenn jugendlicher Elan und jahrelange Erfahrung
ein gemeinsames Ziel verfolgen.
*
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland.
*
Wenn ein Arbeitsleben nur mit Paragrafen bewertet wird,
bleibt kein Platz mehr für jene, die schuldlos ins Abseits
gedrängt wurden.
Mögen wir bei allem, was wir tun, stets davor bewahrt bleiben, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein.
Und halten wir auch in ausweglosen Situationen
das scheinbar Unmögliche für möglich.
*
Ein Großteil der Handlung und die meisten Namen sind frei erfunden. Nicht aber die Schauplätze. Wer den Spuren von Kommissar Häberle folgen will, kann dies tun.
1
Es war höchste Zeit, diesem Rotzbuben eine zu verpassen. So einer wie der hatte doch allenfalls mal in den Semesterferien einen flüchtigen Blick in die Werkstätten und Produktionsbetriebe geworfen. Was wusste dieses geschniegelte Bürschchen im Nadelstreifenanzug schon von der Arbeitswelt? Gerhard Ketschmar, der seinen kräftigen Oberkörper in ein dunkelblaues Jackett gezwängt hatte, kochte innerlich. Über 30 Jahre lang hatte er gearbeitet, ohne Fehlzeiten, ohne Krankheitstage, ohne jemals dem Staat zur Last gefallen zu sein. Und jetzt musste er sich von diesem Schnösel, der sein Sohn hätte sein können, kaltschnäuzig sagen lassen, dass man ihn leider nicht einstellen könne. »Sie sind überqualifiziert«, stellte der Kerl fest und lehnte sich genüsslich in seinem wuchtigen, ledernen Chefsessel zurück. Auf der blitzblanken Schreibtischplatte aus Buchenholz ließ nichts, aber auch gar nichts auf irgendeine produktive Arbeit schließen, die dieser überhebliche Großschwätzer heute schon getan haben könnte. Ketschmar spürte plötzlich, wie ungemütlich der gepolsterte Stuhl war, auf dem er sitzen musste. Wie ein Schulbub. Wie ein Bittsteller. Allein schon dieses Büro vom Ausmaß einer ganzen Wohnung, wie sie neuerdings einem Hartz IV-Empfänger nicht mal zugestanden wurde, war eine einzige Provokation. Alles vom Feinsten. Eine Wand komplett aus Glas mit Blick hinüber zu den bewaldeten Hängen der Schwäbischen Alb, die jetzt im November längst ihren sommerlichen Schimmer verloren hatte. Auf der gegenüberliegenden Seite sündhaft teure Gemälde, vermutlich Originale, dachte er, während sich auf seiner Stirn dünne Schweißperlen bildeten. »Wenn ich Sie einstellen würde«, hörte er die Stimme dieses eiskalten Milchbubis, »dann wären Sie so teuer wie zwei junge Kräfte.« Er spielte mit einem Füllfederhalter, dem einzigen Utensil, das sich neben dem Telefon auf dem Schreibtisch fand.
Ketschmar holte tief Luft und sah sein Gegenüber mit versteinertem Gesichtsausdruck an. Die Falten auf der Stirn waren tief eingegraben. Eigentlich hatte er etwas sagen wollen – doch was halfen hier Argumente? Was würde es helfen, würde er hinausschreien, was er von so viel Arroganz hielt? Dass Erfahrung heutzutage offenbar nichts mehr zählte, Erfahrung, Wissen und Können. Dass nur noch billig produziert werden musste, billig und schnell. Was wusste dieser Kerl da schon von dem Qualitätsbegriff ›Made in West-Germany‹? Vergessen, vorbei. Abgewirtschaftet. Diese Werte zählten nicht mehr. Der schnelle Euro musste es sein. Dass sich damit das Qualitätsniveau längst im freien Fall befand, wollte diese Generation nicht wahrhaben. Sie würde es aber zur Kenntnis nehmen müssen. Früher oder später. Auf bittere Weise, dachte Ketschmar und wünschte sich, diesen Niedergang noch miterleben zu dürfen, um die Schadenfreude genießen zu können. Mehr würde ihm nicht bleiben.
Er spürte ohnmächtige Wut in sich aufsteigen – Wut darüber, dass es ein System gab, das solche Typen nach oben gespült hatte und ihnen auch noch alle Rechte und politische Unterstützung in die Hand gab. Ohnmacht auch darüber, dass er solchen Arrogantlingen hilflos ausgeliefert war, dazu noch mit staatlicher Billigung.
Er erhob sich wortlos. Seine Körpergröße und sein Auftreten waren durchaus geeignet, einem Gesprächspartner Respekt einzuflößen. Er wusste um diese Wirkung, blieb deshalb vor dem Schreibtisch stehen und sah seinem Feind für einen Moment in die Augen, als wolle er ihn mit Blicken töten. Dann drehte er sich wortlos um, ging über den dicken Teppich zur Tür und kämpfte mit sich, ob er noch etwas sagen sollte. Ketschmar entschied, diesen Arrogantling nicht in seiner triumphierenden Gnadenlosigkeit zurückzulassen: »Soll ich Ihnen mal was sagen?«, presste er hervor und es klang gefährlich. »Typen wie Sie kotzen mich an. Typen wie Ihnen wünsche ich von ganzem Herzen, dass Sie mit Ihrer menschenverachtenden Arroganz kräftig auf die Schnauze fallen.« Das hatte gesessen. Der Knabe hinterm Schreibtisch war sprachlos. Mit allem hatte er offenbar gerechnet, nur nicht mit einer solchen frechen Attacke. Nie zuvor hatte es jemand gewagt, ihn derart respektlos anzusprechen. Er wirkte höchst irritiert, sein im Sonnenstudio gebräuntes Gesicht verlor an Farbe. Ketschmar ergriff die Gelegenheit, um gleich noch eine Bemerkung nachzuschieben: »Sie sollten aufpassen, dass Ihnen nicht eines Tages Hören und Sehen vergehen.«
Als er dieses Verwaltungsgebäude verließ, hörte er eine innere Stimme, die ihn ermunterte, sich dieser unglückseligen Entwicklung nicht zu beugen. Seit er Anfang des Jahres arbeitslos geworden war, bloß weil die Baufirma, bei der er ein halbes Leben lang als Ingenieur gearbeitet hatte, Insolvenz hatte anmelden müssen, bemühte er sich eisern um einen neuen Job. Er schrieb Bewerbungen, war bereit, als Pendler täglich 60 oder 100 Kilometer zurückzulegen – doch wo er auch vorstellig wurde, es war immer dasselbe: Einen 54-Jährigen will keiner einstellen. Je mehr er darüber nachdachte, desto größer wurde sein Zorn gegen die Politiker, denen er allesamt jegliche Ahnung vom tatsächlichen Geschehen an der Basis absprach. Sie wollten die Rentengrenze auf 67 Jahre anheben. Ein Schlag ins Gesicht für solche wie ihn. Sollten doch die Damen und Herren Politiker, die ihre Ärsche in den warmen und sicheren Ministerien breitdrückten, einmal erklären, welcher Unternehmer eine Person über 45 noch einstellte. Sein Blutdruck stieg immer, wenn er an diese himmelschreiende Ungerechtigkeit dachte. Als er zu seinem VW-Golf ging, den er auf dem Besucherparkplatz abgestellt hatte, stand sein Entschluss endgültig fest: Er würde kämpfen. Und je mehr man ihn in die Ecke drängen würde, bei Betrieben oder in diesem seltsamen ›Job-Center‹ der ›Agentur für Arbeit‹, desto heftiger wollte er sich wehren. Man würde noch an ihn denken.
Red bloß nicht immer von früher. Wie oft hat er das seinen Eltern gesagt! Früher – nein, dieses Wort, er hatte es gehasst. Damals, als er noch ein Kind war, in den 50er Jahren, hatten sie alle von ›früher‹ gesprochen. Die Eltern und deren Eltern. Früher, das war die Zeit zwischen den großen Kriegen gewesen. Armut und Inflation, Angst vor neuem Völkermorden, das dann so verheerend wurde, wie keines der vielen zuvor. Dann die Kriegsgefangenschaft des Vaters, 4 Jahre England – Gott sei Dank nicht Russland. Die Zeit danach – wieder in Armut, in Trümmern, in Trostlosigkeit. Die Zeit der Hoffnung und des Aufbruchs. Sie alle haben mitgemacht, die Arbeiter und die Unternehmer, die Politiker und die Landwirte. Alle haben zugepackt, die Ärmel aufgekrempelt. Nicht Schwätzen war gefragt, sondern die praktische Arbeit. Was wir heute als Wirtschaftswunder bezeichnen, was uns erscheint, wie ein Geschenk des Schicksals, das war in Wirklichkeit eine harte, entbehrungsreiche Zeit gewesen. Ja, das war für ihn und seine Generation das Früher. Was wussten diese jungen, machtbesessenen Kerle, die wie Maden im Speck saßen, von früher? In den späten 60er Jahren geboren, hatten die doch nicht den geringsten Schimmer davon, was es bedeutet hat, in der Nachkriegszeit aufgewachsen zu sein. Damals, als man noch über die reichen Nachbarn staunte, die sich schon einen Fiat 500 leisten konnten. Oder gar einen VW-Käfer, mit dem sie damals bereits nach Italien gefahren sind, von dem kaum die Eltern sagen konnten, wo man dies auf der Landkarte fand. Denn die einzige Landkarte, die man zu Hause auftreiben konnte, hörte ohnehin unten am Bodensee auf. Die Welt war klein, sehr klein. Das war alles gerade mal 50 Jahre her. Dennoch schien es von jenen vergessen zu sein, die jetzt das Sagen hatten – die in die Chefetagen aufgestiegen waren, durchstudiert – wie Ketschmar es immer wieder formulierte. Durchstudiert oder von Beruf Sohn. Das waren die besten Voraussetzungen, um den Betrieb aus Großvaters Zeiten totzurechnen und betriebswirtschaftlich zu ruinieren. Menschen waren nur noch Kostenfaktoren, ein gutes Betriebsklima zählte nichts mehr. Statt ein positives ›Wir-Gefühl‹ aufzubauen, trugen Unternehmensberater dazu bei, dass jeder mit dem Ellbogen nach oben strebte. Niemand brauchte sich zu wundern, dass damit Deutschlands Niedergang begonnen hatte, dachte Ketschmar. Die wahren Werte zählten schon lange nichts mehr.
2
Er fuhr auf dem direkten Weg zum Arbeitsamt, diesem mit Backsteinklinkern aufgemotzten Prunkbau am Rande der Göppinger Innenstadt. Seit einiger Zeit hatte man es umbenannt in ›Agentur für Arbeit‹. Als ob allein eine andere Bezeichnung den Bürokratenmief vertreiben könnte. Auch so ein Schwachsinn der jungen dynamischen Manager. Schönreden, Schönschwätzen. Wenn sich schon in dieser Republik nichts mehr zum Positiven änderte, dann mussten wenigstens neue Titel und Namen her. Mit den Berufsbezeichnungen hatte es angefangen, erinnerte er sich. Es gab keinen simplen Schlosser mehr, keinen Müllkutscher. Das waren jetzt Industriemechaniker oder Entsorger ›Abfall‹. Es musste ganze Stäbe von Verwaltungshengsten geben, die tagaus, tagein nur solchen Unsinn erfanden. Ihm kam ein Beispiel in den Sinn, von dem ihm jüngst ein befreundeter Polizeibeamter berichtet hatte: Hat man das ›fahrende Volk‹ in früheren Zeiten landläufig als ›Zigeuner‹ bezeichnet, so waren es später die ›Landfahrer‹. Doch auch dies ist im Amtsdeutsch inzwischen verpönt. Einfach genial, dass irgend jemandem die Bezeichnung ›mobile ethnische Minderheit‹ eingefallen ist. Solche Veränderungen brachten dieses Land enorm weiter.
Ketschmar hatte den Golf auf dem Parkdeck des ›Marktkaufs‹ abgestellt, weil dort keine Gebühr verlangt wurde. Langsam musste er sich daran gewöhnen, auch kleine Beträge einzusparen. Schlagartig war ihm klar geworden, wie schnell ein Jahr vorbei sein würde. So lange nämlich konnte er mit dem Arbeitslosengeld rechnen – doch danach würde er unweigerlich aus allen sozialen Netzen fallen. Noch verdrängte er den Gedanken, welch verheerende Auswirkungen dies auf seinen Lebensstandard und den seiner Frau haben würde. Sie mussten ihr mühsam Erspartes anknabbern, denn alles, was sie ein Leben lang erworben hatten, überstieg bei weitem jene Grenze, bis zu der sie auf Unterstützung hoffen konnten. Da half es nichts, dass er lückenlos in die Arbeitslosenversicherung hineinbezahlt hatte. Wenn er daran dachte, wie viel Geld dies war, Monat für Monat überkam ihn jedes Mal die blanke Wut. Hätte man ihn diese Beträge in eine private Versicherung anlegen lassen, könnte er jetzt in Saus und Braus weiterleben. Doch die staatlich verordnete Zwangsversicherung, die eigentlich gar keine war, weil sie im jetzt eingetretenen Versicherungsfall nur ein Jahr lang zahlen wollte, war von großem Übel. Wie alles, was staatlich verordnet war. Dass eine Änderung notwendig war, schien den Politikern jetzt zu dämmern. Doch konnten sie dies doch nicht auf dem Rücken derer austragen, die ein Leben lang auf diese Versicherung vertraut und gebaut hatten. Was da jetzt abging, war ein astreiner Versicherungsbetrug, hatte Ketschmar schon viele Male im Freundeskreis geklagt.
Er besah sich im Rückspiegel seines Golfs, strich sich die graumelierten schwarzen Haare aus dem Gesicht, das auf den Baustellen ein Leben lang Hitze und Kälte ertragen hatte, und rückte seine Krawatte zurecht. Dann nahm er den Aktenordner vom Rücksitz, stieg aus und verließ das Parkdeck. Draußen auf der Kreuzung schlug ihm die raue Novemberluft entgegen. Eigentlich war er immer um diese Jahreszeit mit Monika, seiner Frau, für zwei Wochen zum Sonnetanken auf die Kanaren geflogen. Alles gestrichen. Vorbei.
Er überquerte die stark befahrene Kreuzung hinüber zur Poststraße und erreichte nach wenigen Schritten den leicht zurückversetzten, verschachtelten Komplex des Arbeitsamtes. Im Eingangsbereich hatte sich die übliche Schlange der erst vor kurzem arbeitslos gewordenen Menschen gebildet, die hier zunächst geduldig auf ihre Registrierung warteten, ehe sie einen Berater aufsuchen durften. Er hatte diese entwürdigende Prozedur bereits hinter sich. Er fühlte sich hier immer unwohl. Die Luft war schlecht, es roch meist nach Knoblauch und Schweiß. Außerdem war dieses Foyer gemessen an den unzähligen Büros viel zu dunkel und klein. Er mied es, in die Gesichter zu blicken. Meist waren es Jugendliche, die hier neue Hoffnung schöpften, oft auch Ausländer. Einige hatten sich ein Outfit zugelegt, das nach seiner Überzeugung nicht gerade dazu angetan war, einen schwäbischen Unternehmer zu einer Einstellung zu bewegen. Aber hier ging es ohnehin nur um die Befriedigung des allgegenwärtigen Bürokratismus. Ums Herausrechnen von Arbeitslosen aus der Statistik. Daran musste er denken, als er durch den langen Flur ging, auch hier vorbei an wartenden Menschen. Die Berater, Betreuer und ›Fall-Manager‹ oder wie sie sich alle nannten, mussten wahre Künstler im Beschönigen der Statistik sein. Politisch verordnet natürlich. Was waren da in der Vergangenheit für Fort-und Qualifizierungsangebote ersonnen worden – alle mit dem Ziel, die Betroffenen als Schüler in die Statistik aufnehmen zu können und nicht als Arbeitslose. Notfalls würde man sie zum Gabelstaplerfahrer ausbilden. Am Monatsende, wenn den Medien regelmäßig ein Zahlenwerk vorgelegt wurde, das eine halbe Doktorarbeit für einen Mathematiker sein konnte, mussten die Zahlen jedenfalls so hin- und her jongliert worden sein, dass insgesamt, ›saisonbereinigt‹ natürlich, ein positiver Trend erkennbar wurde.
Ketschmar ging an der Reihe der Türen entlang, bis er am Namensschild ›Friedbert Grauer‹ angelangt war. Er klopfte, wartete aber gar nicht auf eine Reaktion, sondern öffnete.
Als er das Büro des Sachbearbeiters, einem Mann mittleren Alters, betrat, überwältigten ihn zum zweiten Mal an diesem Tag Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein. Im Arbeitsleben war er es, der die Entscheidungen getroffen hatte – oft genug auch schwerwiegende. Als Bauingenieur hatte er für Projekte verantwortlich gezeichnet, die mindestens drei, vier Generationen überdauern mussten. Kläranlagen, Brücken, Umgehungsstraßen. Sein Wort galt. Seine Erfahrung zählte. Zusammen mit seinen engsten Mitarbeitern waren sie ein eingeschworenes Team gewesen. Hatten ohne zu murren Überstunden gemacht, auch am Samstag zusammengesessen, um neue Berechnungen anzustellen, wenn es hatte sein müssen. Sie waren die Zupacker gewesen und hatten keine Sekunde an den Gedanken verschwendet, einmal vor dem Nichts zu stehen. Zwar waren viele Baufirmen, auch große, in diesen Zeiten pleite gegangen. Doch dass es auch sie erwischen würde, war ihnen völlig abwegig erschienen. Diejüngeren Kollegen, die 30-und 35-Jährigen, hatten wieder einen Job gefunden, im Raum München und am Bodensee. Einige andere, die ohnehin aus dem Norden stammten, waren inzwischen in alle Winde verstreut. Nur er schrieb sich noch immer die Finger mit Bewerbungen wund. Er konnte nicht so ohne weiteres alle Zelte abbrechen und in eine andere Ecke dieser Republik ziehen. Flexibilität predigte sich so leicht in politischen Sonntagsreden – doch die Herren, die dies vollmundig priesen, konnten es aus einer gesicherten Position heraus tun. Was wussten die schon vom wahren Leben …
Und dieser Sachbearbeiter, vor dem er jetzt saß, in einem viel zu warmen Büro, das mit all den Aktenregalen den Charme eines Buchhalterkontors verbreitete, dieser Sachbearbeiter hatte sicher auch keine Ahnung, wie es draußen in den Betrieben und auf den Baustellen zuging. Bei ihm war er nichts weiter als eine Nummer, ein Vorgang, eine Zahl in der Arbeitslosenstatistik. Fehlte nur noch, dass man ihm anbot, einen Gabelstaplerkurs zu absolvieren. Zur Weiterbildung, als Qualifizierung – in Wirklichkeit natürlich, um ihn für ein paar Wochen aus der Statistik herausnehmen zu können und irgendwo zu parken.
Friedbert Grauer, sicher in diesen Amtsstuben in Ehren ergraut, bot ihm einen Platz an der abgerundeten Seite des Schreibtisches an. Dort stapelten sich Akten, von denen jede einzelne vermutlich das Schicksal eines Arbeitslosen enthielt.
»Sie haben mir am Telefon gesagt, dass nichts geklappt hat«, kam Grauer gleich auf den Punkt und lehnte sich in seinem Schreibtischsessel zurück.
»Gelinde gesagt, Scheiße«, entgegnete Ketschmar mit unterdrücktem Zorn, »das macht doch alles gar keinen Sinn. Gerade eben wieder – drüben bei ›Xandom-Bau‹, null Chance. Sie wissen genau so gut wie ich, dass ich keine Chance hab.«
Grauer, der seinen wohl genährten Bauch gegen die Schreibtischplatte presste und sich über seinen Wollpullover strich, holte tief Luft und nickte langsam. »Sie sind einfach zu alt.«
Jetzt wars endgültig raus. Amtlich sozusagen. Behördlich festgestellt. Ketschmar zögerte für einen Moment, doch dann spürte er, dass das Maß voll, die Schmerzgrenze überschritten war. »Jetzt haben Sie es endlich gesagt. Danke, herzlichen Dank.« Seine Stimme verriet Zorn. »Zu alt, prima. Zu alt – natürlich«, es brach förmlich aus ihm heraus. »Sie sind genau wie ich mit Ihrem Latein am Ende. Und was Sie mir im letzten Vierteljahr empfohlen haben, war nichts weiter als Augenwischerei, nur Aktionismus. Und jetzt werden Sie mir gleich empfehlen, mich fortzubilden.« Ketschmar wandte den Blick von ihm ab und sah zu den Aktenregalen hinüber. »Soll ich einen Computerkurs belegen? Oder das Gabelstaplerfahren lernen? Oder was haben Sie noch auf Lager? Vielleicht könnte ich umschulen – ist ja mit 54 überhaupt kein Problem. Oder soll ich einen Ein-Euro-Job annehmen – oder eine Ich-AG gründen?« Ihn widerte alles an. Sein Blutdruck schoss in die Höhe. Er wollte arbeiten, richtig, vernünftig arbeiten, sein Wissen anbringen und mithelfen, dieses Land vor dem völligen Absturz zu bewahren.
Grauer ließ zwei Sekunden verstreichen, ehe er sachlich entgegnete: »Wir tun, was wir können – aber der Arbeitsmarkt …«
»Der Arbeitsmarkt!«, unterbrach ihn Ketschmar abrupt, »der Arbeitsmarkt gibt nichts her, das weiß doch jeder Idiot. Entschuldigen Sie, aber um mir das sagen zu lassen, brauch ich nicht jedes Mal hierher zu kommen.«
»Die neue Bundesregierung ist bemüht, wieder ein investitionsfreundliches Klima zu schaffen«, versuchte Grauer einzulenken. Es schien so, als spule er ein für solche Fälle erlerntes Notfallprogramm ab.
»Ach, gehn Sie mir doch weg!«, entfuhr es dem arbeitslosen Bauingenieur, der jetzt seine Krawatte lockerte, »Bundesregierung! Vergessen Sie doch die Politiker. Die haben uns doch alles eingebrockt. Alles, was in Berlin angezettelt wird, dient doch nur den Unternehmen – mit der Begründung, dann würden Arbeitsplätze geschaffen. Und was geschieht?« Ketschmar blickte sein Gegenüber an. »Es wird investiert, ja, natürlich – in moderne Fabrikationsanlagen und die entstehen meist im Ausland. Mit der Folge, dass immer noch mehr Arbeitsplätze wegfallen. Herr Grauer, in welcher Welt leben Sie denn?« Beinahe hätte er ihm gesagt, dass seine Welt wohl nur aus Akten und Statistiken bestand, vor allem aber aus einem sicheren Arbeitsplatz, an dem er sich seinen Hintern platt drücken konnte. Sesselfurzer nannte man solche Kerle, wenn an den Stammtischen von ihnen gesprochen wurde. Ketschmar versuchte, ruhig zu bleiben. Der Mann tat schließlich auch nur seine Pflicht. Die Wurzel des Übels lag woanders.
»Wenn ich ganz ehrlich bin«, begann Grauer wieder mit sanfter Stimme und nestelte verlegen am Knoten seiner dezent schwarz-rot-karierten Krawatte herum, »Menschen in unserem Alter«, er ließ ein Lächeln über sein rundes Gesicht huschen, »sind einfach nicht mehr zu vermitteln.« Ketschmar war ob dieser plötzlichen Ehrlichkeit für einen Moment sprachlos. Er schluckte und verschränkte die Arme. »Na, endlich«, stellte er fast ein bisschen erleichtert fest, »wir brauchen uns doch nichts vorzumachen. Nur …«, er kniff die Augen gefährlich zusammen, »eines unterscheidet uns beide: Ich krieg keinen Job mehr – und Sie haben einen sicheren.«
Grauer ging nicht darauf ein. »Sie sind noch sieben Wochen lang für ›Alg 1‹ bezugsberechtigt.«
Alg 1, ja, dachte Ketschmar, an nichts anderes dachte er seit zehn Monaten. Arbeitslosengeld eins, auch wieder so eine Wortneuschöpfung. Ein Jahr lang würde er es bekommen, 60 Prozent seines letzten Nettoeinkommens. Das war alles, was ihm die sogenannte Arbeitslosenversicherung für über 30 Beitragsjahre bot. Dann würde er das Gleiche bekommen wie die ewigen Nichtstuer und Tagediebe. 345 Euro standen ihm zu, monatlich. Aber nur theoretisch. Denn so lange er noch Erspartes hatte, ein viel zu großes Haus, wie ganze Heerscharen von Bürokraten bald feststellen würden, sein Wohnmobil und einige Annehmlichkeiten, die er und seine Frau durch eisernes Sparen angeschafft hatten, so lange bekam er gar nichts. Null. Ach, hätten sie doch nur nicht gespart, sondern ihr Geld verprasst, mit Reisen und teuren Autos, dann würden sie jetzt, im Alter, nicht mit ansehen müssen, wie alles den Bach hinunterging. Ketschmar schossen tausend Gedanken durch den Kopf. In einer einzigen Sekunde. Wieder überkam ihn der Wunsch, so einen Kerl am Kragen packen zu wollen.
»Sie müssen natürlich weiterhin dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen«, hörte er plötzlich die Stimme seines Beraters. »Sollten Sie zu Weihnachten verreisen wollen, müsste dies von uns genehmigt werden.«
Wieder eine Demütigung, eine Kränkung. Sie würden ihm also wider besseres Wissen weitere Adressen schicken, bei denen er sich bewerben musste. Eine schwachsinnige Tretmühle, ein Irrenhaus. Nein, er wollte nicht mehr. Er wollte nicht noch einmal abgespeist werden. Ketschmar spürte das Blut im Kopf pochen. Nein, jetzt war Schluss. Wenn, dann unternahm er etwas auf eigene Faust. Mit 54 hatte er es nicht mehr nötig, erniedrigt zu werden. Er sprang auf und wurde laut. »Lassen Sie sich eines sagen, Herr Grauer, ich mach dieses Kasperltheater nicht mehr mit. So nicht.«
Der Berater war vom Verhalten seines Besuchers sichtlich irritiert. »Sie sollten das nicht überbewerten«, sagte er und griff zu einem Kugelschreiber, den er sogleich mit den Fingern zu drehen begann, »es gibt manchmal Zufälle, die dem einen oder anderen doch wieder zu einem Job verhelfen. Sie sollten nichts unversucht lassen.«
Ketschmar stand vor dem Schreibtisch, als wolle er Gift und Galle spucken. »Und Sie, Herr Grauer, Sie sollten darauf achten, dass diese ganze verdammte Behörde hier nicht eines Tages der Teufel holt«, giftete er und geriet außer sich. »Pfui Teufel kann ich da nur sagen.« Und er wiederholte es schreiend: »Pfui Teufel.« Er war plötzlich wie von Sinnen. Frust, Zorn und eine unbändige Wut entluden sich, als sei ein Vulkan in ihm ausgebrochen. Er schrie immer wieder »Pfui Teufel, mit euch allen hier. Pfui Teufel.« Und er war bedrohlich nah an den kreidebleich gewordenen Beamten herangekommen.
Eine Gesellschaft, die dem Jugendwahn verfallen war. Was zählte in dieser Ex- und Hoppgesellschaft schon noch die Erfahrung? Oder das, was die Väter aufgebaut hatten? Wofür sie gekämpft hatten? Früher, in den Fünfzigern. Es war für den Vater eine Schinderei gewesen. Schichtdienst, Akkord an der Besteckpresse der WMF. Bis es allmählich aufwärts ging, doch alles war förmlich vom Munde abgespart: Ein Motorrad, eine NSU wars, das kleine Stück Freiheit. Samstag wurde die Maschine poliert, der Motorblock mit Petroleum vom Öl gereinigt und anschließend der Inhalt des blechernen Putzbehälters in den kleinen Bach geschüttet, der am Haus vorbeilief und in dem das Benzin so herrlich bunt schillerte. Dieser Bach, der längst nicht mehr lustig plätschern durfte, weil sie ihn in den Untergrund verbannt haben, hat gleichzeitig die Küchenabwässer mitgenommen. Samstagnachmittags, wenn alle in ihren Holzzubern oder Zinnwannen gebadet hatten, verfärbte sich das Wasser grünlich und roch nach Fichtennadel. Und sonntags, nach dem Mittagessen, kamen die Reste der Nudelsuppen angeschwommen und wirbelten um die Wasserrädchen, die er aus Sperrholz gezimmert hatte.
Es war, gerade mal zehn, 15 Jahre nach Kriegsende erst, ein Stück heile Welt. Hier, auf dem Lande, wo man der Politik in dieser jungen Demokratie noch traute, erschien die provisorische Hauptstadt Bonn so unendlich weit weg zu sein. Und Paris oder Washington würde man ohnehin nie im Leben besuchen können.
Es war Ende der Fünfziger, als der Nachbar mit seinem Käfer nach Italien gefahren ist. Unglaublich, wie der das finanziell geschafft hat. Und der auf der anderen Seite, ein Schreinermeister, verbrachte den Urlaub mit seinem VW-Bus am Plansee. Wo immer das sein mochte, jedenfalls irgendwo weit weg, in Österreich. Dort, wo Vaters Landkarte gar nicht mehr hinreichte.
Doch auch Ketschmars Eltern hatten durch eisernes Sparen an diesem Wirtschaftswunder teilhaben dürfen. Einfach war das nicht gewesen. Nur weil die Mutter stundenweise und so gut es ging, weil sie doch in der kleinen Mietswohnung auf ihn, den kleinen Gerhard, hatte aufpassen müssen, arbeiten gegangen war, hatte man sich mehr leisten können, als es ein WMF-Arbeiter geschafft hätte. In einem Hotel, dessen Glanzzeit irgendwann vorüber gewesen war, hatte sie vielen prominenten Gästen die Betten gemacht, während er auf den langen Fluren endlose Stunden gespielt hatte. Er war ein typisches Einzelkind. Er wuchs in die aufstrebende Republik hinein, ohne sich dessen bewusst zu sein. So war halt das Leben. Er kannte kein anderes.
Irgendwann war er so groß geworden, dass er auf dem Motorrad nicht mehr zwischen Vaters Rücken und Mutters Schoß gezwängt mitfahren konnte. Anfang der Sechziger leisteten sich die Eltern ein Auto. Unglaublich. Ein Auto. Der ganze Stolz. Grasgrün und putzig klein – ein gebrauchtes Goggomobil, das fortan vor dem Haus stand, direkt am Bach.
Möglich war dies nur geworden, weil die Mutter nun richtig arbeitete. Ein Scheißjob, wenn man es genau nimmt. In einer chemischen Fabrik, wo kein Mensch an Umweltschutz, an Luftfilter oder an die Gefahr irgendwelcher Substanzen dachte.
Das war die Zeit, als Ketschmar die Mittelschule besuchte. So nannte man damals die Realschule.
Er begann damals bewusst zu erleben, wie hart die Eltern für das Geld arbeiten mussten. Er las die Zeitung der Industriegewerkschaft Metall, obwohl er nicht viel davon verstand. Sein Vater war ein ehrenamtlicher Funktionär geworden, hatte sich für die Streiks stark gemacht, mit denen sich die Arbeiter Stück für Stück Rechte und höhere Löhne erkämpften. ›Samstags gehört der Papa uns‹, hatte ein Slogan gelautet, an den sich Ketschmar noch heute erinnerte. Es ging um den arbeitsfreien Samstag. Daran musste er jetzt denken, jetzt, wo all diese hart erkämpften Werte leichtfertig von diesen Bürschchen in den Chefetagen über Bord geworfen wurden.
3
Tausend Gedanken fuhren in seinem Kopf Achterbahn. Ketschmar hatte Göppingen verlassen, ohne sich dessen bewusst geworden zu sein. Er hatte die Schnauze voll. Es war alles unsinnig, eine nach unten gerichtete Spirale. Es war aus, einfach vorbei. Abgestellt. Kaltgestellt. Der Golf rollte in das Neubaugebiet von Donzdorf, einem beschaulichen Städtchen, eingebettet in die ebenso beschauliche Landschaft zwischen den Dreikaiserbergen Hohenstaufen, Rechberg und Stuifen einerseits und den steil aufragenden Hängen der Schwäbischen Alb andererseits. Als er und seine Frau dort vor 20 Jahren ein schmuckes Einfamilienhaus gebaut hatten, damals, als Tochter Chrissi ausgezogen war, um in Tübingen zu studieren, da hatten sie keinen Gedanken daran verschwendet, dass sie einmal vor dem Nichts stehen würden. Die Bauwirtschaft hatte geboomt, Straßen wurden gebaut, auch der neue Albaufstieg der Autobahn am Aichelberg war gerade angestanden.
Seine Stimmung entsprach dem Wetter, das eine dicke Nebelschicht um die Hänge der nahen Schwäbischen Alb gelegt hatte. Er fuhr nicht in die Garage, sondern stellte den Golf am Straßenrand ab. Sein Blick traf das Wohnmobil, das unter dem mit Efeu umrankten Carport stand. Wie oft noch würde er mit Monika in die Berge oder ans Meer fahren können? Im Januar würde das Ersparte schmelzen. Und zwar schnell. Was waren da die knapp hunderttausend Euro, die sie zusammenkratzen konnten? Bausparvertrag, ein paar dümpelnde Aktien von Telekom und Daimler, einige Sparkassenbriefe und ein uraltes Sparbuch. Alles war längst der staatlichen Kontrolle unterworfen. Mit List und Tricks, so hämmerte es jetzt in seinem Kopf, hatte die Regierung es geschafft, den Bürger zum gläsernen Sparer zu machen. Nie hatte Ketschmar es begriffen, dass das mühsam Ersparte, schon mal versteuerte Einkommen, immer und immer wieder versteuert werden musste, alljährlich, wenn die Zinseinnahmen die kontinuierlich gesenkte Freigrenze überstiegen.
Monika spürte sofort, was los war. Sie drückte ihm in der Diele einen Kuss auf die Wange und lächelte ihn aufmunternd an. Doch er hängte lustlos seine Jacke an die Garderobe, zog die Krawatte vom Hals und ging ins Esszimmer, das seine Frau geschmackvoll herbstlich dekoriert hatte.
»Null Chance«, sagte er und blickte aus dem Fenster. Die November-Stimmung zog ihn noch tiefer in die Depression.
»Wir werdens schaffen«, versuchte Monika ihn zu trösten. Doch es klang wenig überzeugend. Sie legte ihre Arme um seinen Nacken. »Auch andere haben damit zu kämpfen.«
Er nickte und umarmte sie. »Das sagt sich so leicht«, meinte er mit gedämpfter Stimme, »ich befürchte, wir werden vieles aufgeben müssen.«
»Wir schaffen das«, wiederholte sie jetzt eine Spur überzeugender. »Notfalls geh ich jobben.«
Ketschmar blickte seiner Frau ungläubig in die Augen. »Das kommt überhaupt nicht in Frage.« Ihn überkam der Gedanke an diese Billigjobs, mit denen finanziell in Not geratene Frauen ausgenutzt wurden. Supermärkte, geöffnet bis 20 Uhr. Samstagsarbeit bis zum Abend. Junge Chefs, die Sklaventreiber waren. Solche, die von über 40-Jährigen sowieso nichts hielten. Die auf dauernde Fluktuation setzten. Einstellen, ausnützen – rauswerfen. Heuern und feuern, wie es die Gewerkschaften einmal formuliert hatten. Nein, das wollte er seiner Frau nicht zumuten. Nicht ihr.
Warum, zum Teufel, nahm es eigentlich dieses Volk hin, dass alle Errungenschaften des Sozialstaates aufgegeben wurden? Monika spürte, wie seine Gedanken abschweiften. »Was denkst du jetzt?«
»Ich überleg mir, warum es in diesem Land so weit kommen musste.« Er schaute einer Amsel zu, die auf einem der kahlen Äste herumhüpfte. »Sie haben alles aufgegeben, was Deutschland einmal wirtschaftlich so stark gemacht hat. Denk doch mal an die Unterhaltungsindustrie. Schlagartig alles weg – an Japan verloren. Hat wohl Ende der Sechziger angefangen. Anstatt innovativ zu sein und zu forschen, hat die zweite Generation der Unternehmer die schnelle Mark gemacht und verkauft.« Er machte eine Pause. »Oder denk an die Optik, die Fotoindustrie. Ab nach Japan. Ein Ausverkauf der Technologie. Was soll man da noch erwarten?«
Monika, die er über alles liebte, wandte sich ihm zu. Sie hatte unendliches Verständnis für ihn – und vor allem Geduld, wenn er, wie in den vergangenen zehn Monaten so oft, ins Grübeln kam. Wenn er die Kontoauszüge studierte, die Ordner mit den Lebensversicherungen und all den anderen regelmäßigen Auslagen, den Strom-und Wasserkosten, Telefon, Fernsehkabel und all die vielen Dinge, die es nun zu minimieren galt. Haftpflichtversicherung, Gebäudebrandversicherung, Rechtsschutzversicherung, das Lotterielos, die Vereinsbeiträge. Ganz zu schweigen von Grundsteuer und Kfz-Steuern. Hatten die in Berlin eigentlich eine Ahnung, wie schnell das Ersparte zusammenschmelzen würde? Jedes Mal, wenn er sich diese Beträge vorstellte, die regelmäßig von seinem Konto abgebucht wurden, kam er sich in die Enge getrieben vor. In eine bedrohliche Enge. Irgendwann, so spürte er, würde es einen Befreiungsschlag geben müssen. Aber gegen wen – und was?
Hunderttausend Euro, die sie als Rücklage errechnet hatten, würden spätestens in 5 Jahren aufgebraucht sein. Das war realistisch, betrachtete man allein die steigenden Heizungskosten oder die angehobene Mehrwertsteuer. Vorbei der Traum von den Reisen. Australien würde er nie mehr wiedersehen. Dabei war es gerade dort so traumhaft schön gewesen. Und er hatte sich vorgenommen, spätestens beim Eintritt ins Rentenalter, dies noch einmal ausführlich zu genießen. Daran musste er jetzt denken, als er resigniert feststellte: »Wir gehn verarmt in die Rente.«
Monika streichelte ihm übers dünn gewordene Haar. »Gerhard, wir werden das schaffen. Es gibt Menschen, die sind noch schlimmer dran.«
Sie hatte recht, ja. Manche fielen gleich durch alle Raster, konnten nichts abschmelzen. Die rot-grüne Regierung hatte sie nun alle gleich gemacht – und dies als große Errungenschaft sozialer Politik verkauft. Mehr Gerechtigkeit. Und alle hatten applaudiert – von rechts bis fast nach ganz links. Doch er sah das anders, schon immer. Wer ein Leben lang geschafft und durch die treu und brave Einzahlung in die Sozialversicherungen einen gesicherten Lebensabend zu haben glaubte, wurde mit all jenen gleichgestellt, die kaum etwas oder gar nichts dazu beigetragen hatten. Nicht dass er jene hätte verhungern lassen wollen, aber er empfand es als eine riesige Ungerechtigkeit, der er und viele in seinem Alter und in seiner Position ausgesetzt wurden.
»Weißt du, da steckt Methode dahinter«, begann er, drehte sich um und lehnte sich an den Fenstersims, »man setzt sogar die Rentengrenze nach oben, obwohl man natürlich sehr wohl weiß, dass man ab fünfzig keinen Job mehr kriegt. Also wirst du viel länger arbeitslos sein als bisher. Der Staat hat somit länger Zeit, dein Vermögen abzuschmelzen. Denn die Ganoven in Berlin wissen ja, dass sehr viel Geld auf den Sparkonten liegt – das muss weg, rein wieder in den Kreislauf, egal, wie. Verstehst du?«
Monika sagte nichts. Sie sah es längst genauso. Sie fragte sich nur, wie lange sich das Volk solche Tricksereien noch gefallen ließ.
Über der Albkante brach die frühe Dämmerung herein. Sie schwiegen sich ein paar Minuten lang an, während denen sie in seinen Armen lag und sich an seine Brust kuschelte. Sie wünschte sich, weit weg zu sein, irgendwo im Süden, wo das Leben einfacher zu sein schien – zumindest empfand sie es jedes Mal so, wenn sie im Spätsommer durch die beschaulichen Gässchen von Meran oder Bozen schlenderten.
Auch wenn sie sich anschwiegen, war die Atmosphäre voll Harmonie. Ja, sie würden es schaffen, dachte Ketschmar. Er atmete tief ein. Denn unterkriegen, nein, das ließ er sich nicht.
»Du hast das Auto nicht in die Garage gefahren?«, hörte er plötzlich wieder Monikas Stimme.
»Ich muss noch ein bisschen raus«, seufzte er und schaute sie an, »ich fahr Eier holen.«
Sie nickte verständnisvoll. Immer freitags fuhr er zum Steinberghof hinauf, wo es frische landwirtschaftliche Produkte gab. Zwar ein paar Cent teurer als in den Supermärkten, aber zum einen schätzten sie beide die Frische des heimischen Angebots und zum anderen entsprach es ganz und gar nicht Gerhards Philosophie, die großen Filialisten zu unterstützen, die ihm allein schon ihrer Personalpolitik wegen suspekt waren. Die Frage war nur, wie lange sie es sich noch leisten konnten, nicht nach dem allerbilligsten Produkt zu greifen. Bald würden sie die Zeitungsinserate bis auf den letzten Cent vergleichen müssen – sofern sie sich dann überhaupt noch eine Zeitung leisten konnten.
»Frische Milch heut auch«, sagte Monika und versuchte ein Lächeln, »vielleicht baut dich der alte Georg wieder auf.«
Der ›Steinbergbauer‹, wie man den alten Hofbesitzer drüben im Nachbarort Reichenbach seit Menschengedenken nannte, war zwar schon bald achtzig, aber noch immer voller Optimismus. Er war dort oben, wo die Wiesen weit hinauf zu den bewaldeten Hängen reichten, aufgewachsen und sicher nie weiter als nach Stuttgart gekommen. Nur dass er mit seinem 300 Meter entfernten Nachbarn, dem ›Eulengreuthof-Eugen‹, seit Jahr und Tag Händel hatte, das konnte kein Mensch hier im Tal verstehen. Sie waren schon bis zum Landgericht nach Ulm gezogen, weil ihre Schimpfkanonaden letztlich in handfeste Tätlichkeiten ausgeartet waren. Von gegenseitigen Mordversuchen hatten sie auch schon dem Göppinger Amtsrichter berichtet, sich gegenseitig Teile des Traktors geklaut oder dem Vieh des jeweils anderen alle erdenklichen Krankheiten gewünscht. Längst hatte der Streit auf die übernächste Generation übergegriffen. Nun oblag es den Enkeln, auch schon knapp 30 Jahre alt, die traditionelle Fehde fortzuführen. Schon sprach man in Juristenkreisen süffisant, aber seufzend, vom ›Bauernstreit vom Eulengreuthof‹.
Ketschmar dachte für einen kurzen Moment daran. Nie hatte er es verstanden, wie Menschen in einem solchen landschaftlichen Idyll nichts anderes zu tun hatten, als sich gegenseitig zu zerfleischen. Anstatt die schönen Seiten des Lebens zu genießen, trachteten sie über Generationen nur danach, dem einzigen Nachbarn Böses zu tun. Und letztlich konnte niemand mehr so genau sagen, was den uralten Streit ausgelöst hatte. Eulengreuthof-Eugens Urgroßvater, so hieß es, habe mal versucht, den Grenzstein zwei Meter weiter Richtung Steinberghof zu versetzen. Aber das musste fast noch im 19. Jahrhundert gewesen sein.
Monika drückte ihrem Mann einen Kuss auf die Wange und sah so optimistisch aus, als sei für sie die Welt noch in Ordnung. »Halt dich nicht so lange auf«, bat sie im Flüsterton. Er holte sich die Eierschachteln aus dem Küchenschrank, nahm die silbern glitzernde Milchkanne und verließ die Wohnung.
Draußen atmete er tief ein, genoss diese frische und raue Luft und stieg in seinen Golf. Der Nebel kroch über die Hänge herab. Schloss Ramsberg, das auf einem der Berge thronte, war schon nicht mehr zu sehen. Ketschmar bog in die Straße nach Reichenbach unterm Rechberg ein und schob eine CD mit verträumten Instrumentaltiteln in das Gerät. Wie schön könnte die Welt sein, wenn sich die Menschen das Leben nicht gegenseitig schwer machen würden, dachte er.
Diesen Egoisten, diesen Ausbeutern von Mensch und Natur, galt es das Handwerk zu legen. Und dann erschrak er selbst – über diese Gedanken, die nur nach Rache sannen, obwohl er ganz anders sein wollte als diese Kerle, die über Leichen gingen.
Der silberfarbene Golf, den er sich voriges Jahr geleistet hatte, rollte durch Reichenbach hindurch. Hinter dem Ort erstreckte sich ein weites sonniges Tal in nördliche Richtung. Es gab hier eine Vielzahl von Höfen, die sich wie Almen an die Wiesenhänge schmiegten, die erst weit oben bewaldet waren. Von dem schmalen Asphaltsträßchen zweigten nach beiden Seiten die einzelnen Zufahrten ab. Gelbe Hinweisschilder wiesen zu den einzelnen Höfen.
Ketschmar war den Weg zum Steinberghof schon viele hundert Mal gefahren. Er wusste, wo er rechts abbiegen musste. Seit einigen Monaten wurde abseits der schmalen Zufahrt eine größere Stallanlage gebaut, von der gerade erst die Fundamente betoniert waren. Vermutlich einer dieser Schweineställe, wie sie gerade überall wie Pilze aus dem Boden schossen, dachte er und ließ seinen geübten Blick über die Baustelle schweifen. Entlang des Asphaltwegs hatte die Baufirma einen Bürocontainer und das obligatorische Klohäuschen aufgestellt. Zwischen beidem war rückwärts ein helles Auto eingeparkt.
Ein paar Minuten und einen steilen, kurvigen Streckenabschnitt später erreichte er den Steinberghof, über dem sich die Nebelschwaden verdichteten. Das Gehöft des verhassten ›Eulengreuthofbauern‹ lag längst im Nebel.
Ketschmar drehte zwischen dem Wohnhaus und den U-förmig angeordneten Stallungen um und parkte den Wagen in Richtung Ausfahrt, wo Stammholz zum Abtransport bereitlag.
Als er ausstieg, schlug ihm ruppige Kühle entgegen. Hier oben war es deutlich kälter als drunten im Tal. In der feuchten Luft hing der strenge Geruch nach Mist, Kühen und Schweinen. Faro, der Schäferhund, bellte pflichtbewusst zwei-, dreimal und tippelte an der Scheunenfront entlang – so weit, wie ihm die an Rollen unterm Vordach befestigte Laufleine Freiheit bot.
Ketschmar griff sich Eierschachteln und Milchkanne und ging über den naturbelassenen Innenhof zur Eingangstür des verwitterten Wohnhauses hinüber. Sie stand wie üblich einen Spalt weit offen. »Hallo«, machte er sich bemerkbar, worauf auch schon die junge Bäuerin erschien, ihn mit einem breiten Lächeln begrüßte und über den schmalen, gefliesten Flur in ein kleines Esszimmer führte, in dem der alte Georg Pfeife rauchend an einem hölzernen Ecktisch saß und einen wohlriechenden Tabakduft verbreitete.
»Opa hat schon gefragt, wo Sie bleiben«, sagte die burschikose Frau, die einen blauen Arbeitsanzug trug und sich Eierschachteln und Milchkanne reichen ließ.
»Will’sch an Moscht?«, fragte der Alte, der einen Steinkrug vor sich stehen hatte. Es war jeden Freitag dieselbe Frage. Und Ketschmar verneinte sie auch diesmal nicht.
Georg, den sie hier im Schwäbischen überall ›den Schorsch‹ nannten – oder noch besser den ›Stoiberg-Schorsch‹ – verstand es trefflich, die Kundschaft zu unterhalten, während die Schwiegertochter, die so jung auch nicht mehr war, frische Eier holte und Milch in die Kannen goss.
Schorsch griff hinter sich in den Küchenschrank aus der Vorkriegszeit und stellte mit seinen dicken, aber wieselflinken Fingern ein Glas auf den Tisch. »Schenk dir ein«, forderte er seinen Gast auf. Ketschmar tat es und prostete dem alten Bauern zu.
Sie tranken ihre Gläser zur Hälfte leer.
»Was gibts bei dir Neues?«, fragte Schorsch ernst und wischte sich mit dem Handrücken den Mund und die Bartstoppeln drumherum trocken.
»Beschissen«, erwiderte Ketschmar, »beschissen. Woche für Woche das gleiche Elend. Zu alt, zu teuer. Und überall diese arroganten Managertypen.« Eigentlich hatte er sich vorgenommen, nicht darüber zu reden. Aber Schorsch zeigte jedes Mal ehrliches Interesse.
»Ich sag dir«, begann der alte Bauer und zog an seiner Pfeife, »so wie des jetzt läuft, kannsch des Land vergesse. Ich denk oft zurück an die Kriegszeit. Was waret mir froh an dem Wenige, was mir g’habt habet.« Er kniff die Augen zusammen, um die herum sich tausend Falten bildeten. »Dreckig isch es uns ganga, saudreckig. Aber alle hent z’amma g’halta. Alle. Und jetzt?«, Schorsch machte eine wegwerfende Handbewegung. »Nur Lug und Trug – wo du hingucksch.«
Ketschmar trank sein Glas vollends aus und schenkte sich nach. Sie waren schneller zu seinem Lieblingsthema gekommen, als er gedacht hatte.
»Ich sag dir«, fuhr der Alte fort und stopfte mit dem rechten Zeigefinger Tabak in die Pfeife, »ich bin grad froh, dass ich schon so alt bin.« Dann griff er sein Gegenüber am Unterarm und beugte sich zu ihm: »Ich versteh gar net, dass ihr euch das alles gfalla lasst.«
»Du hast heutzutage keinen wirklichen Rückhalt mehr. Ich war nie ein Freund der Gewerkschaften – habs in meiner Position nicht nötig gehabt. Aber selbst wenn ich Mitglied gewesen wäre – was tun die denn? Rückzieher machen sie, eingeschüchtert sind sie. Oder besser gesagt: Ihre Mitglieder sind eingeschüchtert. Wer wagt es denn heut noch, richtig aufzumucken?« Er nahm einen kräftigen Schluck.
Schorsch nickte. »So isch es. Keiner traut sich mehr was. So weit hat euch die Politik hinbracht.« Er machte wieder eine abwertende Handbewegung. »Ach was. Vergiss doch alles. Wenn i bloß an den Deppen da drübn denk.« Der Bauer deutete in Richtung Eulengreuthof. Es war nicht zu vermeiden, dachte Ketschmar. Egal, worüber sie in den vergangenen Jahren geredet hatten, früher oder später hatte Schorsch die Überleitung ›zu dem Deppen‹ gefunden. Zu dem Streit, der immer wieder aufs Neue aufflammte – vor allem aber zu den seiner Ansicht nach absolut unfähigen Juristen, von denen in all den Jahren kein einziger überhaupt begriffen habe, worum es ging. Dass dieser ›Eulengreuthof-Depp‹ ihn, den Steinberghof-Schorsch, umbringen wollte. Und dafür gab es tausend Beweise, wie Schorsch beschwören konnte. Zerstochene Reifen am Traktor und durchschnittene Bremsschläuche, die keinesfalls Marder zerbissen hatten. Ketschmar kannte diese Geschichten und goss sich nochmal aus dem Steinkrug nach. Vielleicht hatte Schorsch ja gar nicht so Unrecht, dachte er. Vielleicht musste man sich wehren. Gegen die Politiker, die Wirtschaftsbosse – und die anderen Deppen. Und gegen all die verantwortungslosen Burschen.
Verantwortung, hat er gesagt. Sie hatten noch Verantwortung gehabt, damals nach dem Krieg. Heute hatte dieses Wort eine ganz andere Bedeutung. Verantwortung nicht für die anderen, nicht mal für den Betrieb – sondern für sich selbst. Jedem war das Hemd näher als die Hose. Was scherte auch heute schon einen dieser kaltschnäuzigen Manager der Standort einer Firma? Standort war doch nur eine Frage örtlicher Steuern und billiger Arbeitskräfte. Das war früher anders gewesen. Zumindest in vielen Großbetrieben. Da saßen noch keine beliebig austauschbaren Manager, die dank ihres betriebswirtschaftlichen Studiums heute Autos und morgen Gemüse verkauften, die keine Ahnung von den Produkten, den Zusammenhängen und der Art und Weise hatten, wie sie herzustellen waren. Nein, damals, das waren noch Unternehmer, die sich mit ihrer Firma verbunden fühlten, die noch Wert auf Bodenständigkeit und den Erfahrungsschatz jener Menschen legten, die sich mit dem Betrieb identifizierten. In Geislingen, dieser Kleinstadt am Rande der Schwäbischen Alb, sprachen die Menschen einst von der Fabrik, wenn sie die WMF meinten, die Württembergische Metallwarenfabrik. Jeder, der was auf sich hielt, ging in die Fabrik. Sei es ins Büro oder in die Werkstatt. Und das Unternehmen fühlte sich auch noch ein bisschen für die Stadt und für die Kultur verantwortlich. Doch den Managern von auswärts waren diese Werte fremd. Dies allein ihnen anzulasten, wäre sicher unfair – sie haben sich einfach widerstandslos von dem ständig rauer werdenden Wind in Wirtschaft und Politik mitreißen lassen. Dieser Wind ist zum Orkan geworden und hat ein Trümmerfeld hinterlassen, das sich nur mühsam – wenn überhaupt – wieder aufbauen lässt. Doch anstatt festzuhalten, was noch zu retten wäre, gingen die Menschen verängstigt und eingeschüchtert in Deckung.
Was blieb, waren die feurigen Kampfreden irgendwelcher Gewerkschafter, die jedoch selbst nie wirklich das Arbeitsleben kennengelernt hatten. Nein, der alte Schorsch hatte recht, jeder musste sich selbst befreien von diesen Schranken des gnadenlosen Egoismus. Wenn jeder resignierte, wenn jeder nur kuschte und an seiner Arbeitsstelle die Minuten bis zum Feierabend zählte, dann würde dieses Deutschland endgültig in den Status einer Bananenrepublik versinken.
4
Vielleicht hatte er zu viel Most getrunken. Oder er war psychisch und physisch in einer derart schlechten Verfassung, dass der Alkohol wesentlich stärker wirkte als sonst. Er fühlte sich jedenfalls nicht gut, als er in der Garage aus dem Auto stieg. Er roch seinen eigenen Schweiß und hatte noch immer den Gestank von Mist und Gülle in der Nase. Zwar schätzte er dieses bäuerliche Idyll, doch manchmal hätte er sich dort oben im Umgang mit der Kundschaft ein bisschen mehr Hygiene gewünscht. Aus dem Stall kommen und ihm die Hand schütteln, das war etwas, dem er sich am liebsten entzogen hätte. Heute fühlte er sich sogar besonders schmutzig. Bevor er Monika gegenübertrat, musste er die Hände waschen. Er ging in den Nebenraum, ohne das Licht anzuknipsen, hielt die Hände unter den dortigen Wasserhahn und wischte sich mit dem feuchten Handtuch übers Gesicht. Dann nahm er vom Rücksitz des Autos die Schachtel mit den 30 Eiern, stellte sie im Flur ab und holte anschließend die Milchkanne, die im Kofferraum in einem Plastikkorb gegen das Umfallen gesichert war.
Er spürte plötzlich, wie seine Knie zitterten. Im Garderobenspiegel wirkte sein Gesicht blass. Kreidebleich. Die Haare hingen ihm in Strähnen in die Stirn.
»Was ist denn?«, hörte er plötzlich die Stimme seiner Frau hinter sich. Er erschrak und drehte sich um. »Scheiße«, entfuhr es ihm, »verdammte Scheiße. Ich hab beim Ausparken einen Holzstamm gestreift.«
Monika sah ihn prüfend an. So blass hatte sie ihren Mann selten gesehen. Blass, nervös und aufgeregt. »Schlimm?«,
fragte sie behutsam und roch seinen Atem. Er hatte Most getrunken, wie immer.
»Nein, nicht schlimm«, erwiderte er und deutete ihr an, mit in die Garage zu kommen. Der silberfarbene Wagen war vorwärts eingeparkt. »Drüben«, erklärte er und zwängte sich zwischen alten Schränken am Kühler vorbei zur rechten Kotflügelseite hinüber. Monika folgte ihm.
»Ist doch heutzutage nur noch alles Plastikgelumpe«, stellte er fest und deutete auf die zersplitterte Stoßstange.
Seine Frau besah sich den Schaden nur kurz und wandte sich wieder ihrem Mann zu. »Ist doch wirklich nicht schlimm.«
»Fünfhundert Euro«, meinte er tonlos und verbittert. »Mindestens.«
Sie streichelte ihm übers Haar. Als seine Hand die ihre berührte, erschrak sie. Er war kalt. So kalt wie bei einer Leiche, dachte sie und war über diesen Vergleich schockiert. Gerhard hatte sich aufgeregt. Er konnte die Ruhe selbst sein, wenn es nicht um ihn ging. Doch sobald er selbst der Betroffene war, das hatte sie in all den Ehejahren oft genug erfahren, dann verlor er sehr schnell die Kontrolle.
Er ging in die Knie, um den Schaden besser begutachten zu können. Monika gab sich geduldig. »Das sieht doch niemand.«
Ketschmar betastete das zersprungene Plastikteil. »Verdammt!«, entfuhr es ihm. Dann stand er wieder auf und deutete seiner Frau an, dass er die Garage verlassen wolle. Ihm standen dünne Schweißperlen auf der Stirn, obwohl es kalt war.
Drüben in dem mit Kiefernmöbeln eingerichteten Esszimmer sah er aus dem Fenster. Die Nacht war hereingebrochen. »Das hat uns gerade noch gefehlt«, knüpfte er an das Gespräch in der Garage an, während seine Frau am Tresen stehen blieb, der das Zimmer von der Küche optisch trennte. »Das kann jedem passieren«, versuchte sie ihn zu trösten, doch er winkte ab.
»Das kann jedem passieren«, wiederholte er genervt, »ja, jedem – nur kann sichs nicht jeder leisten, es wieder reparieren zu lassen.« Er verschränkte die Arme.
»Wir müssens doch nicht reparieren lassen«, meinte Monika und tat so, als ob ein kleiner Blech- oder Plastikschaden das Normalste auf der Welt wäre.
»Natürlich nicht, Monika. Natürlich nicht. Aber du siehst schon jetzt, wie es losgeht. Wir nehmen es halt hin, dass etwas nicht mehr so ist wie es war. Weil wirs uns nicht mehr leisten können.« Er schluckte. »Und so wird ein Stück nach dem anderen vergammeln und vor die Hunde gehen. Was glaubst du, welche Reparaturen eines Tages noch mit dem Haus auf uns zukommen? Weißt du, was eine Handwerkerstunde kostet?«
Sie erwiderte nichts.
»Wenn du etwas reparieren lässt, sind ruckzuck einige Hunderter weg. Ruckzuck. Was glaubst du, wie schnell unser Vermögen weg ist!« Jetzt war er wieder so weit, dachte Monika. Wie oft hatte er dies schon gesagt? Sie ließ ihn reden, weil sie den Eindruck hatte, dann würde es ihm leichter.
Doch es fiel ihr zunehmend schwerer, ihn zu trösten. Denn was sollte sie schon dagegensetzen? Im Grunde genommen hatte er recht. Sie würden ganz tief fallen.
»Wie ist dir das denn passiert?« Sie versuchte es mit einem Ablenkungsmanöver.
»Beim Wegfahren. An der Ausfahrt aus dem Hof liegen Stämme. Ich hab sie nicht gesehen, ja, einfach nicht gesehen.«
»Und sonst ist aber nichts passiert?«
Er zuckte zusammen und schaute ihr fest in die Augen. »Was soll denn sonst noch passiert sein? Wie kommst du denn da drauf?«
5
Ketschmar verkroch sich in sein winziges Büro, das er sich unter der Dachschräge des Hauses eingerichtet hatte. Er würde Bewerbungen schreiben, hatte er Monika gesagt, die das Nachtessen zubereiten wollte. In Wirklichkeit lehnte er sich in seinem Schreibtischsessel nach hinten und versuchte, durch das Dachfenster in der Schwärze der Nacht etwas zu erkennen. Doch der Hochnebel hatte sich wie ein bleischwerer Deckel auf die Landschaft gelegt. Wie ein Sargdeckel, dachte er trübsinnig. Er wollte einen klaren Gedanken fassen, was ihm aber seit Wochen nicht mehr wirklich gelang. Zunehmend hatte er den Eindruck, alles ginge schief, alles und jeder hätten sich gegen ihn verschworen. Seit er keinen Job mehr hatte, gab es kein einziges Erfolgserlebnis mehr. Sein Magen rebellierte, die Nächte blieben ohne Schlaf. Es fiel ihm auch immer schwerer, sich auf etwas zu konzentrieren. Zum Leidwesen von Monika hatte er viele Einladungen abgesagt, auch bei den besten Freunden. Er mied Veranstaltungen, bei denen Eintritt verlangt wurde. Und auch die Restaurantbesuche, die sie früher so gerne gemocht hatten, waren weniger geworden. Noch hätte dazu kein Grund bestanden. Noch bekam er 60 Prozent seines letzten Nettogehalts.
Und jetzt auch noch das beschädigte Auto. Während der Bildschirmschoner bunte Ornamente zeichnete und kreisen ließ, goss er sich einen Whisky ein, den er in seinem Aktenschrank stehen hatte. Für Fälle wie jetzt. Der Most hatte ihm nicht gut getan. In seinem Magen rumorte und blubberte es.
Er nahm einen großen Schluck und spürte die wohlige Wärme in sich. Ketschmar wusste, dass er mit Alkohol die Probleme zwar kurzfristig bekämpfen konnte, diese dann aber jedes Mal mit neuer Wucht zurückkehrten.
Doch er fühlte sich von Woche zu Woche energieloser, schlapper, nervöser. Einmal bereits hatte er mit dem Gedanken gespielt, sich an eine psychologische Beratungsstelle zu wenden. Dazu jedoch fehlte ihm der Mut, weil man ihn, den weithin bekannten Bauingenieur, sofort erkennen würde. Und das wäre ihm peinlich gewesen. Außerdem müsste er dort wohl sein ganzes Leben, seine Probleme, sozusagen sein Innerstes preisgeben, was ihm nicht gelingen würde.
Nein, er musste da allein durch. Auch wenn es täglich neuen Ärger gab. Wieder kam ihm der Besuch bei diesem jungen Manager heute Nachmittag in den Sinn. Augenblicke später tauchten vor seinem geistigen Auge die Geschehnisse vom Steinberghof auf. So sehr er sich auch bemühte, so einen Tag wie diesen aus seinen Gedanken zu bannen, es gelang ihm nicht. Er sah das Gesicht dieses selbstgefälligen Sachbearbeiters vom Arbeitsamt. Dann schloss er die Augen, aber das nützte auch nichts. Die Bilder ließen sich nicht wegwischen. Sie hatten sich tief in seine Seele eingebrannt. So saß er da, als habe ihn das monotone Gebläse des Computers in eine Art Trance versetzt.
Er wusste nicht, wie lange er die Augen geschlossen hatte. In diesem Zustand zwischen Wachsein und träumen verschwammen die Erlebnisse der vergangenen Tage wie ein Gemälde verlaufender Wasserfarben mit den tausend Wünschen und Hoffnungen für die Zukunft. Als er die Augen wieder öffnete, fiel sein Blick auf die Fachbücher zu Statik und Architektur. Ob er sie jemals wieder brauchen würde? Das große, gerahmte Farbfoto vom Bau einer riesigen Autobahnbrücke weckte Wehmut. Wie waren sie damals stolz gewesen, diesen Auftrag an Land gezogen zu haben! Und der Chef hatte ihn als mustergültigen Mitarbeiter hervorgehoben, der die Bauleitung bei diesem komplizierten Projekt bestens bewältigt habe.
Aus. Vorbei. Nichts davon zählte mehr. Sie wollten junge, billige Kräfte.
Ketschmar spürte wieder Zorn und Hass aufsteigen. Wo waren die anderen Leidensgenossen? Die vielen hunderttausend Arbeitslosen, die bereit wären, wieder einzusteigen, wenn man ihnen nur eine Chance geben würde? Saßen sie alle daheim und haderten mit ihrem Schicksal? Warum, so überlegte er sich immer häufiger, warum gab es niemanden, der etwas organisierte? Gemeinsam wären sie eine unüberhörbare Macht – gegen Wirtschaft und Politik. Sollte er sich in seinem Alter nochmal politisch engagieren?
Doch dann hämmerte es wieder in seinem Kopf: Das kostet Geld. Schau nach dir, lass dir nicht nehmen, was du mühsam erspart und aufgebaut hast. Sie wollen dich in die Armut treiben. Das ist gewollt.
Sein Puls raste. Früher hatte er nie auf seinen Körper gehört. Er hatte von früh bis spät gearbeitet. Da war keine Zeit, krank zu sein. Doch seit er nur noch rumsaß, achtete er auf die Signale seines Körpers. Hier ein Zwicken, da ein Stechen. Der Blutdruck zu hoch, Herzrasen, Schwindelgefühle, Augenflimmern. Nie zuvor hatte er geglaubt, dass sich seelischer Kummer derart auf Organe und körperliches Wohlbefinden auswirken würde.
Nein, so richtig christlich war er nie gewesen. Das hatte ihm der katholische Pfarrer vergällt. Viermal die Woche war er in die Kirche genötigt worden. Dienstags und donnerstags frühmorgens in den Schülergottesdienst, 7.15 Uhr bei Wind und Wetter, bei Schnee und eisiger Kälte. Die Kirche nicht beheizt. Dann sonntagvormittags, 8.45 Uhr. Die eineinhalb Stunden, die die Messe gedauert hatte, kamen ihm wie fünf Stunden vor. Mindestens. Und die Predigt, deren Inhalt er meist nicht verstand, war genauso lang. Meist war er ›ausgestiegen‹, ließ seine Gedanken um die Fernsehshow vom Vorabend kreisen. Peter Frankenfeld oder Lou van Burg hießen die Showmaster, die ihn weitaus mehr faszinierten als das Evangelium nach Lukas oder Johannes. Sonntagabends nochmals Kirche. Andacht. Der Pfarrer führte im Religionsunterricht eine Liste und fragte nach, wer welche der vorgeschriebenen Kirchenbesuche absolviert hatte. Je nachdem, wie oft man verneinen musste, setzte es schmerzhafte Strafen: Haare ziehen für das Fehlen bei der sonntäglichen Abendandacht, zusätzlich mindestens einen Schlag ins Genick für das Schwänzen der Heiligen Messe am Vormittag. Von den wirklich wichtigen Werten der Kirche hatte er eher weniger mitbekommen. Nie hatte er die Erzählungen seiner Mutter vergessen, die unter dem Druck dieses Pfarrers ihren evangelischen Glauben aufgegeben hatte und mit riesigem Aufwand der katholischen Kirche beigetreten war – nur, weil eine Mischehe damals als verwerflich galt.
Als er beim Abfragen der Gottesdienstbesuche einmal ehrlicherweise einräumen musste, dass er nicht am Sonntagsgottesdienst habe teilnehmen können, weil er droben auf der Alb, in Lonsee, bei der Konfirmation seines Cousins gewesen sei, der aus der evangelischen Verwandtschaft der Mutter stamme, geriet der Herr Pfarrer geradezu außer sich vor Empörung. Er zog ihn an den kurzen Haaren des Hinterkopfes und warf ihm vor, den Sonntagvormittag in dieser Lügenkirche verbracht zu haben. Als er dies daheim seiner Mutter erzählte, tat sie etwas, das in dieser Zeit ziemlich mutig war: Sie beschwerte sich bei einem Mitglied des Kirchengemeinderats. So groß musste ihr Zorn über das Verhalten des Pfarrers gewesen sein. Der hatte sich später dann bei ihr entschuldigt.
Warum ihm dies alles gerade jetzt einfiel? Im Grunde seines Herzens wollte er an etwas glauben. An eine große Macht, an etwas, das die Naturgesetze so wunderbar hervorgebracht hatte. Oft hatte er bei komplizierten Berechnungen gestaunt, wie doch alles in mathematische Formeln zu zwängen war. Heute neigte man dazu, Mathematik als den Beweis für die Erklärbarkeit der Welt darzustellen. Dabei ist Mathematik doch nur der Versuch des Menschen, das Universum in Zahlen zu pressen.
Ketschmar, der eigentlich ein schlechter Schüler gewesen war, hatte sich erst viel später mit diesen Dingen befasst. Dass diese Welt aus dem Nichts und durch eine Kette von Zufälligkeiten entstanden sein soll, wie es die Evolutionstheorie behauptet, vermochte er nicht nachzuvollziehen. Obwohl seine Berufswelt aus knallharten Fakten und Berechnungen bestanden hatte, gab es für ihn stets noch eine andere Seite
– die eines Schöpfers. Ob man diesen Gott nennen wollte, blieb dahingestellt. Die Vorstellung, dabei handle es sich um einen alten weisen Mann, der irgendwo im Himmel thronte, entsprach nicht seinem religiösen Denken. Solche Schilderungen waren Bilder, Bilder, wie sie den Menschen vor 2000 Jahren eben geläufig waren. Längst wäre es an der Zeit, diese Bilder zu übersetzen – in eine Bibel für die heutige Vorstellungswelt.
Wie kam er auf solche Gedanken?
Vielleicht, weil er einen Halt suchte. Einen Halt, den ihm niemand geben konnte. Keine Beratungsstelle und auch nicht dieses dusslige Jobcenter, wie sie neuerdings die Vermittlungsstelle beim Arbeitsamt nannten.
Wenn ihm noch jemand Halt gab, dann Monika. Hoffentlich.
6
Er hatte geschwitzt und schlecht geträumt. Von Unfällen, Blechschäden und Toten. Überm rechten Auge spürte er einen Schmerz. Wahrscheinlich würde sich die Migräne wieder bemerkbar machen. Während Monika noch schlief, war er aufgestanden, hatte die Zeitung aus dem Briefkasten geholt und sich den Jogginganzug übergezogen. Beim Blick aus dem Fenster war tristes Novembergrau zu sehen. Der Nebel hüllte die gegenüberliegenden Hänge ein. Ketschmar setzte sich in den großen Ledersessel im Wohnzimmer und blätterte die Tageszeitung durch. Wie immer samstags suchte er die Stellenangebote, doch schienen es auch diesmal nur wenige zu sein. Bereits beim flüchtigen Drüberwegsehen erkannte er, dass nirgendwo das Wort ›Bauingenieur‹ stand. Stattdessen waren ›Controller‹ gefragt, was immer sich dahinter verbergen mochte. Oder Außendienstmitarbeiter. Oft auch Mitarbeiter ›zur Verstärkung unseres jungen Teams‹. Was auch sonst?, dachte er und blätterte weiter.
Er legte den politischen Teil beiseite, weil er den ewigen Zoff um Pöstchen, Macht und Parteien leid war. Welcher Politiker interessierte sich denn wirklich für die Menschen? Diese machtbesessenen Emporkömmlinge in Berlin hatten doch nur ihre eigene Karriere im Sinn. Für sie war die Regierung nichts anderes als eine große Aktiengesellschaft, in der jeder sein eigenes Monopoly spielte, um möglichst rasch ein Hotel in der Parkallee bauen zu können. Im übertragenen Sinne: Um möglichst rasch so viel Geld gescheffelt zu haben, um sich an den Luganer See zurückziehen zu können. Südhang versteht sich.
Im Lokalteil der Zeitung gings um den Kopftuchstreit einer moslemischen Kindergärtnerin. Ihr war von der Gemeindeverwaltung gekündigt worden, weil sie sich geweigert hatte, während der Dienstzeit dieses religiöse Symbol abzunehmen. Jetzt befassten sich Juristen damit. Unglaublich. Prozessieren um jeden Preis. Denn letztlich, da war er überzeugt, gings auch in diesem Fall nicht ums Kopftuch, sondern ums Prinzip. Um zu beweisen, dass man diesen Staat in die Knie zwingen konnte. Die hatten doch alle keine Ahnung, wie es in der freien Wirtschaft zuging. Natürlich konnte man das Arbeitsgericht anrufen, wenn einem etwas nicht passte. Aber den Job war man früher oder später trotzdem los. Nur in den öffentlichen Verwaltungen konnte man es sich erlauben bis aufs Äußerste zu pochen. Was wussten die denn von Arbeitslosigkeit?
Ketschmar wurde mit einem Schlag aus diesen Gedanken gerissen. Als habe ihn etwas elektrisiert. Als sei er von einem Blitz getroffen worden. Er war für einen Augenblick wie gelähmt. Seine Augen hingen an einer Überschrift, die links unten seine Aufmerksamkeit erregte: Toter beim Steinberghof.
Ihm war kalt. Er unterdrückte einen Schüttelfrost. »Auf der Zufahrt zum Steinberghof bei Reichenbach unterm Rechberg wurde gestern am frühen Abend ein 56-Jähri-ger Mann tot aufgefunden«, las er. »Ersten Ermittlungen zufolge ist unklar, ob es sich um einen Verkehrsunfall oder um ein Verbrechen handelt.«
Ketschmar spürte, wie ihm das Blut in den Kopf schoss. Er zitterte.
»Der Tote, der abseits der Zufahrtsstraße im Bereich einer Baustelle lag, war gegen 17.40 Uhr einem Autofahrer aufgefallen, der zum Steinberghof hatte hinauffahren wollen«, hieß es in dem Artikel weiter. Ketschmar las jeden Satz zweimal. 17.40 Uhr. Wann, verdammt nochmal, war er heimgekommen?
»Spuren an der Kleidung und dem Körper des Mannes deuten nach Angaben der Polizei auf eine Gewalteinwirkung hin. Ob dies auf einen Unfall zurückzuführen ist, den ein Unbekannter verursacht hat, oder ob ein Verbrechen vorliegt, wird erst die für heute angeordnete Obduktion ergeben.«
Gewaltverbrechen. Unfall. Unbekannter Täter. In Ketschmars Kopf schmerzte jeder Pulsschlag. Für einen Moment glaubte er, keine Luft mehr zu kriegen. Ein beklemmendes Gefühl in der Brust. Wie von Schraubzwingen.
Vom Schlafzimmer ein Geräusch. Monika. Sie war wach geworden.
Ketschmar erschrak. Sollte er die Zeitung weglegen? Egal, was er jetzt tat, Monika würde ihm anmerken, dass etwas nicht stimmte. Er entschied, sitzen zu bleiben und weiter zu lesen. »… auf eine Gewalteinwirkung hin«, las er noch einmal jene Zeile, die ihn schockiert hatte. Doch es sollte noch viel schlimmer kommen. In der übernächsten Zeile stach ihm der Name ins Gesicht. Der Name des Toten, den die Zeitung veröffentlicht hatte, weil die Polizei wissen wollte, wie der Mann an diesem dunklen Novemberabend in diese verlassene Gegend gekommen war. Ein Auto habe man nicht gefunden – und auch sonst keine Hinweise, wo er sich vor seinem Tod aufgehalten haben könnte. 56-Jährigen Friedbert Grauer aus Göppingen«, las Ketschmar und bemerkte nicht, dass seine Frau inzwischen hinter seinem Sessel stand. Viel zu sehr war er in den Text des Artikels vertieft. Friedbert Grauer, vergewisserte er sich noch einmal und sog den nächsten Satz gierig auf: »Er ist Berater bei der Göppinger Agentur für Arbeit und vermutlich vielen Arbeitssuchenden bekannt.« Er drehte sich erschrocken um. Seine Frau fuhr ihm über das dünne Haar. »Du schwitzt«, sagte sie, »gehts dir nicht gut?«