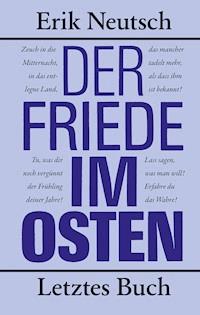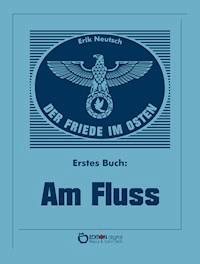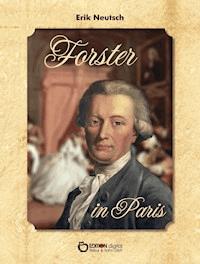Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Eine Reihe von Geschichten um das Chemiekombinat Bitterfeld hat Erik Neutsch in diesem Buch zusammengetragen und später alle in „Heldenberichte“ noch einmal veröffentlich. Es geht um einen Arbeiter, der einen Fernseher hat, aber keine Antenne zu kaufen bekommt, und so zum Dieb wird. Ein junger Arbeiter heiratet eine Frau mit Kind, was damals durchaus nicht normal war. Es geht um das Verhältnis der erfahrenen Praktiker zu den Theoretikern von der Hochschule, um blinden Ehrgeiz, Ehrlichkeit, um die Unterstützung der Arbeiterklasse bei der Kollektivierung der Landwirtschaft, … Neutsch stellt hier sein Erzähltalent unter Beweis. Für alle, die sich für das Berufsleben in der DDR interessieren, eine unerschöpfliche Quelle. LESEPROBE: Beinahe wären die beiden aufeinandergeprallt. Als Greiner um die Mauer bog, die den Park auf der einen Seite von den Hinterhöfen der angrenzenden Mietshäuser trennte, stand das Mädchen vor ihm. Es hielt erschrocken inne und sah dem Arbeiter groß in die Augen. Er merkte, wie es seine Blicke über ihn hinweggleiten ließ. Er fühlte sich gemustert und errötete. Er glaubte nicht anders, als daß die Unbekannte seine Gedanken erriete, als daß sie den Grund seiner Anwesenheit erahnte. Sie lachte. Silbern. Ein wenig zu schrill. Greiner hatte sich das Wiedersehen völlig anders ausgemalt. Er hatte seine Schritte verlangsamen wollen, sobald er sie entdeckte. Ihre Gestalt wollte er abforschen, ihr Gesicht, ihre Haare, ihren Mund... Jetzt verwirrte ihn ihre Nähe, und er senkte den Kopf und eilte von dannen. Als er sich nach ihr umdrehte, fand er sie nicht mehr. Aber er war froh. Er hatte sie wiedergetroffen. Er würde ihr wieder und wieder begegnen, täglich in diesem Park, der noch vor kurzem eine Trümmerstätte zerbombter Häuser gewesen war, den man angelegt hatte, um die Toten zu vergessen, die unter ihm lagen. Das schöne Mädchen hatte ihm zugelacht, seine Stimme klang ihm in den Ohren nach. Sie waren nicht nur aneinander vorbeigelaufen, sie besaßen ab heute eine Gemeinsamkeit. Das halb erschrockene, halb belustigte Lachen der schwarzhaarigen Fremden hatte allein ihrer plötzlichen Begegnung gegolten. Außer ihm hatte es niemand gehört. Oder hatte sie über sein törichtes Benehmen gelacht? Darüber, daß er über und über rot geworden war? Karl Greiner wollte mit sich allein sein. Noch einmal wollte er in Ruhe das Wiedersehen auskosten. Es verlangte ihn nicht, schon die elterliche Wohnung aufzusuchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 476
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Erik Neutsch
Bitterfelder Geschichten
ISBN 978-3-86394-744-6 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1961 im Mitteldeutschen Verlag Halle (Saale).
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Auf Wunsch des Autors wurde nicht auf neue Rechtschreibung umgestellt.
© 2014 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Die Straße
Ich hatte mir in einem Gästehaus der Stadt ein Zimmer besorgen lassen, ein Zimmerchen, eine enge Mansarde, weiß getüncht, die herausragenden Balken des Dachstuhls als Borde eingerichtet, mit einem butzenhaften Fenster, durch das ich auf weiter nichts als auf den mit intimer Wäsche behängten Balkon eines Nachbarhauses blicken durfte, und mit einem bei leisester Berührung knarrenden Stahlrohrbett.
Nachdem ich dieser ständig lamentierenden Pritsche drei Nächte lang meine Hochachtung gezollt hatte, bin ich kurzerhand ausgezogen. Was sollte ich hier... Mich lockte doch nicht die Einsamkeit, mich lockte das pralle, das bunte Leben. Und so quartierte ich mich in einer der Baracken ein, die die Werkleitung für alle diejenigen hatte errichten lassen, die nicht in der Nähe des Kombinats zu Hause sind. Ab heute schlafe ich in einem Raum mit vier Betten, gemeinsam mit drei Arbeitern.
Mit Sack und Pack betrat ich das neue Schlafgemach. An den Händen hingen mir die schweren Koffer, angefüllt mit der Wäsche und der Kleidung für vier Wochen, darin auch ein halbes Dutzend Bücher und Manuskriptpapier. Unter die Arme geklemmt trug ich drei Wolldecken und die dazugehörigen Bezüge, die ich in der Ausgabe des Wohnlagers erhalten hatte. Die Arbeiter blickten kaum auf, als ich in dem Rahmen der Tür stand, sie taten jedenfalls so, musterten mich aber, den Neuling, aus den Augenwinkeln vom Kopf bis zu den Füßen. Das heißt, der eine von ihnen befand sich während meines Einzugs gerade auf Spätschicht, er betrachtete mich erst nachträglich, um so aufmerksamer freilich, denn er glaubte, ich schliefe, als er kurz vor Mitternacht heimkam. Die beiden anderen also belauerten mich geduldig, genossen das Vorrecht der Alteingesessenen, stumm bleiben zu dürfen: Sie hatten schon mehr als nur mich kommen und gehen sehen. Ich war ja derjenige, der zuzog; folglich mußte ich als erster das Wort ergreifen, mich vorstellen, sagen, daß ich in ihre Gemeinschaft aufgenommen werden wollte.
Nun gut! Wenn euch durchaus an eurem Privileg gelegen ist, ich will es euch nicht streitig machen. Ich grüßte und nannte meinen Namen. Ich sagte, daß mich die Partei hierhergeschickt habe, damit ich für einen Monat in einer Fabrik körperlich arbeite, von den Menschen lerne und ihnen helfe.
Der eine der beiden hockte am Tisch, er schnitt mit einem schartigen Dolch Scheiben von einem halben Laib Brot, schmierte die Butter fingerdick, biß ab und befreite eine Bratwurst von ihrer zähen Pelle. Er kaute mit vollen Backen, klopfte mit dem Horngriff des Messers auf die Holzplatte und knurrte etwas vor sich hin. Mit seinen harten, stahlblauen Augen sah er mich entschuldigend an: Du siehst doch, ich hab einen vollen Mund. Der andere lag in einem Trainingsanzug auf seinem Bett, stützte sein schmales, doch rundes Kinn auf den Handteller und las in einem Buch, Jorge Amado, wie ich erkannte. Auch er erwiderte meinen Gruß, schaute aber erst gar nicht von seiner Lektüre auf, was andererseits bedeutete: Verzeih, ich bin gerade an einer spannenden Stelle.
Ärgerlich packte ich meine Koffer aus, schichtete die Sachen säuberlich im Spind übereinander und begann, mein Bett zu bauen. »Ihr seid aber gar nicht lustig«, erklärte ich, sprach’s mehr für mich, gegen die Wand.
Da knarrte in meinem Rücken eine Matratze. Ich fühlte einen dumpfen Schlag gegen meinen Nacken. Ich drehte mich um, die Leseratte hatte mit dem Kopfkissen nach mir geworfen. Wenigstens ein Lebenszeichen meiner stummen Brüder, dachte ich. Ich nahm das Kissen und schmiß es zurück, mein frischbezogenes Bettzeug gleich hinterher, mit doppelter Munition sozusagen. Mein Freund am Tisch ging in volle Deckung, denn der Bursche auf dem Bett zielte schon wieder nach mir. Als die Geschosse kamen, fing ich sie auf und schleuderte sie erneut durch das Zimmer. Hin und her wogte die Kissenschlacht, bis eins der weißen Laken auf ein Glas mit Marmelade fiel und es zu Boden riß. Dort zerschellte der Behälter, die Konfitüre lief aus und besudelte das Linnen mit roten Flecken. Es war meine erst empfangene Kopfkissenhülle. Am nächsten Tag lieferte ich sie in der Verwaltung ab, beteuernd, ich hätte über Nacht plötzlich Nasenbluten gekriegt. Die Frau hatte Humor und antwortete: In Ihrer Nase wachsen wohl Himbeeren, junger Mann ..
Jedenfalls hatten wir unseren Spaß gehabt. Und wir hatten uns angefreundet. Die Leseratte lachte aus vollem Halse. Der Eßwütige lachte ebenfalls, verschluckte sich aber an den Brotkrümeln und hustete.
Und nun erfuhr ich auch, wer meine Zimmergefährten sind. Der eine, der mit dem Buch, heißt Herbert Lester. Er stammt aus dem südlichen Eichsfeld, ist vierundzwanzig Jahre alt und arbeitet jetzt im Chlorbetrieb des Kombinats als Reparaturschlosser. Er hat sich hier anheuern lassen, wie er sich seemännisch ausdrückte, da er bis vor kurzem noch bei den Seestreitkräften diente, weil ihn der hohe Lohn im Chemiepott reizt. Der andere nennt sich Achim Czillat. Nach dem Abitur trat er der Nationalen Volksarmee bei und bekleidet jetzt den Rang eines Leutnants. Er ist ein Jahr älter als Lester. Er befindet sich wie ich für einige Monate im körperlichen Einsatz im Chlor. Der dritte, der nicht anwesend war, ist Schlosser und montiert augenblicklich die neuen Elektrolysebäder. So waren wir nun alle gemeinsam Angehörige derselben Fabrik, in der Chlor produziert wird, Natronlauge und Wasserstoff und die nur ein winziger Teil in dem riesigen Chemiekombinat ist, das am Rande einer Stadt im Mitteldeutschen liegt.
Hier also habe ich begonnen, meine Geschichten aufzuschreiben, in Gesellschaft meiner Freunde. Das Fenster ist weit geöffnet, in seinen Scheiben spiegelt sich orange die sinkende Aprilsonne. Der herbe und würzige Duft umgepflügter Erde steigt herein, manchmal vermischt freilich mit dem Geruch nach Schwefel, wenn der laue Wind ihn vom Werk herübertreibt.
Vor meinen Augen schlängelt sich ein Pfad durch die grünen, sprießenden Saathalme eines Ackers. Die Barackenbewohner haben ihn ausgetreten, sie benutzen ihn, den weiten Bogen der gepflasterten Straße meidend, wenn sie abends in die Stadt einkehren, deren Häuser sich jetzt grau und schattig, als läge über ihnen schon die Dämmerung, gegen den leuchtenden Himmel abheben. Der getrampelte Feldweg steuert schnurstracks auf die Eisenbahnüberführung zu, die den Stadtkern mit dem Kombinat verbindet. Vom höchsten Punkt dieser Brücke aus erhält man eine weitläufige Aussicht auf die Fabrik und das Land ringsum. Linkerhand paffen die Schornsteine des Kraftwerkes schwarze Qualmwolken gegen das Abendrot. Ganz in der Nähe sieht man die Führerkabine des Kranes auf den Schienen über dem Salzlager des Chlorbetriebes hin und her gleiten. Rechterhand erhebt sich behäbig breit das Kulturhaus der Chemiearbeiter, ein Theaterbau mit allem Komfort. Fern stehen am Horizont die langen Schlotzeilen und die Destillierkolonnen der benachbarten Chemiebetriebe, schwelen die Trockner der Brikettfabriken, ragen die Eisengestänge der Absetzer auf den Kippen der Braunkohlengruben. Vor allem nachts ist der Anblick von dieser Brücke aus überwältigend. Endlos scheint das Meer der Lichter, das von den tausend Signallampen an den Gleisen bis weit zu den roten fünfzackigen Sternen reicht, die in der Finsternis von allen Werken leuchten. Wie oft habe ich hier gestanden, habe mich über die Brüstung gelehnt und das Panorama pulsender Industrie, die vielleicht fünfzig-, sechzig-, was weiß ich, vielleicht achtzigtausend Menschen und mehr beschäftigt, in mich hineingesaugt. Und wie oft werde ich hier noch stehen und hinabblicken auf die bewegte Straße und mich selbst einreihen in die lange Kolonne, die in das Werk strömt.
Die bewegte Straße — sie verbindet die beiden Städte, beginnt bei der Eisenbahnbrücke hier und endet weit hinten, nach zehn Kilometern vielleicht, an den Toren der Fabriken. Und sie verbindet uns alle, an jedem Morgen, an jedem Abend, immer und immer wieder, wenn wir gemeinsam auf ihr entlangschreiten. Es ist eine neue Straße, nicht nur wegen des Asphalts, der vor wenigen Jahren erst neu gegossen wurde, nicht nur wegen der Breite, die ihr vor wenigen Jahren erst neu angemessen wurde. Neu ist die Straße, weil man sie gern geht, weil sich auf ihr niemand mehr einsam zu fühlen braucht, denn sie trägt so viele, die den gleichen Weg haben.
Wir drei, Lester, Czillat und ich, verlassen die Baracke. Wir stapfen noch schlaftrunken an dem Pförtnerhäuschen vorbei, dessen Fenster mit Briefen und Karten von der letzten Post dicht bespickt sind. Wir grüßen mit rauher Kehle die Reinemachefrauen, den schnauzbärtigen Alten in der Bude: Morgen, Morgen. Die Sonne wirft lange Schatten, sie wühlt sich aus dem Dunst hervor, den der Frühnebel und der Rauch der Fabrikessen über die Erde breiten. Die Luft ist kühl, sie strafft die Haut der Wangen und der Finger und rötet sie. Lester treibt uns mit schnellen Schritten, er hat den Jackenkragen hochgeschlagen, einen Campingbeutel über die Schulter geworfen, die Hände tief in den Hosen vergraben. Czillat steckt in seiner Leutnantsuniform. Er hat seine Aktentasche mit einem Gurt am Koppel befestigt, sie baumelt ihm in die Kniekehlen, seine Stiefelabsätze hacken das Pflaster. Hinter uns, vor uns gehen andere Arbeiter, einzeln und in Gruppen, schweigend, ohne Frage, ohne Antwort. Dort ein Gesicht und dort eins: Irgendwo habe ich dich schon einmal gesehen. Natürlich, wir kennen uns alle, auch wenn wir uns zuvor noch nie begegnet sind...
Wir gelangen auf die Straße, vor einem halben Jahrhundert vielleicht noch eine wirkliche Landstraße, bepflanzt damals mit Birnbäumen und Birken. Heute begrenzt von den Umzäunungen der Werke, von Planken aus brüchigem Holz, von Backsteinmauern, kaum ein Fleckchen Feld dazwischen. Die Spatzen schilpen im Staub der Gosse, was suchen sie, Pferdemist finden sie nicht. Dort hinten, in unserem Rücken, die schwarze Wand der Filmfabriken, schon im Weichbild einer anderen Stadt. Dann das zerklüftete Gelände, die ausgebaggerten Gruben, die Betonfundamente, künftige Produktionsstätte für den Zauberstoff Polyvinylchlorid, dem mindestens so viel Legenden über seine Wundereigenschaften vorausgehen, wie dem Porzellan nachgegangen sind. Ganz nahe die nördlichen Werkgebäude des Kombinats, das niedrige, mit Efeu berankte Haus des Edelsteinbetriebes, dahinter die klobige Halle mit den Aluminiumöfen. Und auf dem breiten asphaltierten Band der Straße, das all diese Werke aufeinanderreiht, wimmelt es von den Frauen und Männern, die zur Arbeit eilen.
Wir aus den Baracken müssen die Fahrbahn überqueren, den Omnibussen des Berufsverkehrs ausweichen, die auf ihren Federungen auf und nieder wippen und fast lautlos herangleiten. Wir müssen warten, bis wir eine Lücke in der Kette finden, die sich Rad an Rad, wie Glied an Glied, auf dem Radfahrweg entlangzieht, und hindurchschlüpfen können. Dann erst schluckt uns der Strom der Fußgänger auf, der aus den umliegenden Siedlungen und Wohnblocks quillt, auf der Straße anschwillt und mächtig ansteigt, wenn sich in ihn die Fracht ergießt, die der Bahnhof ausstößt. Mittendrin lacht der geschminkte Mund eines Mädchens, hinter der Scheibe eines der Omnibusse vielleicht, winkt eine Hand uns zu, drückt sich ein Näschen am Fenster noch platt, wenn der Bus längst vorübergerollt ist. Lester winkt zurück, erinnert sich an das lachende Antlitz, gestern abend in einer der Gaststätten der Stadt hat er das Mädchen zwei-, dreimal zum Tanz aufgefordert. Ein schrilles, ungezogen plärrendes Klingeln, dicht neben unseren Ohren hinter den hochgestellten Kragen, ein ulkender Zuruf, ein Schlag auf die Schulter Czillats. Schon ist er vorbei, der Radfahrer in der Lederjoppe, blickt sich kurz noch einmal um und grient. Der Leutnant erkennt ihn, droht scherzend mit der Faust. Das war doch einer aus dem Chlorbetrieb, ich werd’s ihm geben, nachher, in der Waschkaue. Und dort vor uns, der mit dem breiten Kreuz und dem schwankenden Gang, die Stirn tief unter der Schirmmütze verborgen, die Augen buschig und immer ernst, als ob sie fortwährend nachsännen, ist das nicht ein bekanntes Gesicht? Ach richtig, es klebt in Überlebensgroße auf den Aufstellern im Werk: Held der Arbeit...
Wieviel Menschen auf dieser Straße? Ich weiß es nicht. Zehntausende! Der Menschenstrom brandet gegen die aufgesperrten Tore der Werke. Dort schieben sich zu beiden Seiten die Fußgänger durch die Eingänge, dort stauen sich auf dem Fahrdamm die Motorräder und die Fahrräder, dort entleeren sich an den Haltestellen die Omnibusse. Wir lassen uns in dem Gewühl vorantreiben.
Wir drängen uns durch die Pforte, zücken unsere Ausweise, zeigen sie den Wachmännern, drücken unsere Kontrollkarten in die Stechuhr, schauen auf das Zifferblatt, um zu sehen, ob wir noch Weile haben oder ob wir uns beeilen müssen. Und da erstreckt sich vor uns der Bau der Elektrolysehalle mit seinem Sheddach. Wir erblicken durch die offenen Türen die flimmernde Luft über den Bädern. Wir werden den Schweiß wieder fühlen am Körper, das Gesumm der Quecksilberpumpen in den Ohren rauschen hören, den Gasgeruch auf der Zunge schmecken, und wir werden einer den anderen wiedersehen, wie gestern, wir Freunde, auf der bewegten Straße unserer gemeinsamen Arbeit.
Der Dieb
Sechs Tage erst, eine magere, hohlwangige Woche war der Vertrag alt, in dem sich die Arbeiter des Chlorbetriebes in vielerlei Hinsicht verpflichteten, sozialistisch zu leben, da hatte die Brigade bereits ihr Problem: Das Problem war von weißblonden Haaren, die wie Nadeln auf einem Steckkissen vom Kopfe abstanden, hatte ein breitknochiges Gesicht mit blaßblauen munteren Augen und eine Nase voller Sommersprossen, so dicht wie auf einem Rebhuhnei. Zweiundzwanzig Jahre zählte das Problem, spielte Fußball in der Reserve der Ligamannschaft, arbeitete in einer Reparaturkolonne an den Elektrolysebädern und hieß Ulli Mohring.
Donnerstag waren die Verpflichtungen von allen Brigademitgliedern unterschrieben worden, am Mittwoch darauf erschien der Staatsanwalt im Werk. Die Tagschichter waren eine Stunde früher zum Duschen gegangen, sie hatten schneller als sonst das schwärzlichgrüne Öl und den beißenden Schweiß von ihren Körpern gespült, sahen nun aus wie frisch gehäutet und waren in den Speisesaal geeilt, wo die öffentliche Sitzung der Konfliktkommission stattfand.
Als das Geschurr der vielen Stuhlbeine auf den rotbraunen Fliesen, deren Kühle angenehm in die Hosenbeine kroch, zur Ruhe kam und erwartungsvolles Räuspern den Saal erfüllte, ließ sich der Staatsanwalt das Wort erteilen. Mit den Knöcheln seiner Finger, die unter der gestrafften Haut weißlich schimmerten, hämmerte er die Satzzeichen seiner weitschweifigen Rede auf die Tischplatte.
Nach einer Viertelstunde wurde er plötzlich unterbrochen. Jemand rief ungeduldig dazwischen: »Auf gut deutsch: Ulli Mohring hat geklaut.«
Ich saß in einer der vordersten Stuhlreihen und konnte einen jeden einzelnen vor mir beobachten. Der Vorsitzende der Konfliktkommission erhob sich hinter dem roten Fahnentuch, mit dem die Präsidiumstafel behängt war, drückte bedächtig seine Zigarette im Aschenbecher aus und grollte dumpf besänftigend: »Aber Kollegen, laßt mal das Rumoren sein. Das ist eine ernste politische Frage hier. Nachher könnt ihr diskutieren, wie euch der Schnabel gewachsen ist.«
Krachend setzte er sich. Der Staatsanwalt sprach weiter, nach wie vor ein wenig zu langatmig. Er hatte sich noch nicht daran gewöhnt, mit Arbeitern über ein Delikt zu beraten. Er tat es das zweite oder dritte Mal und fühlte sich deshalb unsicher. Er flüchtete sich in seine ermüdende Gründlichkeit, hackte bedachtsam mit den Fingern das Holz und hoffte so, seinem Auftrag am besten gerecht zu werden.
Mohring kauerte allein an einem Tisch, der provisorischen Anklagebank sozusagen. Während der Darlegungen des Staatsanwaltes hatte er unentwegt aus dem Fenster geblickt. Schämte er sich, oder stellte er sich gelangweilt, als ob ihn die Sache nichts anginge? Als der Zwischenruf, peitschend wie ein Stockschlag, in den Redeschwall des Staatsanwaltes fiel, zuckte er zusammen. Er suchte hastig und verwirrt die Gesichter der Arbeiter ab, um herauszufinden, wer geschrien hatte, vergrub aber schnell wieder seine Blicke in den Wolkenballen, die sich verschwiegen hinter den Scheiben auftürmten.
Mochte er nun den Gleichgültigen spielen oder sich niedergeschlagen und zerknirscht fühlen, ich kannte an ihm weder die eine noch die andere Regung. Ulli war stets lustig und vergnügt gewesen. Im hartnäckigsten Arbeitstrubel verließ ihn nicht seine Fröhlichkeit, sie lag auf seinem Gesicht wie der ewig rosige Schimmer seiner Haut, die der von reifen Glaskirschen ähnelte. Manchmal geschah es doch in der Elektrolyse, daß ein Zellendeckel porös war, nachdem man ihn eben erst frisch bekohlt hatte. Dann lagen die Dichtungsringe an den Anodennippeln nicht gepreßt genug aufeinander. Wir standen um das Bad und warteten. Einer machte die Probe, indem er mit der in Salmiak getränkten Wolle nacheinander die Verschlüsse betupfte. Überall, wo das Chlorgas durchsickerte, quiemten weiße Rauchschlangen auf. Der Gestank breitete sich aus und biß in die Lungen; jeder hustete. Ulli aber sagte lachend: »Was wollt ihr! Eche, eche ... Geht zu Muttern an den Kochtopf! Eche, eche... Aber nicht in die Chemie! Eche, eche ... Das bißchen Chlor! Eche, eche... Mir macht’s nichts, ich kann noch pfeifen.« Und schon trällerte er einen Schlager in unsere Flüche.
Ulli Mohring arbeitete flott und gewissenhaft. Wenn er die Schrauben an den heißen Zellenschaltern festzog, wirbelte er die Schlüssel herum, als wären sie an seinen Armen festgewachsen. Die Hitze schien ihn kaum zu stören, er schnaufte nur hin und wieder über die Lippen weg, pustete die Schweißtropfen fort, die an seiner besprenkelten Nase hingen. Er kam aus der Braunkohle, er hatte jahrelang an den Brikettpressen gestanden. »Das hier ist eine Sommerfrische gegen die Höllenglut da«, sagte er. »Wenn du da die Zentner hochstemmst, hast du keine Hand frei, dir die Brühe von der Gurke zu wischen. Läßt es laufen und denkst, es regnet.« Als mich der Meister am ersten Tag meines körperlichen Einsatzes in die Kolonne einwies, der auch Mohring angehörte, stellte er ihn mir mit den Worten vor: »Unser Fußballer, unbedingt ligareif. Schon weil er die Seifert-Methode bei uns eingeführt hat.«
Kurz darauf, wir hockten beim Mittagessen nebeneinander, fragte ich ihn: »Sag mal, Ulli, du hast die Seifert-Methode im Chlorbetrieb eingeführt?«
Er hielt das Kotelett zwischen Daumen und Zeigefinger und nagte schmatzend das Fleisch von der Rippe. »Stimmt nicht«, antwortete er, »mußt dem Alten nicht alles glauben.« Andächtig kaute er weiter.
»Na, na«, knurrte uns gegenüber Walter Wildgrube, ein untersetzter, kahlköpfiger Arbeiter aus der Nachbarkolonne, der seit einiger Zeit, seitdem die fünfzig neuen Quecksilberzellen eingebaut waren, so etwas wie unser zweiter Anlagefahrer war. Wildgrube hatte sieben Kinder zu Haus, das älteste, ein fülliges blondhaariges Mädchen, heiratsfähig, das jüngste ein Nachkömmling, noch im Kinderwagen. An ihn wandten sich oftmals die Chlorarbeiter, wenn sie Rat brauchten, Rat in kleinen häuslichen Dingen, Rat aber auch manchmal in seelischen Konflikten. Dieser fragte Wildgrube, ob er ihm nicht eine Rasse Fleischhühner empfehlen könnte, die gleichzeitig legefreudig sei. Wildgrube nannte ihm die ockergelben Orpington: »Jeden zweiten Tag ein Ei und gut sechs Pfund schwer.« Ein anderer kam und wollte wissen, was er mit seinem Sohn beginnen solle, dessen Versetzung in der Schule gefährdet sei: »Du hast doch sieben Kinder, Walter, was meinst du?« Wildgrube verwies ihn an den Lehrer. »Mit ihm mußt du reden. Ihr beide müßt euch einig sein. Sonst reißt einer wieder ein, was der andere aufbaut. Dein Junge muß vor allem spüren, daß er in einer Gemeinschaft lebt, in der alle an einem Strang ziehen.«
Jetzt hängte Walter Wildgrube seine knollige Nase über einen Bogen Pergamentpapier, in den er raschelnd die Knochenreste der Mahlzeit einwickelte, die ihm von allen Seiten gereicht wurden und die er für seinen Schäferhund sammelte, den er sich daheim hielt. Ich wußte nicht, wem Wildgrubes Gebrumm gegolten hatte, der Antwort Mohrings oder dem Berg Futter, der so rasch anwuchs, daß ihn seine schrundigen Hände kaum mehr zu halten vermochten. Ich sah zu ihm hinüber, er blinzelte mir aufmunternd zu.
Nach einer Weile strich sich Mohring mit dem Handrücken das Fett von den Lippen. Er warf den abgeknabberten Knochen zu den anderen und forschte: »Willst wohl einen Artikel machen, du Zeitungsmensch, was?«
»Keine Bange«, beruhigte ich ihn, »bin von Natur aus neugierig.«
»Wenn du’s unbedingt wissen willst«, fuhr er fort, »wir haben alle drei angefangen, die ganze Kolonne. Seifert-Methode einzeln geht nämlich bei uns nicht. Einer ist doch auf den anderen angewiesen.«
»Na gut«, sagte ich, froh, daß Mohring auf einen Schwatz einging, »einer muß doch aber der treibende Keil gewesen sein?«
»War ich auch nicht«, erklärte er, »bin nur der gewesen, der die Wartezeiten und die Reparaturzeiten getrennt auf einen Zettel geschrieben hat.«
»Die anderen beiden haben dich dazu bestimmt. Oder wie?« ließ ich nicht locker.
»Du traktierst mich ganz schön«, lachte er und richtete seine wasserklaren, durchsichtigen Augen auf mich. »Aber ich sag nichts weiter.«
»Die Sache war nämlich so«, mischte sich Walter Wildgrube ein. Klickend drückte er die Schlösser an seiner Aktentasche zu, in die er soeben die Speisereste verstaut hatte. »So war die Sache nämlich. Die beiden Knacker in seiner Kolonne wollten nicht ’ran, an die neue Methode. Ulli will mit der Sprache nicht ’raus, mußt du verstehen, weil er denkt, sie könnten’s ihm verübeln. Immer, wenn was Neues kommt, sind sie bei uns vorsichtig. Sie drehen das Ding nach links und nach rechts, beschnuppern es von hinten und von vorn, wie ’n Rüde die Hündin. Bei dem Alten, da weiß man, was man hat, sagen sie, aber bei dem Neuen, da kann man vorher nie wissen... So ist das bei uns. Die Menschen denken oft noch wie vor zwanzig Jahren. Damals, in dem Betrieb hier, wurde auch immer so vieles als ganz neu angepriesen. Fiel man darauf ’rein, war es stets das Alte, nur schlechter noch. Für den Arbeiter schlechter. Daran denken sie. Als nun die Gewerkschaft kam, meinte der eine aus Ullis Kolonne: Seifert, das ist zum Einseifen, wir lassen uns nicht halbieren. Als die Gewerkschaft ein zweites und drittes Mal kam, meinte der andere: Natürlich sind wir für Seifert, aber laßt uns mit dem Papierkram in Ruhe.«
»Und deine Meinung, wie war die?« wandte ich mich an Mohring.
»Ehrlich, ich war weder dafür noch dagegen«, entgegnete er. »Aber wie sich die beiden mit den Ausreden abstrampelten, das gefiel mir nicht.«
»Ist doch klar«, griente Wildgrube und bleckte seine schwarz gerauchten Zähne, »sie wollten die Seifert-Methode nicht und schoben die Schreiberei vor.«
»Das kam mir vor wie beim Fußball, weißt du«, sagte Mohring. »Deine Mannschaft kriegt einen Elfmeter, aber keiner will ihn schießen. Weil jeder Angst hat, er könnte den Ball am Tor vorbeiknallen und dafür ausgepfiffen werden. Und da sagte ich: >Wenn ihr nicht schreiben wollt, schreibe ich. Daran soll’s nicht hapern.< Denn wenn du bei der Seifert-Methode nicht genau die Verlustzeiten von den produktiven Zeiten trennst, ist sie für die Katz.«
»Hast also doch angefangen«, rief Wildgrube und schlug Mohring kameradschaftlich auf die Schulter.
»Schreib das aber nicht in die Zeitung«, protestierte Ulli.
Näher lernte ich Mohring jedoch erst kennen, als wir beide einmal nach Feierabend in den Kulturpalast gingen. Das war, als die letzten Etappen der Friedensfahrt getreten wurden und sich die Gespräche während jeder Arbeitspause im Chlorbetrieb um die Spurts von Venturelli, Vanderveken und Adler und um die Blauen Trikots der sowjetischen Mannschaft und das Gelbe Täve Schurs drehten. Da wurde heftig darum gestritten, wer wohl die kräftigeren Muskeln an den Beinen habe, die Belgier oder die Deutschen.
Mohring begeisterte sich als Sportler natürlich auch für die Kämpfe auf den Landstraßen. Er wollte sich den Fernsehbericht von einer der letzten Etappen beschauen und bat mich, ihm Gesellschaft zu leisten. Wir gingen frühzeitig zum Kulturhaus, um einen guten Platz zu erhalten, denn der Raum, in dem der Apparat stand, war Nachmittag für Nachmittag dicht bevölkert.
Unterwegs, als wir an einem winzigen Krämerladen vorbeikamen, in dem auch Bier verkauft wurde, sagte Mohring: »Meine Frau wird denken, ich bin versackt.«
Er deutete mit einem Kopfnicken auf einige Arbeiter, die auf dem abgewetzten Steintritt vor der Budike saßen oder am Zaun des Vorgartens lehnten, mit Flaschen in den Händen.
»Was«, wunderte ich mich, »du bist verheiratet?«
Er kicherte. »Traust du mir nicht zu. he? Vater werde ich auch bald. Ein strammer Mittelverteidiger wird’s. Sie ist im siebten Monat.«
Wir bogen von der Straße ab und schritten durch die Grünanlagen, die die breite Auffahrt zum Kulturhaus säumten. Die Erde duftete süß und würzig nach modrigem Laub. An den dunklen Buchsbaumhecken platzten zartgrün frische Knospen auf.
»Ihre Eltern waren dagegen, gegen unsere Hochzeit«, plauderte Mohring weiter. »Ihr Alter legt Gleise in der Kohle. Aber er wollte, daß es dem Mädchen mal besser geht. Wer weiß, an wen er sie verkuppelt hätte. An so einen geschniegelten Bürohengst vielleicht. Dafür war sie sich zu schade. Und da haben wir uns ins Gras gelegt und einfach ein Kind gemacht. Erst hat der Alte sie durchgeprügelt, dann hat er uns doch seinen Segen gegeben. Ich werd’s ihm zeigen, was seine Tochter an mir hat. Ich arbeite nach Feierabend auf dem Bau. Wir werden uns eine Wohnung einrichten, sag ich dir, tipptopp.« Er schnalzte mit der Zunge.
Ich empfand Zuneigung zu Mohrings unkomplizierter, freilich ein wenig roher, aber aufrichtiger Art. Wenn er so dachte, wie er erzählte, mußte sein Wesen klar und durchsichtig sein wie seine blaßblauen Augen. Da hatten sich die beiden Liebenden ohne Umschweife einander hingegeben, um den spießbürgerlich fürsorglichen Nachstellungen ihrer Eltern zu entgehen. Ich musterte Mohring unbemerkt mit einem Seitenblick. Die weißblonden, widerspenstigen Borsten über der rosigen Stirn verliehen ihm etwas jungenhaft Unbekümmertes. Nein, diese Sachlichkeit, sich eine Frau zu nehmen, hatte ich ihm nicht zugetraut.
Als wir uns vor dem flackernden Bildschirm niedergelassen hatten, fuhr er fort: »Solch ein Weib wie meins, sag ich dir, findest du so leicht nicht wieder. Wirtschaften kann’s und Arme hat’s, für die Arbeit wie geschaffen. Einen Fernsehapparat kaufen wir uns auch bald. Ich bin schon lange angemeldet, bei der Gewerkschaft. Bis die Spiele um den Europapokal beginnen, will ich ihn haben. Vor allem für den Sport brauche ich ihn, weißt du. Und wenn meine Frau dann in die Wochen kommt und Urlaub macht, hat sie immer was zum Gucken. Der ihre Alten sollen vor Staunen die Maulsperre kriegen...«
Auf dem Bildschirm verschwand das Gitter. Die Sendung wurde angekündigt. Ulli folgte gebannt dem Film.
Ein Tag nach dem anderen verging, blätterte ab wie die ersten Blüten im Wind. Die beiden für Ulli Mohring so wichtigen Ereignisse rückten immer näher, der Fußballkampf zwischen der Nationalmannschaft der DDR und Portugal und die Geburt seines Sohnes (daß er eine Tochter gezeugt haben könnte, daran dachte er nicht einmal). Aber mit dem Fernsehapparat, den Ulli sich kaufen wollte, hatte es seine Tücken. Kaum hatte er einmal Muße, seinen Blick von der Zelle zu heben, schimpfte er uns die Ohren voll: »Ist das nicht eine Schweinerei? Den Kasten kann ich mir jederzeit abholen, denkt euch. Brauche nur die Scheine vorzuzählen. Aber meint ihr, ich kriege Aluminiumstäbe für die Antenne? Keine Spur! Wißt ihr nicht, wo man solche paar lumpigen Dinger auftreiben kann?«
Wir wußten es nicht. Er schleppte das Gerät nach Hause und gab ihm einen Ehrenplatz in der Wohnstube. In den Sportjournalen wurden die Leistungen der Auswahlspieler eingeschätzt. Ullis Frau horchte immer öfter auf das Klopfen in ihrem aufgewölbten Leib. Die Schwiegermutter murrte, sie ließ sich ihren mehrmals angekündigten Besuch nicht mehr länger hinauströsten. Das viereckige Zyklopenauge des Apparates jedoch glotzte blind aus der Nische zwischen Couch und Vertiko hervor.
Jeden Tag sprach Mohring im Magazin des Werkes vor und erkundigte sich nach Aluminiumstangen. Sie lachten schon, wenn sie sein rothäutiges Gesicht auftauchen sahen, das der Ärger nun weitaus dunkler als glaskirschenfarben getönt hatte. »Habt ihr...?« fragte er, den Kopf noch im Türspalt. »Zum Teufel mit dir Quengelgeist, wir haben nicht«, antworteten sie. »Mit eurer Schlamperei könnt ihr einem die ganze Freude verderben«, zürnte er und fuhr sich wütend durch seine Haarstacheln. »Geduld, mein Lieber. Hast so lange auf den Guckkasten gewartet, kannst du auch noch die Antenne abwarten.« — »Ich hab das Warten satt.« Knallte die Tür zu.
Eines Morgens fanden wir uns wie üblich an den Werkzeugspinden in der Elektrolyse ein, ein jeder die Schläfrigkeit der Nacht mit dampfenden Zigaretten aus den Gliedern räuchernd. Der Anlagefahrer Walter Wildgrube verteilte die Arbeit, er beauftragte unsere Kolonne, zwei Tonnen Quecksilber zu laden. Wir holten die dunkelgrünen, mit chinesischen Schriftzeichen bemalten Flaschen, deren jede siebzig Pfund wog, mit einem Lastwagen von außerhalb des Kombinats und schafften sie zum Lager des Chlorbetriebes. Oben wälzten wir die zylindrischen Behälter mit ihrem schweren Inhalt auf die eiserne Plattform des Aufzuges, im Keller nahm sie Mohring in Empfang und stapelte sie übereinander.
Während wir uns auf der Rampe wieder mit den Quecksilberkanistern herumplagten, konnte Mohring unten Atem schöpfen und von der Plackerei seinerseits verschnaufen. So stöberte er ein wenig in den Winkeln des Lagers umher und entdeckte zwischen Ölfässern, aufgefädelten Hartgummiringen und verstaubten Wergballen ein Bündel mannshoher, fingerdicker Kupferrohre.
Nebenhin fragte Ulli den Anlagefahrer, als wir uns wieder in der Elektrolyse meldeten: »Sag, Walter, wozu brauchen wir die Kupferstangen im Keller?«
»Keine Ahnung«, erwiderte Wildgrube, »die liegen schon Jahre dort. Das ist eine Fehllieferung. Wir müßten sie mal wieder ins Magazin zurückschaffen.«
Seitdem war es Mohring, als läge das kupferne Bündel quer in seinem Kopf. Bei jedem Schritt, den sein Denken tat, stolperte es über die Rohre. Keine Menschenseele kümmert sich um das Metall da unten. Es setzt schon Grünspan an und wird noch ganz verlottern. Ein Irrtum, sagte Wildgrube, hat das Kupfer in das Lager des Chlorbetriebes verschlagen. Wenn ich ihn nicht daran erinnert hätte, hätte auch er es vergessen. Unsereins aber rennt sich die Hacken wund nach Aluminiumstangen. Zu Hause knackert und flackert der Fernsehapparat, wenn man ihn sehnsüchtig andreht. Es geschieht kein Wunder mit ihm. Die Antenne fehlt, weil die Magaziner kein Material haben. So sind sie: In einer Ecke lassen sie es lieber von den Asseln bepissen. Wenn ich nur vier oder fünf Stäbe aus dem Bündel nehme und sie zurechtschneide, kein Hahn wird danach krähen. Oder soll ich doch besser zu den Ausgebern sagen: Ich wüßte schon, wo was für die Antenne liegt? Doch dann werden sie antworten: Wo denkst du hin, Kollege, brauchen wir für dies oder das! Eine lange Nase werden sie mir machen.
Ulli Mohring dachte an Gerda, seine Frau. Sie hatte Arme und Hüften, breit und wohlig wie ein Bett. Kam er abends vom Bau, nachdem er seine Aufbaustunden abgeschuftet hatte, saß sie noch immer wach und wartete auf ihn. Ihre Bluse straffte sich unter der Last der schweren, prallen Brüste. Ihr Gesicht war blaß, und ihre Augen waren umschattet, doch sie gönnte sich keine Ruhe den Urlaub über. Sie häkelte und strickte weißwollene Jäckchen und Hemden, zierlich wie Puppenkleider, und legte die Hände erst müde über den Schoß, wenn sie Ulli die Treppe aufsteigen hörte. Woher weiß sie nur, wunderte sich Ulli, wie winzig so ein Babyärmchen sein muß? Er goß sich den dampfenden Kaffee ein, den sie für ihn gekocht hatte. Und wenn er ihn mit spitzen Lippen schlürfte, deutete sie auf ihren Leib und erzählte ihm von dem Leben darin. Nein, solch ein Weib wie die Gerda würde er nicht wieder finden, so mutig, wie sie der Niederkunft entgegensah. Sollte er ihr nicht eine Freude bereiten mit den Fernsehsendungen? Die Schwiegermutter sollte ihn nur besuchen, sobald er die Antenne aufgesteckt hatte. Er würde sich hinter ihr auf einen Stuhl setzen und sich heimlich eins kichern, wenn sie sich den Hals am Bildschirm ausrenkte. Einen Federfuchser hatte sie der Gerda geben wollen...
Wohl mit derartigen Gedanken im Kopf erklärte uns Mohring eines Mittags, er komme nicht mit zum Essen, er habe noch irgendwo etwas zu erledigen. Er stellte sich mit uns an den Waschtrog, scheuerte die Hände und warf sich die Jacke über das verschwitzte Hemd. Er verließ auch mit uns die Halle, doch dann schlich er sich in die summende Stille der Elektrolyse zurück und stieg in das Lager hinab.
Niemand aus unserer Brigade hatte ihn dabei beobachtet. Ulli Mohring aber hatte bei der Vernehmung ausführlich seine Tat geschildert. Und ich hatte das Protokoll nachgelesen, das darüber angefertigt worden war.
Im Keller mochte die Aussicht, nun bald auch die Antenne für den Fernsehapparat zu besitzen, seine Angst, jeden Augenblick bei dem Diebstahl überrascht zu werden, wohl unterdrückt, jedoch nicht vollends beseitigt haben. Denn immer fühlte er sich verfolgt, erschrak, als er seinen eigenen Schatten entdeckte, den das grelle Licht der nackten Glühbirne an die Wände geisterte, zuckte zusammen, als das Metall unter seinen zitternden Händen scheppernd aneinanderschlug. Mehrmals wollte er über die verstaubten Wergballen wieder zurückklettern, aber immer wieder rechtfertigte er sich damit, daß das Kupfer irgendwann fehlgeliefert worden war und sich niemand mehr seiner erinnert hatte.
Sechs, acht Rohre zog Ulli Mohring aus dem Bündel, hastig, seine Hände flogen. Zweifellos, sein Gewissen war aufgestört. Laß sein, du bist ein Dieb, sagte es. Keine Ahnung, das ist eine Fehllieferung, antwortete es. Du bestiehlst das Werk... Der Apparat braucht eine Antenne... Er stürzte aus dem Keller. Die Elektrolyse lag noch immer verwaist. Nur die handtellergroßen Scheiben auf den Quecksilberpumpen rotierten surrend. Die Arbeiter saßen noch im Speiseraum vor ihren Suppen.
Ulli lief zum Werkplatz der Montageschlosser hinüber. Er zersägte die Kupferstangen in gleichlange Stücke. Er fühlte sich in allen Gliedern zerschlagen. Die Aufregung in dem engen muffigen Keller hatte ihn ermüdet. Aber das Blut jagte ihm nun nicht mehr wild durch die Adern. Sein Denken war jetzt wieder klar. Es war nicht mehr verwirrt wie in den letzten Tagen. Seine Klarheit, seine Verwirrung bestand darin, daß es sich wieder dem Fernsehapparat überließ. Mohring sah ihn vor sich, wie er sein blindes Auge öffnete.
Sechzehn Rohre hatte sich Mohring zugeschnitten. Sie waren nicht dicker als ein Finger und nicht länger als ein ausgestreckter Männerarm. Ulli umwickelte sie mit alten, öligen Putzlappen. Das Paket wirkte harmlos. Niemand würde ahnen, daß sich darin die Kupferstangen verbargen. Auch der Keller würde schweigen. Das Bündel in der Ecke war nicht auffallend dünner geworden. Sollte es Wildgrube wieder ins Magazin schaffen. Niemand erinnerte sich mehr an die Fehllieferung. Nur noch schnell die Antennenstäbe an einem Platz auf der Werkumzäunung verstecken, daß man sie von außen leicht greifen könnte. Und dann im Schutz der Dunkelheit heute abend das Bündel abholen. Gerda würde bald lachend vor dem Bildschirm sitzen. Ihre griesgrämigen Alten könnten auf Besuch kommen. Vater Gleisleger könnte sich das Fußballspiel ganz aus der Nähe begucken. Wie er den Fernsehapparat sehend gemacht hatte, das freilich würde sein Geheimnis bleiben. Niemand dürfte es erfahren, auch Gerda nicht. Sie vor allem nicht.
Ulli verließ die Halle. Wir kamen aus dem Sozialgebäude, Wildgrube und ich. Ulli sah uns und bog rasch von uns ab. Zehn Schritte von uns entfernt. Unter dem Arm hielt er ein graues Paket.
»He, Ulli!« rief Wildgrube. Freundlich. Nichts ahnend.
Mohring duckte sich. Sein roter Hals versank in den Schultern. Er schien nicht gehört zu haben.
Wildgrube sah mich überrascht an. Seine Augen fragten: Was hat er? Er wiederholte seinen Ruf.
Mohring wandte sich nicht um. Er schritt schneller aus. Er setzte sich in Trab. Er lief davon.
Wildgrube war verdutzt. Ebensowenig wie ich konnte er sich Ullis Gebaren erklären.
Mohring lief schneller. Er bog zum Schuttplatz ein. Seine Füße stampften im Staub.
»Da stimmt was nicht«, brummte Wildgrube, wie zu sich selbst. Er rannte hinter Mohring her. Ich folgte ihm.
Ulli war zwanzig Meter vor uns. Wir vernahmen seinen keuchenden Atem. Walter Wildgrube blähte die Nüstern wie ein Pferd. Der Abstand zwischen uns und dem Ausreißer verringerte sich. Das Bündel behinderte Mohring beim Laufen. Sonst wäre er uns davongeeilt.
Wildgrube spie in den Sand. Seine Lunge pfiff und röchelte. Doch er hetzte dem Schlosser nach. Auf meiner Zunge schmeckte ich den Staub, den Mohrings Beine vor uns aufwirbelten.
Ulli Mohring drehte sich um. Sein Gesicht war verzerrt, ln seinem Blick wucherte die Angst. Kopflos hastete er auf die Planke zu. Sie schloß das Werk vom Bahngelände ab.
»Schneller!« trieb mich der Anlagefahrer an. »Sonst entwischt er uns... Über den Bretterzaun da...«
Ich wunderte mich über Wildgrube. Er sprang behend über die Geröllhaufen des Schrottplatzes. Die Jagd verdoppelte seine Kräfte.
Meter um Meter kamen wir dem Flüchtling näher. Er verhaspelte sich in einem Berg rostigen Eisendrahts. Er schlug hin, raffte sich, auf, blutete.
Plötzlich stand Mohring vor der mannshohen Wand. Fast im selben Augenblick waren wir bei ihm.
Mohring warf das graue Paket von sich. Er japste nach Luft, streckte uns die blutigen Handflächen entgegen.
Wir standen uns gegenüber.
»Sagt nichts!« jammerte Ulli. »Es war doch wegen Gerda... Und dem Fernsehapparat...«
»Was denn?« Wildgrube bückte sich und riß die öligen Lappen von dem Bündel.
Mohring senkte die Augen. Seine Lippen sperrten sich schreilos. Seine Haut wurde blaß.
Durch die Verpackung schimmerte rot das Kupfer.
Wildgrube richtete sich auf. »Geklaut hast du! In die Fresse hau ich dich.« Er hob die Hand zum Schlage. Als er Mohrings unvertraut fahles Gesicht sah, ließ er sie wieder sinken. Er glotzte den Dieb an, verbittert, voller Vorwurf. Doch nicht ohne väterlichen Schmerz, als habe ihn sein eigener Sohn betrogen. Er wandte sich ab, spuckte aus, ging wortlos.
Zwei Wochen später erschien der Staatsanwalt im Chlorbetrieb. Und eben jetzt hackte er zum letzten Mal mit seinen weißlichen Knöcheln auf die Tischplatte, seine Rede beschließend.
»Ihr kennt nun das Problem, Kollegen«, sagte der Vorsitzende der Konfliktkommission. Breit mit den Ellenbogen auf die Tischplatte gestützt, rieb er vor seiner Nase die Handballen aneinander, die vom vielen Gebrauch der Werkzeuge rauh und rissig waren und sich nun gegenseitig wie Schmirgelpapier bekratzten. »Ihr seid eine sozialistische Brigade. Einer von euch hat gestohlen. Was, denkt ihr, soll mit ihm geschehen? Die Konfliktkommission will eure Meinung wissen.«
Es dachten wohl alle. Schon während der Ausführungen des Staatsanwaltes hatten sie gedacht. Und auch jetzt beschäftigten sich die Gedanken eines jeden mit Mohring. Aber niemand sprach. Es war so schwer, den Anfang zu machen, wenn man sozusagen in eigener Sache reden sollte. Denn Ulli Mohring gehörte doch zu dem Kollektiv, mittendrin befand er sich. Täglich morgens hatte man auch ihn in der Gruppe vor den Spinden der Elektrolyse getroffen, in jener Gruppe, in der zehn Minuten vor Arbeitsbeginn jeder jedem noch einmal ins Gesicht schaute, jeder jedem die Hand drückte. Hier versammelte man sich, vertrat sich die Füße, verschränkte die Arme und döste vor sich hin, in den Ohren das noch träge Rauschen des Blutes. Worte wurden nur wenige gewechselt, nicht mehr, als unbedingt notwendig waren; die Zungen schliefen noch. Man versuchte dafür, alles, was gesagt werden könnte, mit den Augen zu erledigen, alles, was man hören könnte, zu sehen. Der Minutenzeiger der großen Normaluhr an der hinteren Hallenwand rückte mechanisch vor, unerbittlich sich der Stunde der Ablösung nähernd. Mit den Blicken folgte man dem Mechanismus und übertrug ihn tropfenweise auf sich, als träufelte man eine Medizin in sich hinein, die langsam die Glieder belebt. Man ließ die Augen über die endlose Reihe der Quecksilberzellen schweifen und entdeckte auch nur allmählich, daß es die vertraute Landschaft der täglichen Arbeit war, die man gestern erst verlassen hatte. Und man beobachtete seinen Nebenmann, bemerkte lächelnd, daß man selbst gemustert wurde, und gewahrte dabei auch die sommersprossige Nase Ulli Mohrings und das Glaskirschenrot seiner Haut. Hatte er gestern nicht das siegbringende Tor im Ligaspiel geschossen? Wollte er sich nicht einen Fernsehapparat kaufen? Natürlich, bald wird man ihm zur Geburt eines Sohnes gratulieren müssen. Jeder von den Chlorarbeitern brauchte diese zehn Minuten vor Schichtbeginn, um den Schlaf abzuschütteln, um sich dem Tag einzugewöhnen, dem Tag mit seinem beißenden Gasgeruch, der aufsteigen würde, mit dem Schweiß, der salzig über die Lippen rinnen würde. Diese frühen zehn Minuten benötigten die Chlorarbeiter aber vor allem, um sich vor der Arbeit noch einmal, mit schweigenden Zungen freilich, aber mit beredten Augen, gegenseitig zu vergewissern: Du bist also auch hier erschienen, das heißt, ich kann mich auf dich verlassen. So festigten diese zehn Minuten an jedem Morgen wie kaum eine andere Gelegenheit das Zusammengehörigkeitsgefühl der Männer. Doch nun hatte einer aus ihrer Gruppe das stumme Versprechen gebrochen. Wie sollte man darauf antworten? Man schämte sich für sich selbst. — Es sprach der Betriebsleiter. Der Meister sprach. Ein Mitglied der Konfliktkommission sprach. Sie alle aber kannten Mohring am wenigsten. Die Chlorarbeiter schwiegen. Es war so schwer...
Ulli Mohring kauerte wie betäubt an seinem Tisch. Er getraute sich nicht aufzublicken. Wenn irgend jemand seinen Namen nannte, erschrak er. Seine Hände zuckten, er hatte sie wie zum Gebet zusammengefaltet. Seine Lippen zitterten, sie waren schmal wie ein Strich. Einmal entdeckte ich seine wasserklaren, blaßblauen Pupillen. Ich fand sie grundlos, ohne Halt, wie eine Wasserwüste, die sich fern am Horizont im Dunst auflöst, traurig und benommen. Neben mir saß Walter Wildgrube. Er saugte an seiner erkalteten Tabakspfeife. Er nickte beifällig mit seinem dicken Glatzschädel, sobald er in den Reden der anderen eine seiner Überlegungen wiederfand. Doch mißmutig stieß er seinen Atem in den Pfeifenstiel, daß der Saft darin quackerte, wenn er eine Äußerung verschmähte.
Einer aus Mohrings Kolonne stand auf, ein Alter mit Höckerrücken und hohlen Wangen. Er war Reparaturschlosser wie der Angeklagte. Er hustete und umklammerte mit beiden Händen die Stuhllehne vor sich. Wir alle fühlten, daß jetzt die Entscheidung heranreifte. Auch Ulli mochte es ahnen. Als er die heisere Stimme des Schlossers vernahm, schaute er ihm voll ins Gesicht, nach Trost in jedem Worte hungernd.
»Weg mit ihm! ’raus aus dem Betrieb mit ihm. Diebe können wir nicht gebrauchen. Ich bin vierzig Jahre im Chlor. Wenn einer geklaut hat, wurde er immer ’rausgeschmissen.«
Mehr sagte der Alte nicht. Alles wartete, daß er sein Urteil begründete. Aber er ließ sich wieder auf seinen Platz fallen. Er hatte genügend begründet: Er kannte es nicht anders, als daß ein Dieb verdammt wurde. Damit basta.
Mohring stöhnte gequält.
Er hatte umsonst gehofft.
Walter Wildgrube nahm die Pfeife aus dem Mund und steckte sie in die Hosentasche. »Ich will mal was sagen«, erklärte er und rekelte sich hoch. »Ich habe Mohring erwischt, wie er das Kupfer gestohlen hat. Glaubt mir, ich wollte ihn niederschlagen. Ich bin keiner, der den...«, er stockte, er besann sich »... na ja, der die Sache beschönigen will.«
Der Anlagefahrer drehte sich um. Er durchmaß die Gesichter der Versammelten. Er wartete, ob ihm jemand widerspräche. Niemand bezweifelte seine Unvoreingenommenheit. Wir alle lauschten ihm. Wir waren gespannt, wie er entscheiden würde. Er hatte den Diebstahl entdeckt, er hatte den Dieb angezeigt. Er verfügte aber auch über die Erfahrung eines harten Lebens. Manch einem von den Arbeitern hatte er bereits kluge Ratschläge erteilt. Sie stimmten ihm kopfnickend zu. Walter Wildgrube wandte sich wieder an das Präsidium und fuhr fort:
»’rausschmeißen, aus dem Betrieb verbannen, das ist leicht gesagt. Noch leichter getan, vielleicht. Dann sind wir alle Sorgen los. Sperrt ihn gar noch ins Gefängnis. Für Diebe ist die Polizei zuständig, was?«
Durch die Reihen wogte ein Gemurmel. Wildgrube scheute nicht, brutal zu schlußfolgern. Er faßte den höckerrückigen Alten aus Mohrings Kolonne ins Auge.
»Vierzig Jahre bist du im Chlor. Du hast es nicht anders gekannt, sagst du. Mein Lieber, mehr als die Hälfte dieser Zeit zählt nicht. Nicht, wenn du über einen Arbeiter richten willst. Denn das war eine Zeit, in der ein Arbeiter nichts galt. Wer da fiel, wurde gestoßen und getreten, damit er noch tiefer fiel.«
Der Anlagefahrer hielt inne. Er sprach gedehnt, bedächtig. Jeden Satz legte er erst auf der Zunge zurecht.
»Wenn du ein Kind hast, das Dummheiten macht. Das geklaut hat, sagen wir. Wirfst du es gleich auf die Straße? Wenn du es tust, bist du ein schlechterer Vater, als dein Kind schlecht ist. Denke doch wenigstens daran, daß dein Kind auch gut sein kann. Daß es dir immer die Haussocken gewärmt hat...«
Einige lachten. Der Alte rief: «Das ist was anderes.«
»Nichts ist anders«, sagte Wildgrube, »Mohring gehört zu unserer Familie. Er gehört zur Brigade im Chlorbetrieb. Also sind wir alle für ihn verantwortlich. Du und ich, wir alle. Vielleicht haben auch wir ein bißchen schuld. Daß es mit ihm so weit gekommen ist, meine ich...«
»Oho!« wurde geschrien. »Er ist wohl ein Engel ?« — »Wir haben nicht gemaust.«
Wildgrube hob seine Stimme. »Legt endlich eure kleinbürgerliche Seele ab! Immer zu den Leuten hübsch verlogen sein! Bloß keine eigenen Fehler zugeben! Immer die Wohlanständigkeit wahren! Wie klein ist das, wie verächtlich. Nicht der ist anständig, der keinen Makel hat. Fehler hat jeder Mensch. Wenn er sie beseitigt, dann ist er anständig.«
Walter Wildgrube war ärgerlich geworden. Wütend hatte er seine Moral verkündet. Niemand wagte, ihn zu unterbrechen. Wegen seines heiligen Zorns nicht? Deshalb auch, möglicherweise. Vor allem aber wegen seiner Moral nicht. Sie war schlicht, ehrlich, einleuchtend. Sie war wahr.
»Ein jeder von uns kennt Mohring. Der Fußball hat ihn behext. Seine Frau kriegt ein Kind. Er war besessen auf einen Fernsehkasten. Nirgends erhielt er Antennen. Das alles wußten wir. Ulli hat es uns erzählt. Er hat es uns vorgejammert. Nehmt mich zum Beispiel. Mich hat er nach dem Kupfer im Keller gefragt. Aber ich wurde deswegen nicht hellhörig. Wie eine Brutmaschine war ich zu meinem Ei, aber nicht wie eine Glucke. Und dann wollte ich ihn in die Fresse schlagen, an der Planke, als ich ihn schnappte. Wißt ihr, warum? Weniger aus Wut über ihn. Aus Wut über mich. Weil ich ihn nicht gehindert habe ...«
Wieder sann Wildgrube nach. Die Menschen im Saal harrten geduldig. Wir verstanden Mohring plötzlich besser.
»Und was die Haussocken betrifft... Mohring hat geklaut. Das ist die eine Seite. Mohring hat die Seifert-Methode eingeführt. Das ist die andere Seite. Er hat die Rohre genommen, also den Betrieb bestohlen. Er hat die Verlustzeiten aufgedeckt, also den Betrieb beschenkt. Er ist ein Arbeiter, der hier genommen, was er dort gegeben. Das sind die beiden Seiten in einem. Und das wollte ich sagen.«
Walter Wildgrube setzte sich. Seine Rede hatte ihn erschöpft. Er zog die Pfeife aus der Hosentasche und klopfte die Asche in die hohle Hand. Aus einem schmutzigen Lederbeutel fingerte er Tabak und stopfte den Pfeifenkopf. Doch noch ehe er ein Streichholz anzünden konnte, fragte ihn der Vorsitzende: »Was schlägst du denn nun vor?«
Wildgrube erhob sich noch einmal. »Das Wichtigste vergißt man oft. Wir schmeißen ihn nicht 'raus. Meinetwegen gebt ihm einen Verweis. Aber er bleibt in unserer Brigade. Er soll uns zeigen, daß er kein Dieb ist. Wir werden ihm dabei helfen.«
Ulli Mohring war nicht wiederzuerkennen. Die aufgespeicherte Erregung der letzten Tage in ihm machte sich Luft. In die Stille brach sein Schluchzen. Er heulte und lachte. Er biß sich auf die Lippen. Er rang mit seinen Gefühlen. Seine Scham balgte sich mit seiner Freude. Aber weder die eine noch die andere vermochte er zurückzudrängen. »Ich werd’s beweisen...«, stammelte er, »ich beweise es euch... Ihr sollt sehen... Ich bin kein Dieb... Beschimpft mich, ja... Aber vertraut mir doch...« Über sein rotes Gesicht rollten die Tränen wie Regentropfen über eine reife Glaskirsche.
Die Konfliktkommission zog sich zur Beratung zurück. Als sie wiederkam, verkündete der Vorsitzende das Urteil. Es entsprach Wildgrubes Vorschlag.
Die Versuchung
Das Kombinat schrie nach Kohle, die Kohleversorgung stockte. Die Kraftwerker lebten bereits von der Hand in den Mund, wie man zu sagen pflegt. Ihre Kessel zehrten von dem, was gerade erst am Vortage auf langen Güterzügen ins Werk geschoben worden war. In den Fabriken gab es wieder Stromabschaltungen, die Produktion mußte überall gedrosselt werden, die Chemiearbeiter fluchten. Wir in der Elektrolyse spürten den Kohlemangel daran, daß die Werte an den Bädern ungewöhnlich stark auf und nieder schwankten und der leidige Restgasgehalt im Chlor stieg. Bald erfuhren wir von der Ursache der Störungen, der plötzliche Wetterumschlag hatte die Gruben verheert. Die Tagebaue schwammen im Schmelzwasser, die Strossen waren morastig, unter den Schienen rutschte die Erde. Die Zeitungen riefen auf, den Bergleuten zu helfen. Auch vom Chlorbetrieb wurden fünf Mann in die Braunkohle geschickt, ich ging mit.
Wir fünf bildeten den Stamm einer Gleisbaukolonne, Arbeiter aus anderen Industriezweigen wurden uns zugeteilt. Zwei waren darunter, die kamen aus einer Kupferhütte in der Mansfelder Gegend und zeigten sich bereits vertraut mit unserer neuen Tätigkeit. Wir merkten auch bald, daß die beiden unzertrennlich waren, stets gegenseitig ihre Nähe suchten. Sie schienen im gleichen Alter zu sein, waren aber ihrem äußerlichen Aussehen nach das direkte Gegenteil. Der eine war von schlankem Körperbau, blond und blauäugig, er überragte seinen Freund um einen Kopf. Der andere war von untersetzter Gestalt, hatte braunschwarze Haare und dunkle brennende Augen. Wenn sie irgendwelche Wünsche hatten, die die Arbeit betrafen, die Unterkunft oder sonst etwas (und nie hatte einer von ihnen einen Wunsch für sich allein), sprach in jedem Fall der Blonde. Der Dunkelhaarige hörte nur zu, nickte oder schüttelte jeweils bejahend oder verneinend mit dem Kopf. In Gesprächen, in die wir die beiden sonderbar Unzertrennlichen natürlich hineinzuziehen trachteten, nachdem sie unsere Neugier geweckt hatten, fiel uns auf, daß der eine, der Schweigsamere, nur in gebrochenem Deutsch antwortete und stets, wenn er nicht gleich einen passenden Ausdruck fand, seinen Freund hilfesuchend zu dolmetschen bat.
Es läßt sich denken, daß ich um die beiden eine Geschichte witterte. Den anderen aus dem Chlorbetrieb erging es übrigens ähnlich, sie schickten mich denn auch vor, sagten: Los, frag sie doch mal, uns quetschst du doch auch immer aus, bis kein Tröpfchen Vergangenheit mehr in uns ist... Also bat ich die beiden eines Tages, uns zu erzählen, was es mit ihrer Freundschaft auf sich habe.
Und da erfuhren wir die nachfolgende Begebenheit, die nun schon um Jahre zurückliegt und sich in einer naturwidrigen Januarnacht ereignete.
Sie stürzten ins Zimmer. Die Tür krachte auf. Das Gebälk bebte in den Fugen. Die blanke Messingklinke grub sich wieder um, ein Stückchen tiefer in die Wand. Kaum ausgetrockneter Mörtel rieselte auf die Dielen. Aus dem Loch im Putz lugte rot die zerkratzte Fläche eines Ziegelsteines. Sie erinnerte an das rohe Fleisch in einer Wunde.
Eine zappelnde und lärmende, eine fröhliche und manchmal auch rücksichtslose Bande, diese vier, fünf Jungen! Sie kamen aus dem Duschraum der Villa. Dort hatten sie den Dreck und den Schweiß, die Spuren der Schufterei im Tagebau, von ihren Körpern gewaschen. Splitternackt hatten sie sich um die beiden Duschen gebalgt, hatte einer den anderen aus dem Kreis des warmen, belebenden Wassers gestoßen. Sie schämten sich nicht voreinander, sie taten zumindest so, als schämten sie sich nicht, und rissen obszöne Witze über ihre Nacktheit. Gleichzeitig aber betrachteten sie sich neugierig und wandten sich keusch ab, wenn sie die prüfenden Blicke eines anderen fühlten. Sie liefen in ihr gemeinsames Schlafzimmer. Sie schubsten sich die Stufen der Treppe hinauf, bewarfen sich mit den feuchten Seiflappen und peitschten sich mit den Handtüchern. Sie wälzten sich in die aufgeschlagenen, weißen Betten, schossen Purzelbäume über die Drahtgestänge an den Fußenden. Die Frau des letzten Gastwirts aus dem noch verbleibenden Teil des Städtchens, eine Vierzigerin mit hochgeschnürtem Busen und beinahe schon zu einladendem Becken für den Rest einer Stadt, hätte zeternd die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wenn sie die Verwüstung ihrer Mühe gesehen hätte. Denn sie hatte in der Frühe erst die sieben Betten im Raum frisch bezogen.
Sechzehn, siebzehn, achtzehn Jahre waren sie alt; ihre Seelen häuteten sich gerade. Sie beobachteten sich selbst vielleicht am meisten und entdeckten so auch den Zwiespalt in sich, den Zwiespalt zwischen der Kindheit von gestern und der Mannbarkeit von morgen, die Geschlechtsreife des Geistes, die für ihr Denken und für ihre Handlungen gefährlicher war als die des Fleisches, der sie folgte. Eigentlich waren sie empfindsamer als je zuvor; wenn sie mit sich allein blieben, horchten sie erstaunt auf das Geflüster der zartbesaiteten Stimmen in ihrem Innern. In Rudeln allerdings wie jetzt wetteiferten sie miteinander, ihre geheimsten Regungen nach außen zu verleugnen, denn sie fanden sie fremd, weibisch, weil sie sie früher an sich nicht gekannt hatten. Und so suchten sie jegliche Empfindsamkeit, die sie als Zimperlichkeit auslegten, in übersteigerter Hast mit Roheit zu unterdrücken. Sie übten sich tagtäglich darin. Was Wunder, daß nicht auch ein Schatten der Vergewaltigung fortan auf ihren Gefühlen lag und ihre Taten bestimmte? Sie waren rücksichtslos gegen sich selbst, also waren sie es auch gegen alles, was sie umgab, gegen die Scheu der Kameraden, gegen die Fürsorge der Älteren, gegen die Mütterlichkeit ihrer Mütter, erst recht gegen ein gemachtes Bett und gegen eine saubere Unterkunft.
Das Schlafzimmer, in dem die Bengel tobten, lag im ersten Stock einer Villa, die, wollte man den Behörden Glauben schenken, schon nicht mehr stand. Unmittelbar vor der Ankunft der siebenköpfigen Brigade war sie aus dem Straßenverzeichnis der Gemeinde gestrichen worden, da sie, wie bald auch noch der Rest des Städtchens, abgebrochen werden sollte. Zwanzig Meter von ihr entfernt, fraßen die Abraumbagger bereits das Erdreich weg, wühlten gerade den Friedhof um und stießen auf die Gebeine längst eingeebneter Gräber. In letzter Minute hatte man sich der Villa entsonnen, als die jungen Arbeiter gekommen waren und Quartier verlangt hatten. Mit Mitteln des Braunkohlenwerkes waren die verwaisten Räume, die einem der wenigen Mittelständler in dieser rauchigen, geschwärzten Gegend, einem Bauwarenhändler, der hoch entschädigt worden war, gehört hatten, schnell aufgeputzt worden. Sie boten nun eine nahezu feudale Bleibe, weithin bis in alle Tagebaue des Geiseltals ihren Ruhm verbreitend, teils herbeigewünscht, teils verflucht von jenen, die vor der Kälte nur dürftigen Schutz in Holzbaracken fanden.
Den Jungen freilich schien in dem Haus alles zu vornehm, ihrem Überschwange nicht standesgemäß. Sie klebten an die frischgetünchten Wände die Bilder von leicht bekleideten Mädchen, die Illustrierten entstammten, und die Photographien von Schlagersängerinnen. Einer von ihnen hatte mit einem Stück Braunkohle auf den grüngestrichenen Grund des Treppenaufgangs Männlein mit Mondgesichtern und maskierte Revolverhelden gemalt. Sie fühlten sich dazu berechtigt, ihre Behausung nach ihrem Geschmack auszugestalten. Denn die Kohle brauchte sie, nicht sie die Kohle. Die Tagebaue hatten um Hilfe geschrien, der eisige Winter hatte sich in die Strossen gekrallt, der Boden lag hartgefroren wie Beton, die Gleisleger schafften die Arbeit nicht mehr, die Förderung stockte. In einer Kupferhütte im Mansfeldischen war die Brigade bunt zusammengewürfelt worden, der Betrieb hatte geschickt, wen er entbehren konnte, einen Elektriker, Schmelzer, Former. Die Jungen waren nicht die besten, sie waren nicht die schlechtesten. Seit zwei Wochen legten sie nun schon Gleise im Abraum.
Harry Müller, der Elektriker, hechtete auf das Bett. Die Stahlmatratze quietschte unter dem Aufprall. Der Junge kuschelte seine bloßen Arme in die Decken. Er drückte seine Nase tief in das Kissen. Die Bezüge rochen wohlig nach Waschpulver. Müller wippte bäuchlings mit seinen starken Schenkeln auf der Federung. Mit einem Ruck warf er seinen schlanken, durchtrainierten Körper herum und setzte sich auf.
»Jungs!« schrie er. »Feierabend! Man reiche mir eine Zigarette!«
Er schlug die Beine unter sein Gesäß und streckte die Hand aus. Er thronte wie ein Sultan auf seinem Diwan. Die anderen lachten, gingen auf den Ulk ein. Einer kniete nieder und kreuzte die Arme über der Brust. »Salam alaikum! Und die Lieblingsfrau bitte?«
„Eine Zigarette!“
Die Jungen wühlten die Taschen ihrer Anzüge durch. Sie sahen in allen Schubfächern nach. Nirgends war eine Zigarette aufzutreiben.
Müller sprang von seinem Lager. Er ging an einen der Nachtschränke. Er faßte hinein und zog triumphierend eine Packung Turf heraus.
»Da!« sagte er, immer noch in der Pose eines Alleinherrschers. »Sie gehört dem Polacken. Ich streue Almosen unter das Volk.« Er riß mit den Fingernägeln die Banderole auf und warf eine Zigarette nach der anderen in den Raum. Gierig sammelten die Jungen die Stäbchen auf. Müller behielt die Schachtel mit dem Rest für sich, verstaute sie gelassen in seiner Trainingshose. Zufrieden über seinen Spürsinn klemmte er sich eine Turf zwischen die Lippen und rauchte sie an.
Gregor Koscwiendewsky trat ein, der Pole. Er war dick eingemummt in eine Wattekombination. Seine Füße steckten in grauen Filzstiefeln. Bis über die Ohren hatte er eine russische Pelzmütze gezogen. Er trug den eisigen Hauch des Winters ins Zimmer. An Hacken und Sohlen klebten Fetzen schmelzenden Schnees. Jeder seiner Schritte hinterließ eine schwarzflüssige, schmutzige Wasserpfütze. Von seiner wohl zähen, aber doch dürren Gestalt war nur das Gesicht zu sehen. Auf ihm hatte die Kälte einen Topf violetter Farbe ausgegossen. Die vollen, von vorstehenden Schneidezähnen etwas aufgewölbten Lippen waren aufgeplatzt und mit Schorf überkrustet. Aus den Spitzen des Hakenkinns und der breiten slawischen Nase war das Blut gewichen: weiße Bergkuppen in der dunkel geröteten Haut. Die Augäpfel lagen tief in den Höhlen, überwachsen von buschigen Brauen, in denen jetzt silbrig winzige Eiszapfen tauten, gefrorener Atem.
»Hu!« schüttelte sich Müller, als er den Ankömmling bemerkte. »Er sieht aus wie der Weihnachtsmann.« Er blies den Rauch des Tabaks genießerisch in die Luft.
Wieder lachten die Jungen.
Auch Koscwiendewsky verzog seinen rissigen Mund zu einem Lächeln. Er wirkte häßlich, es schmerzte. Er knöpfte seine Steppjacke auf und stapfte auf sein Bett zu. Die Jungen bewachten mit ihren Blicken jede seiner Bewegungen. Er fühlte ihre Neugier körperlich an sich. Er ahnte, daß sie ihn belauerten. Es war nicht das erste Mal in diesen vierzehn Tagen, daß sie ihren Schabernack mit ihm trieben, Schabbernagg, wie er sagte.
Koscwiendewsky riß das Schubfach an seinem Nachtschränkchen auf. Er wollte ihm Seife und Handtuch entnehmen. Er gewahrte: Seine Zigaretten fehlten. Er besann sich: Gestern hatte er sie gekauft und hierhergelegt. Er richtete sich auf und forschte in der Runde. Die Gesichter erwarteten seine Frage. Er fragte, im Zorn verhaspelte sich seine Zunge noch mehr als gewöhnlich: »Meine Zigaretten wo sind? Ihr geklaut, psiakrew!«
Harry Müller besänftigte ihn: »Entschuldige man, Gregor. Wir haben sie uns geschenkt. Wir hatten solchen Appetit, verstehst du ?« Er schlug mit seinen muskulösen Armen einen weiten Bogen, um die Größe seines Tabakhungers anzudeuten. »Keiner besaß Zigaretten... Du bist doch unser Kamerad, nicht?«
Gregor Koscwiendewsky blinzelte mißtrauisch. Gut, dachte er, dachte in seiner Muttersprache, ich will mich darum nicht streiten. Die Arbeit und die Kälte haben sie ausgelaugt. Und sie wollten ihre Lungen wärmen. Sein Blick wurde freundlicher, versöhnend. »Dobry«, sagte er, »gutt.«
Müller hielt ihm die angebrochene Schachtel hin. »Da, Pole, nimm!«
Gregor Koscwiendewsky beugte sich vor und griff in die Packung. Ein Faustschlag traf ihn ins Gesicht. Müller hatte zugeschlagen.
Zwei, drei Jungen grölten roh. Sie spürten in ihrem Fleische wieder den Stachel der Grausamkeit, das Verlangen zu quälen, um nicht zartfühlend sein zu müssen. Ihre Herzen befanden sich in einer Zeit des Aufruhrs, sie waren daher sehr leidenschaftlich. Und wie alles Leidenschaftliche, ließen sie nur das Entweder-Oder gelten, entweder das Zärtliche oder das Brutale, das Gute oder das Böse. Jede Empfindsamkeit aber hielten sie für Verirrung und wehrten sich dagegen. Den Polen Koscwiendewsky hatten sie zum Opfer ihrer Gefühle erkoren, sie sträubten sich sogar jetzt, ihn zu bedauern. Er war ein Krüppel für sie, seine Häßlichkeit, sein gebrochenes Deutsch glichen in ihren Augen körperlicher und geistiger Unvollkommenheit. Andererseits bewunderten sie Müller, seine kraftstrotzenden Glieder, seinen gezielten Fausthieb. Sie anerkannten ihn als Führer, sie wollten so stark und so rücksichtslos sein wie er. Selbst diejenigen, die jetzt zornige Gerechtigkeit in sich aufkeimen spürten, als Müller Koscwiendewsky niederschlug, unterdrückten sie in lauthalsem Gejohle. Die Armen, sie ahnten nicht, daß die zwei, drei anderen ebenso ihre natürlichen Empfindungen geißelten wie sie. Einer stand auf und stellte sich drohend vor Müller, er wurde mit Püffen beiseite getrieben, höhnisch wurde er ausgelacht. Er rettete sich, indem er angeekelt aus dem Raum lief, sich die Ohren zuhielt. Gewahrte er vielleicht, daß Müller nicht nur an Komplexen litt, sondern daß er haßte, daß er den Polen haßte?
Koscwiendewsky taumelte gegen den eisernen Bettpfosten. Er spuckte Blut, die Faust hatte seinen Mund getroffen. Er drückte die Lippen auf den Ärmel seiner Wattejacke. Er sah den Hohn seines Peinigers und sprang ihn an. Mit der Stiefelspitze trat er Müller vor das Schienbein. Aber wieder mußte er sich der Stärke des anderen beugen. Er fiel auf die Decken und schluchzte. Weniger aus Schmerz als aus ungetilgter Wut.
Plötzlich Gedröhn in der Luft. Klirren der Scheiben. Zittern der Mauern. Aufschrei von Metall. Gellende Nacht. Und Stille. Nur das Winseln Koscwiendewskys.
Die Jungen starrten sich an. Sie stürzten ans Fenster. Sie rissen die Flügel auf. Sie drängten ihre Köpfe in das Viereck.
Die Dunkelheit gähnte kalt und schweigend. Feiner, zerstäubter Schnee streute ins Zimmer. Er glitzerte wie kandierter Zucker. ln die weite bizarre Schale des Tagebaus fielen weiße Wehen. Am Gestänge eines nahen Baggers dösten schummrig die Positionslichter. Sie zogen wie kleine Monde in dem dichten, lautlosen Schneetreiben gelbe Höfe.
Der Streit war vergessen. Nein, er war nicht vergessen. Die plötzlich aufgellende Nacht hatte ihn nur vernarbt. Er schwärte prickelnd unter der Haut. Er würde aufbrechen bei der geringsten Infektion. Heute abend vielleicht schon. Oder morgen ...
Die Jungen hatten in die Finsternis hineingehorcht, jedoch außer dem dünnen, fernen Geschepper verspäteter Abraumzüge und dem Rauschen des treibenden Schnees nichts vernommen. Sie hatten die Fenster wieder zugeknebelt und waren in den Gemeinschaftsraum geeilt, der sich im Parterre der Villa befand. Drei, vier Mann hockten um einen Tisch und spielten Skat, sie droschen mit ihren Fäusten die Tischplatte. Harry Müller klimperte auf einem Schifferklavier, er dudelte Seemannslieder. Der Pole kauerte in einer Ecke nahe dem Ofen und blickte düster auf die nackten Zehen seiner entblößten Beine. Er hatte seine verschwitzten Fußlappen zum Trocknen über die Kacheln gebreitet. Fritz Lindermann, der Brigadier, der älteste der Arbeiter und als einziger schon verheiratet, schrieb einen Brief an Frau und Kinder daheim (»Macht Euch keine Sorgen, Ihr Lieben, mir geht es gut«). Aber er fühlte sich nicht wohl, er litt darunter, daß er die Jungen, die ihm in der Kupferhütte anvertraut worden waren, nicht zu zügeln vermochte. Von der Schlägerei hatte man ihm nichts verraten, als er nach einer Besprechung im Werk später als die Jungen zurückgekehrt war. Aber Lindermann enträtselte sich aus dem verquollenen Gesicht Koscwiendewskys den Vorfall. Er hatte den Polen danach gefragt. Der hatte ihn prüfend angesehen und geschwiegen. Der Brigadier schwor sich, bei passender Gelegenheit eine Aussprache mit den Jungen herbeizuführen. Er hatte nicht den Mut, sofort, jetzt, heute abend noch den Streit zu klären.
Das Telefon schellte, zornig, gebieterisch. Sein Plärren zerschnitt das Netz der Geräusche im Zimmer. Die Jungen hoben die Köpfe. Die Kartenspieler unterbrachen einen Grand. Müllers Harmonika verjaulte. Der Pole blickte überrascht von seinen Zehen auf. Fritz Lindermann nahm den Hörer ab. In den Gesichtern nistete Erwartung. Das Telefon hatte noch nie so spät geläutet. Jeder ahnte: Echo des unheilvollen Aufschreis von vorhin.
Fritz Lindermann lauschte in die Muschel. Dann sagte er: »Hallo! Hier ist die Brigade Kupferhütte.«
Die Jungen vernahmen die schnarrende Stimme auf der Gegenseite, aber sie verstanden kein Wort. Sie konnten sich das Gespräch nur aus den knappen, kargen Fragen und Antworten Lindermanns zusammenfügen.
»Bin selbst hier. Fritz Lindermann«, antwortete der Brigadier.
Die Membrane ächzte.
»Unsere Hilfe? Mitten in der Nacht?« fragte Fritz.
Wieder erklang die näselnde, durch die Übertragung zerquetschte Stimme am anderen Ende der Leitung.
»Eine Havarie? Verdammter Mist!« Lindermann fluchte in das Mikrophon. »Wo denn?«
Heisere Antwort.
»Auf Strosse 64...«, wiederholte der Brigadier nachdenkend. »Das ist doch... Moment mal... bei uns in der Nähe.«
Gekrächze von jenseits, es scholl hart und fordernd aus der Muschel.
»Gut!« erklärte Lindermann. »Wir gehen...«