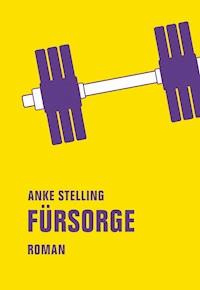Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2015! Von den 68-Müttern hat eine Töchtergeneration den Auftrag erhalten, die Welt zu verbessern - Sandra kann ihn nicht vergessen. Inzwischen ist sie vierzig und hat selbst zwei Kinder, doch statt im Gemeinschaftshaus glücklich zu sein, ist aus ihr eine Art Kassandra geworden. Mit viel Ironie erzählt Anke Stelling von den Hoffnungen, Kämpfen und Widersprüchlichkeiten des Mutterdaseins. "Dank des unerbittlichen Blicks und trockenen Humors der Autorin hält der Roman wunderbar die Balance zwischen Erschrecken und Vergnügen. Gegenwartsliteratur im buchstäblichen und besten Sinn." Katja Oskamp, MDR Figaro "Bodentiefe Fenster" - ist nominiert für die Hotlist 2015, der besten 10 Büchern aus unabhängigen Verlagen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anke Stelling
Bodentiefe Fenster
Als Sandra Anfang der Siebziger geboren wurde, war es Mode, den Kindern kurze Namen zu geben. Leicht auszusprechen, unprätentiös. Selbst »Sandra« schien damals noch umständlich, sodass Sandra die meiste Zeit nur »Sanni« gerufen wurde.
Doch eines Nachmittags, als sie neun war, spielte sie mit ihrer Freundin Anne Zirkus, und da beschlossen die beiden Mädchen, dass zumindest Artistinnen etwas Glitzernderes und Aufwändigeres verdient hatten, und nannten sich »Kassandra« und »Anakonda«.
Als sie den Eltern am Abend das Programm vorführten, kicherten sie und drehten affektiert ihre Handgelenke. Mehrmals stellten sie einander vor, ja: Man könnte fast sagen, dass die Artistinnennummer aus nichts anderem bestand als aus Kichern, Verbeugen und der Beschwörung zweier Wesen, die sie selbst waren und auch wieder nicht.
Die Eltern applaudierten geduldig.
Woher die neunjährige Sandra den Namen »Kassandra« hatte? Vermutlich aus dem Fernsehen, aus der Zeichentrickserie »Biene Maja«. Mythen und Sagen des Altertums gab’s nur bei Leuten, die sich auch in den Siebzigern das Recht herausnahmen, ihren Kindern drei- bis viersilbige Rufnamen und zudem noch Zweit- und Drittnamen zu geben.
»Sandra?«
»Hm?«
»Siehst du was?«
»Nö. – Ich hab’ meine Kontaktlinsen noch nicht drin.«
1
Ich bin wie meine Mutter.
Ich sitze hier und heule, weil ich meine Freundin nicht retten kann.
Isa wird zugrunde gehen, sie wird in der Klapsmühle enden, die Kinder tot oder ebenfalls in der Klapsmühle oder knapp entkommen, aber nur fürs Erste, nur so lange, bis sie selbst Familie gründen, dann geht’s noch mal von vorne los.
»My Mother / My Self« – in schöner Regelmäßigkeit wiederholt sich alles, und für mich ist, genau wie für meine Mutter, die Rolle der Freundin vorgesehen, der stets vergeblich warnenden Freundin, der am Ende nichts anderes übrig bleibt als fortzugehen, um zumindest nicht mitschuldig zu werden.
Man soll das so machen, man soll kranke Systeme nicht stützen.
»Wissen Sie«, hat die Angehörigenberaterin der Drogenhilfe zu mir gesagt – vor fünfzehn Jahren, als mein damaliger Freund auf Heroin war und ich mein Geld vor ihm verstecken musste –, »wissen Sie, es ist hart mit anzusehen, wie ein geliebter Mensch sich kaputtmacht, aber indem Sie bleiben, verhindern Sie jede Veränderung zum Guten, damit beweisen Sie nur, dass es ja doch noch irgendwie geht.«
Taten sagen mehr als Worte, das hab’ ich mir damals gemerkt.
Vorher hat es allerdings immer anders geheißen.
Im Kinderladen und in der Schule sollte man reden: reden, um einander zu verstehen, reden, um Konflikte zu lösen. Als mir Eva Engelmann im Kinderladen ein Büschel Haare ausgerissen hat, hat Elvira, die Erzieherin, uns beiseite genommen; sie hat sich mit uns in die Garderobe gesetzt – jede von uns auf einem ihrer Knie – und gewartet, bis ich aufgehört habe zu weinen und ausführlich berichten konnte, wie sehr mir das wehgetan hat. Dann hat sie gewartet, bis wiederum Eva aufgehört hat zu weinen und so weit war zu behaupten, dass sie es schließlich nicht mit Absicht getan habe und außerdem ich diejenige gewesen sei, die angefangen hätte –
Dieses Vorgehen hat sich mir eingeprägt, nach diesem Vorbild bin ich dann auch mit meinem Ex-Freund verfahren. Ich sagte beispielsweise, dass es mir wehtue, wenn er mir mein Bafög stehle, und er sagte, sicher, doch dass das im Grunde keine Absicht gewesen sei, sondern nur die Sucht. »Du musst das lassen«, sagte ich, und er: »Ja, verdammt noch mal, das will ich doch auch.« Woraufhin ich wartete, bis es das nächste Mal geschah.
Das hat sich erst geändert durch den Termin bei der Drogenberaterin, durch das neue Motto »Taten statt Worte«. Aber wenn ich es mir recht überlege, bestätigt dieses Beispiel doch wiederum die Wirksamkeit des Redens, schließlich war das Gespräch mit der Beraterin auch nichts anderes als Gerede, und das neue Motto bestand ebenfalls nur aus Worten.
Allerdings denen einer professionellen Beraterin.
Ich hingegen bin nur die Freundin. Wenn ich rede, hilft das nichts.
Ich muss die, die ich liebe, verlassen und darauf warten, dass sie sich zugrunde richten oder sich selbst helfen, dass sie freiwillig etwas ändern oder sterben.
Ich will nicht, dass Isa stirbt. Ich will sie um Himmelswillen da rauskriegen.
Ich habe sie in der Uni kennengelernt. Ich weiß noch, wie ich meiner Schwester erzählte, dass da eine Frau sei, mit der ich gern befreundet wäre, zwei Semester über mir und wahnsinnig cool, dass ich aber nicht so recht wisse, wie ich es anstellen solle, weil doch so viele in den Seminaren säßen und in der Mensa erst recht. Meine Schwester riet mir, einfach abzuwarten, nach ein paar Monaten würden sich die, die zusammenpassen, schon finden; meine Schwester ist älter als ich und hatte Erfahrung mit dem Studieren.
Im Jahr darauf waren Isa und ich dann befreundet, ich hatte mich gar nicht anstrengen müssen, und es war eine tolle Zeit. Isa war Feministin und hat wunderbare Texte geschrieben, und dann hat sie Tom kennengelernt und mit ihm zwei Kinder gekriegt, obwohl Tom das eigentlich nicht wollte, weil er schon zwei Kinder hatte und eine psychotische Ex. Aber Isa dachte, na ja, wenn die Kinder erst mal da sind, wird sich das schon regeln, und außerdem kümmerte sie sich ja auch um die früheren Kinder von Tom, und wirklich geweigert hat Tom sich schließlich nicht, sondern die neuen Kinder auf natürlichem Wege gezeugt.
Überhaupt konnte Isa sich das, was dann kam, wohl nicht so richtig vorstellen – ich verstehe das, das kann sich keiner vorstellen: Wie Tom es seitdem schafft, derart ernst zu machen mit dem Nichtwollen und Trotzdemhaben. Und zwar nicht nur in Bezug auf die Kinder, sondern auch in Bezug auf Isa selbst.
Tom macht es so, dass er Isa nicht hilft. Niemals. Bei nichts.
»Du wolltest die Kinder«, sagt er, wenn Isa ihn bittet, nur ganz kurz nach dem Baby zu sehen, während sie in der Dusche ist; »Das ist dein Problem«, wenn Isa ihn bittet, ausnahmsweise mal den Zweijährigen in die Betreuung zu bringen – am Tag nach der Geburt des zweiten Kindes – und: »Ich kann nicht, das weißt du«, wenn sie fragt, ob sie ihm dann wenigstens das Baby kurz mal dalassen könne. Und also nimmt Isa das frisch abgenabelte Kind auf den Arm und das ältere an die Hand und schleppt sich mit Wochenfluss und Milcheinschuss in die Kita.
Tom macht es so, dass er sein natürliches menschliches Mitgefühl einfach abstellt – falls er überhaupt ein solches besitzt – und in seinem Zimmer verschwindet und die Tür zumacht. Fertig. Schließlich hat er es ihr von Anfang an gesagt.
Isa teilt sich ein Zimmer mit ihren Jungs, während Tom in dem anderen wohnt und seine früheren Kinder, wenn sie da sind, in dem dritten. Tom kennt seine Grenzen, er braucht Ruhe.
Tom kassiert das Kindergeld, schließlich bezahlt er die Miete. Überhaupt findet Tom, dass Isa Schulden bei ihm habe, denn als sie nach der Geburt des zweiten Kindes drei Monate nicht arbeiten konnte, hat er für Isa auch das Essen bezahlt und die Windeln für das erste und das neue Kind. Dieses Geld muss Isa ihm irgendwann zurückgeben, Tom hat alles säuberlich notiert, aber er ist großzügig und belässt es erst mal dabei.
Isa kann keine Sozialleistungen beantragen, weil sie eine Bedarfsgemeinschaft bildet mit Tom, und Tom mit seiner Ex-Frau aber noch eine Eigentumswohnung besitzt, die wegen der Bedarfsgemeinschaft auch auf Isas Einkommen angerechnet wird.
Isa bezahlt die Nebenkosten für die gesamte Wohnung – immerhin wohne sie mietfrei und irgendwas müsse sie schließlich auch zum Haushalt beitragen, findet Tom.
Isa mag sich nicht um Geld streiten.
Isa mag sich überhaupt nicht gern streiten.
Tom habe es auch nicht leicht, findet sie, er mache sich Sorgen um seine früheren Kinder, die er den Strapazen einer Trennung ausgesetzt habe, weshalb seine ganze Fürsorge nun eben ihnen gelte, und das habe sie schließlich gewusst, sagt Isa, das habe er ihr gesagt, dass er keine Kapazitäten mehr frei hätte. Sie selbst, sagt Isa, sei äußerst egoistisch gewesen mit ihrem Kinderwunsch, insofern müsse sie jetzt eben dafür bezahlen, und immerhin sei er da, und ihre gemeinsamen Kinder seien also keine Scheidungskinder und gegenüber den anderen Kindern im Vorteil.
An Weihnachten hat Tom allerdings aus seinem Zimmer eine SMS geschickt, dass er doch nicht zur Bescherung in die Küche kommen könne – die eigentlichen, alten Kinder waren für die Feiertage ohnehin bei der Ex – und also hat Isa mit den neuen Kindern alleine gefeiert. Die waren ein bisschen enttäuscht, weil die Absage ja auch ziemlich kurzfristig kam, aber Isa hat das ausgeglichen, hat mit den Kindern in ihrem Zimmer gefeiert und sie mit Singen und Spielen abgelenkt, damit sie nicht doch noch bei Tom an die Tür klopfen.
Isa ist inzwischen äußerst geübt im Ausgleichen. Sie sagt auch mir gegenüber immer wieder, dass Tom nicht ganz verkehrt sei, nur eben sehr empfindsam, wenig belastbar und mit einer ganz eigenen Auslegung von Wahrheit und Gerechtigkeit begabt.
Was ist schon wahr und gerecht?
Isa und Tom sind gebildet. Nette Leute. Unser Milieu, meine Generation.
Isa schreibt wunderbare Texte, allerdings kommt sie kaum noch dazu, weil sie mit Deutschkursen Geld verdienen und die Kinder versorgen muss, und wenn sie Max und Felix ins Bett gebracht hat, kann Isa auch kein Licht mehr machen, schließlich wohnen sie bei ihr mit im Zimmer, und in der Küche ist auch nicht so viel Platz, weil die Spülmaschine kaputt ist und Tom findet, es sei nicht wirklich mehr Aufwand, das Geschirr von Hand zu spülen – allerdings muss er mit seinen großen Kindern nach dem Essen noch Schulaufgaben machen, und dann wollen sie ausruhen, dann wollen sie’s zur Abwechslung mal schön haben zu dritt, wo sie doch ohnehin nur so selten zusammen sind und die Kinder bei ihrer Mutter schon genug im Haushalt helfen. Wenn Isa will, darf sie ein Stündchen mit dazukommen, aber bitte nicht mit einem solchen Gesicht.
Ich weiß nicht, ob mir das irgendjemand glaubt. Es klingt zugespitzt und übertrieben, witzig fast. Ich kann es selbst kaum glauben.
Ich kann es so wenig glauben, dass wir sogar schon zusammen im Urlaub waren, Tom und Isa, Hendrik und ich und alle unsere Kinder, und ich dann Baby Felix genommen und auf Max aufgepasst habe, damit Isa duschen gehen konnte, während Tom mit der Zeitung am Strand lag. Ich habe Max’ Eis bezahlt, weil Tom nur seinen früheren Kindern eines spendierte, und ich habe Isa Geld zugesteckt, heimlich, damit Tom es nicht sah und von dem, was Isa bisher im Urlaub alles bezahlt hatte, wieder abzog. Und am Abend, wenn die Kinder schliefen, saßen wir schön zu viert beisammen, Isa kontrollierte ihr Gesicht und wir tranken Rotwein und redeten nicht darüber.
Wie auch?
Darüber kann man nicht reden, das ist einfach nur absurd.
Also redeten wir über andere Dinge.
Isa und Tom sind klug und unterhaltsam. Weder Hendrik noch ich können glauben, dass so kluge Menschen so seltsame Dinge tun beziehungsweise sich gefallen lassen.
Also ließ ich mir am nächsten Tag beim Abwasch von Isa immer neue und noch haarsträubendere Episoden erzählen, und ich wusste, sie hat sich das nicht ausgedacht, ich habe es ja selbst gesehen.
Nachts im Dunkeln sagte ich zu Hendrik, dass ich fände, es könne so nicht weitergehen. Aber am nächsten Tag fuhren wir nach Hause und im Grunde ging es uns ja auch nichts an. Wenn ich zu Tom gesagt hätte: »Hör mal, was soll das denn?«, hätte er mit unbewegter Miene geantwortet: »Das haben wir unter uns geklärt.«
Es war nicht meine Sache, war nicht einmal gesetzeswidrig. Isa ließ sich freiwillig quälen und bestehlen, und das Jugendamt hatte wohl auch schon schlimmere Fälle gesehen. Nichtbeachtung von Kindern ist durchaus verbreitet, immerhin schlug und missbrauchte Tom sie nicht.
Alles, was passierte, war offiziell in Ordnung.
Ich konnte nur versuchen, es zu vergessen, und das klappte auch ganz gut: Je länger es her war, desto weniger konnte ich glauben, dass es wirklich passiert war, und außerdem wohnen sie in Frankfurt und Hendrik und ich in Berlin, und also sahen wir uns eine ganze Zeit lang nicht mehr.
Ab und zu fiel mir die Geschichte mit der SMS wieder ein, immer dann, wenn eine meiner Freundinnen sich beschwerte, dass ihr Ex sich nicht an die vereinbarten Termine und Besuchsabsprachen für die gemeinsamen Kinder hielte. Dann sagte ich: »Sei froh, dass ihr wenigstens nicht mehr zusammen wohnt und er an Heiligabend per SMS aus dem Zimmer nebenan die Weihnachtsbescherung absagt«, und das war jedesmal ziemlich lustig und ein schöner Trost für die alleinerziehende Freundin.
Dass so etwas wirklich passiert, kann ja keiner glauben.
Ich auch nicht.
Die ganze Sache ist mit der Zeit von der Wahrheit zu einer wahren Begebenheit, sprich: zur Anekdote geronnen; das kann nicht die Wirklichkeit sein, wir sind Figuren in einer Geschichte über die Ausbeutung und das Sichausbeutenlassen von Frauen, über kranke, sadistische Männer und hilflose, eingesperrte Mütter, über Freunde, die jahrelang dabei zusehen, ohne sich offen zu äußern.
Nur so kann ich mir auch erklären, dass ich, als Isa letzte Woche anrief, um zu fragen, ob sie bei uns wohnen könnten, wenn sie gemeinsam nach Berlin kämen, gesagt habe: »Ja, sicher, selbstverständlich, ihr könnt gerne bei uns wohnen, klar!«
Wir wohnen in einem generationenübergreifenden Hausprojekt – Hendrik und ich und unsere zwei Kinder – und haben darin eine gemeinschaftlich nutzbare Gästewohnung.
Heide, die Hausälteste, verwaltet diese Gästewohnung, und als ich den Schlüssel bei ihr geholt habe, hat sie mich angelächelt und gesagt: »Wie schön, eine Familie mit vier Kindern, da ist ja wieder ordentlich was los!«
»Ja«, habe ich geantwortet, voller Stolz, dass ich so lustige Leute kenne.
Es ist nämlich so, dass wir im Wohnprojekt darum konkurrieren, wer die lustigsten Bekannten, die besten Argumente, die begabtesten Kinder und die schönste Balkonbegrünung hat – ganz normal vielleicht, wenn man sich so nahe kommt, aber es trägt wie jede Konkurrenz dazu bei, bestimmte Seitenaspekte auszublenden. Zum Beispiel den, dass Isa, Tom und die vier Kinder zwar eine große, aber ganz gewiss keine lustige Familie sind.
Als sie kamen, umarmte ich also Tom und sagte: »Herzlich willkommen, fühlt euch wie zu Hause!«, obwohl ich doch eigentlich nie mehr mit ihm reden, geschweige denn ihn umarmen wollte.
Und wieder ging alles von vorne los: Ich redete mit Tom über Politik und Kunst und die Energiebilanz unseres Hauses; ich ließ mir von Isa beim Abwasch erzählen, dass sie immer noch mit den Jungs in einem Zimmer wohne und nicht wisse, woher in den Schulferien, wenn sie keine Kurse geben könne, das Geld kommen solle, dass aber Tom seine halbe Eigentumswohnung immer noch nicht verkauft habe, weil die psychotische Ex so sehr an dieser Wohnung hänge und sie ja auch in gewisser Weise die eigentliche Heimat seiner eigentlichen Kinder sei; ich sah zu, wie Max und Felix verzweifelt versuchten, mit immer gewagteren BMX-Stunts im Garten Toms Aufmerksamkeit zu erregen, während Tom damit beschäftigt war, seine eigentlichen Kinder unseren Nachbarn vorzustellen, die ihn alle wahnsinnig nett und klug und interessant fanden.
Und wenn ich hingegangen wäre und zu ihm gesagt hätte: »Hör mal, du Drecksack, was bildest du dir eigentlich ein? Glaubst du im Ernst, ich lasse einen wie dich bei mir wohnen?«, dann hätte das ja auch nichts genutzt und wäre am Ende nur auf Isa zurückgefallen.
Ich bin gut darin geworden, zu sehen ohne zu sprechen.
Ich lebe in einem alternativen Wohnprojekt, da beobachtet man einander ständig und lächelt allenfalls dazu.
Seit drei Jahren wohnen wir jetzt hier.
Von außen sieht das Haus aus wie ein ganz normaler Neubau, Berliner Traufhöhe, Lückenschließung, sechs Stockwerke, dreizehn Parteien, unterschiedliche Wohnungsgrößen von fünfzig bis hundertfünfzig Quadratmetern, je nachdem, mit wie vielen Personen man darin wohnt. Ein Gemeinschaftsraum unterm Dach für alle und die Gästewohnung im Erdgeschoss.
Wir haben versucht darauf zu achten, dass unsere Gruppe nicht zu homogen ist, dass auch Ältere, Kinderlose, Schlechtverdienende und Nichtakademiker dabei sind und wir trotzdem alle Entscheidungen im Konsens treffen, trotz der unterschiedlichen Interessen.
Wir haben das Grundstück einer Stiftung überschrieben, um es ein für alle Mal dem Markt zu entziehen; wir sind gegen die Bildung von Wohneigentum und wollen stattdessen genossenschaftlich wirtschaften – weil die Gemeinschaft das wahre Kapital darstellt in dieser von Profitgier und Entsolidarisierung geprägten Gesellschaft.
Isa hat gesagt, dass sie mich beneide. Um den Garten und die netten Nachbarn, darum, dass man sich gegenseitig helfe und die Welt der Kinder nicht an der Wohnungstür ende, sondern sie verschiedene Lebensentwürfe kennenlernen würden. »Du hast es richtig gemacht«, hat Isa gesagt.
Ich weine.
Ich bin die Freundin, die alles richtig macht, und sicher: Im Vergleich zu Isa darf ich mich auf keinen Fall beschweren. Im Vergleich zu Isa geht es mir prima, im Vergleich zu ihren Kindern haben meine hier den Himmel auf Erden, im Vergleich zu den Kindersoldaten im Kongo geht es allerdings auch Isas Kindern relativ gut.
Hendrik kommt rein und sieht besorgt aus.
»Was ist los mit dir?«, fragt er, und ich schniefe und sage, dass es anstrengend gewesen sei mit Isa und Tom, mit all den Lügen und hilflosen Gesprächsversuchen, dass das doch nichts bringe und ich Angst hätte, dass Isas Söhne sterben würden.
»Wieso sollten sie sterben?«
Ich antworte nicht.
Hendrik ist ein großer Verfechter der »Jeder muss sich selbst helfen«-Theorie. Er findet es befremdlich, wie viele Gedanken ich mir um meine Freundinnen und die Bekannten und die Nachbarinnen und die Kitamütter und die Kaiser’s-Kassiererinnen mache.
Also sage ich nichts und setze einen Hefeteig an.
Bo fragt, ob er mir helfen dürfe, aber ich lasse mir nicht gern von Dreijährigen helfen. Ich will meinen Hefeteig alleine machen, nur dann bin ich sicher, dass er auch gelingt. Und er muss gelingen, ich muss Zimtwecken backen für Tinkas Geburtstag. Morgen hat Tinka Geburtstag, und dazu bringe ich traditionsgemäß Zimtwecken mit.
Wenn ich weinend Hausarbeit verrichte, bin ich auch wie meine Mutter – Verstärkung von Selbstmitleid durch demonstratives Tätigsein für andere.
»Guck doch mal nach, ob jemand im Garten ist«, sagt Hendrik zu Bo, damit er mich in Ruhe lässt, aber Bo sagt: »Nein«, und Hendrik seufzt und sagt: »Dann kommst du eben mit mir einkaufen.«
Ich bringe Heide den Schlüssel zurück.
»Hat’s deinen Gästen gefallen?«, fragt sie.
Ich nicke. Heide lächelt zufrieden.
»Ja, wir haben’s schon schön hier«, sagt sie. »Reizende Kinder waren das, die Kinder von deinen Freunden, ich hab’ sie im Garten beobachtet.«
Wir haben Balkons nach hinten raus und überall riesige Fenster.
Heide ist pensioniert und deshalb viel zu Hause.
Heide weiß genau, welches Kind sich auf welcher Entwicklungsstufe befindet und wie ausgeprägt oder verkümmert sein Sozialverhalten ist; Heide hängt anthroposophischen Ideen an und hat mir gratuliert, als sie mitbekam, dass ich Bo als Säugling kein Vitamin K und Vitamin D verabreicht habe; Heide hat allen jungen Müttern im Haus ein Video zukommen lassen mit dem Titel »Kinder sind Hüllenwesen«, in dem dazu geraten wird, sie zu berühren, bevor man sie anspricht.
»Stimmt«, sage ich. »Die Kinder sind wirklich sehr nett.«
Soll ich ihr die wahre Geschichte von Isa und Tom erzählen? Soll ich ihr sagen, dass ich denke, ich hätte mich mitschuldig gemacht, indem ich sie hier wohnen gelassen und Tom damit die Gelegenheit geboten hätte, sich als aufgeklärter Vierfachvater zu präsentieren? Vor ihr, Heide, zum Beispiel?
Doch was bringt das, so etwas erst zuzulassen und danach zu entlarven, nichts bringt es, ich muss aussteigen, handeln oder schweigen, ich bin still.
Ich rede gerne mit Heide.
Andere im Haus verstehen das nicht, weil sie doch so herrisch und besserwisserisch, so humorlos und furchtbar schnell beleidigt sei. Kann schon sein. Aber die anderen haben leicht reden, die haben alle noch ihre eigenen Mütter, ich selbst habe keine mehr und bin deshalb dankbar für jeden Ersatz.
Ich lasse mich gerne loben für meine Entscheidungen, für meine wohlgeratenen Kinder, meinen unerhörten Fleiß. Ich lasse mich anstandslos belehren und einspannen für allerhand Anliegen. Ich verstehe, dass Heide manches anders sieht als ich und habe Achtung vor ihrer Lebensleistung. Ich entschuldige ihre Charakterschwächen als Folge ungerechter Verhältnisse. Fast alle Frauen Ende sechzig haben einen Putzfimmel und sind Meisterinnen darin, ihre Mitmenschen mit Gefühlen zu manipulieren –
Ich bin gerne bei Heide und ihrem Mann Dieter in der Wohnung. Da gibt es selbst gemachten Holunderblütensirup und sauber geputzte Oberflächen; Heide zeigt mir ihre Handarbeiten; ich betrachte die Fotos, auf denen Heide und Dieter noch jung sind, Dieter im Parka, Heide im bodenlangen Rock, die Kinder mit Topffrisuren und Nickipullovern. Eine Familie genau wie die, aus der ich stamme, auf den ersten Blick zumindest, auf diesen Fotos, die überall im Flur hängen.
Ich stelle mir vor, dass meine Mutter statt Heide die Kinder im Garten beobachtet.
Ich kann froh sein, dass es Heide gibt.
»Wenn du so gut bist, und die Stühle, die sie benutzt haben, wieder hoch in den Gemeinschaftsraum stellst?«, sagt sie.
Ich nicke.
»Sauber gemacht habt ihr.«
Ich nicke erneut.
»Und dann sieh doch mal zu, dass irgendjemand sich dort um die Dusche kümmert. Da läuft ständig Wasser neben dem Duschkopf raus, das geht jetzt schon recht lange.«
Ich nicke. Sie gießt mir noch mehr Holundersirup ein.
»Sag mal, Sandra, was hältst du eigentlich davon, dass die Kinder mit dem Gartenschlauch im Sandkasten spielen?«
»Die wollen da drin eine Matschepampe haben.«
»Ja, schon, aber Wasser ist ein Rohstoff. Ein wertvolles Gut, für das andere Kinder in anderen Regionen dieser Erde stundenlang anstehen müssen oder sogar tagelang zu Fuß gehen.«
Ich nicke.
Abends sitze ich mit Hendrik in der Wohnküche, Lina und Bo schlafen, wir gucken beide in unsere Rechner, der Hefeteig geht unter seinem Geschirrtuch, und ich versuche, eine Mail an Isa zu schreiben, aber was soll ich ihr sagen? Ich habe schon alles gesagt. In einer Mail, die ich ihr vor fünf Jahren geschickt habe, finde ich exakt die Formulierungen, die auch jetzt wieder passend wären. Ich muss aussteigen, das System nicht weiter stützen, Reden hilft nichts und E-Mails-Schreiben erst recht nicht.
»Sie könnten vielleicht bei uns einziehen.«
Hendrik schaut mich an und sagt: »Nein, auf keinen Fall.«
»Aber wir müssen ihr doch irgendwie helfen!«
»Es liegt nicht daran, dass sie keine Wohnung hat. Sie kann eine haben, wenn sie sich von Tom und der ganzen Scheiße trennt. Außerdem haben wir selbst nur drei Zimmer.«
»In anderen Ländern wohnen noch viel mehr Menschen auf noch viel engerem Raum!«
»Warst du zu lange bei Heide?« Hendrik schaut wieder in seinen Rechner.
»Aber sie braucht Freunde und Solidarität!«
Hendrik antwortet: »Hat sie.«
Ich fange schon wieder an zu weinen.
»He«, sagt Hendrik.
»Ich weiß«, sage ich. »Es fühlt sich nur so fürchterlich an.«
»All die Märchen, die man uns verspricht / das sind unsere Träume nicht. / Diese Welt ist veränderbar / das ist unser Traum, und der ist wahr!« Volker Ludwig, »Nashörner schießen nicht«, 1975. Hatte ich auf Schallplatte. Habe ich ungefähr tausendmal gehört.
»Ins Wasser fällt ein Stein / ganz heimlich, still und leise / und ist er noch so klein / er zieht doch weite Kreise!« Neues Kirchenlied von Manfred Siebald, 1973. Haben wir anderthalb Jahre lang im Konfirmandenunterricht gesungen.
»Doof gebor’n ist keiner / doof wird man gemacht / und wer behauptet doof bleibt doof / vor dem nehmt euch in acht.« Volker Ludwig, 1973. Hatte ich auch auf Platte.
»Es reißt die schwersten Mauern ein / und sind wir schwach, und sind wir klein / wir wollen wie das Wasser sein / das weiche Wasser bricht den Stein!« Lied der Friedensbewegung, gedichtet von Diether Dehm. Sangen wir 1983 bei der Menschenkette von Stuttgart nach Neu-Ulm und im Bonner Hofgarten. Dann wieder bei der Blockade der Kommandozentrale der US-Streitkräfte gegen den Golfkrieg.
Ich werde das nicht mehr los. Ich bin eine Botschafterin der Hoffnung, der Freude, der Gerechtigkeit, der Liebe, des Friedens, des Gripses und der Beharrlichkeit. Wenn ich mich nur genug anstrenge, dann –
Dann –
Hendrik tröstet mich. Es müsse andersherum sein, sagt er. Wenn Isa käme, dann würden wir ihr natürlich helfen. Wenn sie sage, sie finde keine Wohnung, dann würden wir mit ihr zusammen eine suchen. Wir seien mit ihr befreundet, wir seien solidarisch, natürlich seien wir das, aber zwingen könnten wir sie nicht – und auch nicht an ihrer Stelle abhauen.
»Einer ist keiner!«, sage ich. »Zwei sind mehr als einer!«
Hendrik schaut mich kopfschüttelnd an. Diese Art von Gehirnwäsche kennt er nicht, seine Eltern sind nie mit ihm im Gripstheater gewesen.
Ich klappe den Rechner zu und stehe auf, um nach dem Hefeteig zu schauen.
Backen tut gut, außerdem ist morgen Tinkas Geburtstag.
Tinka wohnt nicht mit uns im Projekt, weil Robert, ihr Freund, in einer sehr strengen, christlichen Kommune aufgewachsen ist und deshalb skeptisch, was Gemeinschaftswohnen betrifft. Zwischendurch bereuen die beiden, nicht dabei zu sein, aber dann muss ich nur von Heide und dem Sandkastenstreit erzählen, und schon sind sie wieder froh, dass sie sich für ihr anonymes Mietshaus entschieden haben, in dem die Nachbarn zwar vom Balkon runterbrüllen und Briefe an die Hausverwaltung schreiben, wenn die Kinder mit dem Wasserschlauch spielen, aber dann darf man die Nachbarn auch doof finden, kann sie meiden und den Kindern als Feindbild präsentieren – während ich meinen Kindern ausrichte, dass sie doch bitte Rücksicht nehmen sollten auf Heide, die, wie sie doch wohl wüssten, einer anderen Generation angehöre.
Die Einzige, die aus meiner alten Kinderladenclique mit bei uns im Haus wohnt, ist Regine.
Regine hat während der Bauphase immer das Lied vom Baggerführer Willibald gesungen, sie ist eine vehemente Verfechterin der Selbstverwaltung, hat allerdings vor anderthalb Jahren einen Zusammenbruch gehabt, Burn-out-Diagnose, und versucht seitdem, ihre Ansprüche runterzuschrauben. Dass ich jetzt, um zehn Uhr abends, noch Zimtwecken backe, würde sie verurteilen; sie findet, man könne auch mal mit leeren Händen auf eine Party gehen, aber ich backe wirklich gerne und außerdem sind meine Zimtwecken auf Tinkas Geburtstag Tradition.
Tinkas Geburtstag findet in der Regel im Freien statt, mit Wimpelketten und Himbeertorte, Waldmeistersirup und Wespen, und das eine Mal, das mir inzwischen zum Inbegriff von Tinkas Geburtstag geworden ist, war vor siebzehn Jahren ihr Vierundzwanzigster.
Eine Wiese im Park am Weißen See. Decken, Zimtwecken und achtundzwanzig Grad im Schatten. Badeanzüge, die wir auf dem Flohmarkt am Arkonaplatz gekauft hatten, wo wir jetzt aber nicht mehr hingehen, weil er nicht mehr das ist, was er mal war.
Nichts ist mehr so, wie es mal war, ja natürlich, und damals war ganz gewiss auch nicht alles gut. Aber irgendjemand kam auf die Idee, Hans-guck-dich-um zu spielen, und das taten wir mehrere Stunden lang.
Ich sehe Pit, wie er das Gesicht gegen die riesige Eiche gekehrt hat; wir anderen lauern in seinem Rücken, Matthias prescht vor, wird natürlich erwischt, muss zurück hinter die Linie.
Wir waren so viele bei der Party, dass manche auch nur baden oder Bier trinken konnten und immer noch genug übrig blieben, die sich mit Ehrgeiz und Ernst diesem Kinderspiel widmeten – das wie jedes Spiel nur Spaß machte, wenn man die Regeln beachtete und vorhatte zu gewinnen. Und ich bilde mir ein, dass ich während dieses Nachmittags, an dem wir immer abwechselnd »Hans« waren und uns barfuß an ihn heranpirschten, ohne auf die Ästchen und Pfirsichkerne zu achten, die uns in die Sohlen stachen, absolut und unbeirrbar froh war.
Ich weiß, dass das Quatsch ist. Nostalgische Verklärung im Nachhinein.
Ich war todunglücklich zu dieser Zeit; Matthias, mit dem ich alt werden und Kinder kriegen wollte, hatte mich zwei Wochen zuvor endgültig verlassen; unsere große WG, die mein eigentliches Wohnprojekt hätte sein sollen, hatte sich aufgelöst; Tinka war plötzlich viel enger mit Kerstin als mit mir befreundet; und Anne hatte sich mit dem Hinweis, dass ihr die familienähnlichen Verstrickungen in unserer Clique langsam auf die Nerven gingen, einen anderen Freundeskreis gesucht.
Trotzdem.
Tinkas Geburtstagsfeiern sind eine Institution, unangreifbare Höhepunkte, immer schon und bis heute.
Tinka weiß, wie man feiert.
Als Tinka klein war, hat ihre Mutter Marlies Faschingspartys für sie ausgerichtet – Fasching deshalb, weil Tinkas Geburtstag Anfang August ja stets in die Sommerferienzeit fiel. Zu den Ersatz-Geburtstagspartys im Februar wurde dann Tinkas gesamte Schulklasse geladen; zum einen, damit Tinka nicht in die Verlegenheit kam, auswählen und einzelne ausschließen zu müssen, zum anderen, damit das Haus ordentlich voll wurde. Dreißig Kinder mindestens, sonst wäre das für Marlies kein Fest, sondern Alltag gewesen. Ich selbst war nicht in Tinkas Klasse, ich kannte sie aus dem Kinderladen, aber statt dass ich mich fremd fühlte unter all den Klassenkameraden, war ich eine Art Ehrengast und wurde von Thomas Meining zum Tanzen aufgefordert, einem Jungen, der trotz seiner Weitsichtigen-Brille ganz oben auf der Beliebtheitsskala der Schulklasse stand. Dass ausgerechnet zwei Brillenträger zum Paar des Nachmittags gekürt wurden, war gewiss auch ein Resultat der integrativen Einladungspolitik von Tinkas Mutter. Es lief eine Kassette mit Kinderschlagern, Thomas und ich bekamen Medaillen aus Goldfolie umgehängt, wir schrien und tobten und hatten das ganze Haus für uns. Dachboden, Kinderzimmer, Elternschlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Arbeitszimmer, Küche, Keller und Flur. Darunter lief nichts für Tinkas Mutter, wir durften überallhin und alles machen, was wir wollten. Wir waren so viele, dass wir uns in Kleingruppen zusammentun und auf den verschiedenen Stockwerken verschanzen konnten, um dann brüllend aufeinander loszugehen – aber nur im Spiel, als Piraten oder Ritter. Am Ende versöhnten wir uns wieder und versammelten uns zu einer weiteren Runde Torte, Pudding und Schokoküssen; es war Tinkas Geburtstag, wir waren wild und glücklich und frei.
Inzwischen weiß ich natürlich, dass das Quatsch ist.
Anne, die in Tinkas Grundschulklasse ging, meint, dass sie sich schon damals immer gefragt habe, wer wohl hinterher das Haus wieder aufräume, und dass außerdem nicht Thomas Meining, sondern Ralf Wendrich der beliebteste Junge der Klasse gewesen sei, Mittelstürmer nämlich und im Tennisverein.
Trotzdem.
Tinkas Partys waren eine Institution, waren der Beweis, dass Tinka und ihre Geschwister frei aufwuchsen, dass ihre Eltern zu leben verstanden und Marlies alles anders machte, als Marlies’ Mutter früher mit ihr.
»My Mother / My Self« – ohne Marlies.
»Diese Welt ist veränderbar« – das war Marlies’ Traum, und der wurde wahr.
Marlies und meine Mutter waren zusammen im Kinderladen.
Ich weiß, das klingt seltsam, aber so muss man das sagen, denn der Kinderladen war in erster Linie ihr Ort und nur nachrangig der, an dem ihre Kinder betreut wurden.
In der Zeitung steht, dass die Eltern heutzutage durchdrehten, weil sie die Kinder nicht mehr für selbstverständlich nehmen, sondern zu ihrem Projekt machen würden, aber ich glaube nicht, dass das neu ist. Kinder sind die Zukunft, die unbeschriebenen Blätter, auf denen man als Eltern seine Ideen entwirft. Immer schon. Vielleicht gab’s früher noch keine Pränataldiagnostik und kein Kleinkindchinesisch, aber besser haben und besser machen sollten es die Kinder auch.
Wir zum Beispiel, wir sollten frei aufwachsen. Damit wir später keine Soldaten würden, keine Mörder oder Mitläufer. Wir sollten streiten lernen, uns nichts gefallen lassen, immer weiter nachfragen und so lange diskutieren, bis klar war, wer recht hatte –
Auf keinen Fall sollten wir begrenzt werden von irgendwelchen Konventionen, erwachsener Scham oder Anstandsregeln.
»Pippi Langstrumpf«, erschienen 1949.
Marlies hat Astrid Lindgren wörtlich genommen und das Einfamilienhaus in Stuttgart zur Villa Kunterbunt gemacht. Marlies ist entgangen, dass Pippi in der Villa nicht mit anderen Leuten, sondern alleine mit ihrem Pferd und einem Affen wohnte, der Vater weit weg, die Mutter von vornherein tot. Dass es schwierig ist, als Mutter etwas nachzustellen, worin für einen selbst keine Rolle vorgesehen ist, ist mir aber erst aufgefallen, als ich selbst Mutter wurde. Erst heute ist mir klar, dass Marlies das überkommene Bild der hierarchisch organisierten, gesitteten Familie ersetzt hat durch das Bild einer anarchischen Wohngemeinschaft mit Tieren – in dem Glauben, dass daraus Kinder hervorgehen würden, die Zauberkräfte besäßen. Kein Wunder, dass das nicht geklappt hat.
Man darf literarische Utopien nicht wörtlich nehmen, doch ich werde mich hüten, undankbar zu sein. Es war toll damals, zumindest für uns Kinder. Ich bin gerne bei Tinka gewesen, ich habe Marlies geliebt und die Kinderladenzeit war die beste meines Lebens.
Was dann passiert ist –
Ich knete meinen Hefeteig.
Morgen ist Tinkas Geburtstag, und ich freue mich darauf.
Alle werden da sein, von den alten Kinderladenfreunden über die Klassenkameraden und Kommilitonen bis hin zu den neuen Kitabekannten und Ehepartnern. Tinka hält fest an der Tradition, ihren Geburtstag im ganz großen Rahmen zu feiern. Tinka weiß, wie man feiert, Tinka lässt sich das nicht nehmen. Und ich bestehe auf der Tradition, zu Tinkas Geburtstag Zimtwecken zu backen! Auch zu ihrem Achtzigsten werde ich noch Zimtwecken beisteuern, denjenigen will ich sehen, der mich daran hindert –
Hoffentlich kommt Regine heute Abend nicht mehr rauf.
Im Gemeinschaftshaus sind die Türen offen; wenn Regine kommt, muss ich sie reinlassen, muss mir ihr spöttisches Grinsen gefallen lassen: »Na Sandra? Backst du Zimtwecken? Denkst du, du darfst ohne morgen nicht auf Tinkas Party?«
Nein, das denke ich nicht.
Ich denke, dass es schön ist, an Traditionen festzuhalten. Warum soll ich, verdammt noch mal, das Backen aufgeben? Es ist nichts Schlechtes daran, für andere zu sorgen. Und der Teig ist wirklich gut geworden.
Die Füllung wird auch gut, nur der Ofen ist ein Problem, heizt hinten stärker als vorne.
Ich muss das Blech zwischendurch einmal umdrehen, das darf ich nicht vergessen, sonst sind die hinteren nachher verbrannt.
Ansonsten ist alles in Ordnung.
Es geht uns gut, es geht mir immer noch besser als Isa. Ich habe Freunde, ich habe dieses Haus, ich habe es hinbekommen, für meine Kinder einen Ort zu schaffen, an dem sie frei und ungehindert aufwachsen können –
Es klopft.
»Hab’ ich doch richtig gerochen. Du backst.«
Ich lache und beeile mich, Regine ein Glas Wein einzuschenken. Das ist nämlich die wahre Kunst: lässig zu bleiben beim Kochen und Backen, genauso wie bei der Kinderaufsicht und allen anderen mütterlichen Aufgaben. Sich zweizuteilen, in Wahrheit über wichtigere Dinge nachzudenken, sich mit Freunden zu unterhalten, Wein zu trinken, Utopien zu entwerfen. Alles gleichzeitig zu machen und zu sein.
Regine mustert mich eindringlich.
Laut Regine ist die Hälfte unserer Nachbarinnen akut vom Burn-out bedroht – alle die, die Kinder haben.
»Alle!«, sagt sie. »Außer vielleicht Maren.«
Sie sitzt am Esstisch, die Füße auf Bos Tripp-Trapp-Stuhl; ich lehne am Küchenblock und behalte unauffällig die Zimtwecken durch das Backofenfenster im Auge.
»Ach«, sage ich. »Und warum Maren nicht?«
»Maren hat ein dickes Fell. Die weiß, wie man Arbeit delegiert. Außerdem vergleicht sie sich nicht, das ist ihr Vorteil.«
Ich nicke. Das ewige Vergleichen ist wirklich ein Problem. Aber führt es nicht auch zu Entlastung? Dass ich mich beispielsweise damit trösten kann, dass es mir immer noch besser geht als Isa? Dass ich zumindest nicht so runtergewirtschaftet bin wie Regine?
»Maren vergleicht sich auch«, sage ich. »Die findet zum Beispiel, dass sie ihre Kinder besser im Griff hat als wir unsere.«
»Na gut«, sagt Regine, »ich präzisiere: Maren vergleicht sich nur da, wo sie von vornherein im Vorteil ist.«
»Und warum ist sie bei den Kindern im Vorteil?«
»Weil sie Mädchen hat, natürlich!«
»So ein Quatsch. Ich habe auch ein Mädchen. Und ich hab’ mit Lina noch mehr Kummer als mit Bo.«
»Ja. Du!« Regine grinst überlegen. »Weil du dich davor fürchtest, dass sie genau so wird wie deine Schwester.«
Es ist hoffnungslos, mit Regine zu streiten. Sie kennt mich, seit wir Kinder waren.
Sie sitzt da und trinkt ihren Wein und knibbelt an den eingewachsenen Härchen an ihren Beinen; sie weiß, wie ich zu der wurde, die ich bin, weiß um die ewigen Streits meiner Schwester mit meiner Mutter damals – Sie hat selbst eine Schwester, die ständig mit ihrer Mutter im Clinch lag. Außerdem ist sie neidisch, weil ich eine Tochter habe und sie nicht. Weil ich Zimtwecken backen kann, die so luftig und locker gelingen wie bei schwedischen Hausfrauen, weil es bei uns in der Wohnung riecht wie in Bullerbü und auf Saltkrokan, wie bei Tinka zu Hause, als Marlies noch backen konnte –
»Okay, du hast recht«, sage ich. »Es ist schlecht, sich zu vergleichen.«
Regine nickt.
»Und wie schaffst du es, es nicht zu tun?«
»Schaff’ ich ja nicht. Aber ich versuch’s zumindest.«
»Ach«, sage ich. »Ausgerechnet hier im Haus.«
Regine lacht. »Es gibt keinen besseren Ort, um zu üben.«
In der Nacht träume ich von Tinkas Geburtstag.
Alle alten Freunde sind da und auch Tinkas Eltern, Marlies und Wolfgang.
Marlies sieht aus wie früher. Sie trägt eins dieser alten Herrenhemden und Clogs; so liefen sie rum damals, Marlies und meine Mutter: Herrenhemden oder indische Kleider, bequeme Schuhe, Feinrippunterwäsche. Dazu rauchten sie ununterbrochen Lord Extra.
Jetzt ist meine Mutter tot, und Marlies kommt unter Garantie auch nicht zu Tinkas Geburtstag; Marlies ist seit über zwanzig Jahren krank und geht nirgendwo mehr hin.
Aber im Traum ist sie so alt wie Tinka und ich jetzt, da sind wir alle zusammen und miteinander befreundet – schön ist es trotzdem nicht, denn ich traue mich nicht, mit jemandem zu reden. Mein Mund ist trocken und ich fürchte, dass ich Mundgeruch habe. Ich will nicht, dass jemand sich davon belästigt fühlt, also drehe ich mich weg, sobald man sich mir nähert, spreche allenfalls zur Seite, sodass mich niemand versteht.
Als ich aufwache, merke ich, dass mein Mund tatsächlich wie ausgedörrt ist. Wenn ich aufstehe und etwas trinke, kann ich vielleicht zurückkehren in den Traum und Marlies ansprechen, aber meistens funktioniert das nicht, lässt ein Traum sich nicht einfach so weiterträumen.
2
Das Kuchenbuffet ist wirklich beeindruckend.
Im Mittelpunkt steht eine stolze, mehrstöckige Himbeertorte; gar nicht so einfach, die bei der Hitze und dem Tiefdruckwetter hinzukriegen, dauernd gerinnt die Sahne, lässt sich nicht steif schlagen, aber unsereins hat ja – im Gegensatz zu vielen anderen auf der Welt – unbegrenzte Wiederholungschancen. Nur fünfunddreißig Cent der Becher Schlagsahne bei Penny, was soll’s also, und beim vierten Versuch gelingt es dann auch. Zudem gedeckter Apfelkuchen nach Marlies’ altem Rezept, Käsekuchen, Schokomuffins, meine Zimtwecken! – ich stelle sie mit Schwung aufs Buffet.
Tinka kommt und nimmt mich in die Arme.
Robert hat eine Flasche Prosecco in der Hand und schenkt aus, Hendrik hält sich mit unseren Kindern im Hintergrund. Bo will noch nicht aus dem Fahrradsitz raus, und sogar Lina fremdelt – obwohl sie eigentlich das perfekte Erwachsenen-Kind ist, zwar erst neun, aber immer für ein intellektuelles Pläuschchen zu haben. Doch der Ort hier ist ganz neu: Roberts aktueller Arbeitsplatz.
Robert hat beschlossen, endlich wieder richtig Kunst zu machen; seit Wochen erzählt Tinka von seinem neuen Atelier. Früher haben hier wohl mal Konserven gelagert, jetzt hat ein Freund von Robert das ganze Geviert für fünf Jahre gemietet – malerisch verfallene Remisen, lauschig bewachsener Innenhof, mitten im Wedding, der im Kommen ist, aber doch nicht allzu sehr.