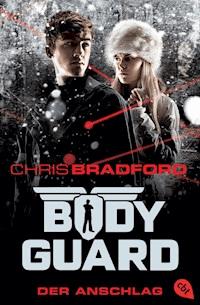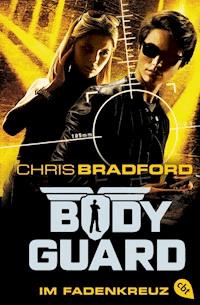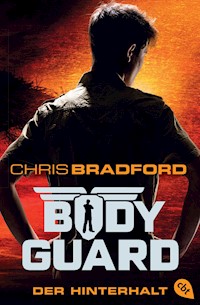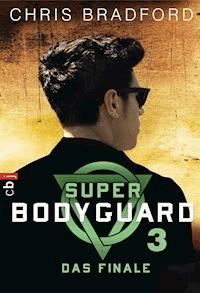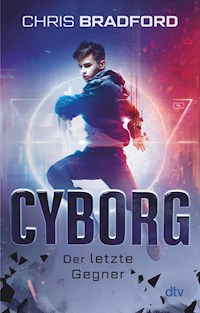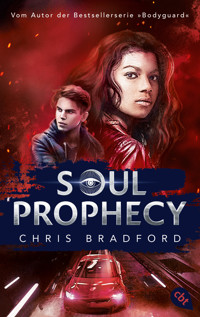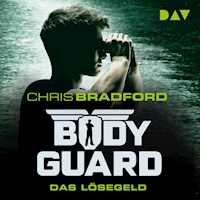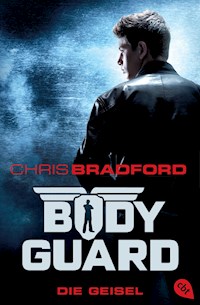
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Bodyguard-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Ein knallharter Schutzengel auf einer riskanten Mission
Ein 14-jähriger Junge als Bodyguard? Das glaubt doch kein Mensch! Eben deshalb ist Connor Reeves bei seinen Inkognito-Einsätzen so erfolgreich. Sein erster Auftrag führt ihn direkt ins Zentrum der Macht: Er soll die Tochter des amerikanischen Präsidenten beschützen. Allerdings darf Alicia nicht merken, dass er in Wahrheit Personenschützer ist. Denn die Präsidententochter hat die Nase voll von dem goldenen Käfig, in dem sie sitzt, und entwischt den Beamten des Secret Service immer wieder. Eines Tages jedoch gerät sie ins Visier einer terroristischen Schläferzelle. Und plötzlich ist sie doch froh, dass ein Bodyguard an ihrer Seite ist: Denn Connor entpuppt sich als stahlharte Kämpfernatur.
Erfolgsgarant Chris Bradford liefert mit "Bodyguard" kugelsichere Action kombiniert mit explosiven Showdowns.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 500
Ähnliche
DER AUTOR
©Danny Fitzpatrick
CHRISBRADFORDrecherchiert stets genau, bevor er mit dem Schreiben beginnt: Für seine neue Serie »Bodyguard« belegte er einen Kurs als Personenschützer und ließ sich als Leibwächter ausbilden. Bevor er sich ganz dem Bücherschreiben widmete, war Chris Bradford professioneller Musiker und trat sogar vor der englischen Königin auf. Seine Bücher wurden in über zwanzig Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Chris Bradford lebt mit seiner Frau, seinen beiden Söhnen und zwei Katzen in England.
Mehr Informationen zur Bodyguard-Serie unter:
www.cbj-verlag.de/bodyguard
CHRISBRADFORD
DIE GEISEL
Aus dem Englischen von
Karlheinz Dürr
Für Zach und Leo
Möget ihr einander ein Leben lang beschützen …
PROLOG
Der Fahrer trat das Gaspedal hart durch. Er packte das Lenkrad mit solcher Kraft, dass seine Handknöchel weiß hervortraten. Der gewaltige Motor des Humvee brüllte auf. Das gepanzerte Fahrzeug beschleunigte und schoss über den zerbombten Asphalt.
Die beiden Insassen im Fond starrten schweigend auf die von Einschlagkratern übersäte Autobahn hinaus, die sich wie die zerfetzte Haut einer toten Schlange bis zum Horizont erstreckte. An den Seitenfenstern flog die karge irakische Landschaft vorbei – höllische Bilder eines vom Krieg zerrissenen Landes. Ausgetrocknete Felder, übersät mit Müll, verkohlte Skelette ausgebrannter Fahrzeuge, Häuser halb in Ruinen, die Mauern von unzähligen Einschusslöchern durchsiebt … und dazwischen immer wieder die gehetzten, gequälten Gesichter irakischer Kinder, die die Abfall- und Trümmerhaufen durchstöberten.
Der weibliche Passagier, eine junge Botschaftsassistentin mit gepflegten blonden Haaren, blickte mit weit aufgerissenen Augen auf die trostlose Landschaft. Ihr sonst so frisches, unbekümmertes Gesicht war starr vor Entsetzen. Mit zitternder Hand wischte sie sich eine Träne von der Wange. Der Mann neben ihr, ein groß gewachsener Hispanoamerikaner mit ausgeprägten Wangenknochen und dunkelbraunen, scharf blickenden Augen, hatte sich besser im Griff. Doch auch seine Hände hatten sich in die Armstützen verkrampft und verrieten seine innere Anspannung.
Nur der Bodyguard saß äußerlich unbewegt auf dem Vordersitz, angeschnallt, dasMP5-Maschinengewehr quer über dem Schoß. Es war bei Weitem nicht seine erste Fahrt auf dieser Straße, und bisher hatte er alle heil überstanden. Aber das machte ihm diese Fahrt nicht leichter. Die Strecke war nicht einmal zwölf Kilometer lang, verlief aber in einem weit geschwungenen Bogen und war die einzige große Verkehrsader, die den internationalen Flughafen von Bagdad mit der Grünen Zone verband – dem rund zehn Quadratkilometer großen, festungsähnlich gesicherten Sperrbezirk mitten im Herzen von Bagdad, in dem sich die wichtigsten Militär- und Regierungseinrichtungen befanden. Das machte die sogenannte Route Irish zum gefährlichsten Autobahnabschnitt der Welt – ein monumentaler Schießstand für Terroristen und Aufständische. Sich auf diese Straße zu wagen, war fast selbstmörderisch.
Und heute ist der Einsatz noch höher, dachte der Bodyguard und warf einen kurzen Blick über die Schulter auf den neu ernannten amerikanischen Botschafter im Irak. Gewöhnlich setzten die Amerikaner für den Transport hochrangiger Amtsträger Hubschrauber ein, aber heute herrschte heftiger, böiger Wind, und ein Sandsturm war angekündigt worden, sodass alle Fluggeräte auf dem Boden hatten bleiben müssen.
Unablässig ließ der Leibwächter den Blick durch die kugelsicheren Scheiben über das Terrain streifen, das sich ringsum erstreckte. Vor und hinter dem Fahrzeug donnerten noch drei weitere Humvees über den Asphalt; zusammen bildeten sie eine eindrucksvolle Militäreskorte. Sämtliche Fahrzeuge strotzten vor Waffen: fest montierte schwere M2-Maschinengewehre und MK19-Maschinengranatwerfer. Ein Humvee raste vor dem Konvoi her und trieb sämtliche zivilen Fahrzeuge zur Seite, wenn sie nicht schnell genug freiwillig Platz machten.
Eine Unterführung kam in Sicht. Der Bodyguard spannte sich. Das war die ideale Stelle für einen Überfall. Am Abend zuvor hatte natürlich ein Spezialtrupp die Brücke genauestens auf IEDs untersucht, wie die »Improvised Explosive Devices« oder »unkonventionellen Sprengfallen« im Militärjargon kurz genannt wurden. Aber das hieß noch lange nicht, dass sämtliche Sprengfallen entdeckt worden waren. Instinktiv tastete er nach dem Schlüsselanhänger in seiner Tasche. Er trug ihn immer und überall bei sich. Der Anhänger zeigte das Foto eines achtjährigen Jungen, der fröhlich in die Kamera grinste – sein Sohn. Der Bodyguard strich mit dem Finger über den Anhänger und schwor sich – wie immer in gefährlichen Situationen –, dass er diese Fahrt überleben würde, und sei es nur für seinen Sohn.
Die Brückenpfeiler waren bedeckt mit Graffiti, aber der Bodyguard bemerkte sie kaum. Er konzentrierte sich voll und ganz darauf, nach »Spähern« Ausschau zu halten, während die Kolonne unter der Brücke durchraste – vorgeschobenen Beobachtern, die sofort zum Handy griffen, sobald der Konvoi an ihnen vorbeibrauste, um ihn den irgendwo weiter vorn an der Straße auf der Lauer liegenden Rebellen zu melden. Überhaupt konnte man mit einem Anruf vom Mobiltelefon alles Mögliche bewirken: ein mit Sprengstoff vollgestopftes geparktes Auto in die Luft jagen, eine Sprengfalle am Straßenrand auslösen, ein Drive-by-Shooting aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug oder sogar einen Beschuss mit Mörsern oder Panzerfäusten veranlassen. Das alles und noch mehr hatte der Bodyguard schon selbst erlebt, und die meisten Angriffe hatten tragisch geendet.
Als sie auf der anderen Seite aus der Unterführung herauskamen, hörte er den Fahrer erleichtert aufseufzen. Der Humvee beschleunigte erneut und raste weiter auf die Grüne Zone zu. Der Bodyguard konzentrierte sich wieder auf die Beobachtung der Umgebung – er suchte nach allen Anzeichen von Gefahren im Verkehr, an den Baumstümpfen auf dem Mittelstreifen, in den Gebäuden an der Südseite der Straße. Und auf der Überführung und den Auffahrrampen des Autobahnknotens, dem sie sich nun näherten.
»Sieht nicht gut aus«, knurrte der Fahrer, als der Konvoi nur noch im Schneckentempo vorankam. Weiter vorne hatte sich ein Stau gebildet; der Verkehr kam zum Stillstand.
Aus dem HF-Funkgerät kam plötzlich eine Stimme. »Tango eins an Tango drei. Unfallbedingter Stau voraus.«
Der Teamleader, der im hinteren Fahrzeug saß, antwortete sofort. »Tango eins, hier ist Tango drei. Durchstoßen. Auf den Mittelstreifen ausweichen.«
Der führende Humvee näherte sich dem Ende der Fahrzeugschlange. Als er auf die Bordsteinkante fuhr, fiel dem Bodyguard plötzlich ein toter Hund auf, der am Straßenrand lag. Der Kadaver, der in der Sonne verweste, wirkte unnatürlich aufgebläht.
Gerade als sie sich dem Hund näherten, entdeckte der Bodyguard einen Mann, der auf der Überführung stand, ein Mobiltelefon an das Ohr gepresst. Die Instinkte des Leibwächters lösten sofort Alarm aus. Er packte das Lenkrad und riss es hart nach rechts herum. Der geschockte Fahrer warf ihm einen wütenden Blick zu, als der Humvee über den Straßenrand schoss.
Einen Sekundenbruchteil später explodierte die Sprengfalle – der Hund. Der führende Humvee verschwand in einem Feuerball.
Wie von einer gewaltigen Faust wurde der Humvee, in dem der Botschafter saß, von der Druckwelle geschüttelt. In Todesangst schrie die junge Frau auf, als eine Feuerwalze auf Tango zwei zurollte. Der Bodyguard verlor nicht die Nerven; sein Blick huschte über die Umgebung … und tatsächlich entdeckte er aus dem Augenwinkel das verräterische Aufleuchten einer raketengetriebenen Granate, die von einem Wohnblock in der Nähe abgefeuert worden war.
»LOS! LOS! LOS!«, brüllte er den Fahrer an.
Der Soldat kickte das Gaspedal bis zum Anschlag durch; der Motor protestierte mit wütendem Aufheulen. Sie schossen voran, aber es war schon zu spät. Die Granate traf das Heck des Humvee und explodierte. Obwohl der Humvee über zweieinhalb Tonnen wog, wurde er wie ein Spielzeugauto hochgeschleudert. Die Insassen wurden wie Stoffpuppen herumgewirbelt. Der Humvee landete mit urgewaltigem Krachen auf der Fahrerseite. Sofort füllte sich das Innere mit Rauch und dem scharfen Gestank von brennendem Diesel, Gummi und Lack.
Die Ohren des Leibwächters klirrten; mühsam versuchte er sich zu orientieren. Er stemmte sich gegen den Sitz und drehte sich zum Botschafter um. Der Humvee war zwar mit einer zusätzlichen Panzerung ausgestattet, um Anschlägen widerstehen zu können, aber ein direkter Granattreffer richtete trotzdem katastrophale Schäden an. Dem Bodyguard war vollkommen klar, dass ein zweiter Treffer das Ende bedeuten würde.
»Sir! SIR!«, brüllte er, konnte aber den Botschafter durch den dichten Rauch nur schemenhaft sehen. Heftig wedelte er die Schwaden beiseite. »Sind Sie verletzt?«
Der Botschafter war benommen, aber bei Bewusstsein; er schüttelte den Kopf.
»Wir müssen hier raus! Sofort!«, schrie der Leibwächter, griff nach hinten und löste den Sicherheitsgurt des Politikers. Er tippte dem Fahrer auf die Schulter. »Sie kümmern sich um die Frau!«
Doch der Fahrer reagierte nicht. Sein Kopf war mit ungeheurer Gewalt gegen die Windschutzscheibe geschmettert worden. Er war tot.
Der Bodyguard fluchte und versuchte, die Beifahrertür aufzustoßen. Aber obwohl er das volle Körpergewicht dagegenrammte, gelang es ihm nicht. Die Gewalt der Explosion hatte den schweren gepanzerten Aufbau des Humvee verbogen; die Tür war fest verkeilt. Sie saßen in der Falle – wie Sardinen in der Büchse.
Der Bodyguard bückte sich nach seiner Waffe, die neben seinen Füßen lag. Er betete, dass die Scheiben nur in einer Richtung kugelsicher waren, wie er es verlangt hatte.
»Bedecken Sie Ihr Gesicht!«, befahl er dem Botschafter.
Er richtete die Mündung direkt auf die Scheibe und feuerte mehrere Salven ab. Das Glas explodierte nach draußen. Der Bodyguard kickte die Reste der Scheibe aus dem Rahmen. Der Rauch quoll hinaus. Er kroch durch das Fenster.
Draußen war ein heftiges Feuergefecht im Gange. Ohrenbetäubende Granatenexplosionen und das Rattern schwerer Maschinengewehre mischten sich mit dem gewaltigen Donnern der Mörser. Dichter schwarzer Rauch lag über der Straße; Kugeln zischten vorbei.
Der Bodyguard half dem Botschafter durch das Fenster und zog ihn schnell hinter das Fahrzeug in Deckung.
»Hayley!« Der Botschafter deutete auf seine Assistentin, die schlaff auf dem Rücksitz hing. Er schaute den Leibwächter flehend an.
Aber der hatte bereits gesehen, dass es für sie zu spät war. Die junge Frau hatte die volle Wucht der raketengetriebenen Granate abbekommen.
Er schüttelte bedauernd den Kopf. »Sie ist tot.«
Dann schützte er den Botschafter mit seinem Körper und winkte das Begleitteam herbei. Der Fahrer des hinteren Humvee hatte sie bereits entdeckt und lenkte sein Fahrzeug in ihre Richtung. Eine weiße Limousine näherte sich von hinten mit großer Geschwindigkeit. Bevor ein Ausweichmanöver möglich war, schwenkte das weiße Auto auch schon direkt neben den Humvee ein. Eine Sekunde später explodierte es. Die Explosion war so gewaltig, dass der Humvee völlig vernichtet wurde – mit der gesamten Besatzung und ohne jede Hoffnung auf Rettung oder auf Überlebende.
Der Bodyguard brauchte jetzt keine weiteren Beweise mehr: Ihm war bereits klar geworden, dass das ein sorgfältig koordinierter Anschlag war. Ein gleichzeitig durchgeführter Angriff mit IEDs, RPGs und Selbstmordattentätern konnte nur eins bedeuten: Die Attentäter hatten über die Route genau Bescheid gewusst, die der Botschafter nehmen würde, und alles darangesetzt, ihn zu ermorden.
Der Botschafter befand sich in höchster Lebensgefahr; dem Bodyguard war klar, dass er sich unter diesen Umständen nicht mehr an das Standardverfahren halten konnte, wenn er seinem Klienten das Leben retten wollte. Der Humvee war nicht mehr fahrbereit; es konnte nur noch Sekunden dauern, bis er von einer weiteren Granate getroffen wurde.
»Wir sitzen hier auf dem Präsentierteller«, sagte der Leibwächter. »Können Sie rennen?«
»Hab an der Uni mal den 400-Meter-Lauf gewonnen«, gab der Botschafter zurück.
»Halten Sie sich dicht hinter mir. Tun Sie genau, was ich sage. Wir müssen uns in die Unterführung retten.«
Als Deckungsfeuer gab er eine Salve ab. Dann packte er den Botschafter, deckte ihn mit dem eigenen Körper und rannte mit ihm über das ungeschützte Straßenstück. Während sie liefen, flogen ihnen Kugeln mit lautem Überschallknall um die Köpfe.
Sekunden später krachte es hinter ihnen, als eine RPG in den Humvee einschlug. Die Wucht der Druckwelle schleuderte beide Männer zu Boden. Vollgepumpt mit Adrenalin, riss der Bodyguard den Botschafter wieder auf die Füße.
Er zerrte ihn zu einem stark verbeulten BMW, hinter dem sie in Deckung gingen. Rasch checkte er ihre Lage. Die Besatzung im letzten verbliebenen Humvee versuchte sich mit allen Waffen gegen das feindliche Feuer zu wehren. Ein paar Iraker, die sich noch nicht in die Unterführung hatten retten können, kauerten hinter ihren Fahrzeugen. Der Bodyguard wusste, dass die meisten unschuldige Zivilisten waren, aber trotzdem hielt er sein MG schussbereit auf sie gerichtet. Ein einziger Aufständischer reichte, um den Botschafter zu töten.
Vorsichtig spähte er über die Kühlerhaube und entdeckte ein schwarzes SUV mit dunkel getönten Scheiben. Der Wagen raste eine der nächsten Abfahrten hinunter. Im selben Augenblick ging das Beifahrerfenster herunter und der Lauf einer Waffe erschien. Die Mündung zielte genau in ihre Richtung.
Schon wurde der BMW von einem heftigen Kugelhagel durchsiebt. Sämtliche Scheiben implodierten. Der Bodyguard warf sich über den Botschafter und deckte ihn gegen die tödlichen Schüsse. Der Wagen bekam den größten Teil des Kugelhagels ab, Salve um Salve schlug durch die Karosserie. Dann ließ das Trommelfeuer plötzlich nach: Der MG-Schütze im letzten Humvee hatte seine Waffe auf das SUV der Rebellen gerichtet und ihn mit so massivem Sperrfeuer belegt, dass die Angreifer gezwungen waren, sich gegen den Beschuss vom Humvee zu wehren.
»Wir dürfen uns hier nicht festnageln lassen«, murmelte der Bodyguard und rollte sich vom Botschafter herunter.
Gebückt schlängelten sie sich zwischen den dicht stehenden Autos hindurch und liefen auf die Unterführung zu. Ein Kugelhagel folgte ihnen. Kaum hatten sie den Schutz der Unterführung erreicht, als sich der Bodyguard auch schon nach einem Auto umblickte, das nicht in der Fahrzeugschlange hinter dem offenbar inszenierten Unfall feststeckte. Er entdeckte einen silberfarbenen Mercedes, der ziemlich weit vorne in der Autoschlange stand.
Eine MG-Salve schlug in die Seitenmauern der Unterführung ein. Querschläger jaulten, Betonstaub wirbelte durch die Luft. Die entsetzten Schreie der Menschen hallten durch die Unterführung.
»Sie verfolgen uns!«, schrie der Botschafter und blickte sich besorgt um.
Der Bodyguard stieß den Botschafter vor sich her, während er gleichzeitig das Feuer erwiderte. Immer hielt er sich zwischen den Angreifern und seinem Klienten.
Sie rannten im Zickzack zwischen den Fahrzeugen hindurch und hatten den Mercedes fast erreicht, als der Botschafter so abrupt stehen blieb, dass der Bodyguard gegen ihn prallte.
»Weiter!«, schrie der Bodyguard.
Doch dann sah auch er den Mann, der plötzlich vor ihnen aufgetaucht war.
Er trug Jeans und ein T-Shirt; das Gesicht wurde halb von einem rot-weiß gemusterten Kopftuch verborgen. Und er hielt ein AK47-Sturmgewehr in den Händen. Die Mündung zielte genau auf den Botschafter. Sein Finger am Abzug krümmte sich.
Instinktiv warf sich der Bodyguard vor den Botschafter, stieß ihn beiseite und deckte ihn mit dem eigenen Körper.
Der Angreifer feuerte.
Der Botschafter sah, dass sein Beschützer von den Kugeln getroffen, rückwärts zu Boden geschleudert wurde und reglos liegen blieb.
Der Bodyguard hatte das ultimative Opfer erbracht, um ihn zu retten.
Aber es war umsonst gewesen. Der Rebell trat ganz nahe an den Botschafter heran und hielt ihm die noch rauchende Mündung direkt vor das Gesicht.
»Jetzt bist du dran, Ungläubiger!«, zischte der Angreifer.
»Du kannst mich ermorden, aber die Hoffnung lebt weiter!«, gab der Botschafter zurück und starrte den Angreifer herausfordernd an.
Eigentlich hätte der Bodyguard auf der Stelle tot sein müssen, aber seine kugelsichere Weste hatte ihn vor dem Schlimmsten bewahrt. Zwar war er kaum bei Bewusstsein, aber seine Ausbildung war ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Und dieses Training befahl ihm nun zu reagieren. Die MP5 war ihm aus den Händen geglitten, deshalb zog er eine SIG Sauer P228 aus dem Gürtel und erschoss den Rebellen aus nächster Nähe.
Der Mann schlug schwer auf den Boden, während sich der Bodyguard mühsam aufrichtete, erst auf die Knie, dann auf die Füße. Arme und Beine kamen ihm schwer wie Blei vor und in seinem Mund sammelte sich eine dicke, nach Kupfer schmeckende Flüssigkeit. Kein gutes Zeichen.
»Sie leben!«, rief der Botschafter erstaunt und stützte ihn beim Aufstehen.
Der Bodyguard taumelte zum Mercedes und riss die Tür auf. Der Fahrer hatte in Todesangst die Flucht ergriffen, aber den Schlüssel im Zündschloss stecken lassen.
»Steigen Sie ein. Ducken Sie sich, so tief wie möglich«, befahl der Bodyguard dem Botschafter. Keuchend rang er nach Atem.
Mit zitternden Händen fummelte er am Zündschlüssel herum, betete, dass der Wagen sofort anspringen würde. Im selben Augenblick implodierte das Rückfenster unter einer Gewehrsalve. Der Motor sprang an, der Bodyguard trat das Gaspedal durch und der Wagen schoss aus der Unterführung auf die Route Irish hinaus. Auf der Brücke ratterte ein MG los und die Kugeln hagelten auf die Straße herab. Der Bodyguard riss das Lenkrad herum; der Wagen scherte kurz seitwärts aus, um den Kugeln auszuweichen, dann trat der Bodyguard das Gaspedal wieder voll durch und raste die Straße entlang. Der Mercedes schwankte heftig, als der Bodyguard zwischen den Granatenkratern hindurchkurvte. Sie rasten aus der Überfallszone und dann endlich verklangen die Schüsse hinter ihnen.
»Sie sind schwer verletzt!«, rief der Botschafter und starrte entsetzt auf das Blut, das vom Fahrersitz tropfte.
Der Bodyguard reagierte kaum; es kostete ihn den gesamten Rest seiner Kraft, seine Aufgabe zu Ende zu bringen.
Nach einer Weile näherten sie sich dem ersten Checkpoint, der gegen Sprengsätze gesichert war und wie ein sicherer Hafen wirkte. Er nahm den Fuß vom Gaspedal, denn die Wärter konnten nicht wissen, dass er den Botschafter im Wagen hatte; wenn sich der Mercedes zu schnell näherte, würden sie wahrscheinlich nicht zögern und das Feuer eröffnen. Kurz vor der Barriere hielt er an, bedeutete dem Botschafter auszusteigen und begleitete ihn die letzten paar Schritte bis zur Schranke.
Keine Sekunde lang hatte seine Aufmerksamkeit nachgelassen. Doch während er sich immer noch nach möglichen Bedrohungen umsah, geriet er ins Stolpern, taumelte noch einen Schritt weiter. Seine Kampfkleidung war blutgetränkt.
»Sie müssen sofort ins Krankenhaus!«, befahl der Botschafter und packte ihn am Arm.
Der Bodyguard blickte benommen auf seine blutige Kleidung hinab. Erst jetzt, als sich der Adrenalinspiegel senkte, verspürte er die Schmerzen.
»Zu spät dafür«, murmelte er mit schmerzverzerrtem Gesicht.
Blauhelmsoldaten rannten herbei und bildeten sofort einen Schutzring um die beiden Ankömmlinge.
»Sie sind jetzt in Sicherheit, Sir«, sagte der Bodyguard und brach vor den Füßen des Botschafters zusammen. Seine Hand hielt einen kleinen, blutverschmierten Schlüsselring umklammert.
KAPITEL 1
Sechs Jahre danach …
Der Faustschlag erwischte Connor völlig unvorbereitet. Ein kurzer, knallharter Aufwärtshaken, der ihm fast den Kiefer ausrenkte. Sterne blitzten in seinen Augen auf; er taumelte zurück. Nur blanker Instinkt rettete ihn, sonst hätte ihn die linke Gerade, die sofort dem Haken folgte, auf den Boden geschickt. Connor blockte den Schlag mit dem Unterarm ab und antwortete mit einem Kick gegen den Oberkörper des Gegners. Aber er war angeschlagen und dem Kick fehlte die nötige Kraft.
Der Angreifer, ein Fünfzehnjähriger mit Rastazöpfchen und einem durchtrainierten Oberkörper, der wie aus Stein gemeißelt schien, hatte kein Problem, den Kick abzuleiten. Sofort drang er mit kalter Wut auf Connor ein. Connor riss die Fäuste hoch, um sich gegen die schnelle Schlagkombination zu schützen, die nun auf ihn niederging.
»LOS, JET! SCHLAG IHN K.O.!«
In Connors Ohren klangen die Rufe der Menge wie ein einziger, urgewaltiger Aufschrei, während Jets Schläge auf ihn einprasselten. Connor tauchte weg, duckte sich, zuckte zurück, um dem brutalen Angriff auszuweichen. Aber Jet trieb ihn unerbittlich vor sich her in die Ecke.
Dann schrillte die Glocke durch das Gebrüll und der Schiedsrichter trat zwischen die Kämpfenden. Jet starrte Connor an, wütend, dass er seinen Vorteil nicht mehr ausnutzen konnte.
Connor kehrte in seine Ecke zurück. Vierzehn, mit kurz geschnittener brauner Igelfrisur, blaugrünen Augen und einem athletischen Körper – den er acht Jahren intensivem Kampfsporttraining zu verdanken hatte. Er spuckte den Mundschutz aus und nahm dankbar die Wasserflasche, die ihm Dan hinhielt.
Sein Trainer war ein Mann mit kahlem Kopf, eng beieinanderstehenden Augen und einer platten Nase, die offensichtlich mehr als nur einmal einen Treffer abgekommen hatte. Im Moment sah Dan nicht sehr zufrieden aus.
»Nimm die Deckung hoch, verdammt!«, schimpfte er.
»Jet ist so schnell mit den Fäusten«, keuchte Connor zwischen zwei großen Schlucken Wasser.
»Aber du bist schneller«, sagte Dan unbeirrbar. »Der Meistertitel gehört dir, aber du musst ihn dir holen. Statt Jet freundlich das Kinn hinzuhalten.«
Connor nickte. Er raffte seine letzten Kraftreserven zusammen, schüttelte die Arme und atmete ein paarmal tief ein und aus. Jeder einzelne Muskel brannte wie Feuer. Die Gelenke fühlten sich steif an. Nach den sechs Kämpfen in den Vorausscheidungen war er hundemüde. Aber er hatte so lange und so hart für den »Battle of Britain«-Wettkampf trainiert, dass er jetzt, so kurz vor dem Ziel, nicht einfach aufgeben konnte.
Dan wischte Connor mit dem Handtuch den Schweiß vom Gesicht. »Siehst du den Burschen dort in der zweiten Reihe?«
Connor warf einen Blick auf den Mann – Ende vierzig, silbergraues, militärisch kurz geschnittenes Haar. Er saß ruhig mitten unter den aufgeregten Zuschauern, die der letzten Runde entgegenfieberten. Der Mann hielt das Turnierprogramm in der Hand und beobachtete Connor unauffällig.
»Er ist der Manager eines Kickbox-Stalls. Sucht nach neuen Talenten.«
Connor verspürte plötzlich einen neuen Energieschub – und zusätzlichen Erfolgsdruck. Das könnte seine große Chance sein, endlich in die internationale Kickboxszene aufzusteigen, wo um die großen Weltmeistertitel gekämpft wurde und man sich vielleicht sogar einen Sponsorenvertrag angeln konnte. Für Connor ging es nicht nur um den eigenen Ehrgeiz; auch seine Familie konnte ein bisschen Geld ganz gut gebrauchen.
Die Glocke läutete. Die dritte und letzte Runde begann.
»Los, hol dir den Titel!«, drängte Dan und klopfte ihm ermutigend auf den Rücken.
Connor schob den Mundschutz ein und stand auf, um sich Jet entgegenzustellen. Er war mehr denn je entschlossen, diesen Kampf zu gewinnen.
Sein Gegner tänzelte leichtfüßig in der Mitte des Rings, offenbar noch genauso frisch wie in der ersten Runde. Die Menge brüllte und jubelte, als sich die beiden Kämpfer im grellweißen Licht der Strahler gegenübertraten. Sie starrten sich an; keiner wollte auch nur die geringste Schwäche zeigen. Kaum hatten sich ihre Boxhandschuhe berührt, als Jet auch schon zum Angriff überging – eine eigentlich vernichtende Kombination von Gerader, Haken, Seitwärtshaken.
Connor wich den Schlägen geschickt aus und konterte mit einem frontalen Kick. Seine Ferse krachte in Jets Magen und Jet krümmte sich zusammen. Connor wusste, dass er jetzt Druck machen musste. Er trieb Jet mit einem schnellen Schlagwirbel in die Seile.
Aber so leicht gab Jet nicht auf. Wild wie ein in die Ecke getriebener Tiger bearbeitete er Connor mit mehreren Körpertreffern. Jeder Schlag schwächte Connor noch ein wenig mehr, bis er gezwungen war zurückzuweichen. Und genau in diesem Augenblick erwischte ihn Jet mit einem äußerst schmerzhaften Shinkick in die Hüfte. Connor krümmte sich zusammen und gab Jet dadurch die Möglichkeit, mit einem schnellen Haken nachzusetzen. Jetzt stürzte sich Jet mit einem neuen Angriff auf ihn, doch Connor gelang es in letzter Sekunde, unter dem Schlag wegzutauchen, sodass Jets Faust über seinen Kopf hinwegging.
Connor war klar, dass er dieses Mal die Niederlage nur mit knappster Not vermieden hatte – und dass Jet jetzt mit einem gewaltigen Haken nachsetzen würde, um ihn endgültig von den Füßen zu holen.
Der Kampf ging durch den Ring hin und her. Schweiß rann Connor über das Gesicht und in die Augen; er keuchte heftig, das Blut pochte durch seine Adern – und immer noch ließ Jet die Schläge und Kicks schnell und hart auf Connor niedergehen. Connor spürte, dass seine letzten Kraftreserven schwanden. Aber aufgeben kam nicht infrage, nicht bei diesem Kampf. Zu viel stand für ihn auf dem Spiel.
»Fußarbeit! Leicht bleiben!«, brüllte Dan aus der Ecke.
Jet kam mit einem Roundhouse gegen den Kopf. Connor blockte ihn mit beiden Armen und konterte mit einem Sidekick. Jet sprang zurück, drang aber sofort wieder mit fliegenden Fäusten auf ihn ein. Die Zuschauer gerieten außer sich – nicht alle Tage wurde ihnen ein derart spannender Kampf geboten, der so lange hin und her wogte. Connors Freunde vom »Tiger Martial Arts Doˉjoˉ« skandierten rhythmisch seinen Namen, der vom Dach zurückhallte: »CON-NOR! CON-NOR!«
Aber Jets Fans brüllten genauso wild zurück. Das Toben der Menge steigerte sich zum Höhepunkt, als die letzten Sekunden des Kampfes anbrachen. Connor wurde plötzlich klar, dass er nach Punkten verlieren würde, wenn es ihm jetzt nicht gelang, den Gegner niederzuschlagen. Aber die Erschöpfung hatte ihn bereits voll im Griff.
»Deckung hoch!«, schrie Dan total frustriert aus der Ecke.
Jet sah die Lücke in Connors Deckung und nutzte sie erbarmungslos aus. Gerade, Haken, Fußkantenschlag!
Aber Connor hatte die Deckungsschwäche nur vorgetäuscht, um seinen Gegner näher an sich heranzulocken … und der schluckte den Köder. Blitzschnell wich Connor den Schlägen aus und konterte mit einer Geraden mit der Führhand. Jet stutzte, momentan aus dem Rhythmus gebracht. Connor holte aus und führte einen gedrehten Hook-Kick aus. Jet wurde kalt erwischt. Connors Ferse krachte gegen Jets Schläfe. Jets schwarzer Mundschutz schoss heraus und Jet fiel wie ein Stein zu Boden. Keine Sekunde später kam auch schon die Glocke und beendete den Kampf.
Der Schiedsrichter half dem völlig benommenen Jet auf die Füße. Connor verbeugte sich anerkennend, und Jet erwiderte die sportliche Geste mit einem mürrischen Nicken. Der Vorsitzende Ringrichter trat in den Ring. Er griff nach dem Mikro und verkündete: »Der Sieger des Finalkampfes um den Titel des britischen Meisters der Altersgruppe unter sechzehn Jahre ist … CONNOR REEVES!«
Die Menge jubelte, als Connor die Trophäe überreicht wurde, die silberne Figur eines Kickboxers auf einem kleinen Sockel aus weißem Marmor. Erst jetzt wurde Connor von der Begeisterung überwältigt; mit der hoch erhobenen Trophäe bedankte er sich bei den Zuschauern, die ihn angefeuert hatten.
Dan legte ihm den Arm um die Schultern. »Gratuliere, Champion!«, rief er breit grinsend. »Dein Vater wäre total stolz auf dich!«
Connor blickte zu der glitzernden Trophäe hinauf, dann auf das begeisterte Publikum. Ja, nichts hätte er sich sehnlicher erwünscht, als diesen triumphalen Augenblick mit seinem Vater gemeinsam zu feiern. Denn sein Vater hatte ihn dazu ermutigt, sich mit dem Kampfsport zu beschäftigen. Der Kampfsport war seine Leidenschaft gewesen – und jetzt war er auch Connors Leidenschaft.
»Ich muss zugeben, für eine Sekunde oder so hab ich mir echt Sorgen gemacht«, sagte Dan.
»Täuschen und zuschlagen. Das hast du mir doch selbst beigebracht«, antwortete Connor. »Du hast die Trophäe genauso verdient wie ich.«
Er übergab seinem Trainer die Trophäe, dann warf er einen Blick auf die zweite Reihe, musste aber zu seiner Enttäuschung feststellen, dass der silberhaarige Mann bereits verschwunden war.
»Der Kickbox-Manager war wohl nicht besonders beeindruckt, wie?«
»Der was? Ach so … Um den brauchst du dir keine Gedanken zu machen«, sagte Dan breit grinsend, während er sich mit der Trophäe bei Connors Fans bedankte. »Keine Ahnung, wer der Typ war. War nur ein Trick. Ich wollte, dass du alles gibst und zeigst, was du draufhast. Hat doch ganz gut funktioniert, oder nicht?«
KAPITEL 2
Ein kalter Wind blies Connor ins Gesicht, als er aus dem ExCel-Sportcenter in den Londoner Docklands kam und zur Bushaltestelle an der Freemasons Road ging. Der Februarhimmel war gnadenlos grau. Der Winter hatte zwar schon seine Schärfe verloren, weigerte sich aber loszulassen. Doch nicht einmal das trostlose Wetter konnte Connors Stimmung trüben. Verdammt – er war Kickbox-Champion des gesamten Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland! Und zum Beweis trug er eine Trophäe in der Sporttasche nach Hause! Er konnte es kaum erwarten, die kleine Statue seiner Großmutter zu zeigen – sie war schließlich sein größter Fan.
Er zog die Kapuze seines Sweatshirts über den Kopf, schob die Träger der Tasche ein wenig höher auf die Schulter und ging schnell über die Brücke, die über die Docklands Light Railway führte. Auf der anderen Seite vermied er die stark befahrene Straße und ging eine Nebenstraße entlang, in der sich längst bankrottgegangene Läden mit vernagelten Schaufenstern aneinanderreihten. Er hatte ungefähr ein Drittel der Straße hinter sich, als er einen Hilferuf hörte.
Weiter vorn in der Straße entdeckte er eine Gruppe Jugendliche, die einen jungen Inder eingekreist hatten. Nach der schicken Kleidung zu urteilen, war der Junge weder arbeitslos noch arm – im Gegensatz zu der Bande, die ihn bedrängte. Ein Mann, der offenbar auf dem Weg zur Bahnstation war, musste den Hilferuf ebenfalls gehört haben, wandte aber den Blick ab und eilte schnell an der Szene vorbei.
Hat wohl Angst, ein Messer in den Bauch zu kriegen, dachte Connor. Kann man ja verstehen.
Aber Connor konnte nicht einfach daran vorbeigehen. Die Starken haben die Pflicht, die Schwachen zu beschützen, hatte ihm sein Vater immer wieder klargemacht. Das war auch der Grund, warum sein Vater zur Armee gegangen war. Und warum er Connor immer ermutigt hatte, Kampfsport zu betreiben. Er hatte nicht gewollt, dass sein Sohn jemals zum Opfer der Gewalt werden würde.
Der Gangleader stieß den Inder grob gegen die Hausmauer und machte sich daran, seine Taschen zu durchsuchen.
»Lasst ihn in Ruhe!«, brüllte Connor schon aus fünfzig Schritten Entfernung.
Wie auf Kommando drehten sich alle um und starrten dem Wahnsinnigen entgegen, der es wagte, allein eine ganze Gruppe herauszufordern.
»Das hier geht dich nichts an, Kumpel«, rief der Anführer zurück. »Verpiss dich, Mann.«
Connor ignorierte die Warnung und ging weiter auf sie zu. »Er ist ein Freund von mir.«
»Der Loser hier? Der hat keine Freunde.« Der Anführer glaubte Connor nicht und spuckte dem Inder auf die Markenschuhe.
Inzwischen war Connor bei der Bande angekommen. Kalt fixierte er den Anführer. Der trug Baggy Jeans und ein Dr. Dre-T-Shirt, war mindestens einen halben Kopf größer als Connor und machte einen durchtrainierten Eindruck – breiter Oberkörper, Muskeln, die fast das T-Shirt sprengten, und Hammerfäuste. Jede Schule hätte sich um diesen Burschen als Stürmer ihres Rugbyteams gerissen.
Wenn er die Schule nicht schon längst geschmissen hat, dachte Connor.
Der Rest der Gang, zwei Jungen und ein Mädchen, wirkten weit weniger furchteinflößend, aber als Gruppe immer noch gefährlich genug. Connor betrachtete die Bande gelassen. Ein Junge mit pockennarbigem Gesicht hielt ein Skateboard in der Hand. Er trug Converse-Trainers, ebenfalls Baggy Jeans und ein graues Hoodie. Der andere Junge trug eine Jeans, dazu eine Puffer-Jacke und eine rote Nike-Baseballmütze, unter der ein paar blonde Haarsträhnen hervorkamen. Er trug die Mütze im Stil von »Ich bin ja sooo cool« mit dem Schild seitwärts. Das Mädchen, eine Chinesin mit kohlschwarzer Bobfrisur und einem Nasenpiercing, hatte schwarzen Eyeliner im Emo-Stil dick um die Augen aufgetragen und trug schwarze Doc-Martens-Stiefel. Sie starrte Connor genau so kalt an wie ihre Kumpels.
»Komm, wir gehen«, sagte Connor ruhig und gelassen zu seinem neuen Freund. Auf keinen Fall wollte er der Bande zeigen, wie nervös er in Wirklichkeit war. So durchtrainiert er im Kickboxen und in Jiu-Jitsu auch sein mochte, suchte er keinen Streit. Sein Jiu-Jitsu-Trainer hatte ihm immer eingetrichtert, dass Gewalt nur das letzte Mittel sein dürfe. Und wenn man allein war und es mit vier Gegnern zu tun hatte, brachte man sich mit Gewalt nur noch mehr in Schwierigkeiten.
Der Inder machte zögernd einen Schritt in Connors Richtung, aber der Anführer stieß ihm die flache Hand vor die Brust. »Du bleibst, wo du bist.«
Der Junge wich starr vor Angst an die Wand zurück und schaute Connor verzweifelt an.
Damit entstand eine spannungsgeladene Pattsituation – Connor auf der einen Seite, die Bande auf der anderen. Connors Blick zuckte von einem Gangmitglied zum nächsten. Die Sporttasche hielt er so, dass er sie jederzeit als Schutz benutzen konnte, falls er mit einem Messer angegriffen wurde.
»Ich hab gesagt, lasst ihn in Ruhe«, wiederholte er, während er versuchte, sich zwischen die Bande und ihr Opfer zu manövrieren.
»Und ich hab gesagt, du sollst dich verpissen«, gab der Anführer zurück, holte aus und boxte dem Inder ins Gesicht.
Der verängstigte Junge stieß einen Schmerzensschrei aus. Connor sprang blitzschnell vor und leitete den zweiten Hieb mit dem Unterarm ab. Dann ging er in Kampfstellung, hob die Fäuste und zeigte damit der Bande, dass er bereit war, falls sie ihn angreifen wollten.
Der Anführer starrte Connor verblüfft an, dann warf er den Kopf zurück und lachte brüllend. »Passt auf, Leute! Das Bürschchen hier hält sich für Karate Kid!«
Freu dich nicht zu früh, dachte Connor und stellte die Tasche ab.
Der Anführer betrachtete Connor abschätzig. Plötzlich schwang er einen harten rechten Haken gegen Connors Kopf. Doch Connor reagierte blitzschnell, duckte sich weg, trat vor und ließ einen mächtigen Hieb in den Bauch des Gegners krachen.
Für den Anführer kam der Hieb völlig unerwartet; eigentlich hätte er zu Boden gehen müssen, aber offenbar war er noch stärker, als er ohnehin aussah. Er stöhnte nur kurz auf, dann griff er Connor mit einer schnellen Schlagkombination an, Jab, Cross, gefolgt von einem blitzschnellen Aufwärtshaken. Connor zog sich auf Verteidigung zurück. Während er die Schläge abwehrte, wurde ihm vollkommen klar, dass er es nicht mit einem Anfänger zu tun hatte – der Junge war ein trainierter Boxer. Connor hatte seinen Gegner unterschätzt, und das hieß, dass er seine Taktik ändern musste. Obwohl er schneller war, hatte sein Gegner die größere Reichweite und mehr Kraft. Und ohne Handschuhe konnte der Kampf potenziell lebensgefährlich werden – schon ein einziger Treffer dieser hammerähnlichen Fäuste konnte Connor ins Krankenhaus befördern.
Je größer der Gegner, desto schwerer schlägt er auf den Boden, dachte Connor.
Eine Jiu-Jitsu-Regel schoss ihm durch den Kopf: Auch ein viel größerer Gegner ließ sich schlagen, wenn man seine Stärke gegen ihn selbst einsetzte.
Als der Gangleader einen bösartigen Roundhouse-Punch gegen Connors Kopf schlug, tauchte Connor blitzschnell in seine Reichweite hinein, drehte sich halb und warf den Burschen über die Hüfte auf den Asphalt. Der Anführer schlug so hart auf, dass es ihm momentan den Atem nahm. Die Bande und der Inder starrten auf den besiegten Anführer, der sich auf dem Boden krümmte – die Bande in ungläubigem Entsetzen, während der Inder kaum ein schadenfrohes Grinsen unterdrücken konnte.
»Macht ihn fertig!«, keuchte der Anführer, während er versuchte, wieder auf die Beine zu kommen, was ihm aber nicht gelang.
Der Junge mit der Nike-Mütze griff mit einem Seitlichen Flugkick an. Connor sprang instinktiv zur Seite, merkte, dass der Inder jetzt direkt hinter ihm stand, und stieß ihn grob weg – keine Zeit für Höflichkeiten. Nikes Fuß krachte genau dort gegen die Mauer, wo eben noch der Inder gestanden hatte. Das brachte Nike nun erst richtig auf die Palme. Er wirbelte herum und setzte Connor mit einer wütenden Serie von Drehkicks zu. Connor war überrascht, wie gut der Junge war; er musste zurückweichen. Und reiner Instinkt, erworben in unendlich vielen Sparringstunden, warnte ihn nun, mit einem weiteren Angreifer im Rücken zu rechnen. Ein schneller Blick über die Schulter: Hoodie kam heran, holte mit dem Skateboard aus und zielte auf Connor Kopf.
Im letzten Sekundenbruchteil tauchte Connor unter dem Skateboard weg. Das eine Ende des Boards verfehlte ihn äußerst knapp, erwischte aber stattdessen Nike voll im Gesicht. Nike ging halb betäubt zu Boden.
Hoodie erstarrte vor Schreck über seinen Fehler und bot daher sekundenlang ein ideales Angriffsziel. Connor nutzte den Vorteil aus und landete einen krachenden Sidekick. Aber der Junge war schneller, als Connor erwartet hatte: Blitzschnell riss er das Board hoch, um den Kick abzublocken. Doch um seinen Schwarzen Gürtel zu bekommen, hatte Connor auch Holzblöcke mit den Füßen zertrümmert und wusste, welche Technik er anwenden musste. Er biss die Zähne zusammen und trieb den Fuß mit voller Kraft in das Board – und nicht seine Knochen, sondern das Board splitterte. Jetzt war nur noch ein einfacher Schlag mit der Handfläche nötig, um Hoodie auf den Asphalt zu schicken.
Die Chinesin hatte den Kampf gelassen beobachtet. Als sie nun sah, dass Connor alle drei Jungen ausgeschaltet hatte, griff sie an.
Connor hob abwehrend beide Hände als Friedenszeichen. »Hör mal, ich kämpfe nicht gegen Mädchen. Verschwinde einfach, dann vergessen wir die ganze Sache.«
Das Mädchen blieb tatsächlich stehen, legte den Kopf ein wenig schief und schenkte ihm ein süßes Lächeln. »Wie lieb von dir.«
Dann flog ihre Faust auch schon so schnell gegen Connors Gesicht, dass er nicht zurückzucken konnte. Seine Unterlippe platzte auf. Aber das Mädchen war noch nicht fertig mit ihm. Sie setzte sofort mit einem Kick gegen Connors Oberschenkel nach, und ihr schwerer Doc-Martens-Stiefel traf ihn genau an der Stelle, an der ihn Jet beim Wettkampf erwischt hatte. Sein Bein fühlte sich plötzlich taub an; Connor taumelte gegen die Wand.
»Aber ich kämpfe gegen Jungs!«, sagte sie. Connor war vor Schmerzen momentan wie benommen und konnte sich nur mühsam auf den Beinen halten.
Das Mädchen holte erneut zu einem Kick aus. Connor versuchte gar nicht erst auszuweichen, sondern packte ihr Bein mitten im Schwung. Sie versuchte, ihr Bein loszureißen, und zielte mit einem Handkantenschlag auf seinen Hals. Connor ließ ihr Bein los, packte stattdessen ihr Handgelenk und drehte ihr den Arm auf den Rücken, sodass sie bewegungsunfähig wurde. Sie heulte vor Schmerzen auf.
»Lass das Mädchen los!«
Connor blickte sich um. Zwei Polizisten, ein großer, kräftiger Schwarzer und eine schlanke weiße Frau, kamen herbeigerannt. Zögernd ließ Connor das Mädchen los, das ihn prompt gegen das Schienbein kickte und sich in der entgegengesetzten Richtung aus dem Staub machte. Der Rest ihrer Gang folgte ihr dicht auf den Fersen.
Connor wollte ebenfalls verschwinden, aber der Polizist erwischte ihn und hielt ihn mit eisenhartem Griff um den Nacken fest. »Nicht so schnell, mein Junge. Du kommst erst mal mit uns.«
»Aber ich wollte doch nur dem Jungen helfen!«, protestierte Connor.
»Welchem Jungen?«, fragte die Polizistin.
Connor blickte sich um, schaute in beide Richtungen. Doch es war niemand zu sehen. Der junge Inder war verschwunden.
KAPITEL 3
Die Beamten führten Connor über die Freemasons Road und in eine Seitenstraße zu einem mächtigen Gebäude aus rotem Backstein. Schon aus einiger Entfernung konnte Connor die altehrwürdige blaue Laterne der Metropolitan Police ausmachen. Darunter war ein Schild angebracht: Canning Town Police Station. Sie stiegen die Stufen der Polizeistation hinauf; neben dem Eingang hing ein großes Poster: Terrorismus – kommen Sie zu uns, wenn Ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt. Die Polizistin stieß einen Flügel der schweren Holztür auf, die blau gestrichen und stark abgenutzt war.
Das Innere der Polizeistation war nur schwach beleuchtet und wirkte bedrückend trostlos. Die Wände waren kahl, von einer großen Anschlagtafel aus Kork abgesehen, an der eine Einladung zur nächsten Gruppenbesprechung der Freiwilligen Nachbarschaftswache hing. Die einzigen Möbelstücke waren eine Bank an der Wand und eine verglaste Empfangskabine, in der ein gelangweilter wachhabender Beamter saß. Als sie näher kamen, blickte er auf und schnalzte missbilligend mit der Zunge, als er Connors aufgeschlagene Lippe und die Blutspritzer auf seinem Sweatshirt sah.
»Name?«, fragte ihn der Wachhabende.
»Connor Reeves.«
»Alter?«
»Vierzehn.«
Der Beamte trug die Antworten in sein Register ein. »Adresse? Telefon?«
Connor gab seine Adresse in Leytonstone an.
»Familie?«
Als Connors Daten eingetragen waren, erklärte die Polizistin den Grund für Connors Verhaftung. Der Wachhabende nickte, offenbar zufrieden.
»Dort rein«, sagte er und deutete mit dem Kugelschreiber auf eine Tür mit der Aufschrift Vernehmungsraum.
Connor wurde durch den Eingangsraum zu der Tür geführt. Der Polizist blieb zurück, um den Inhalt von Connors Tasche registrieren zu lassen.
Die Polizistin öffnete die Tür. »Nach dir«, sagte sie und ließ ihn vorangehen.
Connor trat ein. Mitten im Raum stand ein großer Tisch, darauf eine Lampe. Zwei harte Holzstühle, je einer an den Längsseiten des Tisches. An der Decke summte eine Neonlampe wie eine Stechmücke und goss ihr bleiches Licht über die trostlose Szene. Ein muffiger Geruch lag in der Luft; die Jalousien waren heruntergelassen, sodass der Raum das beunruhigende Gefühl gab, vom Rest der Welt völlig isoliert zu sein.
Obwohl er wusste, dass er völlig unschuldig war, merkte Connor plötzlich, dass sein Gaumen vollkommen ausgetrocknet war. Angst packte ihn; sein Herz begann heftig zu klopfen.
Das ist einfach nicht gerecht!, schoss es ihm durch den Kopf.
Er hatte versucht, einen Straßenüberfall zu verhindern, und nun wurde er verhaftet! Und welchen Dank hatte er dafür bekommen, dass er sich eingemischt hatte? Keinen. Der junge Inder war einfach spurlos verschwunden.
»Setz dich«, befahl die Polizistin und deutete auf einen der Stühle am Tisch.
Zögernd befolgte Connor den Befehl.
Nun trat auch der Polizist ein, schloss die Tür hinter sich und reichte seiner Kollegin eine dicke Akte. Die Frau setzte sich Connor gegenüber und schaltete die Tischlampe ein. Connor verfolgte schweigend, wie sie die Akte auf den Tisch legte und daneben einen Notizblock sowie einen Kugelschreiber zurechtschob. Im harten Licht der Lampe sah Connor, dass quer über die Akte in Großbuchstaben STRENG GEHEIM gestempelt worden war.
Connor brach der Schweiß aus allen Poren. Jetzt erst begann er wirklich zu begreifen, in welche Lage er geraten war. Er hatte noch nie etwas mit der Polizei zu tun gehabt.
Ob die etwas gegen mich in der Hand haben?, überlegte er.
Die Beamtin löste sorgfältig das Verschlussband der Akte und begann darin zu lesen. Der riesige Polizist hatte sich neben seine Kollegin gesetzt und starrte Connor unentwegt an. Die Spannung wurde fast unerträglich.
Nach einer Weile, die Connor wie eine Ewigkeit vorkam, blickte die Polizistin auf und erklärte: »Wenn das Mädchen eine Anzeige gegen dich wegen des Überfalls stellt, kommt die Sache vor Gericht.«
Connor spürte förmlich, wie der Boden unter seinen Füßen wegsackte. Die ganze Angelegenheit entwickelte sich viel schlimmer, als er sich je hätte vorstellen können.
»Deshalb brauchen wir eine volle Aussage von dir«, fuhr die Polizistin fort.
»Sollte ich nicht einen Anwalt anrufen oder so?«, fragte Connor. Das sagten sie jedenfalls immer in den Filmen im Fernsehen.
»Nein, das wird nicht nötig sein«, antwortete sie. »Sag uns nur einfach, warum du das getan hast.«
Connor wand sich verlegen auf dem harten Stuhl. »Weil … das war ein Straßenüberfall. Ein Junge wurde überfallen.«
Die Polizistin notierte etwas. »Und dieser Junge … kanntest du ihn?«
»Nein«, antwortete Connor. »Werde ihn wohl auch nie kennenlernen. Der undankbare Typ ist einfach davongelaufen.«
»Warum hast du dich denn überhaupt eingemischt?«
»Sie haben ihn angepöbelt und wollten ihn zusammenschlagen!«
»Aber andere Leute sind daran vorbeigegangen. Warum nicht auch du?«
Connor zuckte die Schultern. »Ich hab es für richtig gehalten, mich einzumischen. Er hätte sich nicht selbst wehren können. Es stand vier gegen einen.«
»Vier?«, wiederholte die Polizistin und notierte noch etwas. »Aber du hast trotzdem eingegriffen?«
Connor nickte und gestand: »Ich kenne mich mit Kampfsport ein bisschen aus.«
Die Beamtin blätterte in der Akte. »Hier steht, du hast einen Schwarzen Gürtel im Kickboxen und im Jiu-Jitsu. ›Ein bisschen‹ scheint mir ziemlich untertrieben zu sein.«
Connor stockte der Atem. Woher hatte die Polizei all diese Informationen über ihn? Was wissen sie sonst noch?, dachte er.
»Das … das stimmt«, gab er zu und fragte sich, ob sie das wohl gegen ihn verwenden würden. Seine Trainer hatten ihm immer geraten, mit seinen Kampffähigkeiten außerhalb des Trainings und der Wettkämpfe äußerst sparsam umzugehen.
»Gut, fassen wir die Geschichte mal zusammen«, sagte die Polizistin, legte den Kugelschreiber auf den Tisch, lehnte sich zurück und schaute Connor streng an. »Du behauptest also, du hättest für einen völlig fremden Menschen dein Leben aufs Spiel gesetzt.«
Connor zögerte. Soll ich mich jetzt für schuldig im Sinne der Anklage bekennen oder was?, dachte er.
»Na ja … stimmt«, sagte er zögernd.
Zum ersten Mal glitt so etwas wie der Anflug eines Lächelns über das Gesicht der Frau. »Dazu gehört schon eine Menge Mut«, sagte sie anerkennend.
Connor starrte sie völlig verblüfft an. Ein Lob hatte er von ihr nun wirklich nicht erwartet. Die Beamtin schlug die Akte zu, blickte zu ihrem Kollegen auf und nickte.
Der Mann wandte sich an Connor. »Gut gemacht. Du hast bestanden.«
Connor runzelte verwirrt die Stirn. »Bestanden?Wasdenn?«
»Den Test.«
»Sie meinen … das war so eine Art Klassenarbeit?«
»Nein«, antwortete der Mann gelassen. »Sah mir eher wie ein richtiger Kampf aus.«
Connors Verwirrung wurde immer größer. »Hab ich das richtig verstanden: Die Bande hat mich also auf die Probe gestellt?«
Der Polizist nickte. »Und du hast dabei bewiesen, dass du einen ausgeprägten Schutzinstinkt besitzt.«
»Natürlich hab ich den! Die Bande hat mich angegriffen, ich musste mich doch …«
»Das meinen wir nicht«, mischte sich die Polizistin ein. »Wir meinen, dass du eine natürliche Bereitschaft gezeigt hast, jemand anders zu beschützen.«
Connor sprang auf. »Was geht hier eigentlich ab? Ich muss zu Hause anrufen.«
»Nicht nötig«, sagte sie und lächelte ihn freundlich an. »Wir haben deine Mutter schon informiert, dass du heute ein bisschen später nach Hause kommst.«
Connors Mund blieb buchstäblich offen stehen. Ungläubig starrte er die beiden Beamten an. Was zum Teufel hatte die Polizei mit ihm vor?
»Wir beobachten dich schon eine ganze Weile«, verriet ihm die Polizistin, stand auf und hockte sich auf die Tischkante. Ihr strenges, formelles Gehabe hatte sie völlig abgelegt. Jetzt wirkte sie ganz locker. »Der Angriff wurde arrangiert, weil wir deine Moral und deine Fähigkeiten im Kampf testen wollten. Das musste völlig authentisch sein, und das bedeutete natürlich, dass wir dich vorher nicht warnen durften. Und dass wir für den Überfall gut trainierte Leute einsetzen mussten.«
Trainierte Leute?, dachte Connor und rieb sich die aufgeplatzte Lippe. Kein Wunder, dass sie so gut kämpften.
»Aber warum das alles?«, wollte er wissen.
»Wir mussten herausfinden, ob du in der wirklichen Welt das Potenzial für einen CPO hast.«
Connor blinzelte verblüfft und fragte sich, ob er sich verhört hatte. »Für einen was?«
»Für einen CPO – das ist die Abkürzung für einen Close Protection Officer. Und das heißt Personenschutz«, erklärte der Polizist. »Man könnte auch Bodyguard sagen.« Er nickte Connor anerkennend zu. »Du hast dich selbst in Gefahr begeben, um eine andere Person zu schützen. Damit hast du bewiesen, dass du den natürlichen Instinkt eines Bodyguards besitzt. Das kann man niemandem beibringen. Es muss in der Person des Bodyguards angelegt sein.«
Darüber musste Connor laut lachen. »Das meinen Sie doch nicht im Ernst! Ich bin doch viel zu jung, um ein Leibwächter sein zu können.«
»Genau darum geht es«, antwortete eine Stimme hinter Connor. Eine befehlsgewohnte, militärische Stimme.
Connor drehte sich schnell um – und erlebte einen weiteren Schock: Vor ihm stand der silberhaarige Mann, den er beim Wettkampf gesehen hatte.
»Mit dem richtigen Training wirst du zum perfekten Bodyguard werden.«
KAPITEL 4
»Ich bin Colonel Black«, stellte sich Silberhaar mit kurzem Nicken vor. Er trug absolut gepflegte, modische Kleidung, Chinos, glänzende schwarze Stiefeletten und ein khakifarbenes Hemd. Die Ärmel hatte er bis zum Ellbogen hochgerollt. Seine ganze Erscheinung machte jedem auf Anhieb klar, dass Black sein Leben beim Militär verbracht hatte. Jetzt erst, da er ihn so nah vor sich sah, bemerkte Connor, dass sein Gesicht hart wirkte; sein kantiges Kinn ließ vermuten, dass er es gewohnt war, schnelle Entscheidungen zu treffen und Befehle zu erteilen. Sein ganzes Auftreten war diszipliniert und befehlsgewohnt; die steingrauen Augen wichen nicht für eine Sekunde von Connors Gesicht. Er mochte Ende vierzig sein, machte aber mit seiner breiten Brust und den gebräunten, muskulösen Unterarmen einen äußerst fitten Eindruck und wirkte dadurch mindestens zehn Jahre jünger. Nur eine ungleichmäßige weiße Narbe, die sich quer über seinen Hals zog, lenkte von seiner makellosen Erscheinung ab. Connor hatte keinen Zweifel, dass er sich die Narbe im aktiven Dienst zugezogen hatte.
»Ich bin beeindruckt, wie du dich in der Situation verhalten hast«, sagte der Colonel. »Im Ring und auch außerhalb. Du hast wirklich Mumm bewiesen. Selbst als deine Chancen längst nicht mehr zum Besten standen, hast du nicht aufgegeben. Das sehe ich bei meinen Rekruten gerne.«
»Danke«, antwortete Connor automatisch, zu verwirrt, als dass ihm etwas anderes eingefallen wäre. Dann erst begriff er, was der Colonel gesagt hatte. »Rekruten? Was … was meinen Sie damit?«
»Setz dich erst mal, dann erkläre ich es dir.«
Das klang weniger wie eine Einladung, eher wie ein Befehl, aber Connor war ohnehin eher nach Sitzen zumute. Dankbar ließ er sich wieder auf den Stuhl sinken. Der Colonel setzte sich ihm gegenüber und übernahm das Gespräch von den beiden Polizisten.
»Ich leite eine Organisation für Personenschutz namens Buddyguard.«
»Buddyguard?« Connor glaubte sich verhört zu haben. »Nicht Bodyguard?« Er hatte keine Ahnung, was ein Buddy – ein Kumpel – mit Blacks Organisation zu tun haben mochte. »Nie davon gehört.«
»Nur wenige Leute wissen darüber Bescheid. Unsere Organisation ist streng geheim«, nickte der Colonel. »Deshalb muss ich, bevor ich fortfahre, sicher sein, dass alles, was ich dir jetzt sage, im Interesse der nationalen Sicherheit streng geheim bleiben muss. Du darfst niemandem davon erzählen – absolut niemandem.«
Der strenge, ernste Gesichtsausdruck des Colonels machte Connor klar, dass er wohl mit schlimmen Folgen rechnen müsste, wenn er sich nicht an die Anweisung des Colonels hielt. »Ich habe es verstanden«, antwortete er.
Der Colonel nickte und fuhr fort. »In der heutigen Welt ist es nötig, eine neue Art von Bodyguard auszubilden. Zum einen gibt es die ständige Bedrohung durch den Terrorismus, ferner nimmt das internationale organisierte Verbrechen immer weiter zu. Seit ein paar Jahren beobachten wir auch eine starke Zunahme von Piratenüberfällen. Das alles bedeutet, dass das Risiko von Geiselnahmen, Erpressung und Attentaten sehr stark gestiegen ist. Und es sind schon längst nicht mehr nur Erwachsene, die Opfer von Entführungen oder Anschlägen werden. Stell dir nur vor, wie intensiv die Medien über die Familien wichtiger Politiker berichten, oder über den kometenhaften Aufstieg von jugendlichen Popstars, die über Nacht weltberühmt werden, aber zum Teil fast noch Kinder sind, oder über die jungen Computerfreaks, die irgendwelche Internetfirmen gründen und Milliardäre werden! Das heißt, berühmte Kinder und Jugendliche sind heutzutage genauso stark gefährdet wie die Erwachsenen.«
»Sie meinen, so wie der Sohn des französischen Filmstars?«, fragte Connor. Die Story, wie der Junge auf einem Segeltörn entführt worden war, hatte wochenlang für Schlagzeilen gesorgt.
»Ja – für ihn mussten die Eltern eine Million Dollar als Lösegeld zahlen. Aber es hätte gar nicht erst passieren müssen – wenn die Familie ein gutes Personenschutzteam angeheuert hätte. Meine Organisation bietet genau diesen Dienst an. Aber wir unterscheiden uns in einem wichtigen Punkt von allen anderen Bodyguard-Agenturen: Bei uns kommen nur Jugendliche als Bodyguards zum Einsatz – natürlich erst, nachdem sie eine Ausbildung durchlaufen haben.«
Colonel Black schaute Connor direkt in die Augen, als er fortfuhr: »Unsere Leute werden hervorragend ausgebildet und sind oftmals wirkungsvoller als normale erwachsene Leibwächter. Jeder, der aufmerksam hinschaut, wird einen erwachsenen Bodyguard sofort erkennen. Unsere Leute werden überhaupt nicht bemerkt, weil sie als ständige Begleiter der Kinder oder Jugendlichen auftreten, sozusagen als ihre Freunde oder Kumpel. Auf diese Weise können sie den bestmöglichen Schutz für ein gefährdetes Kind oder einen berühmten Jugendlichen bieten.«
Der Colonel legte eine Pause ein, um Connor Gelegenheit zu geben, das alles erst einmal zu verarbeiten.
»Sie wollen alsomichzu einem Ihrer Buddyguards machen?«, fragte Connor, dem die Idee reichlich zweifelhaft vorkam.
»Genau das ist meine Absicht.«
Connor lachte unsicher und hob abwehrend die Hände. »Dann haben Sie einen Fehler gemacht. Sie haben sich die falsche Person ausgesucht.«
Der Colonel schüttelte den Kopf. »Das glaube ich nicht.«
»Aber ich gehe doch noch zur Schule! Ich kann gar kein Bodyguard werden!«
»Warum nicht? Es liegt dir im Blut.«
Connor stutzte und starrte den Colonel verblüfft an. Dann sagte der Colonel etwas, das Connor wie ein Blitz traf.
»Damit würdest du in die Fußstapfen deines Vaters treten.«
»Was … Wovon reden Sie denn da?«, rief Connor aufgebracht. »Mein Dad ist tot!«
Der Colonel nickte ernst. »Das weiß ich. Und mich persönlich hat die Nachricht von seinem Tod schwer getroffen. Dein Vater und ich waren enge Freunde. Wir haben zusammen gekämpft.«
Connor schaute den Mann durchdringend an. War es möglich, dass er die Wahrheit sagte?
»Aber mein Dad hat Sie nie erwähnt«, sagte er zweifelnd.
»Das ist verständlich. Beim SAS trennen wir das private und das dienstliche Leben streng voneinander.«
»Beim … SAS? Aber mein Vater war in der Armee, nicht beim SAS. Er gehörte den Red Signals an«, berichtigte ihn Connor.
»Das war der Job, den er als Deckung benutzte.« Der Colonel beugte sich ein wenig vor. »Tatsächlich gehörte dein Vater jedoch zum SAS Special Projects Team. Das Team ist zuständig für Gegenterrorismus und VIP-Personenschutz«, erklärte er. »Und er war einer der Besten.«
Für Connor war das völlig neu, obwohl er immer gedacht hatte, seinen Vater gut gekannt zu haben. Er lehnte sich zurück. »Aber warum hat er mir nie davon erzählt?«
»Als Mitglied im Special Projects Team musste er seine Identität streng geheim halten. Um sich selbst zu schützen, aber auch dich und den Rest seiner Familie.«
»Ich glaube Ihnen kein einziges Wort«, sagte Connor, nun plötzlich wütend. Seine Hände verkrampften sich an seinem Stuhl. Es war, als würde die ganze Welt, die er bisher gekannt hatte, plötzlich auseinanderfallen, als seine Erinnerung an seinen Vater in Zweifel gezogen wurde.
Der Colonel nahm ein Foto aus seiner Brusttasche und schob es über den Tisch. »Irak. 2004.«
Fünf Soldaten in Kampfmontur. Jeder mit einer MP bewaffnet. Hinter ihnen nichts als eine leere, unfruchtbare Wüstenlandschaft. In der Mitte der Gruppe ein jüngerer Colonel Black, klar erkennbar an der weißen Narbe direkt oberhalb des Kragens seines Kampfanzugs. Und neben ihm ein sonnengebräunter Mann mit dunkelbraunem Haar und den vertrauten blaugrünen Augen – Justin Reeves.
Connor starrte sprachlos auf das Foto hinunter. Mit zitternder Hand hob er es hoch. Mühsam drängte er die Tränen zurück, die ihm bei dem unerwarteten Anblick seines Vaters in die Augen treten wollten.
»Du kannst es behalten, wenn du willst«, sagte der Colonel. »Kommen wir nun zu deiner Rekrutierung als Buddyguard.«
»Was?«, rief Connor. Die Sache ging ihm nun wirklich zu schnell. »Ich habe doch noch gar nicht gesagt, dass ich einverstanden bin.«
»Stimmt. Aber hör mir erst mal zu, dann wirst du sicherlich einverstanden sein.«
Connor legte das Foto vorsichtig auf den Tisch zurück. Es fiel ihm schwer, den Blick vom Gesicht seines Vaters zu lösen und wieder den Colonel anzuschauen.
»Erstens: Deine Schule wird darüber informiert, dass du ab sofort in ein privates Internat wechselst. Und …«
»Ein privates Internat?«, unterbrach ihn Connor. »Wovon soll meine Mutter denn die Schulgebühren bezahlen?«
»Lass mich ausreden. Die Gebühren für das Internat werden durch ein besonderes Stipendium bezahlt. Außerdem ist dein Wechsel in das Internat auch die offizielle Begründung für deinen Umzug ins Buddyguard-Trainingslager. Unsere Operation muss unter allen Umständen geheim bleiben. Niemand darf jemals davon erfahren.«
»Umzug?«, rief Connor aufgebracht. »Tut mir leid, daran scheitert die Sache. Ich kann meine Mutter auf gar keinen Fall allein lassen. Sie müssen sich jemand anders suchen.«
»Wir wissen über deine Situation genau Bescheid«, sagte die Polizistin und lächelte ihn beruhigend an, während sie einen großen Umschlag vor ihn auf den Tisch legte. »Wir haben alle notwendigen Vorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass gut für sie gesorgt wird. Und dass alle Kosten übernommen werden.«
Connor starrte auf den geheimnisvollen Umschlag hinunter, dann schaute er wieder Colonel Black an. »Und was ist, wenn ich kein Bodyguard werden will?«
»Die Entscheidung triffst du ganz allein. Du kannst jederzeit nach Hause gehen, aber ich denke, du würdest es bereuen.«
Jetzt erst dämmerte Connor, was das bedeutete. »Dann bin ich also gar nicht verhaftet?«
Der Colonel hob eine Augenbraue. »Hat das jemand behauptet?«
Connor blickte zu den beiden Polizisten auf, die hinter dem Colonel standen. Plötzlich wurde ihm klar, dass sie ihn weder über seine Rechte belehrt noch offiziell verhaftet hatten – sie hatten ihn nur einfach aufgefordert, mit ihnen zur Polizeistation zu gehen.
»Natürlich musst du dich nicht sofort entscheiden, sondern kannst in Ruhe über mein Angebot nachdenken«, sagte der Colonel und legte eine Geschäftskarte auf den Umschlag. Die Karte war schwarz wie die Nacht und zeigte das geprägte Logo eines silbernen Wappenschilds mit ausgebreiteten Schwingen. Darunter stand nur eine Telefonnummer – und sonst nichts.
Der Colonel nickte ihm zum Abschied kurz zu, stand auf und verließ den Raum. Die beiden Polizisten folgten ihm.
Connor blieb wie gelähmt sitzen. Bewegungslos starrte er auf die schwarze Karte, während sich seine Gedanken überschlugen. Es war, als sei innerhalb einer einzigen Stunde ein Wirbelsturm durch sein Leben gefegt – im einen Moment war er noch zum Kickbox-Champion des Vereinigten Königreichs gekrönt worden und im nächsten Augenblick wollte man ihn als Bodyguard rekrutieren. Er betrachtete den Umschlag, und obwohl es ihn verlockte, ihn zu öffnen, fürchtete er sich doch vor dem, was er wohl enthalten mochte. Er beschloss, ihn erst später zu öffnen. Im Moment musste er über ein paar andere Dinge nachdenken.
Er nahm die Karte, das Foto und den Umschlag und ging zur Tür. Als er sie öffnete, dachte er zuerst, die falsche Tür erwischt zu haben, aber es gab nur eine, die aus dem Raum führte. Im Eingangsbereich waren sämtliche Lichter erloschen. Der Empfangstresen lag verlassen da; das ganze Gebäude war so still wie ein Grab.
»Hallo? Ist da jemand?«, rief er. Aber niemand antwortete.
Er entdeckte seine Sporttasche auf dem Tresen, schob den Umschlag und das Foto neben der Trophäe in die Tasche und die Geschäftskarte in seine Hosentasche. Dann ging er zum Hauptausgang. Seine Schritte hallten hohl durch den großen, leeren Raum. Als er am Aushang vorbeikam, stellte er fest, dass das Treffen der Freiwilligen Nachbarschaftswache schon vor über zwei Jahren stattgefunden hatte; er wunderte sich flüchtig, warum die Ankündigung überhaupt noch an der Anschlagstafel hing. Er zog die schwere Eingangstür auf und trat in das graue Licht des Abends hinaus, erleichtert, dass er der grabähnlichen Atmosphäre der Polizeistation entkommen war. Er schaute die Straße in beiden Richtungen entlang, konnte aber weder Colonel Black noch die beiden Polizisten entdecken. Als die große Tür hinter ihm zuschlug, bemerkte er, dass das Terrorismusposter entfernt worden war. Stattdessen hing ein amtlich wirkendes, blau-weißes Schild an der Wand:
Diese Polizeistation wurde geschlossen. Die nächste Polizeistation befindet sich in 444 Barking Road, Plaistow.
Connor starrte das Schild wie benommen an. Dann war also die gesamte Operation nicht echt gewesen, war nur für ihn arrangiert worden!
Er griff in die Hosentasche und holte das Ding heraus, das bewies, dass er die Begegnung wirklich erlebt hatte – die schwarze Geschäftskarte mit dem silbergeflügelten Schild und der Telefonnummer.
KAPITEL 5
»Du kommst spät, Hazim«, murmelte der düster dreinblickende Mann missmutig und undeutlich auf Arabisch, ohne mit dem Kauen der Khatblätter aufzuhören. Der Mann hatte einen dichten Vollbart, eine Hakennase und von der Wüstensonne tiefbraun gegerbte Gesichtshaut. Er verzog abschätzig den Mund, ein Zeichen, dass er nicht erfreut war, und bleckte dabei eine Reihe gelbbraun verfärbter Zähne.
»Tut mir leid, Malik, aber das Flugzeug hatte Verspätung«, rechtfertigte sich Hazim, wobei er sich ehrfurchtsvoll vor dem Mann verneigte, der wie ein König am hinteren Ende des Mafraj, des prächtigen, rechteckigen Gemeinschaftsraums thronte. Vor den weiß getünchten Wänden wirkte der Mann noch erhabener.
Malik schnalzte verärgert mit der Zunge, winkte Hazim aber näher und wies ihm mit einer knappen Handbewegung einen Sitz neben sich zu. Nervös nahm Hazim seinen Platz unter den anderen Mitgliedern der Bruderschaft ein.
Hazim war ein junger Mann jemenitischer Abstammung mit tiefschwarzen Augenbrauen und einem kantigen Gesicht. Er hätte durchaus als gut aussehend beschrieben werden können, wäre da nicht der ständig verächtlich wirkende Zug um seinen Mund gewesen.
Der Raum war voller Männer – die gesamte Bruderschaft war versammelt. Alle trugen den traditionellen Thawb, ein weißes Baumwollgewand, das bis zu den Knöcheln reichte und die Tageshitze erträglicher machte. Manche trugen rot-weiß karierte Kopftücher, andere waren barhäuptig. Sie ruhten auf großen Kissen, das linke Bein untergeschlagen, den rechten Arm auf das rechte Knie gestützt, während der linke Arm auf einer gepolsterten Armlehne ruhte. Vor jedem lag ein Haufen grüner Stängel, von denen sie immer wieder ein paar Blätter abrissen und kauten, während sie miteinander redeten.