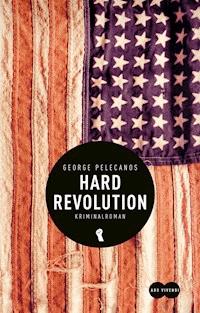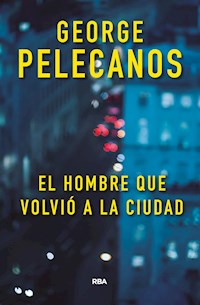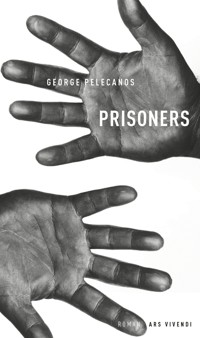Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Washington, D. C.: Bartender und Gelegenheitsdetektiv Nick Stefanos ist ziemlich am Ende und lebt eigentlich nur noch für den nächsten Drink. Als er eines Abends auf einer Parkbank am Anacostia River heillos betrunken Ohrenzeuge des Mordes an dem Teenager Calvin Jeter wird, reißt er sich zusammen, denn die Metropolitan Police scheint der Fall nicht besonders zu interessieren, sie hält den Toten doch für ein typisches Opfer der Washingtoner Gang-Kriminalität. Aber Nick weiß, dass Gangs keine Schalldämpfer benutzen – gemeinsam mit Privatdetektiv Jack LaDuke versucht er die Killer zu fassen und findet sich bald in einem Sumpf aus Drogen und sexueller Ausbeutung wieder: Eine Reise in die Dunkelheit der menschlichen Seele und durch die schwärzesten Schatten der amerikanischen Hauptstadt beginnt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
George Pelecanos
Das dunkle Herz der STadt
KRIMINALROMAN
Aus dem amerikanischen Englisch von Karen Witthuhn
ars vivendi
Die Originalausgabe erschien 1995 unter dem Titel
Down by the river where the dead men go
Copyright © 1995 by George Pelecanos
This edition published by arrangement with Little, Brown and Company, New York, New York, USA. All rights reserved.
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Deutschen Originalausgabe (1. Auflage September 2018)
© 2018 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
eISBN 978-3-86913-960-9
Für Peter
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Der Autor
1
Wie der meiste Ärger in meinem Leben, der mir widerfahren ist oder den ich mir eingebrockt habe, fing auch der in jener Nacht mit einem Drink an. Niemand hat mich gezwungen, ich habe selbst eingeschenkt, zwei Fingerbreit Bourbon in ein schweres, angeschrägtes Shotglas. Viele weitere Gläser folgten, Bourbon und Bier, mitzählen war sinnlos. Aber nur wegen des allerersten trieb es mich in jener Nacht an den Fluss runter, wo ein Junge namens Calvin Jeter ermordet wurde.
Alles begann im Spot, an der 8th und G in Southeast, wo ich drei, vier Schichten die Woche hinter der Bar stand. Es war ein heißer Tag gewesen, diesig und brühwarm, wie die meisten Hochsommertage in D.C. Nach dem Mittagsansturm hatte die Lüftung unseres uralten Ventilators den Geist aufgegeben, und obwohl die meisten unserer Stammgäste versucht hatten, sich das Ganze schönzutrinken, siegte am Ende die Hitze. Um zehn Uhr abends stand ich also verlassen am Hahn, Alleinherrscher über leere Barhocker. Ramon war im Keller, Darnell machte die Küche sauber. Ich rief Phil Saylor an, den Besitzer der Bar, und holte mir die Erlaubnis, den Laden zu schließen.
Ramon kam mit drei Bierkisten die Holztreppe hoch, hinter der obersten lugte sein Kopf hervor. Er hatte unten einen Joint geraucht und lächelte dümmlich, aber angestrengt, und es sah aus, als würde ihm gleich ein Ei platzen. In seinen Cowboystiefeln maß er gerade eins sechzig und brachte knapp sechzig Kilo auf die Waage – zweiundsiebzig Bierflaschen waren also echt hart an der Grenze. Er setzte die Kisten vor meinen Füßen ab und wischte sich mit einem roten Halstuch den Schweiß von der Stirn. Ich nickte ihm zu und gab ihm sein Trinkgeld.
Während ich das Bier in den Kühlschrank räumte – nach dem Rotationsprinzip, sodass immer ein paar kalte Flaschen oben lagen –, hörte ich Ramon und Darnell zu, die sich hinten in der Küche gegenseitig aufzogen. Durch die Durchreiche sah ich, wie Ramon dem großen und spindeldürren Darnell in den Bauch boxte, der es gut gelaunt hinnahm und die ganze Zeit lachte. Dann waren laute Luftküsse von Ramon zu hören, Darnell sagte »Bis dann, amigo«, und Ramon schwirrte ab, aus der Küche, durch die Bar und zur Tür raus.
Ich machte die Biere fertig, schloss den Kühlschrank, wischte die Bar ab, spülte das grüne Tropfnetz aus und stellte die Aschenbecher bis auf einen ins Einweichbecken, dann wusch ich ab und zog mich um, Shorts, T-Shirt, Chucks. Als ich gerade die Schnürsenkel zuband, machte Darnell das Licht in der Küche aus.
»Was geht, Nick?«
»Fast fertig.«
»Viel Betrieb heute?«
»Ja. Der Aal lief echt gut.«
»Hab n bisschen Old Bay reingetan. Meinst du, jemand hat’s gemerkt?«
»Nee.«
Darnell schob seine lederne Kufi-Kappe von der verschwitzten Stirn. »Fährst du uptown? Kann ich mitfahren?«
»Später. Ich will erst Lyla anrufen und fragen, was sie vorhat.«
»Alles klar. Dann mach ich mich auf den Weg.«
Das war unsere Routine an den Abenden, an denen wir zusammen dichtmachten. Darnell wusste, ich würde noch bleiben und trinken, normalerweise alleine, und er versuchte immer, mich vorher rauszubugsieren. Seit seiner Knastzeit in Lorton war er sauber und trocken, aber niemand beging den Fehler, ihn deswegen für ein Weichei zu halten, ich erst recht nicht. Ich hatte miterlebt, was er mit einem Messer anstellen konnte. Darnell ging, ich schloss hinter ihm ab und drehte den Dimmer wider den Uhrzeigersinn.
Es wurde dunkler, das Schlitz-Logo über der Bar tauchte den Raum in blaues Neonlicht. Ich suchte auf der Stereoanlage den Sender Wdcu, jagte die Lautstärke hoch, steckte eine Zigarette an, zog dran und klemmte sie in die Kerbe des letzten verbliebenen Aschenbechers. Dann holte ich eine fast volle Flasche Old Grand-Dad vom Regal, schenkte einen Shot ein und nahm einen Schluck. Ich öffnete ein kaltes Bud, trank mehrere Zentimeter ab und stellte die Flasche neben das Shotglas. Mein Schultern lockerten sich, alles wurde weicher und floss.
Ich sah mich um: eine lange Mahagonibar mit Handlauf, voller Flecken und Sprenkeln, darüber mehrere konische Lampen, in deren dämmrigem Licht mein Zigarettenrauch Schlieren zog, hinter den Lampen ein Gestell, an dem Bier-, Schnaps- und Cocktailgläser hingen und abtropften, ein paar Barhocker, einige mit Lehne, ein paar Sitznischen mit Plastikpolstern, in zwei Ecken abgenutzte Lautsprecher – und ein bisschen »Kunst«: ein Poster der Washington Redskins, das der örtliche Bierlieferant mal mitgebracht hatte (der Spielplan von 1989 – wir hatten ihn einfach hängen lassen), und ein gerahmter Druck der Unabhängigkeitserklärung, auf dem die Unterschriften unserer Gründerväter an verschiedenen Stellen durch die unserer betrunkenen Stammgäste ergänzt worden waren. Auch meine eigene stand da irgendwo hingekritzelt.
Ich trank den Bourbon aus und wählte beim Nachschenken Lylas Nummer. Neben dem Telefon war ein Foto von Phil Saylor an die vergilbte Wand geklebt, aufgenommen zur Zeit seines kurzen Zwischenspiels als Bulle bei der Metropolitan Police. Während ich Lylas AB zuhörte, betrachtete ich sein rundes Gesicht. Dann legte ich auf, ohne eine Nachricht zu hinterlassen.
Die nächste Runde ging glatt runter, schneller als die erste. Ich versuchte meinen alten Kumpel Johnny McGinnes zu erreichen, der vom Elektrohandel über Matratzen inzwischen bei Haushaltsgroßgeräten angekommen war, aber das muntere Kerlchen, das ans Telefon ging – »Goode’s White Goods. Mein Name ist Donny. Wie kann ich Ihnen helfen?« –, sagte mir, dass McGinnes schon Feierabend hatte. Ich bat ihn, McGinnes auszurichten, dass sein Freund Nick angerufen habe, und er sagte »Na klar« und dann »und wenn Sie je ein Haushaltsgerät benötigen, der Name ist Donny.« Ich legte auf, bevor er den Namen noch mal ins Spiel bringen konnte, und versuchte es erneut bei Lyla. Wieder erfolglos.
Also ging ich die nächste Runde an. Beim Einschenken schwappte der Bourbon neben das Glas. Ich öffnete ein Bier, das ich vorhin im Eiseimer versenkt hatte, und drehte die Stereoanlage wieder auf: ein Hupkonzert von irgendeinem Quintett, echt wildes Zeug, der dexamphetaminisierte Drummer völlig drunter und drüber. Am Ende der Session hatte ich den Shot ausgetrunken und beschloss zu gehen. Im Spot war es höllisch heiß geworden, meine Klamotten waren völlig durchgeschwitzt. Außerdem war mein Buzz jetzt genau richtig, viel zu schade, ihn allein zu verbringen. Ich machte das Licht aus, schloss die Vordertür ab und trat mit einem Bier in der Hand auf die 8th hinaus.
Ich lief an einem geschlossenen und vergitterten Sportschuhladen vorbei, passierte eine Seitengasse, eingangs von einer Straßenlaterne schwach erleuchtet, weiter drinnen Stimmen, eine Zigarette glühte auf und erlosch. Ein kleines Stück weiter lag das Athena’s, der letzte Frauenclub in meinem Stadtteil. Hinter der fensterlosen Ziegelfassade gleichmäßiges Bassgewummer. Ich drückte die Tür auf und trat ein.
Über den Donna-Summer-Song und den allgemeinen Lärm hinweg hörte ich jemanden meinen Namen rufen, schob mich an ein paar tanzenden Frauen vorbei und stellte mich an die Bar. Stella, die stämmige, schwarzhaarige Barfrau, hatte mir einen Shot eingegossen, sobald sie mich durch die Tür kommen sah. Ich dankte ihr, nahm das Glas und kippte den Bourbon in einem Schwung runter. Jemand gab mir einen Kuss in den Nacken und lachte.
Am Billardtisch in einer verrauchten Ecke entdeckte ich Mattie, meine aus Brooklyn hierhertransplantierte Freundin. Wir spielten wie so oft 8-Ball, und ich verlor einen Fünfer. Dann holte ich uns die nächsten Drinks, und wir spielten noch eine Runde mit dem gleichen Ergebnis. Mattie hatte vor dem ersten Stoß schon die ganze Partie im Kopf, während ich auf Kraft setzte und keinen Plan verfolgte. Manchmal gewann ich trotzdem – diesmal nicht.
Ich kehrte an die Bar zurück, bezahlte meine Zeche und ließ Stella zu viel Trinkgeld da. Aus dem Barspiegel glotzte mich mein Spiegelbild an, glänzende Augen, hässlich, verschwitzt. Neben der Kasse hing ein gerahmtes Foto von Jackie Kahn, der ehemaligen Barfrau im Athena’s und Mutter meines Sohnes Kent, der jetzt neun Monate alt war. Ich sagte etwas Lautes zu Stella, meine Stimme klang verzerrt und harsch. Sie begann zu lächeln, hörte aber abrupt damit auf, als sie mir in die Augen sah. Ich wandte mich von der Bar ab und schaffte es durch die Tür nach draußen an die frische Luft, auf die Straße.
Ich schloss die Vordertür des Spot auf, schaltete die Alarmanlage aus und ging hinter die Bar, öffnete ein kaltes Bier und trank in tiefen Zügen. Dann schenkte ich ein Shotglas randvoll mit Old Grand-Dad ein, lehnte mich vor, setzte meine Lippen direkt an den Whiskey und trank drei Zentimeter ab, ohne das Glas zu berühren. Ich schüttelte eine Camel mit Filter aus der Schachtel und steckte sie an. Das Telefon klingelte. Ich ließ es klingeln und ging zur Stereoanlage. Auf dem Weg stolperte ich über eine Gummimatte. Ich fand eine Kassette von Lungfish, eine Post-Hardcore-Gitarrenband aus Baltimore, und legte sie ein. Ich drückte auf Play und gab Bass dazu.
Black.
Ich hockte an der Bar und versuchte ein Streichholz anzuzünden. Eine runtergebrannte Kippe lag kalt und tot im Aschenbecher. Ich steckte eine neue an, warf das Streichholz Richtung Aschenbecher, traf daneben. Ich griff nach dem Shotglas und sah die halb volle Flasche Grand-Dad in einem Wald leerer Bierflaschen stehen. Ich schmeckte Whiskey. Die Kassette war zu Ende. Es war still in der Bar.
Black.
Ich trat vor dem Spot vom Gehweg auf die Straße. Eine heulende Sirene kreischte durch die Nacht. Stella kam an mir vorbei, sagte »Nicky, Nicky«, ging durch die offene Vordertür ins Spot und schaltete die Alarmanlage ab und wieder scharf. Sie fragte nach meinen Schlüsseln, nahm sie, schloss die Tür ab. Ein paar Frauen waren aus dem Athena’s gekommen. Stella hielt mir die Schlüssel hin, zog sie weg, als ich danach greifen wollte.
»Komm, Nicky. Komm mit und schlaf dich hinten aus.«
»Alles okay. Gib mir die Schlüssel.«
»Vergiss es.«
»Gib mir die Schlüssel. Ich kann im Auto schlafen. Scheiße, Stella, es sind über dreißig Grad. Glaubst du, ich erfriere? Gib mir meine Scheißschlüssel.«
Stella warf sie mir zu. Ich wollte sie fangen, doch in der einen Hand hatte ich ein offenes Bier und in der anderen die Grand-Dad-Flasche. Ich ging auf ein Knie runter und hob den Schlüssel von der Straße auf. Ich sah hoch, wollte Stella danken. Sie war weg.
Black.
Im Auto die Independence Avenue runter, ein Song von Minor Threat, volle Lautstärke, blies die Boxen meines Dodge durch. Ich hielt mitten auf der Straße, ließ den Motor laufen, stieg aus, urinierte auf den Asphalt. Zur Linken die National Mall, das Washington Monument, bedrohlich, beleuchtet, ein wenig gen Himmel gelehnt. Auf dem Gehweg rannten Touristen vorbei, Väter warfen mir schiefe Blicke zu, schoben ihre Kinder weiter, der Sänger kreischte aus dem offenen Autofenster: »What the fuck have you done?« Ich am Lachen.
Black.
Ich fuhr die M Street in Southeast entlang, rechts lag der Navy Yard. Dort hatte ich, begleitet von meinem Großvater, bei einer Auktion meinen ersten Wagen gekauft, einen 64er Plymouth Valiant. Muss dann wohl versucht haben, zum Spot zurückzukommen, und war falsch abgebogen. Überall Lichter, Laternen und Rücklichter, kreuz und quer. Ich griff zum Bier, spülte mit Bourbon nach. Der Bourbon tropfte mir vom Kinn. Lautes Hupen, eine wütende Stimme, die mich aus dem Wagen nebenan anbrüllte. Die Bierflasche zwischen meinen Beinen war umgekippt, Schaum gluckerte aus dem Hals. Meine Shorts waren klatschnass, ich zog die Brieftasche raus und schmiss sie auf den Beifahrersitz. Musik, im Wagen, laut und verzerrt.
Black.
Das Auto rollte langsam eine einspurige Straße entlang. Auf beiden Seiten Bäume. Zur Rechten, durch die Bäume hindurch, schimmerten bunte Lichter auf dem Wasser. Keine Musik mehr im Wagen. In der Ferne Gelächter, eine hohe Slidegitarre aus einem Radio. Vorne verschwommene gelbe Lichter, über dem Wasser hängend, zum Himmel gerichtet. Muss pinkeln, muss den Wagen anhalten, muss die Lichter zum Stillstand bringen. Höre Kies unter den Reifen knirschen, spüre, wie das Auto zum Stehen kommt. Würge den Motor ab. Öffne die Tür, stolpere raus auf den Kies, höre hinter mir eine Flasche auf den Boden knallen. Schwanke, finde das Gleichgewicht wieder, stolpere, renne, um mich an einem Baum festzuhalten. Muss mich hinlegen, aber nicht hier. Drücke mich vom Baum ab, pralle gegen einen anderen, spüre etwas über meine Wange peitschen. Schließe die Augen, öffne sie, beginne schwebend zu fallen. Nichts unter mir, keine Beine, Lichter und Wasser und Bäume stürzen auf mich ein, drehen sich. Der Stoß, als ich auf dem Boden aufschlage. Kein Schmerz. Auf dem Rücken schaue ich zu den Ästen hoch, durch die Zweige hindurch die Sterne, sie drehen sich, alles dreht sich. Übelkeit. Die Nacht kommt über mich, keine Kraft zum Rumrollen, gerade genug, um den Kopf zu drehen. Ein Schwall warmer Flüssigkeit kommt aus meinem Mund und fließt mir über den Hals, der Gestank meiner eigenen rinnenden Kotze, ihr Dampf steigt vor meinen Augen auf.
Black.
Ein Stich in meiner Wange. Etwas krabbelt über mein Gesicht, meine Hände liegen wie tot neben mir. Lass es krabbeln. Die Äste, die Sterne drehen sich immer noch. Mein Magen krampft. Ich drehe den Kopf und übergebe mich.
Black.
Eine Autotür wird zugeschlagen. Etwas wird durch Kies und Dreck geschleift. Andauerndes, panisches Stöhnen.
Die Stimme eines Schwarzen: »Okay. Du bist ne Schwuchtel und n Arschloch. Jetzt stirb wenigstens wie ein Mann.«
Das Stöhnen jetzt ein erstickter Schrei. Kann mich nicht rühren, kann nicht mal den Kopf heben. Ein dumpfer Knall, dann ein leises Platschen.
Der Schwarze: »Einfach liegen lassen?«
Eine andere Stimme, anderer Tonfall: »Bring in dieser Stadt nen Nigger um, und es ist keine Zeile wert – nichts für ungut, du weißt, was ich meine. Komm, verschwinden wir. Ab nach Hause.«
Black.
Als ich die Augen aufschlug, war der Himmel grau. Mit der Hand strich ich durch Dreck und Papier und Gras und etwas Nasses aus Plastik. Eine Weile blieb ich einfach liegen und schaute auf zu den Blättern, den Ästen und dem Himmel. Mein Rücken tat weh, der Nacken war steif. Ich roch Müll, mein eigenes Erbrochenes, meinen Schweiß.
Ich seufzte tief, richtete mich mit einem Ellenbogen auf. Über dem Wasser ging im Osten die Sonne auf, groß und dreckig-orange. Ich setzte mich auf, rieb etwas Verkrustetes von meinem Kinn, strich mir mit den Fingern durch die Haare.
Ich war unten am Anacostia River – im Hafengebiet, wo die M Street unbeschildert verläuft. Ich erkannte den Ort sofort. Mein Großvater und ich hatten hier früher geangelt. Er hatte die Barsche und den gelegentlichen Aal, die unsere Haken schluckten, immer zurückgeworfen. Der Fluss war schon damals praktisch tot gewesen.
Um mich herum standen Bäume, der Rasen darunter war zu Unkraut und Dreck verkommen, übersät mit Plastikflaschen und Fast-Food-Behältern, leeren Bierdosen, Fuselflaschen, benutzten Gummis, vereinzelten Schuhen. Ich wandte mich nach rechts und sah meinen Wagen halb verborgen im Wald, ordentlich geparkt zwischen zwei Bäumen und ohne einen Kratzer, Narrenglück. Dahinter erkannte ich die angeleinten Sport- und Rennboote eines Yachthafens, und hinter dem Hafen die 11th Street Bridge, die nach Anacostia rüberführt. In meinem Rücken lag die Straße, voller Risse und Schlaglöcher, dann kam dichterer Wald, dann Bahngleise, dann wieder Bäume. Zur Linken öffnete sich der Wald zu einer Lichtung, und dort hing ein verrostetes Hausboot halb versunken im Wasser. Hundert Meter weiter runter überspannte die Sousa Bridge den Fluss, deren Lichter ich letzte Nacht gesehen, aber nicht erkannt hatte.
Letzte Nacht. Eine Erinnerung an etwas sehr Falsches blitzte auf.
Ich rappelte mich hoch und ging mit wackligen Beinen auf die Lichtung zu, dann weiter bis ans Ufer. Holzpfähle, ungleichmäßig um das Hausboot herum verteilt, ragten aus dem braunen Wasser. An einem von ihnen schien sich etwas verfangen zu haben. Die Sonne blendete mich, hämmerte auf meinen Kopf ein. Ich schirmte die Augen ab, ging zu der Stelle, wo der Schaum des Flusses an die Betonspundwand platschte, stand am Rand.
Im Wasser lag ein junger schwarzer Mann, Kopf und Schulter befanden sich dicht unter der Oberfläche, der Ärmel um den einen gefesselten Arm war an einem Nagel im Pfahl hängen geblieben. Klebeband war um sein graues Gesicht herum gewunden und bedeckte den Mund. Unter dem Kinn sah ich eine Einschusswunde, klein und lila, schwarz umrandet und verkohlt. Die Kugel war nach oben gewandert und hatte den Hinterkopf weggesprengt, rosa Hirnbrocken klebten am Pfahl. Die Druckwelle hatte die Augen aus den Höhlen geschoben.
Ich fiel auf die Knie und würgte. Nichts drin, nichts kam hoch. Ich keuchte, starrte den Müll und das Treibgut im Fluss an. Dann stieß ich mich mit den Händen ab, stand auf und drehte mich um, machte ein paar stolpernde Schritte, lief auf die Bäume zu, blickte nicht zurück.
Ich hob die leere Bourbonflasche neben meinem Dodge auf, öffnete die Tür, warf die Flasche rein und setzte mich ins Auto. Der Schlüssel steckte noch. Im Rückspiegel schaute ich mir in die Augen, ohne mich wiederzuerkennen. Ich sah auf die Uhr, rieb den Dreck vom Glas: 6:30, Mittwoch.
Meine Brieftasche lag aufgeklappt auf dem Beifahrersitz. Ich nahm sie und betrachtete das Gesicht, das mir von meiner vom District of Columbia ausgestellten Lizenz entgegenblickte: »Nicholas J. Stefanos. Privatdetektiv.«
Das also war ich.
Ich drehte den Schlüssel um.
2
Am frühen Abend kam meine Freundin bei mir vorbei, Lyla McCubbin. Ich war gerade aufgewacht, saß nackt auf der Bettkante, die Vorhänge im Zimmer waren zugezogen. Die Klamotten von letzter Nacht hatte ich weggeschmissen, und im Laufe des Tages hatte ich zweimal geduscht. Trotzdem hatte ich wieder zu schwitzen begonnen, und das Zimmer stank nach Alkohol. Lyla setzte sich neben mich und rieb mir den Rücken, dann zog sie mir die Hände aus dem Gesicht.
»Ich hab mit Mai im Spot gesprochen. Sie hat heute Abend deine Schicht übernommen. War schlimm diesmal, wie?«
»Ja, ziemlich schlimm.«
»Was hast du da im Gesicht?«
»Bisse. Irgendwelche Kakerlaken, nehm ich an. Als ich aufgewacht bin … lag ich im Müll.«
»Scheiße, Nicky.«
»Ja.«
»Ich hab dich letzte Nacht angerufen«, sagte sie.
»Ich hab dich angerufen.«
Sie sah mir in die Augen. »Hast du geweint oder so, Nick?«
»Ich weiß nicht.« Ich senkte den Blick.
»Du hast den Blues«, sagte sie leise. »Du hast dir so richtig die Kante gegeben, hast Scheiße gebaut und bist abgestürzt. Jetzt bleibt dir nichts anderes übrig, als dich bei den Leuten, denen du dabei über den Weg gelaufen bist, zu entschuldigen und beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen vernünftiger zu sein. Aber mach dich deswegen nicht fertig. So was passiert mal.«
Ich schwieg. Lylas Finger strichen mir die Haare aus dem Gesicht. Nach einer Weile stand sie auf.
»Ich mach dir was zu essen«, sagte sie.
»Setz dich noch mal kurz.« Ich nahm ihre Hand, sie blieb, und alles sprudelte aus mir heraus.
Später saß ich auf der Veranda, während Lyla Burger auf einem Hibachi grillte, den sie auf der gepflasterten Terrasse aufgestellt hatte. Sie trank Chablis und stupste die Burger mit einem kurzen Bratenwender an. Ihre langen roten Haare glitten über ihren Rücken. Meine schwarze Katze strich um ihre Beine, raste dann quer über die Terrasse und jagte einer verirrten Motte nach. Ich beobachtete Lyla, die sich außerhalb des Lichtscheins der Veranda vor einem Sternenhimmel aus Glühwürmchen bewegte, und atmete den hochsommerlichen Hibiskus ein, der im Hof blühte.
Nach dem Essen fuhr Lyla zu Morris Miller, dem Spirituosengeschäft in Shepherd Park, und holte mehr Wein. Mein Vermieter, der die oberen beiden Stockwerke bewohnte, kam aus dem Haus und setzte sich zu mir auf die Veranda. Während ich die erste Zigarette des Tages rauchte, trank er Bier aus der Dose und erzählte mir von einer Frau, die er im Kirchenchor kennengelernt hatte und die »wie ein Engel« singe, aber »außerhalb der heiligen Wände den Teufel in den Hüften« habe. Ich zog an der Zigarette, und er zeigte lachend auf meine Katze, die immer noch im Kreis hinter der Motte herrannte.
»Wenn das alte Viech noch beide Augen hätte, würde sie das Ding kriegen.«
»Sie hat noch Chancen«, sagte ich. »Neulich hat sie einen Spatz gefangen und mir vor die Tür gelegt.«
»Warum schaffst du dir kein richtiges Tier an, Mann? Ich kenne da einen Jungen unten an der 14th und Webster, der hat ein paar Straßenkatzen, die mit jedem Köter fertigwerden.«
»Ich weiß nicht. So eine Katze verschreckt am Ende noch deine Freundinnen.«
»Das wäre schlecht.« Mein Vermieter lachte krächzend. »Weil die Frau, die ich jetzt habe, die Kirchenfrau? Das könnte was Ernstes sein.«
Lyla kehrte zurück, entkorkte den Wein und schenkte sich ein Glas ein. Mein Vermieter gab ihr einen Kuss und ging zu seinem Sessel und seinem Fernseher ins Haus zurück. Lyla setzte sich neben mich, steckte ihre Hand zwischen meine Oberschenkel und streichelte mich.
»Wie fühlst du dich?«
»Besser.«
»Morgen wird’s noch besser.«
»Vermutlich.«
Lyla beugte sich zu mir. Als ich den Kopf abwandte, nahm sie mein Kinn und zwang mich, sie anzusehen. Ich blickte in ihre hellgrünen Augen. Sie gab mir einen langen Kuss, ihr Atem war warm und säuerlich vom Wein.
Nach einer Weile gingen wir ins Haus. Ich schob eine Curtis-Mayfield-Kassette ein, und Lyla zündete in meinem Zimmer ein paar Gebetskerzen an. Ich zog sie von hinten aus, küsste die pulsierende blaue Ader an ihrem Hals. Wir fielen aufs Bett und liebten uns langsam im flackernden Kerzenlicht. Lyla setzte sich auf mich und legte meine Hände auf ihre Brüste. Der Kerzenschein spiegelte sich in ihrem feuchten Haar, der Schweiß auf ihrer Brust glänzte wie Glas.
Ich schloss die Augen und überließ mich ihr, überließ mich den Sinnen, dem Stöhnen aus ihrem offenen Mund, meiner steigenden Erregung, der Stimme von Curtis, der Do Be Down sang. Sie wusste, was sie tat, und es funktionierte: Ein paar Minuten lang vergaß ich den Mann, der ich geworden war. Oder vielleicht wurde ich von ihr an einen anderen Ort gebeamt, wo ich mir einbilden konnte, ein anderer zu sein.
Am nächsten Morgen hatte mir Lyla im Wohnzimmer einen Kaffee neben die Post gestellt. Ich nahm die Tasse, und während ich in kleinen Schlucken trank, starrte ich apathisch die Titelseite der Zeitung an. Lyla kam ins Zimmer und steckte eine cremefarbene Bluse in einen apfelgrünen Rock.
»Hat’s in die Abendausgabe geschafft«, sagte sie. »In den Stichproben versteckt.«
Die Post sammelte die gewalttätigen Todesfälle in Washingtons Unterschicht täglich in einer Rubrik mit der Überschrift »Regionales«, von den Journalisten der Stadt sarkastisch in »Stichproben« umbenannt. Als leitende Redakteurin der seriösen Wochenzeitung D.C. This Week war Lyla selbst nicht vor Kritik an den lokalen Medien gefeit, doch das hielt sie nicht davon ab, hin und wieder gegen die Konkurrenz von der Washington Post zu sticheln.
»Was steht drin?«
»Das Übliche«, sagte sie. »›Unbekannter Toter im Anacostia River gefunden. Tödliche Schussverletzungen. Die Polizei hält den Namen zurück, bis die Angehörigen verständigt wurden, im Augenblick keine Verdächtigen‹ – wie immer. Wer das liest, denkt automatisch: wieder ein Drogenmord. Rache, was auch immer. Und das war’s ja vermutlich auch, oder?«
Ich setzte mich aufs Sofa und strich mit den Fingern über den Rand des Tisches. Lyla band ihre Haare mit einem schwarzen Gummi nach hinten und ließ mich nicht aus den Augen.
Ich sah auf. »Hast du immer noch diesen Freund auf dem Revier?«
Lyla stellte sich vor mich hin und stemmte die Hände in die Hüften. Mit müder Stimme sagte sie: »Ja, und auch noch andere Quellen bei der Polizei. Warum?«
»Nur so. Ich dachte, vielleicht kannst du mal fragen, was sie so rausgefunden haben.«
»Damit du dich einmischen kannst?«
»Reine Neugier, mehr nicht. Ich hab das ja schon lange nicht mehr gemacht. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll.« Ich dachte an meinen letzten Fall vor eineinhalb Jahren: William Henry und April Goodrich, das Haus in der Gallatin Street – ein Blutbad und viel zu viel Schmerz.
Lyla beugte sich vor und küsste mich auf den Mund. »Ruh dich heute mal aus, Nick. Okay?«
»Ich hab eine Schicht«, sagte ich.
»Gut«, sagte sie. »Das ist gut.«
Sie warf mir noch einen bedeutungsvollen Blick zu und ging. Ich hörte die Fliegentür zuschlagen und trank langsam den Kaffee aus. Dann duschte ich, zog mich an und verließ das Haus. Die Zeitung blieb unberührt und ungelesen auf dem Wohnzimmertisch liegen.
Im Spot war an diesem Mittag die Hölle los. Darnells Spezialität, eine dicke Scheibe Hackbraten mit Kartoffelbrei und Sauce, war der Renner, und er schob flink einen Teller nach dem anderen durch die Durchreiche. Ramon räumte die Tische ab und schaffte es gerade so, genug Geschirr und Besteck für die nächsten Bestellungen abzuwaschen. Unsere neue Mittagskellnerin Anna Wang, eine zähe kleine halbchinesische Collegestudentin, arbeitete den kleinen Speiseraum neben der Bar ab.
Anna kam an die Bar und rief »Bestellung«. Sie zog eine Rechnung aus der Schürzentasche, pustete sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und kritzelte ein paar Zeichen auf den Zettel. Ich goss freihändig Wodka in ein Glas und gab für die Farbe Cranberrysaft dazu. Dann zapfte ich ein Bier und trug beides zu Anna hinüber, eine brennende Camel in meinem Mund. Als ich die Getränke auf ihrem Tablett absetzte, steckte sie einen Cocktailstab in den Wodka.
Sie sagte: »Darf ich mal, Nick?«
Ich nahm die Zigarette aus dem Mund und schob sie ihr zwischen die Lippen. Sie zog einmal, ließ den Rauch aus der Nase strömen und zog dann noch einmal, bevor ich ihr die Kippe wieder wegnahm. Sie nickte, nahm das Tablett und ging. Ich sah, wie Ramon sich bemühte, ihr Bein mit seinem zu streifen, als er mit einem Servierwagen voll dreckigem Geschirr an ihr vorbeikam, aber Anna ignorierte ihn.
»Noch ein Martini, Nick«, sagte Melvin, unser Schnulzensänger, der auf seinem Stammhocker an der Bar saß. Ich goss ein bisschen Billiggin in ein hohes Glas, gab ein, zwei Tropfen Dry Vermouth dazu und servierte das Glas ordentlich auf einer Serviette. Melvins Lippen bewegten sich zu der aus dem Kassettendeck dringenden Stimme von Shirley Horn, dann hörte ich Darnell über das Klappern von Geschirr und die Gospelmusik seines eigenen Radios hinweg aus der Küche brüllen: »Essen ist fertig!«
Ich nahm das Tablett aus der Durchreiche und ging an der Bar entlang zu Happy, unserem miesepetrigen Stammalki, der allein saß, immer allein. Auf dem Weg leerte ich den Aschenbecher eines Graubartes namens Dave, der in aller Ruhe bei einem Kaffee einen Schundroman las, die Brille tief auf der Nase, sein Einzelgängerdasein pflegend. Ein paar Ascheflocken schwebten auf Happys Essen hinab; ich blies sie weg und stellte ihm den Teller hin. Happy blickte düster den mit einem farblosen, welken Petersilienstrunk garnierten Fleischbatzen und die in klebrigem Kartoffelbrei schwappende Sauce an. Sein Griff lockerte sich, löste sich aber nicht vom Glas.
»Sieht aus wie Hundefraß«, murmelte er.
»Willst du noch einen Drink, Happy?«
»Ja«, sagte er mit mittäglichem Lallen. »Und gib diesmal ein bisschen Stoff dazu.«
Ich bereitete seinen Manhattan vor (ein Schuss Billigbourbon mit einer Kirsche, kein Vermouth) und stellte ihn auf einen aufgeweichten Untersetzer, der eine Sorte schwarzen Sambuca anpries, die wir nicht führten. Ich hörte Annas müde Stimme am anderen Ende der Bar: »Bestellung!«, ging hin und kümmerte mich um ihre Drinks.
So ging es den ganzen Nachmittag lang. Mit einsetzender Flaute kamen Buddy und Bubba angespült, Büroproletariat, teilten sich ein paar Bierpitcher und diskutierten mit einem fönfrisierten Typen namens Richard die ganze Zeit über Sport, auch wenn keiner der drei seit der Highschool einen Ball in der Hand gehabt hatte. Als sie gingen, steckten sie die Köpfe in die Küche und beglückwünschten Darnell zu der »Präsentation« des Hackbratens, aber Darnell ließ sich nicht stören. Buddy grinste noch höhnisch in meine Richtung, bevor er und Bubba aus der Tür verschwanden.
Nach der Mittagszeit legte ich Anna zuliebe PJ Harvey ein, während sie sauber machte und aufräumte. Phil Saylor wollte, dass zu den Hauptzeiten Blues und Jazz gespielt wurde, aber jetzt saß nur noch Happy in seinem schnittigen, schuppenbestäubten, pflaumenfarbenen Sportsakko an der Bar, umgeben von einer tief herabgesunkenen Rauchwolke aus seiner eigenen Zigarette, und Happy reagierte sowieso nie auf die Musik.
Anna schnorrte noch eine Zigarette und machte sich dann vom Acker. Ramon verzog sich in die Küche, wo er an dem belustigten Darnell irgendwelche albernen Karateschläge ausprobierte, und ich begann, Zitronen für Mais Abendschicht zu schneiden. Ich war gerade fertig, als Dan Boyle durch die Tür kam.
Er platzierte seinen breiten Arsch auf dem Hocker vor mir und fuhr sich mit Fingern, die wie bleiche Zigarren aussahen, durch das drahtige, köterblonde Haar.
»Nick.«
»Boyle.«
Seine behäbigen, ausgewaschenen Augen schweiften zum Schnapsregal und wieder zurück zur Theke. Ich drehte mich um, nahm die schwarz etikettierte Flasche Jack Daniel’s vom Regal, gab einen Schuss Sour Mash in ein Glas und schob es ihm hin.
»Ein Bier dazu?«
»Noch zu früh.«
Er setzte das Glas an die Lippen, legte den Kopf in den Nacken und trank langsam. Dabei öffnete sich sein Jackett ein wenig, und der Griff seines Colt Python schaute heraus.
Das Spot war durch Saylors alte Verbindungen zur beliebten Stammkneipe der Zivilbullen und Detectives von D.C. geworden und abends häufig mit Waffen gespickt. Boyle hatte dabei einen ganz besonderen Ruf, nicht nur wegen seiner allseits bekannten Beteiligung an der Schießerei in der Gallatin Street. Ich war damals bei ihm gewesen, hatte direkt neben ihm gestanden. Meine Rolle war nie öffentlich geworden, aber jeder Blick in den Spiegel erinnerte mich wieder daran: Eine fünf Zentimeter lange Narbe zog sich quer über meine Wange.
»Verdammt, ist das gutes Zeug.« Boyle wischte sich mit der Hand über den Mund. »Jetzt nehme ich das Bier.«
Ich zapfte ihm eins und stellte es neben das Shotglas. Boyle holte eine Schachtel Marlboro hervor, zog eine Zigarette heraus, klopfte sie auf die Schachtel und steckte sie sich zwischen die Lippen. Ich gab ihm Feuer.
»Danke.« Boyle spie Rauch aus und griff nach dem Bier. Ich beugte mich über das Spülbecken und stülpte ein Glas über die Bürste.
»Guten Tag gehabt?«, fragte ich, den Blick in das schlierige Wasser gesenkt.
»Ganz okay. Hab den Typen gekriegt, der vor zwei Wochen drüben auf dem Schulhof an der Duval die Glock abgefeuert hat.«
»Der den falschen Jungen getroffen hat?«
»Den falschen? Wie man’s nimmt. Der Junge, der erschossen wurde, hatte ein Bündel Zwanziger in der Tasche, und die Goldkette um seinen Hals war dicker als mein Handgelenk. Der Typ hat vielleicht nicht den Jungen getroffen, auf den er es abgesehen hatte, aber ganz sicher hat er einen abgeknallt, der zur Drogenszene gehörte. Scheiße, Nick, wenn man in dieser Highschool einen Stein in die Aula schmeißt, trifft man immer jemanden, der irgendwas auf dem Kerbholz hat.«
»Du bist ein wahrer Optimist, Boyle. Weißt du das?«
»Spar dir den Vortrag. Und überhaupt, du schwingst da hinter der Bar große Reden über Soziologie und den ganzen Mist. Ich stehe da draußen an der Front –«
»Im Asphaltdschungel?«
»Was?«
»Concrete Jungle«, sagte ich. »The Specials.«
»Gib mir noch nen Drink«, murrte Boyle, trank den letzten Rest aus seinem Glas, spülte mit einem Schluck Bier nach und wischte sich das Kinn mit dem Handrücken ab.
Am anderen Ende der Theke sagte Happy irgendwas, entweder zu sich selbst oder zu mir. Ich ignorierte ihn, schenkte Boyle den nächsten Bourbon ein, stützte mich mit dem Ellenbogen auf das Mahagoni und stellte einen Fuß auf die Kühlbox.
»Also, Boyle. Der Junge, der da vorletzte Nacht umgebracht wurde –«
»Den man im Fluss gefunden hat?«
»Ja. Das war wohl auch ein Drogending, hm?«
»Würde ich drauf wetten«, sagte Boyle. »Aber das ist nicht mein Revier. Wenigstens einer, um den ich mich nicht kümmern muss.«
»Ich würde gern was wissen. Du kennst dich doch aus damit, welche Waffen gerade angesagt sind? Das ändert sich ja ständig, aber du bist auf dem Laufenden, oder?«
»Und?«
»Benutzen Vollstrecker heutzutage üblicherweise Schalldämpfer?«
Boyle dachte kurz nach und schüttelte den Kopf. Während er seine Kippe ausdrückte, beobachtete er mich aus dem Augenwinkel. Happy rief wieder, und ich ging hin und machte ihm einen Drink. Als ich zurückkam, kippte Boyle den Rest seines Jack Daniel’s runter und trank das Bier aus. Er legte Geld auf die Theke, steckte die Zigarettenschachtel ein und rutschte ungeschickt vom Hocker.
»Pass auf dich auf, Nick.«
»Du auch.«
Ich nahm seine Scheine, legte sie in die Kasse und warf das Wechselgeld in mein Trinkgeldglas. Im Barspiegel sah ich Boyle auf die Tür zugehen. Er drehte sich noch einmal um und starrte mit offenem Mund und leeren Augen meinen Rücken an. Dann verließ er mit schweren Schritten die Bar.
Am Freitag hatte ich noch eine Schicht. Abends sahen Lyla und ich uns einen Film im Dupont an und gingen danach bei Aleko’s an der Connecticut, dem besten Griechen der Stadt, was essen. Lyla trank im Restaurant ein paar Gläser Retsina und zu Hause noch ein paar Gläser Weißwein, bevor wir ins Bett gingen. Ich trank an dem Abend nichts – der dritte Tag ohne einen Tropfen, die längste trockene Phase seit langer, langer Zeit. Allerdings schlief ich nur schwer ein und träumte dann wild und in verwirrenden Einzelheiten von fremden Orten und blauschwarzen Staren, die sich aus allen Ecken in die Lüfte schwangen.
Am Samstag ging Lyla ins Büro, um eine Titelstory zu überarbeiten, und ich fuhr mit meinem Rennrad runter in die National Mall, um mir im Sylvan Theater ein kostenloses Konzert von Fugazi anzuhören. Das Publikum applaudierte höflich einer Go-Go-Band, dann kamen Fugazi auf die Bühne und nahmen den Laden auseinander. Ich entdeckte Joe Martinson, einen Freund aus alten Postpunk-Tagen, und wir standen zwischen all den Teenagern, die voll auf die Musik abgingen.
Den Abend verbrachten Lyla und ich bei mir, wir hörten uns alte Platten an. Lyla trank erst einen Gin Tonic und ging dann zu Wein über. Gegen Mitternacht rief sie mich raus auf die Terrasse, wo sie auf einer ausgebreiteten Decke saß und grinste. Als sie die Beine öffnete, rutschte ihr Rock nach oben, und ich sah den Grund für ihr Lächeln. Es war ein guter Abend, ein weiterer Tag ohne Alkohol war geschafft. Aber meine Träume waren genauso schlimm wie in den Nächten davor.
Am Sonntag fuhren wir rüber nach Sandy Point und vergruben die Zehen im heißen gelben Sand, kühlten uns in der Bucht ab und wichen den Brennnesseln aus, die dieses Jahr wegen der schweren Regenfälle im Frühling spät dran waren. Abends fuhr ich zur Alice Deal Junior High und legte eine Trainingsstunde mit meinem Arzt Rodney White ein, der im Sportzentrum eine Karateschule leitete. Obwohl ich mich dagegen gesperrt hatte, Taekwondo zu »lernen« – ich hatte früher im Boys Club geboxt, und Handtechnik reichte mir völlig –, hatte es Rodney im Laufe der Jahre geschafft, mir ein paar Tricks von der Straße sowie die ersten vier Formen des Taekwondo beizubringen. Ich beendete die letzte dieser Formen, dann absolvierten Rodney und ich ein bisschen Ein-Schritt-Sparring.
»Okay, Mann«, sagte Rodney.
Wir verbeugten uns, dann schlug ich zu. Rodney wich seitwärts aus, ging nach unten in die Reiterstellung, setzte zum Sprung an und peitschte die gestreckte, offene Hand keine zwei Zentimeter an meiner Kehle vorbei. Ich hörte das Flattern seiner schwarzen Gi-Hose und den Schrei, der tief aus seiner Brust kam.
»Verdammt, was war das denn?«
»Die Innenhandkante«, sagte Rodney. »Die vorderen Glieder der Finger sind leicht gebeugt. Du schlägst mit der gesamten Innenseite der Hand zu. Der Clou ist die Bewegung mit dem Handgelenk kurz vor dem Schlag. Geh seitwärts und nutz den Schwung im Hochkommen, um die Hand genau gegen den Adamsapfel zu knallen. Wenn man es richtig macht, kann man den anderen ziemlich übel zurichten.«
Ich versuchte es ein paarmal. »So?«
Rodney nickte. »So ähnlich. Aber schnellere Handbewegung am Ende. Das wird schon noch, wie alles andere.«
»Und jetzt?«
»Zieh die Handschuhe an, Mann«, sagte Rodney. »Wir machen ein paar Runden.«
Nach dem Training fuhr ich direkt nach Hause, nahm ein Bier aus dem Kühlschrank und stellte mich damit unter die Dusche. Ich dachte gar nicht darüber nach, es war einfach die übliche Routine, wenn ich von Rodneys Dojo zurückkam. Keine Alarmglocken schrillten, und auch mein schlechtes Gewissen meldete sich nicht. Das Bier war kalt und tat gut.
Ich stand unter dem Strahl der Dusche, lehnte mich an die Kachelwand und trank. Ich dachte an das, was unten am Fluss geschehen war und was ich gehört hatte: der Tonfall der Stimmen, die Worte, die animalische Angst des Jungen. Die Erinnerung fühlte sich an wie eine klamme Hand auf meiner Schulter. Die Sache war als Drogenmord abgehakt worden, wieder so ein schwarzer Junge aus einer miesen Gegend, der vom rechten Weg abgekommen war. Aber ich war in jener Nacht dort gewesen. Und je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr beschlich mich der Verdacht, dass sich alle irrten.
Ich stieg aus der Dusche, wickelte mir ein Handtuch um die Hüften, holte mir noch eine Dose Bier, die ich auf dem Weg ins Wohnzimmer öffnete, und rief Dan Boyle an.
»Ja«, sagte er über das Gelächter und Gekreische seiner Kinder hinweg.
»Boyle, Nick Stefanos hier. Was ist los bei dir?«
»Diese verdammten Kinder.« Er stieß einen langen, ermatteten Seufzer aus. »Was kann ich für dich tun?«
Ich sagte es ihm, und wir redeten die nächste halbe Stunde darüber. Am Ende versprach er widerwillig, meine Bitte zu erfüllen, vielleicht weil ihm klar war, dass wir beide dasselbe wollten. Wir verabredeten ein Treffen, ich dankte ihm und legte auf. Dann trank ich den Rest des Biers in einem Schluck aus.
Ich hätte Boyle noch mal anrufen und alles abblasen können. Dann wäre es vielleicht zwischen Lyla und mir nicht so gekommen, wie es kam, und ich wäre nie Jack LaDuke begegnet. Aber Neugier ist wie ein knackiger Arsch, von dem man besser die Finger lassen sollte. Am Ende packt man doch zu.
3
Am Montag verließ ich nach der Schicht das Spot und ging zu meinem Wagen, begleitet von Anna Wang, die einen bunten Rucksack umgehängt hatte. Sie trug eine schwarze Radlerhose und ein weißes T-Shirt, das ihr an einer Seite von der muskulösen Schulter gerutscht war und den spitzenbesetzten schwarzen Träger ihres BHs enthüllte. Ich ließ sie auf der Beifahrerseite einsteigen und setzte mich ans Steuer.
»Ludenkarre«, sagte Anna, als sie im Schalensitz meines neuesten fahrbaren Untersatzes versank.
»Mir gefällt’s«, sagte ich mit absichtlicher Untertreibung. Tatsächlich hatte ich mit den coolsten Wagen in ganz D.C.: einen 66er Dodge Coronet 500, weiß mit roter Innenausstattung, vollverchromter Mittelkonsole und einem 318er unter der Haube. Nachdem vor einem Jahr bei meinem Dart die Zylinderkopfdichtung hochgegangen war, war ich nach Winchester im Shenandoah Valley gefahren, hatte dem Vorbesitzer des Dodge rund zweitausend in bar hingeblättert und es seither kein bisschen bereut.
Anna schnappte sich eine Kippe aus dem hinter die Sonnenblende geklemmten Päckchen und drückte den Anzünder rein. Ich ließ den Wagen an, der Doppelauspuff röhrte. Anna warf mir einen Seitenblick zu.
»Bist du etwa ein Autofreak, Nick?«
»Nicht wirklich. Ich mag die alten Chryslers einfach. Mein erster Wagen war ein Valiant mit einem Druckknopfanlasser im Armaturenbrett. Danach hatte ich einen 67er Polara, weiß auf rot, das extralange Modell, ein Motel auf Rädern. Mein Kumpel Johnny McGinnes hat immer ›puertoricanischer Cadillac‹ dazu gesagt. Hatte hinten Katzenaugen. Eine echte Schönheit. Dann hatte ich einen 67er Belvedere, klare Linien, Mann, der Schlitten ließ sich lenken wie Butter. Wahrscheinlich wegen des Achsdifferentials. Dann meinen alten Dart, und jetzt den hier. Echt, diese Mopar-Motoren sind die stärksten, die dieses Land je gebaut hat. Solange sie nicht völlige Rostlauben sind, werde ich diese Autos immer wieder kaufen.«
Anna zog an der Zigarette und grinste. »Achsdifferential? Nick, du bist ein Autofreak, Mann.«
»Ja, na ja, kann schon sein.« Ich sah sie lange an. »Apropos, nächsten Samstagabend steigt ein Tractor-Pulling-Event. Ich hab gedacht … wenn du nichts vorhast, würde ich mich echt freuen, wenn du mit mir hingehst –«
»Sehr witzig. Nimm zum Treckerschleppen lieber deine Freundin mit, Buddy.«