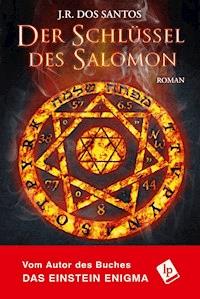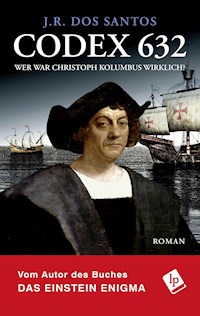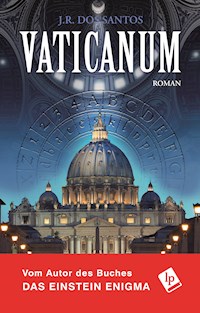Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: luzar publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tomás Noronha-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Kairo, 2006. Der Codespezialist Tomás Noronha soll ein Manuskript Albert Einsteins entschlüsseln: "Die Gottesformel". Der Inhalt ist explosiv. Als Doppelagent wider Willen gerät Tomás Noronha zwischen die Fronten und unter Spionageverdacht. Im Manuskript geht es aber nicht um eine neue Atombombe, sondern um Inhalte mit gesellschaftlicher Sprengkraft: den wissenschaftlichen Beweis für die Existenz Gottes. Ein spannender, fundiert recherchierter Roman, der die Relativitätstheorie auch für den interessierten Laien verständlich macht. Weltklasse!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 714
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Hinweis
Alle in diesem Buch enthaltenen wissenschaftlichen Angaben sind wahr,
und alle hier abgehandelten wissenschaftlichen Theorien werden von
José António Afonso Rodrigues dos Santos ist TV-Moderator und Sprecher der Abendnachrichten des portugiesischen Senders RTP1, mehrfach ausgezeichneter Kriegsberichterstatter und ehemaliger Dozent für Journalismus an der Neuen Universität Lissabon. Er hat das Talent, selbst anspruchsvollste Sachverhalte leicht und spannend zu vermitteln.
Mit seinen Büchern erreicht er ein Millionenpublikum und regelmäßige Bestsellerauflagen, insbesondere mit Das Einstein Enigma (420.000 Exemplare in Frankreich, 210.000 Exemplare in Portugal), das zudem in Kürze verfilmt werden soll. 18 Romane und 7 Essays liegen mittlerweile von ihm vor. Insgesamt wurden mehr als 3 Millionen seiner Bücher verkauft, in bis zu 20 verschiedenen Sprachen.
Folgende Werke sind oder werden in Kürze bei luzar publishing veröffentlicht: Das Einstein Enigma; Der Schlüssel des Salomon, die thematische Fortsetzung von Das Einstein Enigma; Vaticanum; Codex 632 und Das letzte Geheimnis Jesu.
José Rodrigues dos Santos lebt in Lissabon.
Der Autor informiert regelmäßig über aktuelle Ereignisse unter:
www.joserodriguesdossantos.com
J.R. Dos Santos
Das Einstein Enigma
J.R. Dos Santos
Das Einstein Enigma
Aus dem Portugiesischen von Paula Porter
Für Florbela
„Ich bin das Alpha und das Omega,
der Anfang und das Ende,
der Erste und Letzte,
der Allmächtige.“
Johannes, Offenbarung 22, 13
Vorgeschichte
13. Mai 1951
Der Mann mit der dunklen Brille riss das Streichholz an und hielt die bläuliche Flamme an seine Zigarette. Er tat einen tiefen Zug, und langsam stieg eine Wolke grauen Rauchs vor seinem Gesicht auf. Dann ließ er seinen Blick über die Straße gleiten.
Die Sonne schien, in den gepflegten Gärten standen anmutige Holzhäuser, die Blätter rauschten im leichten Morgenwind. Die milde Luft war erfüllt vom frischen Duft der Glyzinien, vom Konzert der Kolibris und der emsig zirpenden Grillen. Ein Kind hüpfte, sorglos lachend und einen bunten Drachen hinter sich herziehend, den Gehweg entlang.
Frühling in Princeton.
Ein Geräusch in der Ferne zog die Aufmerksamkeit des Mannes auf sich. Von rechts tauchten drei Polizeimotorräder auf, die eine Wagenkolonne anführten. Der Motorenlärm schwoll rasch an und wurde schier unerträglich. Der Mann nahm die Zigarette aus dem Mund und drückte sie auf der Fensterbank aus.
„Sie kommen“, sagte er mit einem Blick über die Schulter.
„Soll ich mit der Aufnahme beginnen?“, fragte der andere, mit dem Finger am Knopf des Tonbandgeräts.
„Ja, besser ist es.“
Die Wagenkolonne hielt direkt gegenüber, vor einem zweistöckigen, weißen Wohnhaus mit einer griechisch anmutenden überdachten Veranda. Polizisten in Uniform und in Zivil übernahmen die Kontrolle über das Gelände, und ein untersetzter Mann, offensichtlich ein Bodyguard, öffnete die Tür eines schwarzen Cadillacs. Ein Mann mit weißem, über die Ohren reichenden Seitenhaar und Kopfglatze stieg aus und ordnete seinen dunklen Anzug.
„Ich kann Ben-Gurion schon sehen“, sagte der Beobachter mit der dunklen Brille.
„Und was ist mit unserem Freund? Ist er schon da?“, fragte der andere, frustriert, weil er nicht auch zum Fenster gehen und die Szene beobachten konnte.
Sein Kollege blickte zum Haus. In der Tür erschien eine leicht gebeugte Gestalt mit weißen, zurückgekämmten Haaren und vollem grauen Schnurrbart, die lächelnd die Treppe hinunterging.
„Ja, er ist da.“
Kurz darauf konnten die beiden Beobachter über die Lautsprecher verfolgen, was draußen vor sich ging.
„Schalom, Herr Premierminister.“
„Schalom, Professor.“
„Seien Sie willkommen in meinem bescheidenen Haus. Es ist mir ein Vergnügen, den berühmten David Ben-Gurion zu begrüßen.“
Der Premierminister lachte.
„Sie scherzen wohl, das Vergnügen ist ganz meinerseits. Man ist nicht alle Tage bei Albert Einstein zu Gast, nicht wahr?“
Der Mann mit der dunklen Brille blickte zu seinem Gefährten.
„Nimmst du auch auf?“
Der andere vergewisserte sich, dass die Anzeigenadeln der Geräte korrekt ausschlugen.
„Ja, mach dir keine Sorgen.“
Vor der Tür posierten Einstein und Ben-Gurion für die Reporter. Dann bedeutete Einstein seinem Gast, dass sie bei dem herrlichen Wetter draußen bleiben könnten und zeigte auf eine Gruppe Holzstühle auf dem feuchten Rasen. Die Fotografen und Kameramänner hielten den Moment fest, als Ben-Gurion und Einstein dort Platz nahmen. Nach ein paar Minuten verscheuchte ein Leibwächter die Pressevertreter mit ausgebreiteten Armen und sorgte dafür, dass die beiden Männer sich ungestört unterhalten konnten.
Im Haus zeichnete das Tonbandgerät ihre Stimmen nach wie vor auf.
„Sind Sie mit dem Verlauf Ihrer Reise zufrieden, Herr Premierminister?“
„Ja, Gott sei Dank habe ich einige Unterstützung und zahlreiche Spenden gewinnen können. Im Anschluss werde ich nach Philadelphia reisen, wo ich weiteres Geld zu erhalten hoffe. Aber genug ist es ja nie, nicht wahr? Unsere junge Nation ist von Feinden umzingelt und braucht alle Hilfe, die sie nur bekommen kann.“
„Israel ist erst drei Jahre alt, Herr Premierminister. Da ist es ganz natürlich, dass es Schwierigkeiten gibt.“
„Aber um sie zu überwinden, brauchen wir Geld, Professor. Guter Wille alleine genügt nicht.“
Drei Männer in dunklen Anzügen stürmten durch die Tür des gegenüberliegenden Hauses. Beidhändig richteten sie ihre Pistolen auf die zwei Verdächtigen, die das Gespräch belauschten.
„Keine Bewegung!“, brüllte einer der Bewaffneten. „FBI! Nehmen Sie die Hände hoch, aber schön langsam!“
Der Mann mit der Sonnenbrille und sein Kollege am Tonbandgerät hoben zwar die Hände, wirkten aber keineswegs beunruhigt. Mit den Waffen im Anschlag traten die FBI-Leute näher.
„Auf den Boden legen!“
„Das ist nicht nötig“, erwiderte der Mann mit der Sonnenbrille seelenruhig.
„Ich habe gesagt, auf den Boden legen!“, fauchte der FBI-Agent. „Nochmal wiederhole ich es nicht.“
„Immer mit der Ruhe, Jungs“, sagte der Mann mit der Sonnenbrille. „Wir sind von der CIA.“
Der FBI-Agent runzelte die Stirn.
„Können Sie das beweisen?“
„Ja, wenn Sie mich meinen Ausweis aus der Tasche holen lassen.“
„Dann los, aber langsam. Keine abrupten Bewegungen.“
Langsam griff der Mann mit der Sonnenbrille in seine Jackentasche und zog eine Karte heraus, die er dem FBI-Mann hinhielt. Die Karte mit dem runden Siegel der Central Intelligence Agency wies ihn als Geheimdienstagenten Frank Bellamy aus. Widerstrebend gab der FBI-Mann seinen Kollegen ein Zeichen, die Waffen zu senken und blickte sich prüfend im Raum um.
„Was hat die CIA hier zu suchen?“
„Das geht euch nichts an.“
Der FBI-Agent sah zu den Tonbandgeräten.
„Ihr nehmt das Gespräch auf?“
„Wie gesagt, das geht euch nichts an.“
„Dem Gesetz nach dürft ihr keine amerikanischen Staatsbürger ausspionieren, das wisst ihr doch wohl.“
„Der israelische Premierminister ist aber kein amerikanischer Staatsbürger.“
Der FBI-Mann überdachte die Antwort. Der Agent von der Konkurrenz hatte de facto ein gutes Argument.
„Wir bemühen uns seit Jahren darum, unseren Freund dort drüben abzuhören“, sagte er und sah aus dem Fenster zu Einstein hinüber. „Uns ist zu Ohren gekommen, dass er und seine zickige Sekretärin den Sowjets geheime Informationen zukommen lassen. Aber Hoover lässt uns keine Wanzen bei ihm installieren, aus Angst vor dem, was passieren könnte, falls der Bursche dahinterkommt.“ Er kratzte sich am Kopf. „Offensichtlich habt ihr dieses Problem umgehen können.“
Bellamy verzog seine schmalen Lippen zu einem Anflug von Lächeln.
„Pech für euch, dass ihr vom FBI seid.“ Er deutete mit einer Kopfbewegung zur Tür. „Und jetzt los, verschwindet. Lasst die Großen arbeiten.“
Der FBI-Mann machte ein abschätziges Gesicht.
„Immer noch die gleichen Arschlöcher, was?“, brummte er, ehe er sich zur Tür wandte. Dann winkte er seinen Begleitern. „Kommt, Jungs, wir gehen.“
Sobald die FBI-Leute das Haus verlassen hatten, trat Bellamy wieder zum Fenster und beobachtete die beiden Juden, die sich nach wie vor im Garten des gegenüberliegenden Hauses unterhielten.
„Bob, nimmst du immer noch auf?“
„Ja“, sagte der andere. „Das Gespräch ist gerade in eine entscheidende Phase getreten. Ich stelle lauter.“
Bob betätigte den Lautstärkeregler, und im Raum ertönten abermals die Stimmen Einsteins und Ben-Gurions.
„… Verteidigung Israels“, beendete Ben-Gurion gerade einen Satz.
„Ich weiß nicht, ob ich das machen kann“, erwiderte Einstein.
„Können Sie nicht oder wollen Sie nicht, Professor?“
Es entstand eine kurze Pause.
„Ich bin, wie Sie wissen, Pazifist“, nahm Einstein den Faden wieder auf. „Ich finde, es gibt schon genug Unglück auf der Welt, und wir spielen hier mit dem Feuer. Dies ist eine Macht, vor der wir Respekt haben müssen, und ich weiß nicht, ob wir reif genug dafür sind, mit ihr umzugehen.“
„Und dennoch waren Sie es, der Roosevelt davon überzeugt hat, die Bombe zu entwickeln.“
„Das war etwas anderes.“
„In welcher Hinsicht?“
„Die Bombe sollte dazu dienen, Hitler zu bekämpfen. Aber wissen Sie, ich habe es schon bereut, den Präsidenten zu ihrem Bau überredet zu haben.“
„Ach ja? Und was, wenn die Nazis sie zuerst gebaut hätten? Was wäre dann passiert?“
„Sicher“, pflichtete Einstein ihm bei. „Das wäre eine Katastrophe gewesen. So schwer es mir fällt, das zu sagen, aber womöglich war der Bau der Bombe tatsächlich ein notwendiges Übel.“
„Dann geben Sie mir also Recht.“
„Tue ich das?“
„Ja, natürlich. Und worum ich Sie bitte, könnte erneut ein notwendiges Übel sein, um das Überleben unserer jungen Nation zu gewährleisten. Was ich damit sagen will: Sie haben Ihren Pazifismus bereits im Zweiten Weltkrieg hintangestellt und es erneut getan, um bei der Geburt Israels behilflich zu sein. Ich muss wissen, ob Sie es wieder tun werden.“
„Ich weiß nicht.“
Ben-Gurion seufzte.
„Professor, unsere junge Nation ist in Todesgefahr. Sie wissen ebenso gut wie ich, dass Israel von Feinden umzingelt ist und etwas braucht, das diese Feinde abschreckt und zum Rückzug zwingt. Andernfalls wird das Land noch in den Kinderschuhen verschluckt werden. Deswegen bitte ich Sie und flehe Sie an, stellen Sie Ihren Pazifismus ein weiteres Mal hintan und helfen Sie uns in dieser schweren Stunde.“
„Das ist nicht das einzige Problem, Herr Premierminister.“
„Sondern?“
„Das Problem ist, dass ich zurzeit sehr beschäftigt bin. Ich bin dabei, eine einheitliche Feldtheorie zu entwickeln, die Gravitation und Elektromagnetismus einbezieht. Es ist eine sehr wichtige Arbeit, vielleicht die wichtigste …“
„Kommen Sie, Professor“, unterbrach ihn Ben-Gurion. „Ich bin mir sicher, Sie erkennen, dass das, was ich Ihnen sage, Vorrang hat.“
„Zweifellos“, räumte der Wissenschaftler ein. „Bleibt die Frage, ob das, worum Sie mich bitten, auch umgesetzt werden kann.“
„Und, kann es das?“
Einstein zögerte.
„Vielleicht“, sagte er schließlich. „Ich weiß nicht, ich muss die Sache prüfen.“
„Tun Sie das, Professor. Tun Sie es für uns, tun Sie es für Israel.“
Frank Bellamy machte sich rasch ein paar Notizen und warf dann einen Blick auf die Anzeige. Die roten Nadeln bewegten sich im Rhythmus des Tons, es wurde also jedes Wort aufgezeichnet. Bob verfolgte das Gesagte und schüttelte dann den Kopf.
„Ich glaube, das Wesentliche haben wir“, brummte er. „Soll ich die Aufnahme beenden?“
„Nein“, sagte Bellamy. „Mach weiter.“
„Aber sie haben inzwischen das Thema gewechselt.“
„Das macht nichts. Vielleicht kommen sie ja nochmal darauf zurück. Nimm weiter auf.“
„… mehrmals, ich habe nicht die herkömmliche Vorstellung von Gott, aber es fällt mir schwer zu glauben, dass es über die Materie hinaus nichts weiter geben soll“, sagte Ben-Gurion. „Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich mache.“
„Doch, vollkommen.“
„Sehen Sie“, fuhr der Premierminister fort. „Das Gehirn besteht aus Materie, genau wie der Tisch. Aber der Tisch kann nicht denken. Das Gehirn ist Teil eines lebendigen Organismus, so wie meine Nägel, nur dass meine Nägel nicht denken können. Und wenn mein Gehirn vom Körper getrennt wird, kann es ebenfalls nicht denken. Die Gesamtheit aus Körper und Kopf macht es möglich, dass man denkt, was mich zu der Annahme führt, dass das Universum als Ganzes möglicherweise ein denkender Körper ist. Meinen Sie nicht?“
„Möglich ist es.“
„Ich habe immer gehört, Sie seien Atheist, Professor, aber glauben Sie nicht…“
„Nein, ich bin kein Atheist.“
„Nicht? Dann sind Sie also ein religiöser Mensch?“
„Ja, das kann man so sagen.“
„Aber ich habe irgendwo gelesen, Sie seien der Meinung, dass die Bibel irrt …“
Einstein lachte.
„Und das tue ich auch.“
„Aber das bedeutet doch, dass Sie nicht an Gott glauben.“
„Das bedeutet, dass ich nicht an den Gott der Bibel glaube.“
„Worin besteht der Unterschied?“
Ein Seufzen war zu hören.
„Wissen Sie, als Kind war ich sehr religiös. Aber mit zwölf Jahren habe ich angefangen, diese populärwissenschaftlichen Bücher zu lesen, ich weiß nicht, ob Sie sie kennen …“
„Doch, doch.“
„… und bin zu dem Schluss gelangt, dass die meisten Geschichten in der Bibel nicht mehr sind als Mythen. Praktisch von einem Tag auf den anderen habe ich aufgehört zu glauben. Ich habe lange darüber nachgedacht und begriffen, dass die Vorstellung von einem Gott in Menschengestalt ein wenig naiv, geradezu kindlich, ist.“
„Warum?“
„Weil es eine anthropomorphe Vorstellung ist, erschaffen von der Fantasie des Menschen in dem Versuch, damit auf sein Schicksal einzuwirken und in schweren Stunden Trost zu finden. Da wir die Natur nicht beeinflussen können, haben wir diese Vorstellung von einem gütigen, väterlichen Gott geschaffen, der alles lenkt und der uns hört und leitet. Das ist ein sehr tröstlicher Gedanke, meinen Sie nicht? Wir geben uns der Illusion hin, dass wir ihn mit vielen Gebeten dazu bewegen können, die Natur zu kontrollieren und unsere Wünsche zu erfüllen. Und wenn wir nicht verstehen, warum ein so gütiger Gott es zulässt, dass die Dinge schlecht laufen, vermuten wir dahinter irgendeine mysteriöse Absicht und fühlen uns ein wenig getröstet. Das ergibt doch keinen Sinn, oder?“
„Glauben Sie denn nicht, dass Gott sich um uns sorgt?“
„Sie müssen bedenken, Herr Premierminister, dass wir eine von Millionen Spezies sind, die den dritten Planeten eines peripheren Sterns einer mittelgroßen Galaxie mit mehreren Milliarden Sternen bewohnen, und dass diese Galaxie selbst nur eine von mehreren Milliarden Galaxien ist, die es im Universum gibt. Wie soll ich da bitteschön an einen Gott glauben, der sich die Arbeit macht, sich in der Unendlichkeit dieser unvorstellbaren Dimensionen um jeden Einzelnen von uns zu kümmern?“
„Nun, in der Bibel steht, dass Gott gut und allmächtig ist. Und wenn er allmächtig ist, dann ist er zu allem in der Lage, auch dazu, sich um das Universum und um jeden Einzelnen von uns zu kümmern.“
Einstein schlug sich mit der linken Hand aufs Knie.
„Gut und allmächtig soll er sein? Das ist doch absurd. Wenn er das tatsächlich wäre, so wie die Bibel behauptet, aus welchem Grund erlaubt er dann die Existenz des Bösen? Aus welchem Grund hat er zum Beispiel den Holocaust zugelassen? Wenn man es recht betrachtet, sind das doch zwei widersprüchliche Gedanken, oder nicht? Wenn Gott gut ist, kann er nicht allmächtig sein, da er nicht imstande ist, dem Bösen ein Ende zu setzen. Und wenn er allmächtig ist, dann kann er nicht gut sein, da er das Böse zulässt. Ein Denkmodell schließt das andere aus. Welches ist Ihnen lieber?“
„Nun, vielleicht das, demzufolge Gott gütig ist.“
„Aber ist Ihnen schon mal aufgefallen, mit wie vielen Problemen dieser Gedanke verbunden ist? Wenn Sie die Bibel aufmerksam lesen, werden Sie feststellen, dass sie nicht das Bild eines gütigen Gottes vermittelt, sondern eher das eines eifersüchtigen Gottes, der blinde Gefolgschaft verlangt und Furcht einflößt; eines Gottes, der straft und opfert und der imstande ist, Abraham zu befehlen, seinen Sohn zu töten, nur um die Gewissheit zu haben, dass er ihm treu ergeben ist. Wozu dient eine so grausame Prüfung, wenn er gütig ist? Er kann es also gar nicht sein.“
Ben-Gurion lachte auf.
„Jetzt haben Sie mich erwischt, Professor“, gab er zu. „Also gut, Gott ist nicht unbedingt gütig. Aber wenn er der Schöpfer des Universums ist, dann ist er doch zumindest allmächtig, nicht wahr?“
„Tatsächlich? Wenn er das wäre, warum straft er dann seine Geschöpfe, wo doch alles von ihm erschaffen wurde? Straft er sie dann nicht für Dinge, für die allein er die Verantwortung trägt? Richtet er nicht über sich selbst, wenn er über sie richtet? Um ehrlich zu sein, kann meiner Meinung nach nur seine Nichtexistenz ihn entschuldigen.“ Er legte eine Pause ein. „Bei genauer Betrachtung kann es diese Allmacht übrigens gar nicht geben, auch dieser Gedanke steckt voller unlösbarer logischer Widersprüche.“
„Inwiefern?“
„Die Unmöglichkeit der Omnipotenz lässt sich leicht anhand des folgenden Paradoxons erklären: Wenn Gott allmächtig wäre, könnte er einen Stein erschaffen, der so schwer wäre, dass nicht einmal er selbst ihn heben könnte.“
Einstein hob die Augenbrauen.
„Verstehen Sie? Wenn Gott den Stein nicht heben kann, ist er nicht allmächtig. Kann er ihn doch heben, ist er ebenfalls nicht allmächtig, weil er nicht imstande war, einen Stein zu erschaffen, den er nicht heben kann.“ Er grinste. „Die Schlussfolgerung lautet, es gibt keinen allmächtigen Gott, das ist eine Fantasievorstellung des Menschen, der Trost und zudem eine Erklärung für das sucht, was er nicht versteht.“
„Dann glauben Sie also nicht an Gott.“
„Nein, an den Gott in Menschengestalt aus der Bibel glaube ich nicht.“
„Meinen Sie denn, dass es nichts über die Materie hinaus gibt?“
„Doch, natürlich. Es muss etwas über die Energie und die Materie hinaus geben.“
„Was denn nun, Professor, glauben Sie oder glauben Sie nicht.“
„An den Gott der Bibel glaube ich nicht, das habe ich Ihnen ja bereits gesagt.“
„Woran glauben Sie dann?“
„Ich glaube an den Gott von Spinoza, der sich in der harmonischen Ordnung dessen offenbart, was ist. Ich bewundere die Schönheit und die einfache Logik des Universums, ich glaube an einen Gott, der sich im Universum offenbart, an einen Gott, der …“
Frank Bellamy rollte genervt die Augen und schüttelte den Kopf.
„Himmel aber auch!“, brummte er. „Was reden die denn da?“
Vor den Tonbandgeräten rutschte Bob auf seinem Stuhl hin und her.
„Sieh es doch mal positiv, Frank“, sagte er. „Wir hören hier gerade mit an, was das größte Genie in der Geschichte der Menschheit über Gott denkt. Was meinst du, wie viele Leute dafür bezahlen würden, an unserer Stelle zu sein?“
„Das ist hier keine Showveranstaltung, Bob. Es geht um die nationale Sicherheit, wir müssen noch mehr über das erfahren, was Ben-Gurion von ihm will. Wenn Israel die Atombombe hat, was glaubst du, wie lange es dauert, bis alle anderen sie auch haben?“
„Du hast völlig Recht, entschuldige.“
„Es ist zwingend notwendig, weitere Einzelheiten zu erfahren.“
„Natürlich. Hören wir lieber wieder zu.“
„… von Spinoza.“
Es entstand eine lange Pause, bis Ben-Gurion wieder sprach.
„Halten Sie es für möglich, die Existenz Gottes zu beweisen, Professor?“
„Nein, Herr Premierminister, das halte ich nicht für möglich. Die Existenz Gottes lässt sich nicht beweisen, ebenso wenig wie seine Nichtexistenz. Wir können lediglich das Geheimnis spüren und den großartigen Plan bewundern, der sich im Universum ausdrückt.“
Es entstand abermals eine Pause.
„Aber warum wollen Sie nicht zumindest versuchen, den Beweis für die Existenz oder Nichtexistenz Gottes zu führen?“
„Ich habe Ihnen doch schon gesagt, ich glaube nicht, dass das möglich ist.“
„Und wenn es doch möglich wäre, welches wäre der Weg?“
Stille.
Nun zögerte Einstein mit einer Antwort. Er wandte den Kopf und betrachtete das dichte Grün entlang der Mercer Street. Aus seinem Blick sprachen zugleich die Weisheit und die Jungenhaftigkeit eines Menschen, der über alle Zeit der Welt verfügt und der noch nicht die Fähigkeit verloren hat, das Wunder des üppig blühenden Frühlings zu bestaunen.
Er atmete tief ein.
„Raffiniert ist der Herrgott, aber boshaft ist er nicht“, sagte er schließlich auf Deutsch.
Ben-Gurion machte ein neugieriges Gesicht.
„Was wollen Sie damit sagen?“, fragte er ebenfalls auf Deutsch.
„Die Natur verbirgt ihr Geheimnis durch die Erhabenheit ihres Wesens, aber nicht durch List.“
Frank Bellamy schlug mit der Faust auf die Fensterbank.
„Verdammt!“, rief er aus. „Jetzt reden sie auch noch Deutsch.“
„Was sagen sie denn?“, fragte Bob.
„Was weiß ich, sehe ich vielleicht aus wie ein Kraut?“
Bob schien verwirrt.
„Was soll ich jetzt machen? Weiter aufnehmen?“
„Selbstverständlich. Wir nehmen das Band mit ins Büro und lassen es übersetzen.“ Er verzog verächtlich das Gesicht. „Bei all den Nazis, die wir jetzt da haben, dürfte das ja wohl nicht so schwierig sein.“
I
2006
Das Chaos auf der Straße war unbeschreiblich: Verbeulte Autos, dröhnende Laster und qualmende Busse drängten sich wild hupend auf dem ölverschmierten Asphalt. Säuerlicher Geruch nach verbranntem Diesel erfüllte die heiße Vormittagsluft, und der Smog hing dicht über den heruntergekommenen Häusern. Es hatte etwas Dekadentes, wie die alte Stadt mit den schlimmsten Auswüchsen der Moderne den Anschluss an die Zukunft suchte.
Unschlüssig, welche Richtung er einschlagen sollte, blieb Tomás Noronha auf der Treppe des Museums stehen und prüfte seine Alternativen. Vor ihm erstreckte sich der weitläufige Tahrir-Platz, an dessen anderen Ende zahlreiche Cafés lagen. Allerdings war der Platz das Epizentrum des Verkehrschaos, über das sich die Schrottlawine vor seinen Augen dahinwälzte. Dort hinüber zu gelangen, war undenkbar. Er blickte nach links, wo er die Möglichkeit hätte, in der Qasr El-Nil-Straße im Groopi’s etwas Süßes zu essen und einen Tee zu trinken, doch dafür war sein Appetit zu groß. Mit etwas Gebäck würde sich sein Hunger nicht stillen lassen. Rechterhand konnte er der Corniche El-Nil folgen, der Uferstraße, an der sein Hotel lag, und dort in einem der hervorragenden Restaurants mit Blick über den Fluss und zu den Pyramiden etwas essen.
„Sind Sie zum ersten Mal in Kairo?“
Tomás blickte sich überrascht um.
„Verzeihung?“
„Ich habe gefragt, ob Sie zum ersten Mal in Kairo sind.“
Eine hochgewachsene Frau mit langem, schwarzem Haar trat aus dem Museum und kam auf ihn zu. Ihre Augen waren honigfarben, ihre vollen Lippen scharlachrot geschminkt. Sie trug gediegene Rubinohrringe, ein hautenges graues Kostüm und hochhackige schwarze Schuhe, die ihre makellosen Kurven und ihre langen Beine betonten.
Eine exotische Schönheit.
„Äh, nein“, stammelte Tomás. „Ich war schon oft hier.“
Die Frau streckte ihm die Hand entgegen.
„Sehr erfreut“, sagte sie und lächelte. „Mein Name ist Ariana. Ariana Pakravan.“
„Die Freude ist ganz meinerseits.“
Sie schüttelten sich die Hände.
„Wollen Sie mir nicht Ihren Namen verraten?“
„Oh, entschuldigen Sie bitte. Ich heiße Tomás. Tomás Noronha.“
„Hallo, Thomas.“
„Tomás“, korrigierte er. „Die Betonung liegt auf dem A. Tomás.“
„Tomás“, wiederholte sie. „Richtig?“
„Genau. Araber haben immer gewisse Schwierigkeiten, meinen Namen richtig zu betonen.“
„Und wer hat Ihnen gesagt, dass ich Araberin bin?“
„Sind Sie das etwa nicht?“
„Nein, ich bin Iranerin.“
„Ich wusste gar nicht, dass Iranerinnen so hübsch sind“, erwiderte er.
Arianas Gesicht erstrahlte.
„Ich sehe schon, Sie sind ein Charmeur.“
Tomás errötete.
„Verzeihung, das ist mir so herausgerutscht.“
„Machen Sie sich nichts draus, schon Marco Polo sagte, die Iranerinnen seien die schönsten Frauen der Welt.“
Sie zwinkerte verführerisch.
„Und außerdem gibt es wohl keine Frau, die sich nicht über ein Kompliment freut, nicht wahr?“
Tomás Noronha blickte prüfend auf ihr enganliegendes Kostüm.
„Aber Sie sind so modern. Das ist für jemanden, der aus dem Land der Ajatollahs kommt, doch sehr überraschend.“
„Nun, ich bin ein Sonderfall.“
Ariana blickte zu dem Chaos auf dem Tahrir-Platz.
„Sind Sie hungrig?“
„Und wie“, antwortete Tomás. „Ich könnte einen ganzen Ochsen verspeisen!“
„Dann kommen Sie, ich kenne einen Ort, wo Sie ein paar einheimische Spezialitäten kosten können.“
Das Taxi steuerte in den östlichen Teil der Altstadt von Kairo. Dabei ließen sie die breiten Prachtstraßen der Innenstadt allmählich hinter sich und passierten ein Labyrinth von Gassen, in denen das Leben brodelte, mit Eselskarren, Passanten in traditionellen Gewändern, fliegenden Händlern, Radfahrern, Papyrusverkäufern, Falafelständen, Läden voller Messing-, Kupfer- und Lederwaren, Teppiche, Stoffe und nagelneuer Antiquitäten, mit Straßencafés, in denen die Gäste Wasserpfeife rauchten, und mit dem intensiven Geruch nach Frittiertem, nach Safran, Kurkuma und Chili in der Luft.
Das Taxi setzte sie direkt vor einem Restaurant am Midan Hussein ab, einem begrünten Platz im Schatten eines schlanken Minaretts.
Das Abu Hussein wirkte westlicher als die meisten ägyptischen Restaurants. Alle Tische waren makellos sauber gedeckt, und – was in dieser Stadt nicht unwichtig war – die Klimaanlage lief mit voller Kraft und erfüllte das Lokal mit angenehmer Kühle.
Sie setzten sich ans Fenster mit Blick auf die Moschee, und der Kellner in weißer Livree reichte ihnen die Speisekarte. Als Tomás sie öffnete, schüttelte er den Kopf.
„Ich verstehe kein Wort.“
Ariana sah ihn über den Rand ihrer Karte an.
„Was möchten Sie denn gerne essen?“
„Suchen Sie etwas aus. Ich begebe mich ganz in Ihre Hände.“
„Sicher?“
„Unbedingt.“
Ariana prüfte das Angebot, rief den Kellner und gab die Bestellung auf.
Vom Minarett ertönte die durchdringende Stimme des Muezzins, der die Gläubigen zum Gebet rief. Das in melodischen Wellen intonierte Allahu akbar breitete sich über die Stadt aus, und Ariana sah vom Fenster aus zu, wie die Menschenmenge zur Moschee strömte.
„Es ist komisch“, sagte Tomás, „wir sind hier gemeinsam beim Essen, ohne einander zu kennen. Sie wissen ja außer meinem Namen noch nichts über mich.“
Ariana hob eine Augenbraue und machte ein spitzbübisches Gesicht.
„Da irren Sie sich.“
„So? Aber ich habe Ihnen doch noch nichts erzählt.“
„Das brauchen Sie auch nicht. Ich habe mich bereits informiert.“
„Ach ja?“
„Soll ich es Ihnen beweisen? Ich weiß, dass Sie Portugiese sind und als einer der weltweit größten Spezialisten für Kryptanalyse und alte Sprachen gelten. Sie unterrichten an der Neuen Universität Lissabon und arbeiten im Moment auch als Berater der Gulbenkian-Stiftung, für die Sie die Übersetzung der Hieroglyphen der ägyptischen Exponate und der Keilschrifttexte der assyrischen Basreliefs des Museums überarbeiten, das zur Stiftung gehört.“
Sie sprach, als würde sie auf eine Prüfungsfrage antworten.
„Nach Kairo sind Sie gekommen, um an der Konferenz über den Karnak-Tempel teilzunehmen und haben die Gelegenheit genutzt, die Möglichkeiten für den Erwerb der Narmer-Palette für Ihr Museum auszuloten, die im Keller des Ägyptischen Museums aufbewahrt wird.“
„Sie sind wirklich gut informiert. Ich bin beeindruckt.“
„Ich weiß auch, dass Sie seit kurzem geschieden sind.“
Tomás kniff die Augenbrauen zusammen und fragte sich, was er davon halten sollte. Das war ein Detail aus seinem Privatleben, und es bereitete ihm ein gewisses Unbehagen, dass jemand darin herumgeschnüffelt hatte.
„Woher zum Teufel wissen Sie das alles?“
„Werter Herr Professor, Sie glauben doch wohl nicht, dass ich Sie angesprochen habe, weil ich auf eine schnelle Nummer mit Ihnen aus bin, oder?“
Ariana lächelte kühl und schüttelte den Kopf.
„Nein, ich bin dienstlich hier, und das ist ein Geschäftsessen, verstehen Sie?“
Tomás schaute verlegen.
„Nein, ich verstehe ganz und gar nicht.“
„Denken Sie doch mal nach, Professor. Ich bin eine muslimische Frau und komme, wie Sie selbst vorhin bemerkt haben, aus dem Land der Ajatollahs, wo die Moral, wie Sie wissen, besonders streng ist. Was glauben Sie wohl, wie viele iranische Frauen einen Europäer auf der Straße ansprechen und ihn so mir nichts dir nichts zum Mittagessen einladen?“
„Nun, darüber habe ich in dem Moment wohl nicht nachgedacht.“
„Keine Frau im Iran würde so etwas tun, Professor, keine. Wir beide sitzen hier, weil wir etwas zu besprechen haben.“
„Haben wir das?“
Ariana stützte die Ellenbogen auf den Tisch und sah Tomás in seine grünen Augen.
„Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, Professor, weiß ich, dass Sie wegen der Konferenz hier in Kairo sind und auch wegen der frühägyptischen Stele, die Sie für das Gulbenkian-Museum erwerben möchten. Aber ich habe Sie in dieses Lokal geführt, um Ihnen ein anderes Geschäft vorzuschlagen.“
Sie bückte sich nach ihrer Handtasche und legte sie auf den Tisch.
„Ich habe hier Auszüge eines Manuskripts, das zur bedeutendsten Entdeckung des Jahrhunderts werden könnte.“
Sie strich mit der Hand leicht über ihre Handtasche.
„Ich bin hier im Auftrag meiner Regierung, um Sie zu fragen, ob Sie mit uns an der Übersetzung dieses Dokuments arbeiten möchten.“
Tomás starrte Ariana einen Moment lang an.
„Soll das heißen, dass Sie mich engagieren wollen?“
„Ganz genau.“
„Haben Sie denn keine eigenen Übersetzer?“
Ariana lächelte.
„Sagen wir es so, das hier fällt in Ihr Spezialgebiet.“
„Alte Sprachen?“
„Nicht ganz.“
„Was dann? Kryptanalyse?“
„Ja.“
Tomás rieb sich das Kinn.
„Hm“, murmelte er. „Was ist das für ein Manuskript?“
Ariana setzte sich aufrecht hin und nahm eine ernste, geradezu förmliche Haltung an.
„Ehe wir weiterreden, muss ich eine Bedingung stellen.“
„Bitte.“
„Alles, worüber wir sprechen werden, ist vertraulich. Sie dürfen mit niemandem über den Inhalt unseres Gesprächs reden. Haben Sie verstanden? Mit niemandem. Auch wenn wir uns nicht einigen sollten, müssen Sie über alles, was ich Ihnen jetzt sage, Stillschweigen bewahren.“
Sie sah ihn eindringlich an.
„Habe ich mich deutlich ausgedrückt?“
„Ja, Sie können ganz beruhigt sein.“
Ariana öffnete die Handtasche, holte einen Ausweis und ein Blatt Papier daraus hervor und reichte ihm beides.
„Das ist mein Beamtenausweis vom Wissenschaftsministerium.“
Tomás nahm den Ausweis mit Eintragungen auf Farsi und einem Foto, das Ariana in islamischer Kleidung zeigte.
„Immer hübsch, nicht wahr?“
Ariana lächelte.
„Und Sie? Immer galant, nicht wahr?“
Tomás blickte erneut auf den Ausweis.
„Ich verstehe kein Wort von dem, was da steht.“ Unbeeindruckt gab er ihr den Ausweis zurück. „Für mich kann das genauso gut eine Fälschung aus einer beliebigen Druckerei sein.“
Ariana lächelte.
„Zu gegebener Zeit werden Sie sehen, dass alles echt ist.“
Sie zeigte ihm das Blatt Papier.
„Das hier ist das Dokument des Wissenschaftsministeriums, das die Echtheit des Manuskripts beglaubigt, an dem Sie für uns arbeiten sollen.“
Tomás prüfte das Schriftstück und las es von vorne bis hinten durch. Es war ein auf Englisch getipptes amtliches Schreiben mit dem iranischen Siegel im Briefkopf. Es wies Ariana Pakravan aus als Leiterin einer vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Technologie der Islamischen Republik Iran ernannten Arbeitsgruppe zur Entschlüsselung und Echtheitsfeststellung eines Manuskripts mit dem deutschen Titel Die Gottesformel. Die unleserliche Unterschrift in blauer Tinte am Schluss stammte von Bozorgmehr Shafaq, dem Minister für Wissenschaft, Forschung und Technologie.
Tomás zeigte auf den Titel des Manuskripts.
„Die Gottes was?“
„Die Gottesformel. Das ist Deutsch.“
„Dass es Deutsch ist, war mir schon klar“, sagte er. „Aber was bedeutet es?“
Ariana holte ein weiteres, doppelt zusammengefaltetes Blatt aus ihrer Handtasche, öffnete es und reichte es Tomás. Auf dem karierten Papier stand in Großbuchstaben DIE GOTTESFORMEL. Darunter befanden sich ein Gedicht und eine Unterschrift.
„Das ist eine Fotokopie der ersten Seite von besagtem Manuskript“, erklärte Ariana. „Wie Sie sehen, handelt es sich um denselben Titel, den Minister Shafaq in dem Dokument erwähnt, das ich Ihnen vorgelegt habe.“
„Ja, Die Gottesformel“, wiederholte Tomás. „Aber was soll das sein?“
„Es ist ein Manuskript von einer der bedeutendsten Persönlichkeiten der Menschheit.“
„Von wem?“, fragte Tomás amüsiert. „Etwa von Jesus Christus?“
„Ich habe schon gemerkt, dass Sie ein Spaßvogel sind.“
„Nun sagen Sie schon von wem.“
Betont langsam brach Ariana ein Stück Brot ab, bestrich es mit Hummus und biss hinein. Dann blickte sie Tomás in die Augen.
„Von Albert Einstein.“
Tomás sah die Fotokopie mit wachsender Neugier an.
„Einstein? Hm, interessant. Diese Unterschrift stammt tatsächlich von ihm?“
„Ja.“
„Es ist seine Handschrift?“
„Ja. Wir haben bereits entsprechende Tests gemacht und es überprüft.“
„Und wann ist dieser Text publiziert worden?“
„Nie.“
„Wie bitte?“
„Er ist nie publiziert worden.“
„Wollen Sie damit sagen, es handelt sich um einen unveröffentlichten Text?“
„Ganz genau.“
Tomás pfiff anerkennend; er brannte jetzt vor Neugier. Dann prüfte er noch einmal eingehend die Fotokopie, die Buchstaben des Titels, das Gedicht und die unleserliche Unterschrift darunter. Von dem Blatt Papier wanderten seine Augen zu Arianas Handtasche, die noch immer auf dem Tisch lag.
„Wo sind die übrigen Seiten?“
„In Teheran.“
„Können Sie mir Kopien davon besorgen, um es zu studieren?“
Ariana schüttelte ihre dunklen Haare.
„Nein. Das ist ein höchst vertrauliches Dokument. Um es zu studieren, müssen Sie nach Teheran reisen.“ Sie neigte den Kopf zur Seite. „Was halten Sie davon, direkt von hier aus hinzufliegen?“
Tomás lachte laut auf und hob abwehrend die Hand.
„Langsam, immer mit der Ruhe. Zum einen bin ich mir nicht sicher, ob ich diese Arbeit übernehmen kann. Schließlich bin ich im Auftrag der Gulbenkian-Stiftung hier. Außerdem habe ich in Lissabon noch andere Verpflichtungen. Die Vorlesungen an der …“
„Hunderttausend Euro“, unterbrach Ariana ihn. „Wir sind bereit, Ihnen hunderttausend Euro zu zahlen.“
Tomás zögerte.
„Hunderttausend Euro?“
„Ja. Und sämtliche Spesen.“
„Wie lange soll ich dafür arbeiten?“
„So lange wie nötig.“
„Was heißt das? Eine Woche?“
„Ein oder zwei Monate.“
Tomás runzelte die Stirn.
„Hm, ich weiß nicht, ob ich das tun kann.“
„Warum nicht? Zahlt man Ihnen bei Gulbenkian und an der Universität etwa mehr?“
„Nein, das nicht. Das Problem sind meine Verpflichtungen. Ich kann sie nicht einfach so vernachlässigen. Das werden Sie wohl verstehen.“
Ariana beugte sich über den Tisch und starrte ihn mit ihren honigfarbenen Augen an.
„Professor, einhunderttausend Euro sind viel Geld. Und wir zahlen Ihnen diese Summe monatlich zuzüglich Spesen.“
„Monatlich?“
„Jawohl“, bestätigte sie.
Tomás dachte über das Angebot nach. Einhunderttausend Euro bedeuteten über dreitausend pro Tag, er würde an einem Tag mehr verdienen als an der Universität in einem Monat. Warum also zögerte er? Er lächelte und hielt ihr über den Tisch hinweg die Hand entgegen.
„Abgemacht.“
Per Handschlag besiegelten sie das Geschäft.
„Und wir fliegen sofort nach Teheran“, fügte sie hinzu.
„Hm, das geht nicht“, sagte Tomás. „Ich muss erst noch in Lissabon einige Dinge erledigen.“
„Professor, wir brauchen Ihre Dienste dringend. Wer eine solche Summe bekommt wie Sie, darf sich nicht mit Nebensächlichkeiten aufhalten.“
„Hören Sie, ich muss der Gulbenkian-Stiftung einen Bericht vorlegen und außerdem einige offene Angelegenheiten an der Universität regeln. Es stehen noch vier Lehrveranstaltungen bis zum Semesterende an, und ich muss einen Assistenten finden, der sie abhält. Erst danach kann ich nach Teheran fliegen.“
Ariana seufzte ungeduldig.
„Wie lange wird das dauern?“
„Eine Woche.“
Sie wiegte nachdenklich den Kopf.
„Hm … in Ordnung. Ich nehme an, wir werden uns bis dahin gedulden können.“
Tomás betrachtete erneut die Fotokopie.
„Wie ist dieses Manuskript in iranische Hände gelangt?“
„Das darf ich Ihnen nicht verraten.“
„Aha. Aber ich vermute, dass Sie mir sagen dürfen, um welches Thema es in diesem unveröffentlichten Text von Einstein geht, oder?“
Ariana schüttelte erneut den Kopf und seufzte.
„Leider darf ich Ihnen auch das nicht sagen.“
„Sagen Sie bloß nicht, dass das ebenfalls vertraulich ist.“
„Doch, das ist, genau wie das gesamte Projekt, vertraulich, verstehen Sie? In diesem Fall kann ich Ihnen allerdings aus dem einfachen Grund nicht antworten, weil wir, so unglaublich das auch klingen mag, selbst nicht verstehen, was darin steht.“
„Wieso nicht?“, fragte Tomás erstaunt. „Worin besteht die Schwierigkeit? Haben Sie niemanden, der Deutsch lesen kann?“
„Das Problem besteht darin, dass ein Teil des Textes nicht auf Deutsch verfasst wurde.“
„Sondern?“
„Hören, Sie, was ich Ihnen hier sage, ist wirklich absolut vertraulich, verstanden?“
„Ja, das haben wir doch schon besprochen, Sie können ganz beruhigt sein.“
Ariana atmete tief durch.
„Fast das gesamte Manuskript ist von Einstein handschriftlich auf Deutsch verfasst worden, aber ein kleiner Abschnitt ist aus Gründen, die uns noch nicht ganz klar sind, verschlüsselt. Unsere Codespezialisten haben sich damit beschäftigt, sind aber zu dem Schluss gekommen, dass sie den Text nicht dechiffrieren können, weil er auf einer Sprache basiert, die weder Deutsch noch Englisch ist.“
„Könnte es Hebräisch sein?“
„Nein, Einstein sprach nur schlecht Hebräisch. Er hat ein paar Brocken gelernt, war aber weit davon entfernt, die Sprache zu beherrschen.“
„Welche Sprache könnte es dann sein?“
„Es gibt stichhaltige Gründe zu der Annahme, dass es sich um Portugiesisch handelt.“
Tomás legte ungläubig die Stirn in Falten.
„Aber hat Einstein denn Portugiesisch gesprochen?“
„Natürlich nicht“, sagte Adriana. „Aber wir glauben, dass einer seiner Mitarbeiter, der Portugiesisch konnte, diesen kleinen Abschnitt verfasst und verschlüsselt hat.“
„Aber warum?“
„Die Gründe sind noch nicht ganz klar. Möglicherweise hat es etwas mit der Bedeutung des Textes zu tun.“
Tomás rieb sich die Augen. Er musste einen Moment innehalten und Zeit gewinnen, um seine Gedanken zu ordnen.
„Und deshalb haben Sie sich also an mich gewandt“, sagte er schließlich.
„Ja“, bestätigte Ariana, „denn wenn der verschlüsselte Text ursprünglich auf Portugiesisch geschrieben wurde, ist es offenkundig, dass wir einen portugiesischen Codespezialisten brauchen, nicht wahr?“
Tomás nahm nochmals die Kopie der ersten Manuskriptseite zur Hand und prüfte sie aufmerksam, vor allem das maschinengeschriebene Gedicht unter dem Titel. Er deutete mit dem Finger darauf und sah Ariana an.
„Was ist das?“
„Irgendein Gedicht.“ Sie zuckte mit den Achseln. „Abgesehen von einem merkwürdigen Hinweis vor der ersten verschlüsselten Zeile ist das der einzige Text in Englisch. Alles andere ist auf Deutsch. Sie können doch Deutsch, oder?“
„Meine Liebe, ich kann Portugiesisch, Spanisch, Englisch, Französisch, Latein, Griechisch und Koptisch. Im Erlernen von Hebräisch und Aramäisch bin ich schon recht weit fortgeschritten, aber die deutsche Sprache beherrsche ich leider noch nicht. Ich habe lediglich ein paar Grundkenntnisse.“
„Ja“, sagte sie. „So hatte ich es bei meinen Nachforschungen auch gelesen.“
„Ja, Ihre Nachforschungen …“
Tomás warf einen letzten Blick auf die Fotokopie.
„Die Gottesformel“, las er. „Was soll das sein?“
„Das ist der Titel des Manuskripts.“
Tomás lachte.
„Danke“, sagte er mit spöttischer Miene. „Soweit war ich auch schon gekommen. Aber was bedeutet er?“
Ariana trank genüsslich einen Schluck Karkade, stellte das Glas mit dem süßlichen, dunklen Hibiskustee zurück auf den Tisch. Dann blickte sie Tomás eindringlich an und erklärte es ihm.
II
Die Melodie, die aus seiner Hosentasche erklang, kündete von einem Anruf auf seinem Handy. Er zog das kleine Gerät aus der Tasche und meldete sich. Die vertraute Stimme am anderen Ende der Leitung klang, als wäre sie nur einen Meter weit entfernt.
„Tomás?“
„Hallo, Mutter.“
„Wo bist du? Schon zurück?“
„Ja, ich bin gestern Nachmittag wieder gekommen.“
„Ist alles gut gegangen?“
„Ja.“
„Gott sei Dank. Ich bin immer beunruhigt, wenn du verreist.“
„So ein Unsinn, Mutter! Heutzutage ist es völlig normal zu fliegen. Es ist genauso wie mit dem Bus oder der Eisenbahn zu fahren, nur schneller und bequemer.“
„Trotzdem, ich mache mir immer Sorgen. Außerdem bist du doch in ein arabisches Land gereist, nicht wahr? Dort gibt es lauter Verrückte, die ständig irgendetwas in die Luft jagen und Menschen umbringen, furchtbar. Siehst du keine Nachrichten?“
„Nun mach aber mal einen Punkt“, lachte Tomás. „So schlimm ist es auch wieder nicht. Die Menschen dort sind sogar sehr freundlich und wohlerzogen.“
„Ja, bis sie die nächste Bombe explodieren lassen.“
„Schon gut“, sagte er. Er hatte keinerlei Interesse daran, das Thema zu vertiefen. „Fakt ist, dass alles gut verlaufen ist und ich wieder zurück bin.“
„Zum Glück.“
„Und wie geht es Vater?“
Seine Mutter zögerte am anderen Ende der Leitung.
„Hm, nun, es geht so.“
„Prima“, erwiderte Tomás, der ihr Zögern nicht bemerkt hatte. „Und dir? Surfst du immer noch im Internet?“
„Mehr oder weniger.“ Sie räusperte sich. „Übrigens fahren Vater und ich morgen nach Lissabon.“
„Ihr kommt morgen?“
„Ja.“
„Dann müssen wir zusammen zu Mittag essen.“
„Ja, das müssen wir. Wir machen uns gleich in der Früh ganz gemächlich auf den Weg und müssten dann so gegen elf oder zwölf eintreffen.“
„Dann kommt doch um eins zu mir in die Gulbenkian-Stiftung.“
„Abgemacht.“
„Und was habt ihr hier vor?“
Wieder zögerte seine Mutter.
„Das besprechen wir morgen, Tomás“, sagte sie schließlich. „Das besprechen wir morgen.“
Das großzügige Gebäude aus Beton, das mit seinen abstrakten horizontalen Linien zeitlos wirkte, erhob sich aus dem Grün wie ein riesiges, eckiges Hünengrab auf einer Anhöhe. Jedes Mal, wenn Tomás die gepflasterte Auffahrt hinaufging, war er von diesem Gebäude verzaubert. Es kam ihm vor wie eine Akropolis der Moderne, ein geometrisches Denkmal, ein metaphysisches Werk.
Die Gulbenkian-Stiftung.
Mit der Aktentasche in der Hand betrat er die Eingangshalle und ging die weitläufige Treppe hinauf. Die massiven Wände waren von großen Fensterscheiben unterbrochen, die das Gebäude mit dem Garten, die künstliche Struktur mit der Landschaft, den Beton mit der Vegetation verschmelzen ließen. Er durchquerte das Foyer des Auditoriums, klopfte kurz und betrat das Büro.
„Hallo, Albertina, alles in Ordnung?“
Die Sekretärin stellte gerade einen Aktenordner in den Schrank. Sie wandte sich um und lächelte.
„Guten Morgen, Professor. Sie sind wieder zurück?“
„Ja, wie Sie sehen.“
„Hat alles gut geklappt?“
„Bestens. Ist Professor Vital da?“
„Er ist bei der Personalversammlung des Museums und kommt erst am Nachmittag zurück.“
Tomás war unschlüssig.
„Hm. Ich habe den Reisebericht aus Kairo dabei. Vielleicht sollte ich am Nachmittag noch einmal vorbeikommen?“
„Lassen Sie ihn hier“, schlug Albertina vor. „Wenn Professor Vital kommt, gebe ich ihm den Bericht, und falls er Fragen hat, kann er sich ja bei Ihnen melden. In Ordnung?“
Tomás öffnete die Aktentasche und entnahm ihr einige zusammengeheftete Seiten.
„Gut“, sagte er und überreichte sie der Sekretärin. „Wenn es nötig ist, soll er mich einfach anrufen.“
Tomás wollte schon gehen, als Albertina ihn zurückhielt.
„Ach, Professor, Greg Sullivan von der amerikanischen Botschaft hat angerufen. Sie möchten sich bitte schnellstmöglich bei ihm melden.“
Tomás nahm denselben Weg zurück, den er gekommen war, und betrat dann sein Büro, einen kleinen Raum im Erdgeschoss, der für gewöhnlich von den Beratern der Stiftung genutzt wurde. Dort setzte er sich an seinen Schreibtisch und begann damit, das Konzept für die restlichen Vorlesungen des Semesters vorzubereiten.
Das Fenster des Büros zeigte auf den Garten, wo sich die Blätter und das Gras im Wind wiegten und die Tropfen vom Bewässern in der Morgensonne glitzerten. Er rief einen Assistenzdozenten an und regelte mit ihm die Einzelheiten der Lehrveranstaltungen. Dann suchte er im Speicher seines Handys nach der Nummer von Greg Sullivan, dem Kulturattaché der amerikanischen Botschaft, und rief ihn an.
„Hallo Greg. Hier spricht Tomás Noronha von der Gulbenkian-Stiftung.“
„Hallo Tomás, wie geht es Ihnen?“
Der Kulturattaché sprach Portugiesisch mit starkem amerikanischen Akzent.
„Gut, und Ihnen?“
„Bestens. Wie war es in Kairo?“
„Keine außergewöhnlichen Vorkommnisse. Ich glaube, wir werden den Kauf der Stele, die ich mir dort angesehen habe, abschließen. Die Entscheidung darüber muss natürlich die Verwaltung treffen, aber in meinem Gutachten habe ich dies befürwortet, und die Bedingungen scheinen gut zu sein.“
„Ich weiß nicht, was ihr an diesem alten Kram aus Ägypten so besonders findet“, lachte Sullivan. „Mir scheint, es gibt weitaus Interessanteres, wofür man sein Geld ausgeben kann.“
„Das sagen Sie, weil Sie kein Historiker sind.“
„Vielleicht.“ Er wechselte den Ton. „Also, Tomás, ich wollte Sie sprechen, weil ich Sie bitten muss, auf einen Sprung hier in der Botschaft vorbeizuschauen.“
„Aha, was ist denn los?“
„Es geht um eine Angelegenheit, die nicht am Telefon besprochen werden kann.“
„Sagen Sie bloß, Sie haben schon Neuigkeiten wegen des Angebots, das wir dem Getty Center unterbreitet haben. Hat man es in Los Angeles also tatsächlich angenommen …“
„Nein, darum geht es nicht“, unterbrach ihn Sullivan. „Es ist etwas anderes.“
„Hm“, machte Tomás und versuchte, sich vorzustellen, worum es gehen könnte. Vielleicht irgendetwas Neues aus dem Jewish Museum. Seit er angefangen hatte, Hebräisch und Aramäisch zu lernen, spornte der amerikanische Kulturattaché ihn häufig an, nach New York zu reisen und das Museum zu besuchen.
„In Ordnung. Wann soll ich kommen?“
„Heute Nachmittag.“
„Heute Nachmittag? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Meine Eltern kommen gleich zu Besuch, und ich muss noch an der Universität vorbeischauen.“
„Tomás, es muss heute Nachmittag sein.“
„Aber warum denn?“
„Es ist gerade jemand aus Amerika eingetroffen, der ausschließlich gekommen ist, um mit Ihnen zu sprechen.“
„Um mit mir zu sprechen? Wer ist dieser Jemand?“
„Das kann ich Ihnen am Telefon nicht sagen.“
„Los, kommen Sie schon.“
„Ich darf nicht.“
„Ist es Angelina Jolie?“
Sullivan lachte.
„Mann, Sie sind ja völlig auf die Frau fixiert, stimmt’s? Das ist schon zweite Mal, dass Sie sie mir gegenüber erwähnen.“
„Sie ist eine Frau mit beeindruckenden Attributen“, bemerkte Tomás und grinste. „Aber wenn es nicht Angelina Jolie ist, wer ist es dann?“
„Sie werden es schon sehen.“
„Ich habe wirklich anderes zu tun, als irgendwelche Langweiler zu ertragen, Greg. Sagen Sie mir, wer es ist, und ich komme vorbei.“
Der Kulturattaché am anderen Ende der Leitung zögerte.
„Okay, ich gebe Ihnen einen Tipp. Aber Sie müssen mir versprechen, heute Nachmittag um drei hier herzukommen.“
„Um vier.“
„Prima, um vier hier in der Botschaft. Sie kommen doch wirklich?“
„Sie können sich darauf verlassen, Greg.“
„Dann ist ja gut. Bis nachher.“
„Halt, warten Sie!“ Tomás brüllte fast. „Sie haben mir noch nicht den Tipp gegeben.“
Sullivan lachte auf.
„Mist, und ich hatte gehofft, Sie würden es vergessen.“
„Sehr raffiniert. Also, was ist mit dem Tipp?“
„Es ist vertraulich, verstehen Sie?“
„Ja, ja, ist ja gut. Jetzt rücken Sie schon raus mit der Sprache.“
„Okay“, sagte Sullivan und atmete tief durch. „Sagt Ihnen die CIA etwas?“
Tomás glaubte, sich verhört zu haben.
„Wie bitte?“
„Wir reden um vier Uhr weiter. Bis dahin.“
Dann legte er auf.
Die Wanduhr zeigte zwölf Uhr fünfzig, als es an der Tür seines Büros klopfte. Die Klinke wurde heruntergedrückt, und Tomás blickte in das vertraute Gesicht seiner Mutter, die durch den geöffneten Spalt hereinspähte. Sie war eine Frau mit blondem, lockigem Haar, trug eine große Brille und hatte die gleichen, kristallklaren grünen Augen wie Tomás.
„Darf ich reinkommen?“, fragte sie.
„Mutter“, rief Tomás aus. „Wie schön, dich zu sehen.“
„Mein lieber Sohn“, sagte sie und umarmte und küsste ihn stürmisch. „Wie geht es dir?“
Hinter ihr war ein rasselnder Husten zu hören.
„Hallo, Vater“, begrüßte Tomás ihn und streckte ihm förmlich die Hand hin.
„Na, Junge, wie läuft’s bei dir?“
Sie schüttelten sich leicht verlegen die Hand, so wie immer, wenn sie sich begegneten.
„Ich kann nicht klagen“, sagte Tomás.
„Wann suchst du dir endlich wieder eine Frau, die sich um dich kümmert?“, fragte seine Mutter. „Du bist schon zweiundvierzig und musst dein Leben neu aufbauen, Junge.“
„Ich denke darüber nach.“
„Und uns noch einige Enkelkinder bescheren.“
„Ja, ja.“
„Gibt es denn keine Möglichkeit, dass du und Constança …“
„Nein, die gibt es nicht“, schnitt Tomás ihr das Wort ab. Und um das Thema zu wechseln, schaute er auf die Uhr. „Gehen wir los zum Essen?“
Seine Mutter zögerte.
„Ja, aber zuerst sollten wir uns ein wenig unterhalten.“
„Das machen wir im Restaurant. Ich habe schon einen Tisch reserviert.“
„Wir müssen hier reden“, unterbrach sie ihn.
„Wieso denn hier?“, fragte Tomás.
„Weil wir dazu allein sein müssen. Ohne Fremde um uns herum.“
Verwundert schloss Tomás die Tür seines Büros. Er zog zwei Stühle heran, damit seine Eltern sich setzen konnten, und ging zurück an seinen Platz hinter dem Schreibtisch.
„Also, was ist los?“
Er sah die beiden fragend an. Seine Eltern wirkten betreten. Seine Mutter blickte ihren Mann auffordernd an, aber Manuel Noronha sagte nichts, so dass sie die Initiative ergreifen und ihn drängen musste.
„Dein Vater möchte dir etwas erzählen. Nicht wahr, Manuel?“
Tomás’ Vater setzte sich gerade hin und hustete.
„Ich mache mir Sorgen, weil ein Kollege von mir verschwunden ist“, sagte er sichtlich befangen. „Augusto …“
„Schweif nicht vom Thema ab, Manuel“, fiel ihm seine Frau ins Wort.
„Ich schweife nicht ab. Dass Augusto verschwunden ist, beunruhigt mich nun einmal.“
„Wir sind aber nicht hergekommen, um über Augusto zu sprechen.“
Tomás blickte die beiden der Reihe nach an.
„Wer ist Augusto?“
Seine Mutter verdrehte die Augen.
„Professor Augusto Siza ist ein Kollege deines Vaters an der Uni. Er lehrt Physik und ist seit zwei Wochen verschwunden.“
„Tatsächlich?“
„Aber diese Geschichte ist jetzt völlig uninteressant, Junge. Wir sind aus einem anderen Grund hergekommen.“ Sie sah ihren Mann an. „Oder etwa nicht, Manuel?“
Manuel Noronha ließ den Kopf sinken und prüfte seine Nägel, die vom Tabak gelblich verfärbt waren. Tomás betrachtete seinen Vater. Er hatte fast keine Haare mehr, lediglich ein paar weiße Strähnen im Nacken und hinter den Ohren sträubten sich noch gegen die vollständige Kahlheit. Die dichten, widerspenstigen Augenbrauen waren ergraut und das Gesicht faltig und hager, vielleicht zu hager, mit stark vorspringenden Jochbeinen, hinter denen die kleinen hellbraunen Augen fast verschwanden. Recht betrachtet, war sein Vater alt geworden. Alt und spindeldürr, mit einem schmächtigen, vertrockneten Leib, von dem fast nur Haut und Knochen übrig waren. Er war siebzig, das Alter begann, ihm zu schaffen zu machen, und es war eigentlich unglaublich, dass er immer noch Mathematik an der Universität Coimbra lehrte. Möglich war das nur dank der Klarheit und Brillanz seines Verstandes sowie einer Sondergenehmigung des Rektors. Andernfalls wäre er seit langem schon zu Hause verkümmert.
„Manuel“, drängte ihn seine Frau. „Nun rede schon. Wenn du es nicht erzählst, erzähle ich es.“
„Aber was soll er denn erzählen?“, fragte Tomás, den die ganze Geheimniskrämerei neugierig gemacht hatte.
„Ich erzähle ja schon“, sagte sein Vater.
Manuel Noronha war kein gesprächiger Mensch. Tomás hatte sich im Laufe der Jahre daran gewöhnt, dass er ihm fern war, ein schweigsamer Mann, der sich, stets eine Zigarette in der Hand, in seinem Arbeitszimmer unter dem Dach einigelte und vor dem Leben versteckte. Seine Welt waren die Cantorschen Theorien, die Euklidische Geometrie, die Lehrsätze von Fermat und Gödel, die Mandelbrot-Menge, der Lorenz-Attraktor, das Reich der Zahlen. Er lebte in einer Wolke aus Gleichungen und Tabakrauch, versunken in einem irrealen Universum, in asketischer Abgeschiedenheit. Er war ein Sklave des Nikotins, der Zahlen, der Mengenlehre und der Wahrscheinlichkeit, der Symmetrie, des Pi und des Phi und von allem, das alles betraf. Alles, nur nicht das Leben und seine Familie.
„Ich war beim Arzt“, verkündete Manuel Noronha, als ob damit bereits alles gesagt wäre.
Es wurde still.
„Und?“, fragte Tomás ermutigend.
„Nun, vor einiger Zeit, es muss zwei oder drei Jahre her sein, habe ich angefangen zu husten“, antwortete sein Vater, und wie zum Beweis hustete er zweimal. „Zuerst dachte ich, es sei eine Erkältung, dann eine Allergie. Aber der Husten wurde schlimmer, und ich verlor allmählich den Appetit. Ich wurde immer dünner und schwächer. Zu der Zeit hatte Augusto mich gebeten, ein paar Gleichungen für ihn zu überprüfen, und ich führte meine Erschöpfung und den Gewichtsverlust auf die Arbeitsüberlastung zurück.“ Er legte die Hand auf seine Brust. „Dann wurde mein Atem pfeifend. Deine Mutter wollte mich zum Arzt schicken, aber ich habe nicht auf sie gehört. Dann bekam ich starke Kopfschmerzen, und die Knochen fingen an, mir weh zu tun. Ich dachte, das komme von der Arbeit, aber deine Mutter hat mir derart in den Ohren gelegen, dass ich irgendwann zugestimmt habe, einen Termin bei Doktor Gouveia zu vereinbaren.“
„Du weißt ja, wie dein Vater ist, ein Eigenbrötler“, bemerkte Tomás’ Mutter. „Ich musste ihn fast in die Klinik schleifen.“
Tomás schwieg. Die Richtung, in die das Gespräch lief, gefiel ihm gar nicht, denn das Ganze konnte nur bedeuten, dass sein Vater ein gesundheitliches Problem hatte.
„Doktor Gouveia hat einige Untersuchungen veranlasst“, fuhr Manuel Noronha fort. „Man hat mir Blut abgenommen und mich geröntgt. Daraufhin wurde eine Computertomographie gemacht. Dann hat der Arzt deine Mutter und mich erneut zu sich bestellt und mir eröffnet, dass in meiner Lunge Schatten und eine Vergrößerung der Lymphknoten festgestellt worden seien. Er sagte, eine Biopsie sei notwendig, um anhand der Gewebeprobe mikroskopisch zu untersuchen, was es damit auf sich hat. Bei einer Bronchoskopie wurde mir dann ein Stück Lungengewebe entnommen.“
„Diese Lungenspiegelung war ein Kampf“, seufzte seine Mutter und verdrehte die Augen.
„Ich hätte dich mal an meiner Stelle sehen mögen“, sagte ihr Mann und warf ihr einen vorwurfsvollen Blick zu. „Dir wäre es auch nicht anders ergangen.“ Nach einem Verbündeten suchend, sah er seinen Sohn an. „Sie haben mir einen Schlauch in die Nase gesteckt und durch den Rachen in die Lunge geschoben. Ich habe während der Untersuchung kaum Luft bekommen, es war grauenvoll.“
„Und was hat die Untersuchung ergeben?“, fragte Tomás ungeduldig.
„Nun, sie haben die Gewebeproben untersucht, die sie aus dem Schatten in meiner Lunge und aus den Lymphknoten entnommen haben. Einige Tage später hat Doktor Gouveia uns dann erneut in seine Praxis bestellt. Nach einer langen Vorrede hat er mir eröffnet, ich hätte einen …“ Er sah seine Frau an. „Du merkst dir doch immer diese Sachen, Graça. Wie hat er sich noch ausgedrückt?“
„Ich werde es nie vergessen“, sagte seine Frau. „Er hat es als eine unkontrollierte Ausbreitung der Epithelzellen der Bronchialschleimhaut und der Lungenbläschen bezeichnet.“
Tomás starrte erst seine Mutter an, dann seinen Vater.
„Was zum Teufel soll das heißen?“
Manuel Noronha seufzte. In seiner Brust war ein deutliches Pfeifen vernehmbar.
„Mein Sohn, ich habe Krebs.“
Tomás versuchte, die Nachricht zu verarbeiten, aber er war wie betäubt.
„Krebs?“
„Ich habe Lungenkrebs.“ Wieder atmete er tief durch. „Zuerst habe ich es gar nicht geglaubt. Ich dachte, es läge eine Verwechslung vor, und die Untersuchungsergebnisse seien von jemand anderem. Dann habe ich einen anderen Arzt aufgesucht, Doktor Assis, der weitere Untersuchungen angestellt und mir lang und breit erzählt hat, ich hätte etwas sehr Unerfreuliches und müsste behandelt werden, aber was es war, hat er nicht gesagt.“
Seine Frau beugte sich vor.
„Doktor Assis hat mich später angerufen und zu sich zum Gespräch gebeten“, sagte sie. „Da hat er mir dann das Gleiche gesagt wie zuvor Doktor Gouveia, dein Vater habe, nun, eben diese Krankheit, aber er wusste nicht, ob er es ihm sagen sollte.“
Manuel Noronha zuckte resigniert mit den Schultern.
„Also habe ich mich überzeugen lassen und bin wieder zu Doktor Gouveia gegangen. Er hat mir die genaue Bezeichnung der Krankheit genannt, ein Karzinom mit einem merkwürdigen Namen, es heißt nicht-kleinzelliger Lungenkrebs.“
„Schuld sind die ewigen Zigaretten“, schimpfte seine Frau. „Doktor Gouveia hat gesagt, in fast neunzig Prozent der Fälle kommt der Lungenkrebs vom Rauchen. Und dein Vater hat doch gequalmt wie ein Schlot!“ Sie hob tadelnd den Zeigefinger. „Ich habe dich oft genug gewarnt, Manuel!“
„Warte mal, Mutter“, unterbrach Tomás sie und blickte seinen Vater aufgewühlt an. „Aber das ist doch behandelbar, oder nicht?“
Wie zur Antwort hustete Manuel Noronha.
„Doktor Gouveia hat gesagt, es gibt verschiedene Methoden, um die Krankheit zu bekämpfen. Man kann das Karzinom entweder operativ entfernen oder es mit Chemotherapie oder Bestrahlungen behandeln.“
„Und welche Methode wirst du wählen?“
Es entstand eine kurze Stille.
„In meinem Fall“, sagte sein Vater schließlich, „gibt es zwei Komplikationen, die laut Doktor Gouveia bei dieser Art von Krebs sehr häufig vorkommen.“
„Was für Komplikationen?“
„Bei mir wurde die Krankheit etwas spät erkannt. Offenbar passiert das in fünfundsiebzig Prozent der Fälle. Spätdiagnose.“ Er hustete erneut. „Die zweite Komplikation resultiert aus der ersten. Da es lange gedauert hat, bis die Erkrankung erkannt wurde, ist sie relativ weit fortgeschritten und hat sich in andere Körperregionen ausgebreitet. Ich habe Metastasen in den Knochen und im Gehirn, und Doktor Gouveia hat gesagt, dass ich wahrscheinlich auch welche in der Leber bekommen werde.“
Wie versteinert starrte Tomás seinen Vater an.
„Gott im Himmel“, rief er aus. „Und wie sollst du nun behandelt werden?“
„Eine Operation kommt nicht in Frage. Da der Tumor bereits gestreut hat, ist er in meinem Fall inoperabel. Chemotherapie ist ebenfalls keine Option, da sie nur bei kleinzelligem Lungenkrebs wirkt. Ich habe den großzelligen, der offenbar die häufigere Variante ist.“
„Aber was bleibt, wenn weder eine Operation noch eine Chemotherapie möglich sind?“
„Bestrahlungen.“
„Aber davon wirst du doch nicht geheilt, oder?“
„Nein, aber Doktor Gouveia meint, dass ich ganz gute Chancen habe, dass in meinem Alter die Erkrankung nicht so rasch fortschreitet und dass ich damit umgehen müsse wie mit einer chronischen Krankheit, aber ich habe allerlei gelesen und weiß nicht, ob er vollkommen ehrlich zu mir war.“
Ungehalten über diese Bemerkung, schlug sich Graça Noronha auf die Knie.
„So ein Unsinn!“, protestierte sie. „Natürlich war er ehrlich.“
Ihr Mann schaute sie an.
„Wir wollen uns doch nicht schon wieder streiten, Graça, nicht wahr?“
Nach Unterstützung heischend blickte sie zu ihrem Sohn.
„Siehst du? Jetzt hat er sich in den Kopf gesetzt, dass er sterben wird!“
„Nein“, erwiderte ihr Mann. „Aber ich habe etliches gelesen und begriffen, dass das Ziel der Bestrahlungen nicht die Heilung ist. Sie sollen lediglich den Fortschritt der Krankheit aufhalten.“
„Wie lange aufhalten?“, fragte Tomás.
„Was weiß ich! In meinem Fall kann das ein Monat sein oder ein Jahr, ich habe keine Ahnung.“ Sein Blick trübte sich. „Ich hoffe, es werden zwanzig sein“, sagte er dann. „Aber es kann sein, dass es nur ein Monat ist.“
Tomás spürte, wie er den Boden unter den Füßen verlor.
„Ein Monat?“
„Meine Güte“, wandte Graça ein. „Immer muss dein Vater alles so dramatisieren …“
Ein Hustenanfall schüttelte den alten Mathematikprofessor. Als er sich wieder gefangen hatte, atmete er tief durch und blickte seinem Sohn direkt in die Augen.
III
Die Sicherheitsüberprüfung an der Einfahrt zur amerikanischen Botschaft, einem von Grün umgebenen Gebäude im Stadtteil Sete Rios, hatte fast schon abstruse Ausmaße. Tomás Noronha wurde an zwei Absperrungen von Wachleuten durchsucht, bevor er schließlich einen Iris-Scanner passieren musste. Unter seinen blauen Kleinwagen wurde sogar ein Spiegel gehalten, um eventuell darunter angebrachten Sprengstoff ausfindig zu machen. Seit dem 11. September 2001 waren die Vorsichtsmaßnahmen verschärft worden, und der Zugang zum Gelände der Botschaft war zum Hindernislauf geworden.
An der Eingangstür empfing ihn mit strahlendem Lächeln Greg Sullivan. Der Kulturattaché war ein hoch aufgeschossener Mann von dreißig Jahren mit blondem Haar und blauen Augen. Er war sehr gepflegt, gut gekleidet und sah ein bisschen aus wie ein Mormone. Er führte Tomás durch mehrere Flure in einen hellen Raum, dessen geöffnetes Fenster auf einen sonnenbeschienenen Garten zeigte. Ein junger Mann in weißem Hemd und mit roter Krawatte saß in seinen Laptop vertieft an einem langgestreckten Mahagonitisch. Als Sullivan mit seinem Gast eintrat, stand er auf.
„Don, das ist Professor Tomás Noronha“, sagte Sullivan auf Englisch.
„Und das hier ist Don Snyder“, stellte er Tomás den jungen Mann vor, dessen extrem blasse Gesichtsfarbe gegen sein glattes, schwarzes Haar abstach. Sie begrüßten einander.
Nachdem die drei Platz genommen hatten, führte Sullivan das Gespräch wie ein routinierter Zeremonienmeister. Er sah Tomás unverwandt an, und es war offensichtlich, dass seine Worte ausschließlich ihm galten.
„Dieses Gespräch findet gar nicht statt. Alle Informationen, über die hier gesprochen wird, sind vertraulich und müssen unter uns bleiben. Verstanden?“
„Ja.“
„Sehr gut“, sagte Sullivan. „Dann fangen wir am besten an, Don.“
Snyder schob die Ärmel seines Hemdes hoch.
„Herr Norona, wie schon …“
„Noronha“, verbesserte Tomás.
„Norona?“
„Vergessen Sie’s“, sagte Tomás, als er merkte, dass es dem Amerikaner wohl niemals gelingen würde, seinen Nachnamen richtig auszusprechen. „Nennen Sie mich Tom.“
„Tom“, wiederholte Snyder, froh über den vertrauteren Namen. „Sehr gut, Tom. Meinen Namen hat Greg Ihnen ja bereits genannt. Was er Ihnen nicht verraten hat: Ich arbeite in Langley für die CIA und bin dort als Analyst in der Terrorismusbekämpfung in einem Referat tätig, das zur Direktion für operative Einsätze gehört, einem der fünf Leitungsorgane des Geheimdienstes.“
„Einsätze? So wie James Bond?“
Snyder und Sullivan grinsten.
„Ja, in der Direktion für operative Einsätze arbeiten die amerikanischen 007“, bestätigte Snyder. „Ich bin allerdings nicht direkt einer von ihnen. Ich fürchte, meine Arbeit ist nicht so amüsant wie die meines fiktiven Pendants vom MI6. Ich habe selten hübsche Mädchen um mich, und meist bestehen meine Aufgaben aus völlig uninteressanter Routinearbeit. Die Direktion für operative Einsätze ist hauptsächlich für das Sammeln geheimer Informationen verantwortlich und greift dabei häufig auf HUMINT zurück, was für human intelligence, also menschliche Quellen, steht, die verdeckt ermitteln.“
„Sie meinen Spione.“
„Das ist ein, wie soll ich sagen, etwas laienhafter Begriff. Wir bezeichnen diese Leute lieber als menschliche Quellen zur geheimen Informationsbeschaffung.“ Er legte die rechte Hand auf die Brust. „Jedenfalls bin ich keine dieser Quellen. Meine Arbeit besteht in der Analyse von Informationen über terroristische Aktivitäten.“ Er wechselte einen Blick mit Sullivan. „Und deswegen bin ich nach Lissabon gekommen.“
Tomás lachte.
„Lissabon und Terrorismus? Das sind zwei Wörter, die nicht zusammenpassen. In Lissabon gibt es keinen Terrorismus.“
„Das stimmt nicht ganz, Tomás“, warf Sullivan schmunzelnd ein. „Fahren Sie nicht Auto in dieser Stadt?“
„Wohl wahr“, sagte Tomás. „Es gibt hier Leute, die sind gefährlicher als Bin Laden, wenn sie hinterm Steuer sitzen.“
Don Snyder blickte die beiden etwas irritiert an, lächelte aber höflich.
„Lassen Sie mich meine Vorstellung zu Ende bringen“, bat er dann und tippte etwas in seinen Laptop ein. „Vergangene Woche bin ich wegen eines zunächst nicht einzuordnenden Ereignisses nach Lissabon gerufen worden“, sagte er und drehte den Bildschirm zu Tomás. „Kennen Sie diesen Mann?“
Tomás betrachtete prüfend das Bild eines um die siebzig Jahre alten Mannes mit grauem Schnurr- und Kinnbart und braunen Augen hinter einer Brille mit dicken Gläsern. Dann schüttelte er den Kopf.
„Nein.“
„Er heißt Augusto Siza und ist der bedeutendste Physiker Portugals.“
„Oh!“, rief Tomás, „das ist doch der Kollege meines Vaters.“
„Der Kollege Ihres Vaters?“, wunderte sich Snyder.
„Ja. Ist das nicht der, der verschwunden ist?“
„Stimmt, vor zwei Wochen.“
„Genau, mein Vater hat mir gerade eben davon erzählt.“
„Ihr Vater kennt ihn?“
„Ja, sie sind Kollegen an der Universität Coimbra. Mein Vater lehrt Mathematik, und Professor Siza hat einen Lehrstuhl für Physik. Aber was ist mit ihm passiert?“