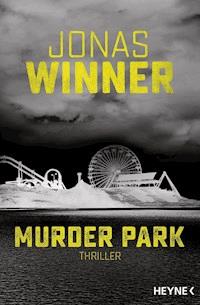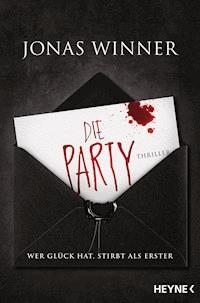4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Karl Borchert, ein aufstrebender Philosoph, erlebt kurz vor seinem dreißigsten Geburtstag eine herbe Enttäuschung: Das Projekt, mit dem er sich endgültig eine feste Position in der Wissenschaft sichern wollte, wird abgelehnt. Von einem Moment zum anderen steht der ehrgeizige junge Mann vor dem Nichts. Da kommt es ihm sehr gelegen, dass der hinfällige alte Professor Leonard Habich ihm anbietet, sein Privatsekretär zu werden. Habich will endlich ein bahnbrechendes Werk zum Abschluss bringen, an dem er seit Jahrzehnten arbeitet. Doch über dieses Vorhaben selbst schweigt er sich aus, und als Karl auf Schloss Urquardt, Habichs einsamem, verfallendem Wohnsitz unweit von Berlin, eintrifft, geschehen von Anfang an merkwürdige Dinge. Auch Lara, Habichs verführerische junge Frau, verwirrt Karl zusehends die Sinne ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Ähnliche
Jonas Winner
Das Gedankenexperiment
Roman
Knaur e-books
Über dieses Buch
Karl Borchert, ein aufstrebender Philosoph, erlebt kurz vor seinem dreißigsten Geburtstag eine herbe Enttäuschung: Das Projekt, mit dem er sich endgültig eine feste Position in der Wissenschaft sichern wollte, wird abgelehnt. Von einem Moment zum anderen steht der ehrgeizige junge Mann vor dem Nichts.
Inhaltsübersicht
Albrecht Dürer, Melencolia I
Prolog
Willst du, oder soll ich?« Karl sah seinen älteren Bruder prüfend an.
Sie hatten den ganzen Tag an dem Rad gebastelt. Die Mutter hatte ihnen aus dem Dorf zwei neue Schläuche mitgebracht. Karl hatte sie aufgezogen, Roland die Kette geölt. Viel mehr hatten sie nicht machen müssen. Das Rad war wirklich noch gut in Schuss. Nur vollkommen verrostet. Aber das machte ja nichts.
»Nee, is’ okay«, meinte Roland nachsichtig. »Du hast es ja auch gefunden.«
Karl grinste. Vorsichtig schwang er ein Bein über die Mittelstange. »Ich fahr ’ne Runde, dann bist du dran.« Er stieß sich ab, rutschte auf den Sattel und nahm mit kräftigen Tritten Fahrt auf. Der Sitz war vielleicht ein bisschen zu hoch eingestellt, er reichte mit den Füßen kaum an die Pedale. Aber das war ihm jetzt ganz egal.
Fast zwei Wochen waren sie schon hier. Urlaub auf dem Bauernhof. Erst hatte es ihnen ja nicht so gefallen, aber jetzt mit dem Rad würde es wunderschön werden, davon war Karl überzeugt.
Behutsam betätigte er den Rücktritt. Die Bremse nahm etwas Schwung aus seiner Fahrt. Vorn war eine Kurve. Seine Hände umklammerten den Lenker. Es saß wirklich verdammt hoch auf dem Sattel. Konzentriert folgte er dem gebogenen Lauf der Schotterstraße. Und lachte, als er die Kurve hinter sich hatte.
Die Straße verlief weiter bergab. Wie ein geölter Blitz rauschte er das Gefälle hinunter. Der Fahrtwind blies ihm ins Gesicht. Weiter vorn machte die Straße erneut eine Biegung. Es war Zeit, dass er umkehrte, dachte Karl, Roland wollte das Rad bestimmt auch mal ausprobieren.
Die Kurve flog heran. Karl kniff die Augen zusammen. Sie war sehr viel schärfer, als er gedacht hatte. Ich muss bremsen, ging es ihm durch den Kopf. Der Lenker vibrierte in seinen Händen. Kleine Steinchen spritzten unter seinen Reifen zur Seite. Er war schon länger nicht mehr auf einer geschotterten Straße gefahren. Schon gar nicht bergab. Schon gar nicht so schnell!
Was hatte Roland vorhin gesagt? »Auf Schotter musst du aufpassen, da kann man leicht wegrutschen. Vor allem, wenn du bremsen musst.«
Karl schluckte. Wenn er jetzt bremste, würde es wahrscheinlich passieren – dass er hinknallte. Auf den Schotter. Mit nackten Armen und Beinen. Aber ohne zu bremsen? War er für die Kurve doch viel zu schnell! Das spürte er mit jedem Muskel, während er weiter hinunterschoss – weiter zu auf die Kurve.
Ihm brach der Schweiß aus. Was jetzt? Bremsen, wegrutschen? Oder sich in die Kurve legen und hoffen, dass die Räder auf dem Scheiß-Schotter hielten?
Noch zwanzig Meter.
Weiter bergab.
Er wurde ja immer schneller!
Noch zehn.
Er war wie gelähmt.
Als Karl wieder zu sich kam, erfüllte ein dumpfes Gefühl seinen Schädel. Er lag mitten auf der Straße, hinter der Kurve, die nackten Beine angewinkelt. Spitz drückten die Schottersteinchen in seine Schulter, seine Hüfte, seine Knie. Die Gedanken tropften ihm ins Gehirn. Wenn nun ein Auto um die Kurve bog … schnell fuhren sie hier ja nicht, aber sie konnten ihn doch nicht sehen … sie würden ihn glatt überfahren.
Er wollte aufstehen, die Straße frei machen. Aber kein Glied regte sich. Auch den Kopf konnte er nicht bewegen. Nur die Augen.
Sie wanderten an seinem Körper herunter. Die Oberschenkel waren rot, blau … das sah nicht gut aus. Auf beiden Schenkeln lila Löcher. Kinderfaustgroße Hohlräume, auf deren Boden es schimmerte. War das der Knochen?
Er atmete aus. Er musste weg hier …
Dann döste er wieder weg.
»Karl!«
Es war Roland. Mit aufgerissenen Augen kam er um die Biegung auf ihn zugerannt.
Karl blinzelte. »Ich hab die Kurve nicht gekriegt.« Seine Stimme war leise. Er versuchte zu lächeln. »Nicht böse sein, Rolli.«
Roland rutschte über den Schotter, ließ sich vor ihm auf die Knie fallen. »Scheiße!« Seine Augen schnellten zu Karls Oberschenkeln.
Karl horchte in sich hinein. Dumpfes Brausen. Spüren tat er eigentlich nichts. »Bleib so liegen, nicht bewegen!«, hörte er Rolands Stimme. Karl versuchte zu nicken, aber sein Kopf gehorchte ihm nicht. Er bewegte die Lippen.
Roland sprang auf. »Ich hol Papa.« Ihm liefen Tränen übers Gesicht.
Karl sah ihm nach. Sein Bruder blieb noch einmal stehen und sah sich um. »Hab keine Angst«, stieß Roland hervor – dann riss er sich los und verschwand um die Kurve.
Karls Augen schlossen sich wieder.
Er würde ja hören, wenn ein Auto kam. Dann könnte er rufen. Sie würden ihn schon nicht überfahren. Er öffnete den Mund, um es auszuprobieren. Es kam kein Laut daraus hervor.
Karl atmete aus und schlug die Augen auf. Dicht vor seinem Auge lag der Schotter der Straße. Über ihm die Blätter einer großen Kastanie und hinter dem Blätterwerk der Sommerhimmel. Seine Augen wanderten weiter. Dort stand sein Rad – eingeklemmt zwischen der Mauer am Straßenrand und dem Strommast davor. Es mussten die Eisendornen an dem Mast gewesen sein. Sie hatten ihm die Schenkel regelrecht aufgeschlitzt, als er dagegen geschleudert worden war. Merkwürdig, dass es gar nicht weh tat.
Schlagartig tauchten die Bilder vor ihm auf. Er war einfach geradeaus weitergerast, mit voller Wucht in die Spalte zwischen Mauer und Strommast hinein. Das hatte ihn aus dem Sattel geschleudert. Einen Augenblick lang hatten sich seine Hände noch an den Lenker geklammert, während er schon durch die Luft geflogen war. Beine oben, Kopf unten. Bis es geknackt hatte. Und sein Hinterkopf gegen den Betonmast geschlagen war.
Karl spürte ein kribbliges Jucken am Hinterkopf, wollte danach greifen, aber sein Arm gehorchte ihm nicht. Er lag wie ein fremdes Stück Fleisch neben ihm. Und das Jucken nahm zu. Karl atmete aus. Versuchte es noch einmal. Er sah, wie seine Finger sich krümmten. Konzentrierte sich ganz auf die Hand. Zog sie mühsam Richtung Kopf, beseelt von dem Wunsch, das Jucken zu stoppen.
Dann hatte er sie oben. Erst fiel sie schlaff auf seine Wange. Aber es gelang ihm, sie weiterzuschieben. Er berührte die Haare, die sich nass und verfilzt anfühlten. Versuchte, den klebrigen Saft von den Fingerkuppen am Ohr abzustreifen. Doch das ging nicht. Also weiter.
Tastend fuhren seine Finger am Ohr vorbei zum Hinterkopf. Hauptsache, er konnte sich kratzen. Dort, wo es juckte.
Unendlich langsam rutschten seine Fingerkuppen über die Schädeldecke auf die juckende Stelle zu. Bis er spürte, wie sie in etwas Weiches eintauchten – wo eigentlich sein Schädelknochen hätte weitergehen müssen. Karl wunderte sich mehr, als dass er erschrak – und tastete weiter. Fühlte, wie ein Finger immer tiefer unter die harte Verschalung seines Kopfes eindrang, vordrang. Wie er fester von etwas Warmem, Weichem umschlossen wurde. Karl wusste, dass er das nicht tun sollte. Konnte aber nicht aufhören. Als würde er an einer verschorften Wunde pulen. Es war wie ein Rausch. Es juckte und ziepte, aber er musste die verschorfte Schicht abkriegen. Aufkratzen. Drunterkommen.
Im selben Augenblick flutschte sein Finger ganz unter die Schädeldecke – ganz in das glitschige, klebrige Blut. Ein Gefühl, als ob ihm der Knochenkasten über die Augäpfel rutschen würde –
»Karl!«
Erschrocken zog er den Finger zurück. Ein schmatzendes Geräusch – ein Ziehen, das Karl bis in die Bauchhöhle hinein zu spüren glaubte. Ein Gesicht tauchte über ihm auf.
»Papa.«
Sein Vater beugte sich zu ihm herunter, berührte ihn vorsichtig mit der Hand an der Schulter.
»Karl?«, flüsterte er. »Kannst du mich hören?«
»Ja, Papa, endlich bist du da. Ihr müsst mich von der Straße wegbringen. Wenn ein Auto um die Kurve kommt – die könn’ mich doch nicht sehn.«
Der Vater nickte. »Roland steht hinter der Kurve und passt auf. Bleib ganz ruhig liegen, der Krankenwagen kommt gleich.«
Das Gesicht der Mutter tauchte neben dem Kopf des Vaters auf. In ihren Augen stand der blanke Schrecken. Sie hockte sich neben ihn, sagte nichts und warf nur dem Vater einen Blick zu. Der sah unverwandt zu seinem Jungen.
Karl spürte: Jetzt wird alles gut. Es konnte ihm nichts mehr passieren. Gleich würde der Krankenwagen da sein. Er konnte sich ausruhen. Die Müdigkeit war wie eine Decke, in die er sich hineinkuscheln wollte.
»Karl?« Sein Vater berührte ihn leicht am Arm.
»Ja?« Karl hielt die Augen geschlossen.
»Mach die Augen auf, du darfst jetzt nicht einschlafen.«
Wieso denn nicht? So müde war er noch nie gewesen.
»Karl?« Jemand rüttelte an seinem Arm. »Nicht einschlafen! Hörst du?«
Karl zwang sich, die Lider hochzuziehen. Es war unendlich schwer. »Wann kommt endlich der Krankenwagen?«, flüsterte er.
»Es dauert nicht mehr lange.«
Karls Blick traf den seiner Mutter. Sie weinte.
Im Krankenwagen war er mit dem Vater allein. Von ferne drang das Heulen des Martinshorns zu ihm durch. Er spürte, wie der Wagen über die Landstraße raste. Hinter den Milchglasscheiben huschten die Alleebäume vorbei. Aber im Inneren des Wagens war alles ruhig.
»Ich kümmer mich«, flüsterte ihm der Vater zu, der neben Karls Trage auf einem Klappsitz saß. »Ich hab schon mit den Ärzten gesprochen. Wir bringen dich in meinen OP.«
Karl sah ihn liebevoll an. Papa würde ihn operieren, Papa würde über ihn wachen.
Er brauchte sich keine Sorgen zu machen.
Erster Teil
1
Hast du den Tisch für heute Abend reserviert?« Tamara stand in der Tür zum Badezimmer und ließ ihn nicht aus den Augen. Die elektrische Zahnbürste surrte in ihrer Hand.
Karl schlug die Bettdecke zurück und setzte sich auf. »Hab ich.«
Er hatte gestern Abend noch in dem Lokal angerufen. Und einen Tisch bestellt. Auf den Namen Borchert. Für acht Personen. Was sollte da schiefgehen?
Er wischte sich mit den Händen übers Gesicht. Natürlich würde nichts schiefgehen. Da konnte er sicher sein. Oder? Was, wenn sie heute Abend das Lokal betraten und die Kellner die Bestellung nicht mehr fanden?
Borchert? Nee, ham wa nich. Was haben Sie? Reserviert? Bei wem?
Den Namen des Kellners, der die Bestellung entgegengenommen hatte, hatte er sich natürlich nicht geben lassen.
»Ich kann ja nachher noch mal im Restaurant anrufen«, schlug er vor und stand auf. »Zur Sicherheit.« Ihm würde es ja nichts ausmachen, wenn sie das Lokal wieder verlassen müssten. Aber Tamara würde ihm das nicht verzeihen.
»Würdest du das tun?« Tamara lächelte ihn an. »Das ist lieb von dir.« Sie schob die noch immer rotierende Zahnbürste zurück in den Mund und verschwand wieder im Badezimmer.
Karl trat zu der verspiegelten Schrankwand und zog eine der Türen auf. Dahinter kamen seine Anzüge zum Vorschein. Braun. Grau. Blau. Leinen. Nadelstreifen. Schurwolle.
Er klappte die Tür wieder zu und wandte sich zu dem Stuhl, der neben seinem Bett stand und auf dem seine Jeans lag. Dazu das hellblaue Hemd, das er in New York gekauft hatte, und das Fischgräten-Jackett aus Rom. Vielleicht entsprach das nicht gerade der Kleiderordnung im Institut. Aber egal. Sie würden ihre Entscheidung doch nicht davon abhängig machen, was er anhatte. Sie wussten doch längst, was sie tun wollten. Da konnte er praktisch nackt auftauchen, das würde auch nichts mehr ändern.
Er zog die entsprechende Schranktür auf, fischte Hemd und Jackett heraus, warf sie aufs Bett und betrat das Badezimmer, das direkt vom Schlafzimmer abging und inzwischen von Tamara wieder verlassen worden war.
Ihm hätte der Termin im Institut heute vollkommen ausgereicht. Aber Tamara hatte ja unbedingt noch das Essen im Restaurant organisieren müssen. Es sei höchste Zeit, dass er anfing, seine Ideen gezielter in der Wirtschaft zu verbreiten, hatte sie gesagt. Vielleicht hatte sie damit ja sogar recht. Ohne zusätzliche Unterstützung würde sich das Projekt nicht wirklich durchführen lassen. Warum also nicht Tamaras Kontakte nutzen? Aber ausgerechnet heute Abend, gleich nach dem Termin im Institut? Das hatte Karl nie so richtig gepasst.
Frisch geduscht, in Jeans, Hemd und Jacke, durchquerte er wenig später das Wohnzimmer Richtung Küche. Durch die breite Panoramascheibe fiel sein Blick auf den Platz vor dem Haus und das gegenüberliegende Konzerthaus. Hinter dem Giebel des Schinkelbaus wölbte sich ein bleicher Herbsthimmel über der Stadt. Es versprach ein kalter Tag zu werden.
»Was soll schon passieren?«, sagte Tamara, als er die Küche betrat. »Forkenbeck steht doch dahinter.«
Sie saß an dem polierten Eichenholztisch und goss sich gerade etwas Biomilch in ihr Müsli.
Karl nickte.
»Außerdem ist es nicht das erste Stipendium, das du bekommst, Karl«, fuhr sie fort und streute sich noch ein paar Sonnenblumenkerne in ihre Schale. »Die wissen doch, dass sie dir was bieten müssen, wenn sie dich halten wollen.«
Klar. Als wenn es nicht Hunderte von hochqualifizierten Wissenschaftlern gäbe, die sich begeistert eine Hand abhacken würden, wenn sie dadurch nur an die Gelder der Forschungsgemeinschaft kämen.
Karl füllte den Kaffeeträger der Espressomaschine, schob ihn unter das Ventil und betätigte die Taste. Röhrend und zischend erwachte die Gaggia zum Leben. Rasch stellte er eine Tasse darunter.
»Ich weiß nicht, wie lange es nachher dauert«, sagte er, ohne sich umzudrehen. »Kann sein, dass sie alles ganz genau wissen wollen. Vielleicht muss ich später noch kurz mit ihnen was essen gehen.«
Er spürte, wie sich Tamara am Tisch aufrichtete.
»Das geht aber nicht«, hörte er sie hinter sich sagen. »Heute Abend ist doch unser Treffen.«
Karl schaltete die Espressomaschine wieder aus, nahm die Tasse heraus und drehte sich um. »Ja, ich glaube, bis dahin bin ich auch fertig.« Karl nippte an dem Espresso. Er war stark und gut.
»Du glaubst?« Tamara sah ihn unwillig an.
Karl kippte den Rest der schwarzen Flüssigkeit hinunter. »Ich ruf dich an, wenn ich fertig bin, okay? Es hat doch keinen Sinn, das alles jetzt schon zu besprechen. Hören wir erst mal, was die Leute von der Forschungsgemeinschaft sagen.«
Tamara ließ den Löffel sinken. »Wie stellst du dir das denn vor?« Ihre Stimme wurde eindringlich. »Soll ich die Herren in letzter Minute vielleicht wieder ausladen?«
Da hatte sie natürlich recht. Karl spürte, wie er ärgerlich wurde. Er hätte sich auf das Treffen im Restaurant erst gar nicht einlassen sollen. »Nein, lass alles so, wie es ist.« Er stellte die Espressotasse in die Spüle. »Ich komm um acht dazu.« Wenn die Forschungsgemeinschaft ihn förderte, würden Tamaras Bekannte schon damit klarkommen, dass er sie sitzenließ, weil er mit den anderen noch essen gehen musste. Und wenn nicht? Dann war sowieso alles egal.
»Sicher?«
»Jaha.«
Er ging um den Tisch herum und beugte sich leicht zu ihr herunter. Tamara spitzte die Lippen. Er küsste sie flüchtig.
»Bis nachher.«
Sie nickte. Für einen Sekundenbruchteil glaubte er zu sehen, wie ein Schatten von Verletzlichkeit in ihren Augen aufblitzte. Eine Regung, die sie offenbar nicht zulassen wollte.
»Und denk daran, dass wir am Wochenende zu Papa fahren«, mahnte sie.
Karl wandte sich ab. Auch das noch. Musste er eigentlich jedes zweite Wochenende mit ihren Eltern verbringen? Aber da war er schon aus der Küche, durchquerte den Flur und zog an der Haustür.
Mit lautem Krachen ließ er sie hinter sich ins Schloss fallen. Und ahnte nicht, dass er Tamara, mit der er seit zwei Jahren zusammenlebte, nie wiedersehen würde.
2
Aus: »Das vierte Paradigma. Fakten, Protagonisten, Hintergründe«, Berlin 2014, S. 54
»Es ist viel darüber spekuliert worden, ob sich der Zeitpunkt, an dem Karl Borchert Leonard Habich zum ersten Mal begegnet ist, allein aus der Entscheidung der Forschungsgemeinschaft ergeben hat – oder ob Habich in irgendeiner Form versucht hat, diese Entscheidung zu beeinflussen, um den Zeitpunkt ihres Aufeinandertreffens selbst zu bestimmen. Eindeutige Belege, die für eine Einflussnahme sprechen, sind bislang zwar nicht aufgetaucht, Argumente jedoch so viele wie Stimmen, die sich zu dieser Frage geäußert haben. Sicher ist nur, dass Borchert in den letzten Wochen vor der Entscheidung der FG sowohl seiner Freundin Tamara Hildebrandt gegenüber als auch verschiedenen Kollegen im Institut gegenüber die Zuversicht geäußert hat, fest mit einem positiven Bescheid seitens der Forschungsgemeinschaft zu rechnen.«
»Karl?«
Er fuhr herum.
»Kommst du mit, einen Kaffee trinken?«
Es war Adrienne. Karl warf einen Blick auf die Uhr. Kurz vor elf. Um elf hatte er den Termin in Forkenbecks Arbeitszimmer. Gerade hatte er seinen Wagen am Park hinter dem Institut abgestellt. Die verbleibende Zeit hatte er eigentlich nutzen wollen, um noch rasch die Mails in seinem Arbeitszimmer zu checken.
»Jetzt ist schlecht, ich muss gleich bei Forkenbeck rein.«
»Es geht um deine Förderung, oder?« Sie schmunzelte und trat einen Schritt näher an ihn heran. »Wie sieht’s denn aus? Schon was gehört?«
Karl lächelte. »Nee. Du?«
Adrienne schüttelte den Kopf. »Aber ich finde das wirklich toll, was du da machst.« Sie sah ihm direkt in die Augen.
Karl registrierte ihre Nähe.
»Wie machst du das, dass du die Forschungsgelder mit links abgreifst?«
Karl grinste verlegen, wusste nicht recht, was er antworten sollte. Noch war die Entscheidung doch gar nicht gefallen, dachte er.
Aber Adrienne ließ nicht locker. »Wenn das losgeht mit dem Projekt, das ist ja fast so was wie eine neue Teildisziplin.«
Karl lachte. »Unsinn, Sprachtheorie, nichts als Sprachtheorie, das sollte man nicht überschätzen.«
»Nein, im Ernst«, warf Adrienne ein, »an deinem Forschungsvorhaben könnten doch mindestens zwei Leute mitarbeiten, oder nicht?« Sie griff nach seinem Arm. »Ist das geplant? Hast du schon mit dem Dekan gesprochen?«
Ihre rotlackierten Fingernägel brannten wie glühende Kohlen auf seinem Fischgräten-Jackett.
»Noch nicht.«
»Wirklich, Karl. Du musst mich unbedingt anrufen, wenn sie das Okay geben, hast du verstanden?« Sie schwieg einen Augenblick, schien zu überlegen, womit sie ihn überzeugen könnte. Und sprach es dann auch wirklich aus. »Was machst du eigentlich heute Abend? Warum setzen wir uns nicht einfach zusammen und besprechen alles in Ruhe?«
Sie sah ihm kurz auf den Mund.
Karl atmete aus. Adrienne war wirklich sexy. Sie hatte ihm schon immer gefallen. Die schwarzen Haare, ihr zierlicher Körper, von dem sie wusste, wie man ihn einsetzen musste.
»Heute Abend kann ich nicht.«
»Dann morgen!« Ihre dunkelbraunen Augen sahen zu ihm auf, die Pupillen halb versteckt hinter den langen Wimpern. Um ihre Lippen spielte ein Lächeln. Als wüsste sie, was er dachte, dass er an Tamara dachte – und wüsste zugleich, dass er wüsste, dass sie es wüsste. »Oder?«
Es kam Karl so vor, als hätte er gleichzeitig einen Kloß im Hals und Ameisen auf den Handflächen.
Adrienne beugte sich noch ein wenig näher an ihn heran, ihr Oberkörper stieß an seinen Arm, ein Hauch ihres Parfüms wehte in seine Nase. »Warst du eigentlich schon mal bei mir zu Hause?«
»Zu Hause?« Für einen Augenblick war er so überrascht, dass er vergaß zu antworten.
»Hm?«
»Ja. Ja, natürlich«, entfuhr es Karl. »Nach deiner Disputation, die Party, da war ich dabei.«
Ihre Hand lag noch immer auf seinem Arm. »Richtig!« Sie atmete so aus, dass es ein klein wenig hörbar war, ein klein wenig in ihrem Rachen kratzte. »Ich mach uns einen Salat. Und dann reden wir über alles, ja?«
»Klar«, stieß er hervor.
»Das freut mich«, sagte sie, und ihre Hand, die sie einfach nur hätte hochnehmen müssen, strich kaum wahrnehmbar über seinen Arm, als würde sie gerade nicht darauf achten.
»Wir können ja noch mal telefonieren«, sagte er, da berührten ihre Fingerspitzen schon seinen Handrücken, während Adriennes Blick wie nach innen gerichtet schien, als hätte sie all ihre Aufmerksamkeit in ihre Fingerspitzen gelegt, deren Nägel spitz, hart und fein über seine Haut glitten – sanft unter den Ärmel seines Hemdes fuhren.
Mit einem Ruck riss er sich los. »Forkenbeck wartet sicher schon.« Dann hatte Karl die Hände in den Hosentaschen versenkt, bevor Adrienne ihn noch völlig durcheinanderbrachte.
Er sah, wie sie die Lippen spitzte, lächelte und sich abwandte. Als sie zum Ausgang ging, konnte er nicht anders, als auf ihren Hintern zu starren und sich vorzustellen, wie sie beide nackt wären und er sie an sich heranziehen würde.
Aus: »Als der Dämon sich entbarg. Unautorisierte Biographie Karl Borcherts« von Adrienne Hruby, München ohne Jahr, Seite 16 ff.
»Ursprünglich waren es die Namen der großen Philosophen, die eine unbezwingbare Neugier in Karl Borchert entfacht hatten. Heidegger. Hegel. Kant. Was hatten sie in ihren Schriften verkündet? Worum war es Nietzsche, Leibniz oder Spinoza gegangen? Was war es, worüber sie nachgedacht hatten? Musste nicht, was auch immer man denken wollte, von ihnen bereits gedacht worden sein?
Dieser Gedanke hatte ihn nicht mehr losgelassen. Er würde alle Schriften der großen Philosophen durcharbeiten, hatte er sich gesagt, als er sich ins Studium stürzte. Und wenn er dann wissen würde, wohin sie von ihren Gedankengängen gebracht worden waren, würde er selbst dort weitermachen, wo sie stehengeblieben waren.
Bald jedoch musste Borchert feststellen, dass die Schriften der Meisterdenker nicht nur auf unendlich viele verschiedene Weisen interpretiert werden konnten – dass es also zahllose Arten gab, sie zu verstehen –, sondern dass jeder Einzelne von ihnen auch eine ganz eigene Terminologie entwickelt hatte, also ganz eigene Begriffe, um daraus sein persönliches System aufzubauen.
Doch Borchert ließ sich davon nicht abschrecken. Mit großem Elan machte er sich daran, die Begriffe der Meisterdenker zu erlernen und die plausibelste Interpretation ihrer Texte zu suchen. Doch sosehr er sich auch abmühte, er wurde den Eindruck nicht los, dass die Systeme der Philosophen nicht viel aufschlussreicher waren als ein Gedicht, dessen Wortgewaltigkeit ihn kurzzeitig betören und glauben lassen konnte, eine ewige Wahrheit, eine großartige Vision erblickt zu haben. Verzog sich jedoch der suggestive Nebel, in den er sich durch die Kraft der Worte hatte verstricken lassen, und wollte er sehen, welches Werkzeug ihm das System des Philosophen an die Hand gegeben hatte, so zeigte sich, dass er nichts anderes gewonnen hatte als ein paar verschlungene Satz- und Wortgefüge, die mit der Wirklichkeit, auf die Karl sie doch hatte anwenden wollen, nichts zu tun hatten. Eine Erfahrung, die ihn schließlich dazu veranlasste, dem Studium der Klassiker enttäuscht den Rücken zu kehren.«
3
Als Karl um Punkt elf Uhr Forkenbecks Arbeitszimmer betrat, waren die Vertreter der Forschungsgemeinschaft bereits eingetroffen. Eine kurzhaarige Frau, Anfang 50, die sich als Gisela Kortner vorstellte, und ein jüngerer Mann, den sie als Julian Goblett präsentierte, hatten an dem runden Tisch vor dem Fenster Platz genommen. Beide hatte Karl noch nie gesehen. Etwas hilflos schaute er zu Forkenbeck, der an seinem Schreibtisch mit Gläsern und einer Mineralwasserflasche hantierte, fing aber von seinem Professor nur einen leicht verschleierten Blick auf, der zwischen Wohlwollen, Aufmunterung und dem Signal »Das ist jetzt dein Ding, Junge« zu schwanken schien. Karl überlegte kurz, ob er eine erfrischende Bemerkung parat hatte, die die aufgeladene Stimmung in dem Zimmer ein wenig auflockern könnte. Da ihm jedoch nichts Passendes einfiel, blieb ihm nichts anderes übrig, als so ruhig und souverän wie möglich zu lächeln und sich zu den beiden an den Tisch zu setzen.
»Wir haben Ihr Exposé sehr aufmerksam gelesen, Herr Borchert«, sagte Kortner nach dem üblichen einleitenden Geplänkel schließlich und hob den Antrag auf, der vor ihr auf dem Tisch lag. »Eine wirklich beeindruckende Bewerbung.« Wie geistesabwesend begann sie, darin zu blättern.
Warum fängt sie mit einer positiven Bemerkung an?, schoss es Karl durch den Kopf. Müsste sie nicht sagen: Wirklich in unseren Zuständigkeitsbereich fällt Ihr Anliegen zwar nicht, aber … Fing sie jedoch mit dem an, was sie gut fand, was sollte dann nach dem aber kommen, das zwangsläufig kommen musste, so wie er die Frau einschätzte?
»Der Komplexitätsgrad Ihres Forschungsvorhabens ist bemerkenswert«, hörte er sie sagen. »Wirklich.«
Aber?, hallte es in Karls Kopf. Aber?
»Sie schlagen vor, eine Population von Automaten zu erzeugen, sehe ich das richtig?« Kortner sah ihn an.
Er riss sich zusammen. »Genau. Es sind sozusagen radikal vereinfachte Modelle von Personen. Auf diese Weise können wir Fragen, die schwierig zu analysieren sind, wenn von Menschen die Rede ist, auf eine einfachere Ebene übertragen.«
Goblett und Kortner sahen ihn an. Das war jetzt der entscheidende Moment. Jetzt musste er das Ding verkaufen!
»Lassen Sie mich das Projekt kurz skizzieren«, beeilte er sich hinzuzufügen – und musste gleichzeitig wieder daran denken, dass die beiden sich ihr Urteil doch längst gebildet haben müssten.
»Ja?«, gab Kortner sich interessiert.
»Ausgangspunkt meiner Überlegung war, dass die Personen der Minimalwelt, die wir in dem Projekt definieren, als unterschiedlich hilfsbedürftig modelliert werden.« Er starrte in die Gesichter der beiden Beamten. »Und sie befolgen unterschiedliche moralische Regeln. Die eine Person ist egoistischer, die andere kooperativer. Die moralischen Regeln legen also fest, wie sich die Personen in Begegnungen mit anderen Personen entscheiden. Ob sie helfen oder ausbeuten oder nichts tun, zum Beispiel. Sind alle Personen der Welt definiert, kann das Experiment gestartet werden. Je nachdem, wie die Personen nun entscheiden, sammeln oder verlieren sie Punkte. Werden sie ausgebeutet, verlieren sie Punkte, beuten sie aus, gewinnen sie Punkte. Je mehr Punkte sie haben, desto besser.« Er holte Luft. Sie unterbrachen ihn nicht. Also weiter. »Indem wir die Personen in unserer Minimalwelt aufeinandertreffen lassen, setzen wir also einen kleinen Evolutionsprozess in Gang. Und können beobachten, welche moralische Regel sich evolutionär am besten durchsetzt. Können Sie mir folgen?«
Karl sah Kortner und Goblett an. Die Augen seiner beiden Zuhörer wirkten erschreckend glanzlos. Aber das bildete er sich vielleicht auch nur ein. Jedenfalls nickten sie.
»Okay«, fuhr er fort. »Wir müssen also nicht mehr im luftleeren Raum darüber nachdenken, was gut ist und was richtig – wir können die Evolution darüber entscheiden lassen, welche moralische Regel die beste ist, also welche Regel den Personen dieser Welt am meisten zugutekommt.«
»In Ordnung. Aber das ist ja nur die erste Stufe Ihres Vorhabens«, entgegnete Kortner.
Karl warf seinem Professor einen Blick zu. Forkenbeck hatte sich mit seltsam zusammengepressten Lippen hinter seinen Schreibtisch zurückgezogen.
»Richtig«, antwortete Karl und sah wieder zu Kortner. »Dieses Modell ist im Grunde genommen nur die Basis für eine sehr viel weitgehendere Versuchsanordnung. Ansätze, die evolutionäre Stärke unterschiedlicher moralischer Handlungsweisen zu bestimmen, hat es ja schon seit den 1990er Jahren gegeben. Das wirklich Neue an dem Vorhaben, das wir anbieten, besteht darin, diese Grundidee auf ein anderes Forschungsgebiet zu übertragen.«
»Auf das Gebiet der Sprache.« Es war das Erste, was Goblett sagte. Karl schaute zu ihm hin. Vielleicht sollte er sich mehr an Goblett halten.
»Ja. Die Automaten werden zu diesem Zweck stark ausgebaut. Wir versehen sie mit einem Input- und einem Output-Kanal. Eine Matrix mit sechs mal sechs Feldern, die einzeln aufleuchten können, und die an der Außenseite jedes Automaten angebracht ist sowie eine Kamera mit dahinter geschalteter Software, die die Matrix eines anderen Automaten lesen und auswerten kann.«
»Ja«, sagte Goblett.
Ja?, hallte es in Karls Kopf. Ja? Ist das eine Zusage? Aber er ließ sich nichts anmerken. »Sowohl die moralische Regel, die ein Automat befolgt, als auch seine Hilfsbedürftigkeit werden durch ein bestimmtes Aufleuchten der Matrixfelder dargestellt«, sagte er. »Jeder Automat erkennt somit, welche Regel jeder andere Automat befolgt und wie sehr der andere auf Hilfe angewiesen ist.« Wieder hielt er inne, um sich der Zustimmung seiner beiden Zuhörer zu vergewissern. Aber jetzt nickten sie nicht mehr.
»Das Neue an unserem Modell ist damit«, fuhr Karl stur fort, »dass die Personen der Minimalwelt nicht nur handeln, sondern auch Zeichen senden und rezipieren. Wobei entscheidend ist, dass sie – aus Gründen der Vorteilsnahme – ihr Gegenüber auch mit absichtlich unwahren Zeichen über den Grad ihrer Hilfsbedürftigkeit täuschen können. Ebenso wie sie ihr Gegenüber über die moralischen Regeln täuschen können, die sie befolgen.«
»Und ob sie ihr Gegenüber täuschen oder nicht, gehört selbst wieder zu den moralischen Regeln, die der Automat befolgt«, sagte Goblett und warf Kortner einen Blick zu.
Karl nickte. Der Mann hatte verstanden, worum es ging, keine Frage. »Natürlich sind die Regeln, die die Automaten befolgen, nicht starr implementiert«, sagte er, »sondern flexibel. Dazu genügt ein einfacher Lern-Algorithmus. Je nachdem, welche Erfahrungen der Automat im Laufe seines Lebens sammelt, ändert er seine Regeln ab. Und damit reguliert er auch, welche Zeichen er sendet. Während also in den früheren Versionen dieses Versuchsaufbaus lediglich untersucht wurde, welches Handlungsmuster sich evolutionär durchsetzt, untersuchen wir, welches Zeichensystem sich evolutionär herausbildet.«
»Wirklich ehrgeizig, das muss man Ihnen lassen.« Kortner hatte wieder zurück in das Gespräch gefunden. Und der Ton, den sie anschlug, gefiel Karl überhaupt nicht.
Er sah zu Forkenbeck. »Haben Sie den Kollegen von unserer Kooperation mit den Amerikanern erzählt?«
Forkenbeck lächelte. Aber es war ein müdes Lächeln. »Sicher. Wir haben darüber gesprochen. Ich habe ihnen auch die Unterlagen über die erste, vorläufige Fassung des Experiments gezeigt, aus denen hervorgeht, dass es bereits ganz gut läuft. Und ich habe deutlich gemacht, dass wir am Institut ein solches Vorhaben, das einen überdurchschnittlichen Aufmerksamkeitswert verspricht, außerordentlich gut gebrauchen könnten.«
Könnten. Nicht können. Karl schaute zurück zu Kortner. Er wusste, dass es das falsche Signal war, aber langsam hatte er keine Lust mehr, dieses alberne Versteckspiel mitzumachen. »Aber?«
»Hören Sie, Herr Borchert«, hob Kortner an – und kaum hatte Karl diese vier Worte gehört, war ihm, als würde ein Kübel siedenden Öls über ihm ausgeschüttet. Das konnte doch nicht wahr sein – sie lehnten seinen Antrag ab?
»Im Grunde genommen geht es in Ihrem Vorhaben doch darum, ein bestimmtes Phänomen, das Sie erklären wollen, nachzuerschaffen«, fuhr Kortner fort. »Sie wollen das Phänomen, in diesem Fall also die Sprache, nachbauen, anstatt es mit den herkömmlichen Mitteln der empirischen Wissenschaft, also experimentell, zu erforschen.«
Karl nickte. Das war ja gerade der Witz daran.
»Das aber ist ein Forschungsansatz, den wir von der FG«, und dabei sah sie kurz zu Goblett, der mit gespitzten Lippen nickte, »nicht unterstützen können.«
»Und warum nicht?« Karls Ton war hart und scharf.
»Wer sagt uns, dass das, was Sie dabei konstruieren, mit dem, was Sie eigentlich untersuchen wollen, irgendetwas zu tun hat?« Kortner sah ihn mit ihren blauen, glanzlosen Augen unverwandt an. »Sie bauen eine Welt. Schön und gut. Aber das tun die Herrschaften, die eine Modelleisenbahn aufbauen, auch. Die Frage ist nur: Was hat so eine Modelleisenbahn mit der wirklichen Bahn zu tun?«
»Wenn wir bei der Untersuchung eines Phänomens mit der Frage ›Warum ist es so?‹ nicht weiterkommen, sollten wir fragen ›Wozu ist es so?‹, nicht: Wodurch ist es verursacht worden?, sondern: Welche Funktion erfüllt es?« Karls Stimme durchschnitt den Raum.
Aber Kortner sah bereits zu Forkenbeck. »Tut uns leid, Herr Forkenbeck, aber wir müssen das Gespräch an dieser Stelle abkürzen. Ich bin sicher, Sie haben Verständnis dafür, dass hier weder der Rahmen noch die Gelegenheit für eine Grundsatzdiskussion –«
Karl wartete nicht ab, bis sie geendet hatte. Mit einem Ruck stand er auf. Der Sessel, in dem er gesessen hatte, rutschte nach hinten. »Ihre Entscheidung steht fest?«
Kortner blieb sitzen. »Ich habe bereits davon gehört, dass Sie hier im Haus so etwas wie einen Sonderstatus genießen, Herr Borchert. Es ist viel die Rede von Ihren brillanten Ideen. Ich habe mir Ihren Antrag deshalb sorgfältig angesehen. Aber ich kann nichts Brillantes daran entdecken.«
Ruhig sah sie ihn an. Karl hatte das Gefühl, dass sie es fast genossen hatte, ihm das zu sagen. Er war so perplex, dass Kortner schon weitersprach, bevor er sich gesammelt hatte.
»Mir ist durchaus bewusst, dass Ihre Laufbahn an diesem Institut mit unserer Ablehnung beendet ist. Und dass Sie erhebliche Schwierigkeiten haben werden, an einer anderen Stelle unterzukommen. Ebenso wie ich vollkommen verstehen kann, wenn Sie mit den herkömmlichen Herangehensweisen unserer Disziplin nicht zurechtkommen. Vielleicht aber«, fuhr sie fort, »sollten Sie sich dann überlegen, ob Philosophie überhaupt das Richtige für Sie ist.«
Karl fühlte, wie ihm die Luft abgedreht wurde. Sein Blick irrte ein letztes Mal zu Forkenbeck. Der saß an seinem Schreibtisch, die Augen nunmehr gänzlich erloschen.
Er musste raus hier – sofort.
»Orientieren Sie sich neu«, hörte er Kortner hinter sich herrufen, während Karl schon zur Tür stolperte. »Wenn Sie wirklich so brillant sind, dürfte Ihnen das doch nicht schwerfallen.«
4
Aus: »Als der Dämon sich entbarg. Unautorisierte Biographie Karl Borcherts«, Seite 18 ff.
»Nach der Enttäuschung, die Borchert mit den Klassikern erlebt hatte, schien eine grundlegende Frage unvermeidlich: War die Philosophie also nichts wert? Karl zögerte nicht, sich dieser Frage zu stellen. Ganz aus heiterem Himmel schien sie ja auch nicht zu kommen, hatte er im Laufe seines Studiums doch des Öfteren erlebt, wie sich andere über seine Disziplin als Zeitverschwendung, als Spiegelfechterei oder gar Scharlatanerie lustig gemacht hatten.
Borchert hatte sich immer dagegen gewehrt. War die Philosophie nicht eines der großen Menschheitsprojekte? Das jahrhunderte-, jahrtausendealte Streben nach Wahrheit, nach genauen Vorstellungen von Gerechtigkeit oder Schönheit – nichts als ein Irrtum, eine Täuschung, ein Wahn? Nein!, hatte Karl dagegengehalten, nichts anderes als dieses Streben hatte doch die unterschiedlichsten Forschungsrichtungen hervorgebracht, die unser Leben von Grund auf verändert hatten. Früher, ja, hatte er seine Widersacher dann spotten gehört, aber heute? War die Philosophie auch heute noch etwas wert?
Natürlich!, hatte er sich nicht unterkriegen lassen, wenn sie uns jahrtausendelang gute Dienste geleistet hat – warum sollte sie dann ausgerechnet jetzt ausgedient haben? War die Epoche, in der wir lebten, wirklich etwas so Besonderes? Nein! Es musste auch heute noch einen Platz für die Philosophie geben, dessen war Borchert sich immer sicher gewesen. Nur welchen? Das wusste er nicht.
Ein Ausflug in die Gegenwart seiner Disziplin, mit der ihn längst eine tiefsitzende Hassliebe verband, brachte ihn einen Schritt weiter. Musste er nicht, bevor er sich ein abschließendes Urteil erlaubte, wissen, was die Meisterdenker der Gegenwart zu sagen hatten?
Es waren genau drei Anläufe, die Borchert unternahm, um dieser Frage auf den Grund zu gehen. Als Erstes stürzte er sich auf die französischen Poststrukturalisten, auf die Texte von Foucault, Lacan und Deleuze, fuhr auch nach Paris und hörte Derrida und Baudrillard. Mit dem entmutigenden Ergebnis, dass er nach einem weiteren Jahr meinte feststellen zu müssen, auch in den Vortragssälen der Sorbonne und der École Normale Supérieure keine Antwort auf seine Frage gefunden zu haben. So berauschend die Beschreibungsorgien der Franzosen auch sein mochten, leisteten sie in seinen Augen doch nichts anderes, als ihren Lesern und Zuhörern im Rausch der Assoziationen das Gefühl vorzugaukeln, sie würden sich gleichsam selbst überwinden können. Das postindividuelle Zeitalter propagierten die Pariser Meisterdenker, aber nachdem sich Borchert nächtelang mit ihren Schriften herumgeschlagen hatte, war er sicher, dass es sich dabei nur um eine hohle Phrase handelte, ein verführerisches Luftschloss, das unweigerlich zusammenbrach, wenn man versuchte, dem vieldeutigen Geraune der Texte eine konkrete Handlungsanweisung, ein nachvollziehbares Denkschema oder auch nur eine einzige Feststellung zu entlocken, über die zwei unterschiedliche Menschen nicht unweigerlich in Streit geraten mussten. Dabei ahnte er nicht, wie nah die Gedanken der Franzosen seinen eigenen späteren Überlegungen schon gekommen waren.«
»Fuck, Kack, Scheiß, Dreck.«
Laut fluchend zog Karl den Rollcontainer unter seinem Schreibtisch hervor und ging die Schubladen von oben nach unten durch. Er machte sich nicht die Mühe, alle Papiere einzeln durchzusehen, sondern holte sie bündelweise aus den Schubfächern hervor und warf sie achtlos in einen Pappkarton, den er offen neben den Schreibtisch gestellt hatte. Kaum waren die Schubfächer leer, machte er sich an das Bücherregal an der Schmalseite des kleinen Raumes, der ihm in den letzten Jahren als Arbeitszimmer im Institut gedient hatte. Es war vollgestopft mit Bänden aus den unterschiedlichsten Bibliotheken der Universität. Hauptsächlich natürlich Philosophie, aber auch Zeichentheorie, Psychologie und Kognitionswissenschaften, Monographien aus dem Bereich der Spieltheorie, Zeitschriften über Phonetik oder Semantik, jede Menge Logik und generative Grammatik.
Karl warf die Bücher, die ihm gehörten, zu den anderen Sachen in den Pappkarton und stapelte die ausgeliehenen Bände auf dem Boden neben der Tür. Dann begann er, die Plakate abzulösen, die er in den drei Jahren seiner Assistententätigkeit an die Wände gepinnt hatte: Reproduktionen von Goya und Bacon, ein Druck von H.R. Giger, eine Fotoarbeit von David Hockney, aber auch Hinweise auf Symposien, Vortragsreihen, Ausschreibungen und Ringvorlesungen. Auch ein Kalender gehörte dazu, auf dem das ganze Jahr im Überblick zu sehen war. Er rollte ihn zusammen, warf ihn in den Karton und ließ sich in den Stuhl vor dem Schreibtisch fallen, den er für seine Besucher dort aufgestellt hatte.
Aus: »Als der Dämon sich entbarg. Unautorisierte Biographie Karl Borcherts«, Seite 20 ff.
»Auf den Ausflug in die französische Postmoderne folgte Borcherts Frankfurter Zeit. Habermas und seine Theorie des kommunikativen Handelns rückten ins Zentrum seiner Aufmerksamkeit: Der verzweifelte Versuch, die Bühne der Macht nicht gänzlich aufgeben zu müssen, trotz der Ohrfeige, die mit dem Zusammenbruch des Ostblocks jedes philosophische Bemühen um Politik, Staat und Gesellschaft hatte einstecken müssen. Praktisch nicht umsetzbar, lautete sein Fazit nach einem weiteren Jahr voller Kolloquien, Gespräche und Lektüren. Praktisch nicht umsetzbar, obwohl doch gerade die Praxis das Forum war, in dem die Habermasschen Ideen sich zu bewähren hatten, sofern man nur ihre eigenen Ansprüche ernst nahm.
Die Enttäuschung reichte tief. Monatelang haderte Borchert mit seinem Fach, ehe er sich zu einem dritten, einem letzten Anlauf durchrang, mit dem er versuchen wollte, die Hoffnung, die er einst in die Philosophie gesetzt hatte, doch noch zu retten. Das brachte ihn mit der analytischen Philosophie in Berührung, einer Richtung, die auf ihre Wissenschaftlichkeit besonders stolz war und ihn zunächst auch im Handumdrehen mit seinem Fach wieder versöhnte. Binnen Wochen erwachte sein Enthusiasmus neu, und er brach auf zu einer Erkundungsreise in eine Welt, die bereits zu Beginn des letzten Jahrhunderts von Frege und Russell entdeckt, von Wittgenstein durcheinandergewirbelt und seitdem in endlosen Verfeinerungen weiter ausgearbeitet worden war. Der große Unterschied zu den Klassikern: Hier erfand nicht jeder Philosoph seine eigene Sprache, hier bemühten sich alle darum, die gleichen Ausdrücke zu verwenden.
In langen Nächten erarbeitete sich Borchert das Vokabular der Analytiker, kämpfte sich durch die Logiklehrbücher von Tarski bis Quine, studierte die Texte ihrer Schüler von Davidson bis Lewis, und fand umso mehr Gefallen an dem analytischen Ansatz, je besser er ihn kennenlernte. Bis er eher zufällig auf die Fleißarbeit eines Mannes stieß, der – genau wie er selbst, nur etwas früher – mit Begeisterung das Projekt der analytischen Philosophie aufgegriffen, nach Jahren des Forschens jedoch innegehalten und einmal untersucht hatte, ob sich anhand ihrer wichtigsten Publikationen eine Weiterentwicklung feststellen ließ. Ob es also möglich war, einen inhaltlichen, historischen Fortschritt innerhalb der analytischen Philosophie zu belegen, die zum Zeitpunkt seiner Untersuchung immerhin schon ein gutes Jahrhundert auf dem Buckel gehabt hatte.
Und das erstaunliche, niederschmetternde Ergebnis: Es war kein stetes Voranschreiten, kein langsames, aber beständiges Vorankommen erkennbar. Nein, es gab nichts als eine Abfolge von Moden, von Trends. Eine willkürliche Sukzession von Vorlieben, wo das streng wissenschaftliche Aufeinanderfolgen belegbarer Ergebnisse und daraus resultierender, neuer Fragen hätte stehen müssen. Betrachtete man, was die Adepten dieser Tradition über die Jahrzehnte hinweg vorgelegt hatten, so zeigte sich, dass sie keineswegs der Lösung eines Problems ständig näher gekommen waren, obwohl es doch genau das war, was sie zu tun vorgaben. Gerade durch diesen Fortschrittsglauben unterschieden sie sich doch letztlich von allen anderen Philosophen! Sie wollten nicht raunen wie die Dichter, sie wollten sich der Wahrheit nähern wie Wissenschaftler. Tatsächlich aber hatten sie sich mitnichten auf ein Ziel zubewegt, wie ein Blick in die Geschichte ihrer Bemühungen unzweideutig zeigte. In all ihren grundlegenden Fragen – Wie funktioniert die Bedeutung eines Wortes?, Wie können wir uns den geistigen Zustand des Beabsichtigens vorstellen?, Was ist eine gerechte Verteilung? – war keineswegs Klarheit eingekehrt, vielmehr herrschte genau die gleiche Verwirrung wie vor hundert Jahren. Es gab keinen Fortschritt! Damit aber auch nichts, wodurch sich die Bemühungen der analytischen Philosophen von denen einer jeden anderen Strömung hätten unterscheiden lassen.«
Das Handy vibrierte leise und drehte sich ein wenig im Kreis. Karl beugte sich vor und sah aufs Display. Tamara. Natürlich. Sie wollte wissen, wie es gelaufen war. Ob für heute Abend alles in Ordnung war. Er starrte auf das Gerät, das er auf die Schreibtischplatte gelegt hatte, bis es sich wieder beruhigt hatte. Kurz darauf kündigte ein Signalton an, dass Tamara ihm eine Nachricht hinterlassen hatte.
Karl lehnte sich zurück. Sein Blick wanderte zum Fenster. Mit der Ablehnung durch die Forschungsgemeinschaft war klar, dass sie auch seinen Vertrag am Institut nicht verlängern würden. Einen Lehrauftrag hatte er dieses Semester ohnehin nicht mehr gehabt. Forkenbeck hatte gemeint, dass Karl sich ganz auf die Ausarbeitung seines Forschungsvorhabens konzentrieren sollte.
Ruckartig stand Karl auf und faltete den Deckel des Pappkartons zusammen. Wer zum Teufel sollte ihm jetzt noch eine Stelle anbieten? Wenn sich erst mal herumgesprochen hatte, dass ihm die Forschungsgelder verweigert worden waren, würde keine andere Universität es wagen, ihn noch anzustellen. Zu sehr hatte er seinen Namen mit diesem Projekt verknüpft, zu oft und nachdrücklich wiederholt, dass er außerhalb seines Projektes keine sinnvolle Aufgabe im Gebiet der Philosophie mehr erkennen könnte.
Er wuchtete den Karton hoch und ließ den Blick ein letztes Mal durch das kleine Arbeitszimmer schweifen. Wie hatte er bloß sein ganzes Leben an der Vorstellung und Hoffnung ausrichten können, eine bahnbrechende Entdeckung zu machen? Wie hatte er nur an der Philosophie festhalten können, nachdem er doch immer wieder zu der Einsicht gelangt war, dass sie nichts taugte und ihn nur stets aufs Neue enttäuschen würde. Wie ein Besessener hatte er an ihr festgehalten, beseelt von der Idee, mit ihr eine Entdeckung machen zu können, die mit einem Schlag aufzeigen könnte, was falsch war an dem Weltbild, in dem wir lebten. Wie hatte er nur darauf kommen können, dass es ausgerechnet ihm beschieden sein würde, eine solche Entdeckung zu machen?
Aus: »Als der Dämon sich entbarg. Unautorisierte Biographie Karl Borcherts«, Seite 23 ff.
»Nachdem sich die Hoffnung wieder zerschlagen hatte, die Borchert durch die Begegnung mit der analytischen Philosophie kurzzeitig geschöpft hatte, sah er sich erneut seiner alten Frage ausgeliefert: War die Philosophie nichts mehr wert? Und davon abgeleitet: Hatte er umsonst noch einmal viele Jahre in sie investiert? Oder konnte es sein, dass es nun an ihm war, sie zu retten, nachdem es allen anderen nicht gelungen war?
Ein ganzes Jahr gab er sich, um diesen Fragen nachzugehen. Er quartierte sich in einem alten Bauernhof ein, den seine Großeltern vor etlichen Jahren gekauft und umgebaut hatten, und verbrachte die Zeit damit, ausgedehnte Wanderungen in der Umgebung zu unternehmen, in einem See in der Nähe zu baden und sich an lauen Abenden auf einem offenen Feuer vor dem Haus sein Essen zuzubereiten. Absichtlich vermied er es – wie er mir später einmal erzählte –, auch nur einen Gedanken an die Philosophie zu verschwenden. Es gab kein Telefon in der Hütte, keinen Internetanschluss, er hatte kein Handy und auch keine Bücher mitgenommen – nur ein wenig Papier und ein paar Stifte.
Es war Winter und das Jahr beinahe um, als Karl schließlich eine Entscheidung traf. An den langen Abenden des Spätherbstes hatte er in den Schränken der Hütte gestöbert und war auf ein altes Tagebuch seines Großvaters gestoßen. Darin hatte sein Großvater, der wie Karls Vater Christian Arzt gewesen war, vermerkt, dass sich ihm mit zunehmendem Alter vor allem eine Frage aufdrängen würde, die alle anderen Geheimnisse, Forschungsfelder und Phänomene, die den Menschen umgäben, doch überstrahlen würde: die Frage nach dem Funktionieren der Sprache. Darin habe ihn gerade erst neulich auch wieder sein Sohn Christian bestärkt.
So unscheinbar die Notiz auch war – sie ging Karl für die restlichen Wochen, die er noch in den Bergen verbrachte, nicht mehr aus dem Kopf. Und er entschied, dass er genau dort ansetzen würde. Bei der Sprache. Er würde die Rahmenbedingungen für die Evolution einer Sprache schaffen. Dies war der Grundgedanke zu dem Projekt, das ihm von der Forschungsgemeinschaft schließlich abgelehnt wurde, nachdem er unter Forkenbecks Schirmherrschaft vier Jahre lang daran gearbeitet hatte.
Diese Ablehnung aber war – wie wir heute wissen – der Auslöser für das, was als sogenanntes ›Viertes Paradigma‹ bekannt geworden ist und was Borcherts Traum von einer radikal umwälzenden Philosophie auf ganz überraschende Weise doch noch einlösen sollte.«
5
Mit seinem Pappkarton auf dem Arm verließ Karl das Institut und trat auf die Straße. Es war bereits dunkel, und ein Nieselregen hatte eingesetzt. Er ging um das Gebäude herum zu dem Park, an dem er seinen Wagen abgestellt hatte. Der Regen bestäubte sein Gesicht. Die Finger, mit denen er den schweren Karton gegen seinen Oberkörper presste, wurden rasch kalt.
Als er sein Auto erreicht hatte, stellte er den Karton auf die Kühlerhaube und holte den Schlüssel aus der Tasche seiner Jeans, um den Kofferraum aufzuschließen. Im selben Moment spürte er, dass er nicht allein war.
Karl fuhr herum. Ein Mann kam durch die Dunkelheit auf ihn zu. Die nächste Straßenlampe befand sich hinter dem anderen, so dass Karl ihn nur als Silhouette im Gegenlicht sah.
»Herr Borchert?«
Unwillkürlich hatte Karl jeden Muskel in seinem Körper angespannt. »Was wollen Sie?« Es kam heftiger heraus, als er es sich gewünscht hätte.
»Es …« Der Mann zögerte – und da erkannte Karl ihn. Es war Forkenbeck.
»… es tut mir leid, wirklich. Sie müssen mir glauben.«
Karl atmete durch. Wie hatte ihm der alte Mann einen derartigen Schrecken einjagen können? Er musste mit den Nerven völlig am Ende sein.
»Was machen Sie denn hier, Professor?« Karl lachte erleichtert auf und wandte sich erneut der Heckklappe zu.
»Ich habe Sie an meinem Arbeitszimmer vorbeilaufen sehen«, hörte er Forkenbeck hinter sich sagen. »Aber Sie waren völlig in Gedanken.«
Karl holte den Karton von der Kühlerhaube, warf ihn in den kleinen Laderaum des Cabrios und schlug die Heckklappe zu. »Wundert Sie das?« Er wandte sich zu Forkenbeck um, dessen Gesicht noch immer im Dunkeln lag.
»Ich kann die Ablehnung nicht verstehen«, sagte Forkenbeck und schüttelte den Kopf. »Ich halte Ihren Ansatz nach wie vor für äußerst überzeugend.«
Karl nickte dem Professor zu. »Danke.« Nach dem, was passiert war, wollte er sich allerdings nicht länger aufdrängen. Forkenbeck hatte schon genug für ihn getan. »Ich …«, er machte eine linkische Handbewegung, »ich werd dann mal.«
Doch Forkenbeck schien noch etwas auf dem Herzen zu haben. »Haben Sie kurz Zeit?«, fragte er. »Nur eine Kleinigkeit, aber vielleicht sollten wir am besten gleich darüber sprechen.«
»Jetzt, hier? Es regnet, Professor.« Karl lächelte. »Es war ein langer Tag. Ich komme morgen bei Ihnen vorbei, in Ordnung? Gleich nach der Vorlesung. Dann können wir in Ruhe reden.«
Aber zu seiner Überraschung ging Forkenbeck darauf nicht ein. »Morgen nach der Vorlesung habe ich einen Termin«, meinte er. »Aber vielleicht kommt es ja sowieso nicht für Sie in Frage.«
»Was denn?«, unterbrach Karl ihn nun doch neugierig.
»Ich habe vorhin mit Leonard Habich telefoniert«, hörte er Forkenbeck sagen.
Habich? Karl stockte. »Wie? Habich?« Für einen Moment schwindelte ihm.
»Sie kennen ihn?«
»Ja – das heißt, nein. Begegnet bin ich ihm nie. Aber ich habe ein paar seiner Sachen gelesen.«
Karl sah, wie Forkenbeck den Kragen seines Mantels hochschlug, um sich besser vor dem Regen zu schützen. »Und? Würde es Sie interessieren, Habich einmal kennenzulernen?«
Karl starrte die schwarze Silhouette vor sich an. »Ja, sicher … Es ist nur … soweit ich weiß, ist der Mann seit fast 30 Jahren nicht mehr öffentlich aufgetreten.«
Aus: »Abschlussbericht der Kommission zur Untersuchung der Ereignisse am 6. und 12. Oktober 2012 in Urquardt«, Innenministerium des Landes Brandenburg, Anlage H: Aussage von Lara Kronstedt, S. 612–614
»Vorsitzender: Haben Sie mit Karl Borchert darüber gesprochen, was er von Habich wusste, bevor er ihm auf Urquardt begegnet ist?
Kronstedt: Er erwähnte einmal, dass er seinen Namen zum ersten Mal als Student gehört hätte, in einem Seminar über Wahrheitstheorien.
Vorsitzender: Können Sie das näher erläutern?
Kronstedt: Ein Kommilitone hat ihn wohl auf einen Aufsatz Habichs aufmerksam gemacht. Das Thema hatte ihn interessiert –
Vorsitzender: Welches Thema?
Kronstedt: Ich glaube, es ging um die Semantik möglicher Welten. Karl hat sich den Aufsatz in der Bibliothek besorgt und war sehr angetan. Als er herausbekam, dass Habich erst 17 Jahre alt gewesen war, als er ihn publiziert hatte, muss ihn das schwer beeindruckt haben. Karl selbst war immer sehr stolz darauf gewesen, seinen ersten Aufsatz bereits im Alter von 23 Jahren veröffentlicht zu haben. Und nun zeigte sich, dass Habich bei seiner ersten Publikation nicht nur sechs Jahre jünger gewesen war, sondern dass sein Aufsatz, der 1962 erschienen war, auch 2004 noch, als Karl darüber stolperte, durchaus lesenswert war. Das hat ihm keine Ruhe gelassen. Drei Tage lang hat er gebraucht, um alle Publikationen, die bis dahin von Habich erschienen waren, in den diversen Datenbanken, Bibliotheken und Zeitschriften ausfindig zu machen. Dabei ist er, wie er mir erzählte, auf eine Reihe von hoch technischen Veröffentlichungen gestoßen, die sich durch ihren Einfallsreichtum von allen vergleichbaren Arbeiten abhoben.
Vorsitzender: Hat Herr Borchert Ihnen gesagt, was für Publikationen das waren?
Kronstedt: Pfff … also … das klingt für mich oftmals alles gleich … lassen Sie mich überlegen … es waren vor allem Aufsätze zur Semantik, aber es ging auch um Deliberationstheorie, um eine verhandlungstheoretische Begründung der Verteilungsgerechtigkeit … am meisten muss ihn jedoch Habichs Forschung auf dem Gebiet der Spieltheorie interessiert haben, weil sie am ehesten das berührte, womit Karl sich damals selbst beschäftigte.
Vorsitzender: Das Buch über die Gedankenexperimente kannte er demnach nicht?
Kronstedt: Nein, das heißt, nicht wirklich. Karl sagte, er hätte es natürlich angefangen zu lesen, aber der hohe Formalisierungsgrad hätte ihn abgeschreckt. Ihm sei sehr schnell klargeworden, dass es Monate dauern würde, bis er auch nur im Ansatz begriffen hätte, was Habich darin darzulegen versuchte. Auch die Rezensionen, die er sich herausgesucht hatte, hätten ihm nicht weitergeholfen, meinte er. Die jeweiligen Autoren hätten sich darauf beschränkt, nur den einen oder anderen Teilaspekt des Buches herauszugreifen, keiner sich jedoch zugetraut, eine umfassende und abschließende Bewertung vorzulegen.
Vorsitzender: Er hat es also beiseitegelegt?
Kronstedt: Das hat er mir zumindest gesagt.
Vorsitzender: Hat er Ihnen auch gesagt, ob er Herrn Habich vor ihrem Treffen im Oktober 2012 schon einmal begegnet war?
Kronstedt: Ja, natürlich. Das war ja etwas, worüber sich Karl nicht aufhören konnte, zu wundern: dass er Habich nie begegnet war. Weder an der Uni in Berlin noch auf einem der verschiedenen Kongresse, an denen er seit 2006 teilgenommen hatte. Allerdings wusste er, dass sich Habich bald nach seiner Habilitation – wann war das? ’76? ’77? Vor etlichen Jahren jedenfalls an eine kleine Universität in England zurückgezogen hatte.
Vorsitzender: Wusste Herr Borchert denn, mit welchen Themen sich Professor Habich seit der Veröffentlichung seines Buches vornehmlich beschäftigt hatte?
Kronstedt: Als wir darüber sprachen, meinte er, es wären allerhand Gerüchte darüber im Umlauf gewesen, Genaueres hätte jedoch niemand gewusst. Die einen hätten behauptet, dass Habich sich auf die Grundlagen der künstlichen Intelligenz gestürzt, andere, dass er begonnen hätte, an einer Philosophie der Psychologie zu schreiben. Wissen taten jedoch alle nur eins: dass Habich seit 1983 nicht mehr unterrichtet hatte.«
»Die Sache ist die«, fing Forkenbeck umständlich an. »Er glaubt –«
»Wer? Habich?« Karl musste lachen. Bis eben hätte er sich nicht einmal gewundert, wenn er erfahren hätte, dass es einen Mann namens Leonard Habich in Wirklichkeit gar nicht gab. Dass es sich bei dem Namen vielmehr um ein Pseudonym handelte, unter dem eine ganze Gruppe von Logikern publizierte, um sich einen Spaß mit der Wissenschaftsgemeinschaft zu erlauben.
Forkenbeck nickte. »Habich ist davon überzeugt, in den letzten Jahren einen vielversprechenden Neuanfang geschafft zu haben. Jahrelang, so hat er mir das gesagt –«
»Sie kennen ihn persönlich?«, unterbrach Karl ihn erneut.
»Ja, wir haben zusammen studiert«, antwortete Forkenbeck. »Wir haben uns ’67 in München kennengelernt, viel Zeit miteinander verbracht. Sein Denkstil hat mich schon immer fasziniert.«
Er sah auf, und Karl bemerkte, dass ein schwacher Lichtschein auf Forkenbecks Gesicht gefallen war. In dem Haus, vor dem sie standen, musste jemand ein Licht angeschaltet haben.
»Das kann ich verstehen«, murmelte Karl. Er war instinktiv ein wenig zusammengezuckt, denn in dem spärlichen Widerschein war ihm das Gesicht seines Mentors plötzlich merkwürdig bleich und ausgemergelt erschienen. Dabei hätte Karl gar nicht zu sagen vermocht, ob es an der regnerischen Nacht, dem fahlen Licht oder der späten Stunde lag. »Was ich von Habich bisher gelesen habe, war schon interessant«, fuhr er fort, ohne sich etwas anmerken zu lassen.
»Er hat in den vergangenen Jahren eine Menge Aufzeichnungen angefertigt, aber bisher keine Gelegenheit gehabt, seine Überlegungen zu einem Buch zusammenzufassen«, meinte Forkenbeck. »Und er fürchtet, dass ihm dazu auch nicht mehr die nötige Zeit bleiben wird.«
»Ist er krank?«
»Nicht, dass ich wüsste. Es kann ja tausend Gründe dafür geben. Vielleicht fühlt er seine Konzentrationsfähigkeit schwinden, vielleicht will er lieber voranschreiten, als innezuhalten und das Gesammelte zu sortieren. Fest steht, dass er mich gebeten hat, ihm jemanden zu schicken, der sich um seinen Vorlass kümmern kann.«
»Seinen ›Vorlass‹?«
»Ja, Vorlass. Eine Art Nachlass zu Lebzeiten, verstehen Sie?« Forkenbecks Augen huschten über Karls Gesicht, als suchten sie dessen Zustimmung. »Er sucht jemanden, der seine Aufzeichnungen aus den letzten Jahren durchgeht, unterschiedliche Fassungen auswertet, auch Wichtiges von Unwichtigem trennt. Ich habe gleich an Sie denken müssen.«
»Wieso das denn?«, entfuhr es Karl.
»Sie arbeiten auf ähnlichem Gebiet.«
»Sprachtheorie.«
Forkenbeck nickte. »Und angrenzende Disziplinen. Nageln Sie mich jetzt bloß nicht fest. Habichs Interessen waren immer breit gestreut. Das Letzte, was ich von ihm gelesen habe, war eine Theorie der Religion. Das hatte mit Sprache nicht das Geringste zu tun. Und doch war es hochinteressant, das können Sie mir glauben.«
Karl studierte die scharfkantigen Züge seines Professors. Die alten Akten eines Kollegen sortieren – konnte das nicht jemand anders erledigen? Sicher, es reizte ihn schon, den Mann einmal kennenzulernen. Jedoch: Würde ihn das in seinen eigenen Fragen wirklich weiterbringen? Eher nicht. Und zu einem Epigonen eines verschrobenen Kollegen zu werden, hatte er eigentlich nie vorgehabt.
»Das ist sehr schmeichelhaft, dass Sie an mich gedacht haben, Professor …«, sagte er und spürte, wie seine Stimme schon verriet, dass er nicht wirklich begeistert war. »Ich habe allerdings überhaupt keine Erfahrung mit dem Sichten von Nach- oder Vorlässen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin Ihnen für das Angebot wirklich sehr dankbar. Aber sollten Sie nicht lieber einen Kollegen fragen, der sich bei der Herausgabe von Schriften sicherer fühlt?«
»Unsinn.« Forkenbecks Augen schauten ihn aus dem matten Widerschein heraus aufmerksam an. »Was glauben Sie denn? Ich habe mir das gut überlegt. Was Habich in den letzten zwanzig, fünfundzwanzig Jahren gemacht hat, ist eine vollkommen eigenwillige Art des Forschens. Da kann ich nicht einen x-beliebigen Doktoranden dransetzen.« Er zog die Augenbrauen zusammen. »Ihre Arbeit hat sich bisher immer dadurch abgehoben, dass Sie Ihre ganz eigenen Wege gegangen sind, Borchert. Und das hat Habich auch so gemacht. Das ist ein ganz besonderer Stil des Forschens. Sie lassen sich nicht sagen, was im Moment interessant ist, Sie definieren selbst, was Sie interessiert. Nicht zuletzt ist das ja auch der Grund dafür, dass diese etwas vernagelten Kollegen von der FG Ihren Antrag abgelehnt haben. Es war denen einfach zu riskant, Sie bei diesem Ausflug zu begleiten. Es fehlten ihnen die altbekannten Referenzpunkte, und das macht ihnen Angst. Das Gleiche hätte ihnen auch mit Habich passieren können. Dort, wo er hingeht, gibt es keine Referenzpunkte. Dort wird sozusagen das weiße Gebiet auf der Landkarte der Philosophie neu vermessen, verstehen Sie?«
Karl fiel auf, dass Forkenbecks Augen regelrecht glänzten. Er hatte zwar gewusst, dass sein Professor große Stücke auf ihn hielt – dass er eine so hohe Meinung von seiner Arbeit hatte, überraschte Karl nun aber doch.
»Dabei ist so ein Forschen auch nicht ganz ungefährlich«, fuhr Forkenbeck fort.
»Was soll denn an Philosophie gefährlich sein?« Karl musste grinsen. »Am freien Spiel der Gedanken hat sich bisher ja noch keiner geschnitten. Oder meinen Sie etwa die Gefahr, die einen Giordano Bruno auf den Scheiterhaufen gebracht hat, als er mit seinen Gedanken den Zorn der Mächtigen hervorgerufen hat?«
Forkenbeck machte einen Schritt auf ihn zu. »Nein, die meine ich nicht.« Seine Augen waren durch den Schritt aus dem Lichtschein des Fensters herausgerückt, so dass Karl statt der Pupillen nur noch die dunklen Augenhöhlen sah, aus denen heraus Forkenbeck ihn anstarrte, während er weitersprach. »Bei Habich geht’s um was anderes. Er hat eine Pforte aufgestoßen, die er vielleicht nicht mehr zubekommt.«
Unwillkürlich zog Karl die Schultern hoch. Pforte? Hatte er richtig gehört? Es erschien ihm so abwegig, dass er in dem Moment, in dem Forkenbeck zu Ende gesprochen hatte, bereits glaubte, er hätte nur geträumt, was der andere gesagt hatte. »Pforte, sagten Sie?«
Forkenbeck stand jetzt dicht vor ihm, das schüttere Haar durch den Nieselregen zu feuchten Strähnen verklebt. Seine mageren Hände hatte er um den Kragen des Mantels gekrallt und das Kinn nach vorne gestreckt.
»Das … das kann doch nicht Ihr Ernst sein, Professor«, stammelte Karl. Er hatte Forkenbeck als nüchternen Verteidiger der Vernunft kennengelernt und sich nicht zuletzt deshalb stets an ihn gehalten. Doch wie er ihn jetzt vor sich sah, kam er ihm wie ausgewechselt vor.
»Verstehen Sie mich denn nicht, Karl?«, drang die Stimme seines Gegenübers leise zu ihm herüber. »Haben Sie denn in all den Jahren, die Sie nun schon der Philosophie gewidmet haben, nie den Reiz der sagenhaften Versprechungen verspürt, die sie uns macht? Die heute vielleicht verschüttet sind, ursprünglich jedoch die Faszination ausmachten, die von ihr ausging? Sie verspricht uns Erfahrungen und Überraschungen, die alles, was jede andere Wissenschaft erreichen kann, weit in den Schatten stellen. Erkenntnisse und Eingebungen, die all das, was uns bisher sicher und wahr scheint, regelrecht auf den Kopf stellen können.«
Und plötzlich sah Karl die glühenden Pupillen des Alten direkt vor sich.
»Und damit meine ich keinen kopflosen Hokuspokus aus dummen, esoterischen Kreisen«, fuhr Forkenbeck fort. »Ich spreche vom Herzen unserer Kultur, von einer Tradition, die noch nie darauf aus war, den Geist zu benebeln, sondern der es immer darum ging, das Licht der Vernunft erstrahlen zu lassen, wenn Sie wissen, was ich meine. Es weiter zu bringen, weiter hinaus in die Welt, tiefer hinein in uns selbst.«
Er griff nach Karls Arm und zog ihn zu sich hinunter. »Es ist die Aufklärung, mein Freund«, flüsterte er jetzt dicht vor ihm, »aber die Aufklärung ist nicht nur Licht, sondern auch Schatten. Haben Sie sich nie vor diesem Schatten gefürchtet – vor der Fratze, die darin lauert? Sie ist es, die hinter all den Anstrengungen der Meisterdenker verborgen ist, die uns wie ein heimlicher Magnetismus immer weiter hinaustreibt in unserem Bestreben, die Erkenntnis zu erweitern. Und die Habich hofft, endlich entschleiern zu können. Eine Vorstellung, die ihm zugleich aber auch einen heiligen Schrecken einjagt.«