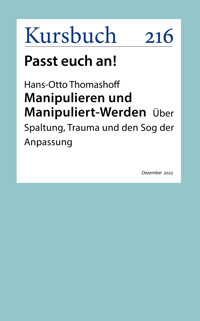15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
Ich fühle, also bin ich
Kann ein Leben gelingen? Lässt sich dieses Grundrätsel der menschlichen Existenz überhaupt lösen? Gibt es Ratschläge aus der Wissenschaft, die wir bei unserer Lebensgestaltung beachten sollten? Ja: Nicht Geld, nicht Leistung, nicht Dauerspaß sind wichtig für ein erfülltes Leben. An erster Stelle stehen gute Beziehungen, die Erfahrung, aktiv selbst etwas verändern zu können, ein gesunder Stresshauhalt und ein Gefühl von Stimmigkeit. Bewiesen haben das die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung, aus denen hervorgeht, wie wenig die gemeinhin verfolgten Lebensziele tatsächlich bedeuten. Um tatsächlich Glück zu empfinden, sind wir gefordert, radikal umzudenken, denn der Psychiater Hans-Otto Thomashoff zeigt, wie stark wir von Emotionen bestimmt werden – und wie wir sie nutzen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 317
Ähnliche
ICH FÜHLE, ALSO BIN ICH
Die jüngsten Ergebnisse der Hirnforschung kommen einer kleinen Revolution gleich. Aus Sicht des Gehirns läuft das Leben als Lernprozess in andauernder Wechselwirkung mit der Umwelt ab. Es hat sich herausgestellt, dass für ein gelingendes Leben vier Säulen entscheidend sind: gute Beziehungen, aktives Bewirken, ein gesunder Stresshaushalt und Kohärenz, also das Gefühl von Stimmigkeit. Werden diese vier Aspekte beachtet, fühlen wir uns pudelwohl.
Die wichtigste neurowissenschaftliche Erkenntnis dabei ist: Wir haben immer mehr Stress, und der macht uns krank. Sein Gegenspieler ist das Bindungs- und Liebeshormon Oxytocin. Von ihm brauchen wir viel mehr, als wir uns in unserem Alltag gönnen. Dabei wäre es so einfach, das zu ändern.
Wie also kann uns die Hirnforschung helfen, unser eigenes Leben besser zu leben?
Wir müssen die Funktionsweise des Gehirns verstehen, die Einflüsse kennenlernen, die es prägen, allen voran seine Abhängigkeit von der Umwelt und seine enorme Bindungsfähigkeit. Forschungen beweisen, dass Liebe unsere Gesundheit wirksamer schützt als jede andere Maßnahme. Wenn wir dafür sorgen, dass wir ein liebevolles Miteinander pflegen und unseren Lebensentwurf selbst gestalten, werden wir immer wieder Momente des kleinen Glücks erleben – eine simple, aber wirksame Empfehlung damit das Leben gelingt.
Ein erfülltes Leben ist keine Hexerei, sondern wir selbst können die Grundlagen dafür schaffen. Das untermauert Hans-Otto Thomashoff mit vielen Beispielen, vor allem auch aus seiner eigenen Lebenspraxis.
HANS-OTTO THOMASHOFF
Das
gelungene
Ich
Die vier Säulen der Hirnforschung für ein erfülltes Leben
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.ddb.de abrufbar.
© 2017 Ariston Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28,
81673 München
Alle Rechte vorbehalten
Redaktion: Regina Carstensen
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie, Zürich
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN: 978-3-641-19755-1V001
Wem, wenn nicht dir
Sich selbst zu kennen ist nicht einfach.
Doch es ist die Basis für ein gut funktionierendes Gehirn.
Peter C. Whybrow
Inhalt
Einleitung
I Wie wir werden, wer wir sind – Grundlagen der Hirnforschung
1 Der Aufbau der Psyche im Gehirn – wie aus Biologie und Chemie unser Lebensentwurf entsteht
Ohne Umwelt sind wir nichts •Vererbte Angst •Was uns der kleine Mann im Kopf erzählt – Leben als Erleben •Die Macht der Schablonen •In Morpheus’ Armen •Wie die Vielfalt unserer Bindungen unser Gehirn wachsen lässt •Das Sonnensystem unseres Denkens •Die Geburt der wahren Liebe •Spielarten der Lust •Leben ist Gefühl •Sind wir flexibel, und wenn ja, wo? •Und wo nicht? •Wie kommen Meeresschnecken ins Gefühl? •Wenn die Angst in den Knochen sitzt und wie wir sie loswerden
2 Bindung – Warum, wann und wie Beziehungen wirken
Wie du mich zu dem machst, der ich bin •Berührungen sind Muttermilch für die Psyche •Wenn Schreien nicht gehört wird •Die Entdeckung der feinfühligen Mutter •Ein Trampelpfad im Dschungel •Es liegt an uns, wie unsere Kinder werden – und damit die Menschheit der Zukunft •Warum die Wiedergeburt rückwärts verläuft •Geburt ins Leben vor dem Tod •Die Wirkung von Bindung im Gehirn •Wundermittel Nähe •Depression und das Trauma früher Trennung •Ich, Du oder besser: Du, Ich •Wenn die Gefühle in Kinderschuhen stecken bleiben •Dank Empathie kann der andere in uns auch Hund oder Katze sein •Impulskontrolle für Anfänger •Die dunkle Seite des Spiegels •Viele neigen zur Spaltung •Freuden und Fallstricke der Partnerwahl •Einsicht ist nur das Popcorn – der Film läuft woanders
3 Bewirken – Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es
Was uns antreibt •Motivation ist das Salz in der Suppe •Das absolute Hoch im Flow
4 Stress – Wann wir ihn brauchen und wann er uns verbraucht
Stress, mal gut, mal nicht •Der Botenstoff des Erfolgs •Stress, Stress und kein Ausweg?
5 Kohärenz – Was stimmt, das stimmt, oder eben nicht
Die Sinnfrage •Über den Aha-Effekt zum Genuss •Wie Stadtpläne und Coca-Cola den Weg in unser Gehirn finden •Unbewusste Verwandlung der Persönlichkeit •Pessimisten leben länger •Kein Kopf ohne Bauch
6 Was das Leben mit uns macht und wir mit ihm
Die Kultur in uns •Warum wir die rosarote Brille so lieben •Die bunte Welt der Vernetzungen •Ohne dich bin ich nichts •Vom Gefühl zum Verstand •Die Wuthürde •Die Sache mit den Marshmallows •Abstraktion – oder gleichzeitig essen und reden •Veronika, der Lenz ist da •Wer wird wie erwachsen, wenn überhaupt •Wer nicht alt werden will, muss jung sterben oder jung bleiben
II Von der Theorie in die Alltagspraxis
7 Die vier Säulen für ein gelingendes Leben
Säule I: Beziehungen
Wie gute Beziehung wirkt •Beziehungsfallen •Die Zauberformel für ewige Liebe •Mit dir und nur mit dir •Dogge oder Hirschkalb? Warum gerade du? •Du in mir, ich in dir •Wie Liebe heilen kann •Von der Selbsterkenntnis zu erfülltem Sex •Wie sich wo die Lust regt •Was ich dir schon immer sagen wollte •Vom kleinen Zwist zum großen Knall •Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende •Liebe heute •Achtung! Dein PC kann nicht Spiegeln
Säule II: Bewirken
Sein schlägt Haben – immer noch •Die Eroberung unseres eigenen Lebens •Von anderen Welten •Wenn der große Kick ausbleibt, tut es auch der kleine
Säule III: Stressausgleich
Dauerstress macht krank •Was passiert, wenn der Stress zu viel wird •Gefühle erkennen und nutzen •Wenn Wut guttut oder Traubenzucker eine Ehekrise verhindert •Mit Liebe und Motivationsbonbons •Mach mal Pause
Säule IV: Stimmigkeit
Das Phänomen des automatischen Miteinanders •Von Sinn und Unsinn •Gemeinsam schwingen wir uns auf das Sahnehäubchen •Gerechtigkeit und der Umgang mit Drückebergern
8 Vom Gehirn in die Gesellschaft und zurück
Zeit für eine Revolution, sanft und radikal •Wider den Starrsinn •Mit dir ist mein Leben lebenswert •Richtige Anreize fürs Gehirn – das beste Anti-Aging •Eine hirngerechte Gesellschaft ist für den Menschen da •Warum wird uns das nicht beigebracht? •Warum es »Känguru-Babys« besser haben •Lasst Horst mit seinen Träumen nicht allein
Hier und Jetzt
Literatur und Links
Einleitung
Wie kann ein Leben gelingen? Lässt sich dieses Grundrätsel der menschlichen Existenz überhaupt lösen? Noch dazu objektiv? Gibt es also klare Ratschläge aus der Wissenschaft, worauf wir in unserer Lebensgestaltung achten sollten? Die Antwort auf diese Fragen lautet eindeutig: Ja. Aber wie können die spröden wissenschaftlichen Erkenntnisse den Weg in unseren Alltag finden?
Zum Glück hat die Hirnforschung ihren Elfenbeinturm verlassen und liefert zusammen mit den in der klinischen Arbeit gewonnenen Erfahrungen aus Psychoanalyse und Psychotherapie konkrete und brauchbare Handlungsempfehlungen für den Weg in ein gelingendes Leben. Unterm Strich bleibt zwar jeder von uns der Schmied seines eigenen Glücks, doch gibt es längst neurobiologisch fundierte Ratschläge, was uns dabei helfen kann.
Gleich vorweg: Die jüngsten Ergebnisse der Hirnforschung sind im wahrsten Sinne des Wortes revolutionär. Sie stellen das in unserer Gesellschaft propagierte Wertesystem auf den Kopf: Nicht Geld, nicht Leistung, nicht Dauerspaß sind die wichtigsten Säulen für ein zufriedenes Leben. Nein, an erster Stelle steht die Qualität der von uns gelebten Beziehungen. Kommen dazu noch die Erfahrung, aktiv selbst etwas gestalten zu können, ein ausgeglichener Stresshaushalt und zu guter Letzt die Erfüllung unseres Bedürfnisses nach Kohärenz, das heißt nach einem Gefühl von Stimmigkeit – wir wissen Bescheid, wir kennen uns aus, es passt –, dann haben wir die vier für unser Leben entscheidenden Säulen vor uns. Das bedeutet: Ein erfülltes Leben ist keine Hexerei. Sondern wir selbst können die Grundlagen dafür schaffen.
Doch wie geht das im Einzelnen? Die Philosophie hat diese Frage seit ihren Anfängen immer wieder gestellt, aber sich nicht zu einer eindeutigen Antwort durchringen können. Viele kluge Köpfe haben eben oft auch viele kluge Meinungen. Und so pendeln ihre Empfehlungen seit Epikur und den Stoikern zwischen Hedonismus und Verzicht in allenfalls immer neuen Varianten. Ihnen gemeinsam ist, dass alle Denker der abendländischen Philosophie das Individuum mit seinen existenziellen Fragen konfrontieren und es dann im selben Atemzug dazu auffordern, diese für sich allein zu lösen. Nur gerade das widerspricht gänzlich unserer Natur.
Erst in jüngster Zeit findet auch in der westlichen Philosophie Beachtung, was die Neurowissenschaft zur Funktionsweise unseres Gehirns und damit zu den Bedürfnissen unserer Psyche etwa nach guten Bindungen beinahe täglich an neuen Details herausfindet. Immer konkreter verdichten sich die gewonnenen Erkenntnisse zu Handlungsanleitungen für eine psychisch gesunde und damit erfüllte Lebensführung. Genau um diese alltagstauglichen Empfehlungen geht es mir, um die Überführung der wissenschaftlichen Einsichten in die alltägliche Lebenspraxis. Die Grundfrage lautet also: Wie kann uns die Hirnforschung dabei helfen, unser eigenes Leben besser zu leben?
Um diese Frage zu beantworten, werden wir im ersten Teil des Buchs einen Blick in die Funktionsweise unseres Gehirns werfen. Es geht dabei darum, die Grundregeln seiner Arbeit zu verstehen und die wesentlichen Einflüsse, die es prägen, kennenzulernen. Also vor allem die Eigenschaften, die sich noch nicht so richtig herumgesprochen haben und die daher immer noch viel zu wenig Beachtung geschenkt bekommen: seine enorme Umweltabhängigkeit, die bereits lange vor der Geburt beginnt, seine Bindungsfähigkeit, seine Kreativität und seine lebenslange Anpassungsfähigkeit, um hier vorab nur einige zu nennen. Auf diesen wissenschaftlichen Befunden aufbauend, ergeben sich anschließend in der zweiten Hälfte des Buchs die praktischen Konsequenzen für unser Leben Schritt für Schritt quasi wie von selbst.
Warum guter Rat so oft danebenliegt
Eigentlich ist es doch verrückt, dass wir nicht einfach so wie Tiere vor uns hin leben und dann alles passt, sondern dass wir uns mühsam den Kopf darüber zerbrechen, was wir in unserem Leben brauchen. Das, was wir intuitiv wissen sollten, gelingt oft nicht. Wieso verlieren wir so leicht den Zugang zu dem, was uns von Natur aus guttut?
Der Grund dafür liegt in einer geradezu genialen Vereinfachung unserer Art zu lernen. Denn vieles von dem, was wir lernen, erfahren wir direkt von unseren Mitmenschen. Wir vertrauen dem, was sie uns sagen. Auf diese Weise wird unser Menschheitswissen ganz direkt von Generation zu Generation weitergereicht. Das ist vom Prinzip her enorm vorteilhaft, denn so muss das Rad nicht immer wieder neu erfunden werden. Der Erfahrungsschatz, auf den jeder Einzelne zurückgreifen kann, ist dadurch riesengroß, eben weil er nicht ausschließlich auf seine selbst gemachten Erfahrungen zurückgreifen muss.
Zugleich aber ist dieser Mechanismus fehleranfällig, da wir nur allzu gern alles Mögliche glauben, solange es uns nicht am Überleben hindert. In der Regel überprüfen wir gar nicht, ob die zahllosen Informationen, die wir von unseren Mitmenschen bekommen, überhaupt zutreffen. Sondern wir glauben das, was andere uns sagen, vor allem dann, wenn wir ihnen vertrauen.
Und so bilden sich in unterschiedlichen Kulturen völlig unterschiedliche Lebensentwürfe heraus. Einmal entstanden, bleiben sie als absolute Wahrheiten unangetastet erhalten und pflanzen sich unhinterfragt fort, werden zu vererbten Traditionen. Je länger sie sich halten, desto beharrlicher werden sie als selbstverständlich empfunden. Egal in welchem Lebensbereich. Alltägliches, wie etwa unsere Ernährungsgewohnheiten oder unser Umgang mit Kindern, aber auch unser Gesellschaftsaufbau, unsere Wertesysteme, selbst unsere Religionen sind letztlich nichts anderes als Wissen, das wir von anderen übernehmen.
Verstärkt wird diese Tendenz zum Beharren noch durch eine Eigenschaft unseres Gehirns selbst, die sich aus seiner biologischen Struktur heraus erklärt. Alles, was einmal in dieser Struktur gespeichert worden ist, wird, eben weil es nun schon vorhanden ist, gerne wiederverwendet. Die Biologie ist von Natur aus sparsam.
Vielleicht ist Ihnen das auch schon selbst passiert. Sie gehen oder fahren tagein, tagaus denselben Weg. Erst durch Zufall entdecken Sie eines Morgens, dass es eine kürzere oder schönere Strecke gibt, die Sie zum selben Ziel bringt. Wir nennen das die Macht der Gewohnheit. Einmal Gelerntes behalten wir bei, solange es nicht einen triftigen Grund dafür gibt, es über Bord zu werfen.
Diese Neigung, die wir aus unserem Alltag kennen, gilt allerdings keineswegs nur dort, sondern genauso in der Wissenschaft. Beliebte Beispiele dafür finden sich in geisteswissenschaftlichen Arbeiten, die nicht selten davon leben, frühere Autoren zu zitieren. Die Logik des aktuellen Verfassers erlangt ihren Anspruch auf Gültigkeit ausschließlich dadurch, dass schon seine Vorgänger Gleiches behauptet haben. So wird in meinem eigenen Fachgebiet, der Psychoanalyse, gerne auf Zitate des Gründungsvaters Sigmund Freud zurückgegriffen. Frei nach dem Motto: Weil Freud das schon gesagt hat, muss meine Annahme richtig sein. Nur war auch Sigmund Freud ein Mensch. Und Menschen können sich bekanntlich irren. Selbst dann, wenn sie genial sind.
Übrigens wäre Freud einer der Letzten, die dem widersprechen würden. Gerade er hat seine Theorien ganz bewusst immer wieder an seine Erkenntnisprozesse angepasst. Und die unterlagen im Laufe seines Lebens durchaus kreativen Wandlungen.
Aber zurück zu uns. Besonders beharrlich neigen wir dazu, das beizubehalten, was wir schon früh in unserem Leben gelernt haben. Weil es sich eben schon früh in unserer Hirnstruktur niedergeschlagen hat. Und so sind wir besonders treu gegenüber den grundlegenden Werten und Lebensweisheiten, die uns in unserer Kindheit beigebracht wurden. Wir nehmen sie als gegeben hin und folgen ihnen blind, meist noch verstärkt dadurch, dass die anderen um uns herum es genauso machen.
Wissensweitergabe und das Festhalten an Bewährtem sind verantwortlich dafür, dass es uns schwerfällt, eingeschlagene Pfade zu verlassen, selbst wenn von außen, etwa durch die Wissenschaft, längst gegenteilige Erkenntnisse vorliegen. Der Kopf mag dann zwar eine neue Richtung gutheißen, der Bauch jedoch bleibt beim Vertrauten. Und der Bauch ist mächtig.
Stellt sich sogleich die Frage, warum ist er das? Warum fällt es uns oft so schwer, aus bewussten Erkenntnissen praktische Konsequenzen zu ziehen? Sind wir womöglich, wie einige Neurobiologen behaupten, gar nicht frei in unseren Entscheidungen? Sind wir, einmal geprägt, für immer hilflose Marionetten unseres Unbewussten?
Ist Erkenntnis möglich, und wenn ja, ist sie wirksam?
Mit dieser Frage befinden wir uns ganz unversehens mitten in einem Streit, der jahrelang erbittert zwischen Hirnforschern und Philosophen ausgetragen wurde. Der Grund dafür? Beide Seiten verrannten sich in ihren Positionen, beschworen die absolute Gültigkeit ihrer jeweiligen Sichtweise und belegten damit beherzt, doch ungewollt, genau die Beharrungstendenz, wie ich sie im vorherigen Absatz beschrieben habe.
Am Ausgangspunkt der Debatte stand die abendländische Philosophie. Die meisten ihrer Vertreter sehen die Selbsterkenntnis und damit die bewusste Selbstkontrolle des eigenen Handelns als wesentlichen Pfeiler unseres Menschseins an. Sie stehen in der Fortsetzung der Tradition von Immanuel Kant und Friedrich Nietzsche und zugleich im Einklang mit unserer alltäglichen Selbstwahrnehmung. Allerdings haben sie dabei den in ihren Augen überlegenen Verstand getrennt von den Gefühlen, die sie als schwach und irreführend empfinden. Folglich haben sie den Anspruch in die Welt gesetzt, das logische Denken müsse die Gefühle beherrschen. Selbst die in vielem so gesellschaftskritische Psychoanalyse sprang auf diesen Zug auf, wenn Sigmund Freud deklarierte: »Wo Es war, soll Ich werden.«
Doch was wäre die Philosophie, wenn es nicht zu jedem gedachten Gedanken auch sein Gegenteil gäbe? Natürlich ebenfalls in vollkommen stimmig hergeleiteter Argumentation. Ein prominenter Vertreter der Gegenposition zur menschlichen Willensfreiheit, bei der der Handlungsspielraum des Menschen innerhalb des unermesslichen Universums als minimal angesehen wird, war Arthur Schopenhauer.
Ende der Siebzigerjahre erhielt seine willenskritische Position unvermittelt Unterstützung aus der experimentellen Psychologie. Die Naturwissenschaft begann gerade damit, sich in die Geisteswissenschaft einzumischen. Ein auf den ersten Blick unspektakulärer Versuch wurde für einige Hirnforscher zum Anlass für eine lautstark verkündete Revolution, von der allerdings, so viel sei vorweggenommen, mittlerweile nicht mehr viel übrig geblieben ist. Worin bestand das Experiment, das so hohe Wellen schlug?
Es war der US-amerikanische Psychologe Benjamin Libet, der 1979 die Schädeldecke seiner Versuchsteilnehmer verkabelte, um auf diese Weise ihre Hirnströme zu messen. Anschließend ließ er sie auf einen Knopf drücken und machte eine überraschende Entdeckung: Noch bevor die Versuchsteilnehmer bewusst die Entscheidung für ihre Handlung getroffen hatten, war an der Aktivierung in ihrem Hirnstrombild zu erkennen, dass der Zeitpunkt gekommen war, an dem sie drücken würden. Ihr Unbewusstes war schneller als ihr Bewusstsein, um durchschnittlich etwa 300 Millisekunden. Damit war klar, dass das Unbewusste und nicht das Bewusstsein die entscheidende Instanz für die Auslösung der Handlung sein musste.
Während Libet eher bescheiden schlussfolgerte, dass er mit seinem Versuch die Existenz des Unbewussten experimentell bewiesen habe, zogen andere Hirnforscher daraus deutlich weiter reichende Konsequenzen. Sie erklärten geradewegs den freien Willen zur Fiktion, schafften ihn ab. Da eine Handlung offenkundig in Gang gesetzt werde, noch bevor das Bewusstsein davon etwas mitbekomme, sei der subjektive Eindruck, wir Menschen könnten Entscheidungen bewusst fällen, nichts weiter als eine von unserem Gehirn erschaffene Einbildung.
Zahllose Forderungen ließen sich aus dieser Behauptung ableiten. Ihr Widerhall drang vor bis zu den Grundfesten unseres Rechtssystems: Denn wie kann ein Täter schuldfähig sein, wenn er die Entscheidung zu seiner Tat gar nicht bewusst gefällt haben kann?
Da rebelliert unser gesunder Menschenverstand – und das zu Recht. In der Tat liegt der Annahme, dass die Denkprozesse, die dem simplen Drücken eines Knopfs vorausgehen, sich auf sämtliche Entscheidungsfindungen in unserem Gehirn übertragen ließen, ein passabler Denkfehler zugrunde. Schließlich kennt unser Zentralnervensystem ganz unterschiedliche Antworten auf ganz unterschiedliche Umweltreize, abhängig von Wichtigkeit und Dringlichkeit der zu fällenden Entscheidung. Wieder ein vertrautes Phänomen aus unserem Alltag als Beispiel: Berührt unsere Hand eine heiße Herdplatte, so ziehen wir sie unweigerlich zurück. Noch bevor wir auch nur den geringsten Gedanken daran verschwendet haben, denn unser Gehirn ist an dieser Handlung gar nicht beteiligt. Es handelt sich um einen simplen Reflex. Und für dessen Steuerung genügt allein das Rückenmark. Erst im Nachhinein wird uns unser Handeln überhaupt bewusst, registrieren wir im Gehirn, dass die Herdplatte heiß war und dass unsere Hand vielleicht deshalb jetzt ein wenig schmerzt, aber nichts Schlimmeres passiert ist.
Komplett anders als bei dieser unwillkürlichen Spontanhandlung verläuft dagegen der Entscheidungsprozess bei komplexeren Fragestellungen, vor allem dann, wenn nicht die Notwendigkeit für eine sofortige Reaktion besteht: bei der Partnerwahl, beim Autokauf, beim Aussuchen des Urlaubsziels oder eben bei der Planung des eigenen Lebensentwurfs. An solchen Entscheidungen ist das Gehirn maßgeblich beteiligt, nicht selten in langwierigen bewussten Abwägungen über das Für und Wider. Was allerdings keinesfalls heißen muss, dass sich die so getroffene Wahl im Endeffekt auch durchsetzen wird.
Doch zurück zu den Probanden im Versuchslabor von Libet. Für sie blieb das Drücken des Knopfs ohne jegliche Konsequenz. Und folglich verschwendeten sie keine unnötige Geistesarbeit darauf, sich den Kopf darüber zu zerbrechen.
Mittlerweile gibt uns die Hirnforschung immer genauere Einblicke in den Ablauf unserer bewussten Handlungssteuerung. Und dabei kristallisiert sich heraus, dass in der Tat unsere Handlungsimpulse in unserem Unbewussten gesetzt werden. Aus dem Bauch heraus wollen wir etwas. Dann jedoch kann dieser Impuls – und darin besteht offenbar die zentrale Aufgabe unserer bewussten Denkebenen – bei Bedarf selbst im letzten Moment noch unterbunden werden. Auch hierzu hat das Experiment von Libet ein Detail zutage gefördert. Zwischen dem bewussten Erleben einer Entscheidung, im Falle seiner Versuchsteilnehmer eben jetzt den Knopf drücken zu wollen, und der aktiven Handlung selbst liegen 200 Millisekunden. Genau in diesem kurzen, aber entscheidenden Intervall kann das bewusste Kontrollzentrum des Gehirns, kann unser Verstand bis zuletzt ein Veto einlegen. Angesichts leerer Kassen vom Kauf des neuen Autos oder vom Urlaub absehen, die Erbtante leben lassen, auf das kalorienreiche Dessert verzichten.
Gerade bei Konflikten zwischen Bauch und Kopf fällt die Entscheidung oft erst im allerletzten Augenblick. Und wer dabei von beiden gewinnt, lässt sich im Einzelfall nicht verlässlich vorhersagen. Wir merken, die Sache beginnt komplex zu werden. Da gibt es bewusst und unbewusst, Gefühl und Verstand, schnelle und langsame Denkprozesse. Aber wie können wir daraus einen gelungenen Lebensentwurf zimmern?
Offenbar müssen wir uns dem Grundaufbau und der Grundfunktionsweise unseres Gehirns im Detail zuwenden, um zu verstehen, was wir wann wie wollen und entscheiden. Schon jetzt nehmen wir als erste Schlussfolgerung mit, dass wir grundsätzlich in der Lage sind, mit bewussten Entscheidungen auf unsere Lebensgestaltung einzuwirken. Das bedeutet, dass wir aktiv an den Grundlagen für ein erfülltes Leben arbeiten können. Sofern wir erkennen, was wir dafür benötigen, was, ganz biologisch gesprochen, unser Organ Gehirn braucht, um uns in der Lebenspraxis mit Erfüllung und Zufriedenheit als dauerhaftem Gefühlszustand zu belohnen.
I Wie wir werden, wer wir sind – Grundlagen der Hirnforschung
1 Der Aufbau der Psyche im Gehirn – wie aus Biologie und Chemie unser Lebensentwurf entsteht
Viele Basisfakten über den Aufbau unseres Gehirns sind mittlerweile Allgemeingut. Wir wissen, dass wir etwa hundert Milliarden Nervenzellen besitzen, die in unzähligen Vernetzungen miteinander verknüpft sind. Vor dem Hintergrund dieser enormen Komplexität sind an unseren Denkprozessen immer zugleich verschiedene Hirnregionen beteiligt, entsteht jeder einzelne Gedanke aus einem flüchtigen charakteristischen Muster an elektrischen Erregungen in einem bestimmten Moment. Schön greifbar, um sich die Entstehung des Geistes in unserem Gehirn vorstellen zu können, finde ich das Bild, das der Neurowissenschaftler Joachim Bauer verwendet. Er vergleicht das Gehirn mit einem Klavier. Erst durch das Spielen der Tasten entsteht Musik. Auf unser Gehirn bezogen heißt das: Erst aus den von den Nervenzellen hergestellten Erregungen bildet sich unsere Psyche, wird im Laufe der Zeit die wunderbare Melodie unseres Lebensentwurfs gespielt.
So weit ist uns das vertraut. Für die praktische Lebensführung, um die es hier ja geht, sind jedoch die vielen bahnbrechenden Erkenntnisse der Hirnforschung, die sich bislang noch nicht wirklich herumgesprochen haben, weitaus wichtiger.
Ohne Umwelt sind wir nichts
Zu diesen Erkenntnissen gehört die Tatsache, dass sich die Struktur unseres Gehirns in weitaus höherem Maße als bislang angenommen unter dem Einfluss der Umwelt aufbaut. Und das gleich auf mehreren Ebenen. Schon die Gene sind keineswegs so mächtig, wie wir das seit ihrer Entdeckung lange gedacht haben. Allein der Umstand, dass wir Menschen nur an die 25000 Gene besitzen, von denen nahezu 99,9 Prozent bei uns allen identisch sind, egal ob wir aus Hamburg, Wladiwostok, Kinshasa oder Chongqing kommen, hätte das vermuten lassen können. Doch inzwischen wissen wir, dass, mehr noch als die Gene selbst, die Epigenetik für die unvorstellbare Vielfalt verantwortlich ist, mit der wir Menschen in bald acht Milliarden Individuen den Planeten Erde bevölkern.
Epigenetik, das ist die Wissenschaft von dem, was unsere Gene steuert, ohne dass sie selbst dabei verändert werden. Der Begriff wurde bereits im Jahr 1942 erfunden, zu einer Zeit also, als die Gene noch gar nicht entdeckt waren. Und doch wird die wahre Bedeutung der Epigenetik erst in allerjüngster Zeit erkannt. Vor allem beschäftigt sie sich mit der Frage, wann und wie welche Gene aktiviert werden und damit auch wie sie in Wechselwirkung miteinander stehen. Zur Veranschaulichung wieder ein Bild: Wenn wir uns die einzelnen Gene als die Buchstaben vorstellen, aus denen unser Bauplan geschrieben wird, dann liefert die Epigenetik die Reihenfolge, in der diese Buchstaben gesetzt werden, wird erst mit ihrer Hilfe der Text verfasst, der uns zu dem einzelnen, unverwechselbaren Menschen macht, der jeder von uns ist.
Enorm wichtig dabei ist der Umstand, dass die Umwelt unmittelbar auf den Schreibprozess dieses Textes einwirkt. Andauernd registriert unser Körper Umweltreize. Sie lösen Reaktionen aus, bei denen diverse Botenstoffe freigesetzt werden, die durch An- und Abschalten unsere Gene steuern. Vor allem sind dies Hormone. Pausenlos sind sie aktiv, ganz besonders bei Stress, bei Angst und in der Liebe. Hormone sind also die Vermittler zwischen Umwelt und Genen. Sie werden als Reaktion auf Außenreize freigesetzt und passen unsere genetische Aktivität an unsere Umwelt an. Das heißt: Wer wir sind, sind wir immer nur in Wechselwirkung mit unserer Umwelt.
Mehr als für jedes andere Organ gilt das für unser Gehirn. Gerade aus seiner enormen Umweltabhängigkeit heraus gewinnt es seine Anpassungsfähigkeit, kann es sich flexibel auf die vielfältigen Anforderungen unterschiedlichster Umgebungen einstellen. Von zentraler Bedeutung für diese Aufgabe und mittlerweile gut erforscht ist dabei vor allem das Stresssystem.
In der Natur entsteht Stress bei jedem intensiven Reiz, besonders bei Gefahr. Dann aktiviert er Kampf oder Flucht. Neben den Akutstresshormonen ist dafür vor allem das Stresshormon Cortisol verantwortlich. Es wird in den Nebennierenrinden gebildet und kann im Körper überallhin gelangen, weil es aufgrund seiner besonderen chemischen Struktur ungehindert die Zellwände sämtlicher Zellen passieren kann, diejenigen unseres Zentralnervensystems eingeschlossen. Im Gehirn angekommen, aktiviert es dort direkt Gene, die zu aggressiverem Verhalten, also zur Kampfbereitschaft führen. Doch nicht nur das. Zugleich werden nämlich auch Gene aktiviert, die eine verstärkte Stressempfindlichkeit, also eine erhöhte Wachsamkeit gegenüber Außenreizen, zur Folge haben. Gleich zweifach bewirkt Cortisol damit eine Anpassung an eine als gefährlich erlebte Umwelt.
Dauerstress mündet deshalb in einen chronischen Alarmzustand, in permanente Wachsamkeit, aus dem einfachen Grund, um sofort kämpfen oder flüchten zu können. Hierdurch kommt eine Spirale in Gang, die sich selbst noch zusätzlich verstärkt. Die erhöhte Stressempfindlichkeit steigert das Stressniveau und damit auch wieder den Stresshormonspiegel, wodurch die Zahl der aktivierten Gene weiter zunimmt. An sich ist das eine gelungene Anpassungsleistung. Wenn überall Gefahr lauert, überlebt eher derjenige, der übervorsichtig und allzeit bereit ist, sich zu wehren oder zu flüchten.
Wer sich so an seine Umwelt angepasst hat, bleibt meist dabei, verlernt dieses Verhalten unter Umständen nie wieder. Zugleich gibt er es automatisch an seine Kinder weiter und das gleich auf mehrfache Weise.
Vererbte Angst
Eine noch ganz junge wissenschaftliche Erkenntnis belegt: Auch Epigenetik wird vererbt. Denn nicht nur die Gene, sondern auch epigenetische Informationen werden in den Keimzellen transportiert, in den Eizellen der Frau und in den Spermien des Mannes. Die Umwelt wirkt damit bereits lange vor unserer Geburt auf uns ein, genau genommen schon vor dem Zeitpunkt unserer Zeugung.
Erst waren es Beobachtungen an Pflanzen, dann epidemiologische Bevölkerungsstudien, also Untersuchungen zur Weitergabe von Merkmalen innerhalb einer Bevölkerung, die dies vermuten ließen. Seit Neuestem liegen nun Laborbefunde vor, die an Mäusen die Weitergabe erworbener Eigenschaften über die Keimbahn belegen.
Der aus Indien stammende Neurowissenschaftler Brian Dias von der Emory University in Atlanta ließ männliche Labormäuse an einem Duftstoff schnuppern und verabreichte ihnen regelmäßig kurz danach unangenehme Stromschläge an ihren empfindlichen Pfoten. Als Folge davon bekamen die Nager Angst vor dem Duft, und diese Angst blieb ihnen auch ohne weitere Stromschläge erhalten. Wie alle Ängstlichen mieden die Tiere von nun an den vermeintlichen Auslöser für ihre Furcht, und sie reagierten mit Nervosität, wenn der Duft in der Luft lag. Doch Dias hatte ein Herz mit seinen geschundenen Mäusemännern und belohnte sie für ihren Einsatz. Sie durften sich paaren.
Die für sie Auserwählten waren Weibchen, denen die Duftprozedur erspart geblieben, für die also der Duftstoff neutral besetzt war. Und doch bekamen ihre Jungen, ja selbst ihre Enkel die Angst vor dem Duft als Erbe mit. Offenkundig hatten sie sie von ihren Vätern ererbt. Wie das funktioniert? Das weiß man bislang nicht genau. Noch ist nicht abschließend geklärt, welcher biochemische Mechanismus für die epigenetische Verhaltensweitergabe über die Spermien verantwortlich ist. Doch die Tatsache, dass sie stattfindet, ist hinreichend bewiesen.
Was für die kleinen Säuger gilt, trifft wie so oft auch auf uns Menschen zu. Dias hat seine Forschungsarbeit mittlerweile ausgedehnt auf die Weitergabe von psychischen Traumen beim Menschen. Und es zeigt sich immer deutlicher, wie deren Auswirkungen über Generationen hinweg erhalten bleiben.
Psychische Traumen, das sind Erlebnisse, die den davon Betroffenen so sehr mit Schmerz und Angst überwältigen, dass er seine Gefühle während des Ereignisses selbst nicht verarbeiten kann. Dadurch bleiben sie unbewusst in seiner Psyche erhalten. Grund dafür ist eine massive Überflutung mit Stress. Wie immer führt übermäßiger Stress zu einer dauerhaften Erhöhung der Stressempfindlichkeit und der Aggressionsbereitschaft. Weil das Verhaltensänderungen mit sich bringt, die auch die eigenen Kinder in der Regel zu spüren bekommen, pflanzen sich die Auswirkungen von psychischen Traumen über Generationen hinweg fort.
Doch offenbar ist das eben nicht alles. Nicht nur das Verhalten, das den Kindern vorgelebt wird, beeinflusst ihre Stressempfindlichkeit, sondern auch ganz direkt die Epigenetik. Das zumindest legen die Erkenntnisse von Dias nahe. Da stellt sich natürlich die Frage, bei welchen anderen Eigenschaften sonst überall noch die epigenetische Prägung über Generationen hinweg ihre Wirkung entfalten dürfte?
Fraglos setzt uns die Epigenetik schon vor unserer Zeugung den Einflüssen der Umwelt aus. Entsprechend entwickeln wir uns auch im Mutterbauch, während der Schwangerschaft, keineswegs starr entlang der genetischen Vorgaben. Gerade das heranwachsende Gehirn baut seine Struktur im Uterus als Reaktion auf die Reize auf, die es von außen empfängt. Diesem konstanten Wechselspiel können wir nicht entgehen. Unweigerlich sind und bleiben wir, solange wir leben, Teil der uns umgebenden Welt. Wir stehen mit ihr in pausenlosem, intensivem Austausch, auch wenn wir davon allenfalls einen Bruchteil erfassen.
Was uns der kleine Mann im Kopf erzählt – Leben als Erleben
Der Grundaufbau unseres Gehirns ist genetisch vorgegeben. Welcher Abschnitt wo liegt, ist genauso vorprogrammiert wie die Lage der Organe im Körper oder der Sitz von Armen und Beinen. Doch schon die Frage, ob sich überhaupt eine Struktur im Gehirn aufbaut und welche Informationen in ihr gespeichert werden, ist von einem sehr frühen Zeitpunkt an abhängig davon, was als Reiz von außen im Gehirn ankommt.
Den Beweis dafür liefert der Homunkulus. Dieser Begriff – wörtlich übersetzt bedeutet er »kleiner Mensch« – stammt aus dem Spätmittelalter. Er wurde geboren aus der Fantasie der Alchemisten, die hofften, in ihren Zauberküchen nicht nur Gold, sondern auch Homunkuli, zwergenhafte Menschlein, herstellen zu können. Heute beschreibt er die Abbildung unserer Körperoberfläche im Gehirn. Seine Entdeckung verdanken wir dem kanadischen Neurochirurgen Wilder Penfield.
Wenn Penfield seine Patienten operierte, ließ er sie meist wach. Ihr Hirn lag zwar frei, weil ihr Schädelknochen aufgesägt worden war, doch es konnte weiter mit ihnen geplaudert werden. Penfield nutzte die Gelegenheit, reizte die offen vor ihm liegenden Gehirne mit Elektroden und ließ sich von seinen Patienten beschreiben, was sie dabei empfanden. Wo es wann kitzelte. Auf diese Weise zeichnete er eine regelrechte Landkarte davon, wie die Oberfläche des Körpers seiner Schützlinge in der Rinde ihres Großhirns abgebildet war. Das Bild, das er gewann, war das einer eigenartig verzerrten, zwergenhaften Gestalt. Penfield, historisch gebildet und humorvoll wie er war, gab ihr den Namen Homunkulus. Übrigens blieb der Neurochirurg zeitlebens kreativ in seinen Denkansätzen. Nach seiner Emeritierung widmete er sich dem Schreiben von historischen Romanen.
Doch wie schaut es nun im Detail aus, dieses Männlein, dieses Abbild unseres Äußeren im Inneren unseres Gehirns? Seine Hände und seine Lippen sind übergroß. Aber nicht nur das, sie liegen außerdem nahe beieinander. Das gilt genauso für seine Füße und seine Genitalien. Offenkundig bildet der Homunkulus damit nicht den genetisch bestimmten, starren anatomischen Bauplan unseres Körpers ab. Statt des üblichen Oben und Unten, mit dem Kopf an dem einen und den Füßen an dem anderen Ende, gibt er den in Embryonalstellung verharrenden Körper des Ungeborenen im Uterus wider. Zusammengekauert hält es seine Hände vor seinen Lippen und seine Füße in der Höhe seiner Genitalien. Das heranwachsende Gehirn speichert also die Körperhaltung, die ihm von den Sinneszellen des Körpers gemeldet wird. Es reagiert damit auf die Information, die es von seiner Umwelt erhält, hier auf die sensiblen Nervenimpulse von den ersten Hautsinneszellen der Körperoberfläche. Das geschieht bereits im zweiten Schwangerschaftsmonat. Selbst zu diesem frühen Zeitpunkt baut sich demnach die Struktur des Gehirns als Folge von Außenreizen auf.
Weitere Einflüsse auch aus der Welt außerhalb des Mutterbauchs treten bald hinzu. Umso intensiver, je mehr Sinne des Ungeborenen bereits ausgebildet sind. Längst ist zweifelsfrei belegt, dass Feten hören und schmecken können. Besonders prägend sind jedoch die Informationen, die das Ungeborene über den Zustand seiner Mutter erhält. Beispielsweise passt sich sein Herzschlag an den seiner Mutter an. Zugleich gelangen die mütterlichen Hormone in den Blutkreislauf des Ungeborenen und entfalten bei ihm ihre Wirkung, da die Blutkreisläufe der beiden eng miteinander verbunden sind.
Wieder gilt das ganz besonders für das Stresshormon Cortisol. Weil es ja sämtliche Zellwände ungehindert überwinden kann, passiert es auch die Plazentaschranke zwischen mütterlichem und kindlichem Blut. Eine Mutter, die Stress hat, gibt ihren erhöhten Cortisolspiegel ungefiltert an ihr Kind weiter. Und dieses Cortisol strömt dann direkt in das sich aufbauende Gehirn des Kleinen. Dort aktiviert es die Gene, die die Stressempfindlichkeit und das spätere Aggressionsniveau des jungen Menschen bestimmen werden.
Die Anpassung an eine gefährliche Umwelt prägt also bereits das Ungeborene im Mutterbauch. Ein Überlebensvorteil, der allerdings problematisch werden kann. Und zwar dann, wenn der Stress gar nicht angebracht ist und trotzdem an das Ungeborene weitergegeben wird.
Einmal stressempfindlicher, bleibt es das bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich ein Leben lang. Selbst als Erwachsener wird es sich nicht grundlegend ändern können. Denn die Eigenschaft ist bereits sehr früh zu einem festen Bestandteil seines Temperaments geworden. Bleibt ihm nur die Möglichkeit, sich damit zu arrangieren, denn bekanntlich ist der Weg zurück in den Mutterbauch versperrt. Und doch ist das kein Grund zu resignieren.
Aufgrund der enormen Flexibilität unseres Gehirns sind wir glücklicherweise in der Lage, uns immer wieder an die jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Wir können uns weiterentwickeln. Ein wesentlicher Schlüssel dazu, aber beileibe nicht der einzige, besteht im Begreifen unserer eigenen Persönlichkeitsstruktur. Zu verstehen, dass wir so geworden sind, wie wir eben sind, hilft uns dabei, das Beste daraus zu machen oder auch grundlegende Akzente schrittweise in eine andere Richtung zu verlagern. Zu erfassen, was unsere allerfrühste Entwicklung geprägt hat, ist deshalb durchaus für unser heutiges Leben noch relevant.
Und doch lassen wir diese frühe Phase unseres Lebens meist unbeachtet. Wer von uns hat schon eine Ahnung davon, wie seine Zeit im Uterus verlief, wie seine Geburt war, was seine ersten Lebenswochen geprägt hat? Fragen wir nach. Je mehr wir davon wissen, je umfassender wir uns selbst kennen, desto besser können wir diese Einsichten nutzen, um uns selbst anzunehmen und gegebenenfalls bewusst und gezielt zu ändern. Zusätzlich können wir mit diesem Wissen Einfluss nehmen auf die Voraussetzungen, die wir unseren Kindern mitgeben, und auf diese Weise verhindern, dass wir Fehler, die bei uns gemacht wurden, bei ihnen wiederholen.
Die Macht der Schablonen
Mit jedem Schritt, den wir in unser Leben hineinwachsen, wird unsere Interaktion mit der Umwelt offenkundiger. Immer besser passen wir uns an die Bedingungen an, denen wir ausgesetzt sind. In einem andauernden Wechselspiel von Nehmen und Geben sind wir untrennbar Teil der Welt. Wie unser Gehirn im Detail verarbeitet, was an Reizen bei ihm eintrifft, auch dazu gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse, die längst noch nicht im Alltag angekommen sind.
Das beginnt mit der auf den ersten Blick absurd anmutenden Feststellung, dass unser Gehirn gar kein direktes Abbild von der Welt da draußen haben kann. Denn alles, was es erhält, sind Nervenimpulse von den Sinneszellen des Körpers. Und diese sogenannten Aktionspotenziale sind ihrer Art nach stets gleich. Lediglich ihre Häufigkeit und die Orte im Gehirn, an denen sie eintreffen, sind variabel. Aus der Verteilung und der Intensität der ankommenden Impulse bastelt sich das Gehirn also ein Bild von der Außenwelt zusammen, das offenbar gut genug ist, um darin zu überleben. So wie auch der Homunkulus auf der Großhirnrinde als Folge der dort eintreffenden Reize ein brauchbares Abbild der Körperoberfläche liefert. Einmal im Gehirn gespeichert, wird ein Erfahrungsgrundmuster beibehalten. Kommt es wieder zu vergleichbaren Situationen, das heißt, wird das Gehirn mit einem vergleichbaren Reizmuster aktiviert, greift es unweigerlich auf seine frühere Erfahrung zurück. Wie eine Schablone legt es sie über das aktuelle Geschehen.
Passt die Schablone, wird sie als brauchbar bewertet. Hierdurch wird sie verstärkt und bei nächster Gelegenheit leichter wiederverwendet. Passt sie hingegen nicht, wird sie entsprechend abgeändert oder durch eine völlig neue ersetzt.
Tendenziell neigen wir also unweigerlich dazu, selbst neue Erfahrungen einem uns schon bekannten Schema anzupassen. Weil die Struktur besteht, greifen wir gerne darauf zurück, so wie bei der vertrauten Wegstrecke. Und weil unser Gehirn den Zustand von Stimmigkeit, von Kohärenz liebt. Wenn wir uns auskennen, empfinden wir das als angenehm.
Vor allem, wenn wir uns ganz auf eine vertraute Tätigkeit konzentrieren, funktioniert alles wie von selbst, und wir fühlen uns wohl dabei. Die elektrischen Erregungen in unserem Gehirn schwingen dann im Gleichtakt. Es arbeitet ohne jeden Widerstand wie ein Supraleiter. Damit ist es durchlässig für kreative Neuerungen und offen für spontane Problemlösungen. Und das verursacht ein gutes Empfinden, führt zur Ausschüttung eines Cocktails an körpereigenen Belohnungsbotenstoffen. Im ständigen Bemühen um Stimmigkeit suchen wir daher ganz automatisch das Vertraute. Ja, mehr noch, wir neigen dazu, unser aktuelles Erleben an unsere alten Erinnerungen anzupassen, damit wir das Gefühl haben, dass wir uns auskennen.
Die Schablonen, mit denen unser Gehirn arbeitet, werden demnach von ihm selbst aus seinen früheren Erfahrungen hergestellt und unterliegen einer permanenten Anpassung. Deshalb sind sie alles andere als starr. Ihre Aufgabe besteht nicht im Bewahren eines naturgetreuen Abbilds von der Vergangenheit. Denn die Vergangenheit ist vorbei und damit für das Überleben unwichtig. Sondern ihre Aufgabe besteht darin, dass wir uns im Hier und Jetzt und möglichst auch in der Zukunft zurechtfinden, um zu überleben. Um hierfür gewappnet zu sein, werden die Schablonen permanent auf den neuesten Stand gebracht. Für unser Gehirn zählt also nicht die objektive Vergangenheit, sondern stets nur der Anteil an Information, der davon auch jetzt noch gebraucht werden kann. Und der wird deshalb ganz nach Bedarf so zurechtgebogen, dass er eben passt.
Zeugenaussagen vor Gericht belegen die fulminante Kreativität unseres Gehirns, wenn es darum geht, Darstellungen von der Vergangenheit neu zu erfinden. Wie leicht lassen sich Zeugen in Verhören verunsichern, wenn sie unter Druck gesetzt werden. Selbst ohne Folter versuchen sie unbewusst, sich dem anzupassen, was von ihnen gefordert wird – und verknüpfen das dann mit Erinnerungsresten aus ihrem Arsenal an eigenen früheren Erfahrungen. Außer sie sind geschulte Lügner.
Experimentell untersucht wurde diese Vergangenheitsfälschung im Dienste der Gegenwart von dem aus Kiel stammenden US-amerikanischen Psychologen Ulric Neisser, dem Begründer der kognitiven Psychologie. Anlass für sein Experiment war eine Katastrophe. Am 28. Januar 1986 startete die Raumfähre Challenger zu einer Mission ins Weltall. Nur dreiundsiebzig Sekunden nach ihrem Start zerbarst sie in einer Höhe von fünfzehn Kilometern in tausend Stücke. Die sieben Astronauten kamen dabei ums Leben. Und all das geschah vor laufenden Kameras.