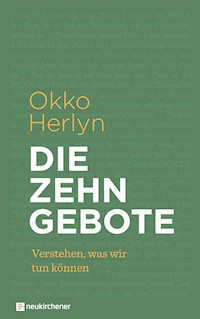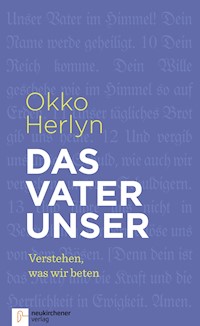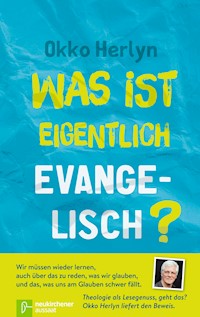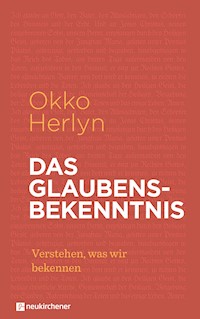
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neukirchener Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Was hat der "eingeborene" Sohn mit den Abenteuerbüchern von Karl May zu tun? Ist "Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria" eine Zumutung für den gesunden Menschenverstand? Und warum bekommt Pontius Pilatus eigentlich eine namentliche Erwähnung? Im dritten Teil seiner erfolgreichen Reihe zu den zentralen christlichen Glaubenstexten beantwortet Okko Herlyn, was wir schon immer zum Glaubensbekenntnis wissen wollten oder uns noch nie gefragt haben. Auch der Frage, ob dieser Text mit seinen althergebrachten Formulierungen noch in unsere Zeit passt, geht er nach: Unterhaltsam und verständlich erklärt der Theologieprofessor und Kabarettist, was sich hinter den Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses verbirgt. Immer ausgehend von unseren heutigen Alltagserfahrungen erhellt er dabei den historischen und biblischen Hintergrund jeder einzelnen Aussage und macht ihre bleibende Bedeutung sichtbar. Theologie als Lesegenuss.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2021 Neukirchener Verlagsgesellschaft mbH, Neukirchen-Vluyn
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Grafikbüro Sonnhüter, www.grafikbuero-sonnhueter.de
Lektorat: Ekkehard Starke
DTP: Breklumer Print-Service, www.breklumer-print-service.com
Verwendete Schriften: Scala, Scala Sans
Gesamtherstellung: PPP Pre Print Partner GmbH & Co. KG, Köln, www.ppp.eu
ISBN 978-3-7615-6772-2 (E-Book)
www.neukirchener-verlage.de
Inhaltsverzeichnis
I. WAS IST EIGENTLICH EIN BEKENNTNIS?9
Ein paar Beobachtungen vorweg
II. „ICH GLAUBE AN GOTT“16
Aufbruch in ein Abenteuer
III. „DEN VATER“28
Heilsame Irritation
IV. „DEN ALLMÄCHTIGEN“42
Bollwerk gegen Omnipotenzphantasien
V. „DEN SCHÖPFER DES HIMMELS 55
UND DER ERDE“
Von einem alten Konflikt
und einer neuen Neugier
VI. „UND AN JESUS CHRISTUS“73
Die Frage, wer das Sagen hat
VII. „SEINEN EINGEBORENEN SOHN,
UNSERN HERRN“84
Ein Geheimnis mit Selbstverpflichtung
VIII. „EMPFANGEN DURCH DEN HEILIGEN GEIST,
GEBOREN VON DER JUNGFRAU MARIA“96
Sinnvoller Stolperstein
IX. „GELITTEN UNTER PONTIUS PILATUS“107
Mehr als eine Marotte
X. „GEKREUZIGT, GESTORBEN UND
BEGRABEN, HINABGESTIEGEN 120
IN DAS REICH DES TODES“
Eine Ungeheuerlichkeit,
die uns zugutekommen soll
XI. „AM DRITTEN TAGE AUFERSTANDEN
VON DEN TOTEN“133
Machtvoller Eingriff in eine Welt des Todes
XII. „AUFGEFAHREN IN DEN HIMMEL,
ER SITZT ZUR RECHTEN GOTTES,
DES ALLMÄCHTIGEN VATERS“144
Zur Abwechslung eine Predigt
zum Himmelfahrtstag
XIII. „VON DORT WIRD ER KOMMEN,
ZU RICHTEN DIE LEBENDEN
UND DIE TOTEN“155
Erhobenes Haupt statt Selbstverwerfung
XIV. „ICH GLAUBE AN DEN HEILIGEN GEIST“165
Gottes bewegende Gegenwart
XV. „DIE HEILIGE CHRISTLICHE KIRCHE,
GEMEINSCHAFT DER HEILIGEN“175
Keine religiöse Wagenburg
XVI. „VERGEBUNG DER SÜNDEN“186
Verdrängung geht anders
XVII. „AUFERSTEHUNG DER TOTEN
UND DAS EWIGE LEBEN“195
Gottes letztes Wort
XVIII. HILFREICH ZU WISSEN207
Zusätzliche Informationen
für neugierig Gewordene
XIX. WARUM ICH GLAUBE227
Ausnahmsweise ein persönliches Nachwort
Quellenangaben234
I. WAS IST EIGENTLICH EIN BEKENNTNIS?
Ein paar Beobachtungen vorweg
„Wir wollen nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Dazu bitte ich Sie – soweit es Ihnen möglich ist – aufzustehen.“ Frau Litterscheid, die heute den Dienst einer Lektorin versieht, blickt uns aufmunternd an. Wenig später stehen wir in Reih und Glied und sprechen leicht schleppend, doch immerhin im gleichen Rhythmus miteinander die altvertrauten Worte: „Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde …“
Merkwürdig. Seit meiner Zeit als Konfirmand hat sich nichts geändert. Dieselben Worte, dieselbe „Choreographie“, dieselbe etwas klamme Stimmung im Raum. Hier und da auch dieselbe Schwierigkeit, bei den vielen verschiedenen Aussagen noch einigermaßen mitzukommen. Während ich noch ein wenig über „den Allmächtigen“ nachdenke, geht es schon um den „eingeborenen Sohn“. Und sobald ich versuche, mir über „geboren von der Jungfrau Maria“ den Kopf zu zerbrechen, ist die versammelte Gemeinde schon bei der „Auferstehung der Toten“ angelangt. Fast ein wenig stressig.
Manche, denen ich meine kleine Not schon mal anvertraue, sagen mir, dass es doch gar nicht nötig sei, immer alles verstehen zu müssen. Das sei so eine typisch protestantische Marotte, den Glauben sozusagen zu „verkopfen“. Man verstehe ja schließlich auch sonst so manches nicht im Leben, ohne sich gleich einen Stress daraus zu machen. Hier komme es doch auf etwas anderes an. Worauf denn dann, bitteschön? Nun, auf das Sicheinfinden in eine Tradition. Auf das Erleben einer Gemeinschaft. Oder auch nur auf das gefühlsmäßige Berührtwerden durch den Klang altvertrauter Worte. Beim Lesen eines Gedichts beispielsweise verlange man ja auch nicht danach, zu jedem poetischen Bild ein Kurzreferat zu hören. Es reiche doch völlig aus, die alten Worte mitzusprechen und sich irgendwie darin „aufgehoben“ zu fühlen.
Ich merke, wie mich diese Antwort nicht wirklich zufriedenstellt. Geißelt nicht schon die Bibel das gedankenlose Plappern von Gebeten? Das mechanische Herunterleiern vermeintlich frommer Worte? Das bloße Festhalten an sinnentleerten Traditionen? „Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen“, heißt es doch immerhin schon in der Bergpredigt Jesu (Matthäus 6, 7). Ist also das Glaubensbekenntnis so ein vermeintlich frommer, aber im Grunde doch stroherner Text, der mit seinen vielen sperrigen Aussagen von dem heutigen Menschen kaum noch nachvollziehbar ist? Eine Bremer Gemeinde hat deshalb bereits vor Jahren das gottesdienstliche Glaubensbekenntnis ganz gestrichen. Begründung: Gemeindeglieder hatten moniert, „sie könnten einige Passagen nicht guten Gewissens mitsprechen“. Ist also das Glaubensbekenntnis dort, wo es nun einmal noch im Gottesdienst gesprochen wird, am Ende nicht mehr als eine Art liturgische Deko, ähnlich dem Altarschmuck oder den bunten Kirchenfenstern? Was hat es mit dem Glaubensbekenntnis überhaupt auf sich? Ja, was ist eigentlich ein Bekenntnis? Gute Frage.
Im Wort „Bekenntnis“ steckt – man erkennt es unschwer – das Wort „bekannt“. Bekenntnis im ursprünglichen Sinne bedeutet also: etwas bekannt, etwas kenntlich machen. Solche „Kenntlichmachungen“ begegnen uns im Alltag laufend. Jemand outet sich mit Schal und Wimpel als „bekennender Schalke-Fan“. Ein anderer gesteht seiner Angebeteten gegenüber seine Liebe. Im Gericht bekennt sich ein Angeklagter als schuldig oder nicht schuldig. Der Vorsitzende des Sächsischen Landesbauernverbandes forderte kürzlich von Seiten der Politik „ein deutliches Bekenntnis zu Großbetrieben als Bestandteil einer vielfältigen Agrarstruktur“. Und hohe Vertreter beider Nachbarländer bekennen sich in regelmäßigen Abständen zur deutsch-französischen Freundschaft. Allen ist gemeinsam, dass sie etwas von sich – eine Haltung, eine Erwartung oder eine Überzeugung – preisgeben, eben anderen gegenüber „kenntlich“ machen.
Bevor es zu einer solchen Kenntlichmachung anderen gegenüber kommt, muss man sich also erst einmal über seine eigene Haltung, Erwartung oder Überzeugung Klarheit verschaffen. Insofern ist ein Bekenntnis zunächst einmal nichts anderes als eine Art Selbstidentifizierung. Wer sich zu etwas bekennt – egal ob zu seiner Schuld, zu einer geliebten Frau, zu Schalke 04 oder zur deutsch-französischen Freundschaft –, sagt ja etwas Grundlegendes über sich selbst aus. Solche zumindest gelegentlichen Selbstidentifizierungen sind beileibe nicht überflüssig. Zumindest von Zeit zu Zeit kann es ja durchaus sinnvoll sein, dass man sich darüber klar wird, wohin man gehört, was man für wichtig erachtet, woran man glaubt oder worauf man hofft. Wer sich etwa zu den allgemeinen Menschenrechten bekennt, sagt damit zunächst einmal das, was ihm wichtig ist. Man bekennt eben „sich“.
Aber eine bloße Selbstidentifizierung könnte auch im stillen Kämmerlein erfolgen oder in einem persönlichen Tagebuch ihren Platz haben. Zum Bekenntnis kommt es erst da, wo solch eine Überzeugung oder Haltung nach außen tritt. Insofern ist ein Bekenntnis in der Tat immer eine Bekanntgabe. Gegenüber der Angebeteten, gegenüber dem Gericht, gegenüber den anderen Fans im Stadion oder gegenüber den Mitmenschen, mit denen ich gerade im Gespräch bin. „Wer mich bekennt vor den Menschen …“, sagt Jesus verschiedentlich. Wer sich bekennt, setzt sich also grundsätzlich einer Öffentlichkeit aus, wie groß oder klein sie auch immer sein mag. Dass meine innerste Überzeugung überhaupt gelegentlich „nach draußen“ will, dafür mag es verschiedene Gründe geben. Allgemein kann man wohl sagen: „Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über“ (Matthäus 12, 24). Ein Szene-Witz sagt: „Woran erkennt man einen Veganer?“ Antwort: „Er sagt es dir.“
Wenn es nun im Gottesdienst heißt, dass wir „unseren christlichen Glauben bekennen wollen“, so kann man füglich fragen, ob es sich hier überhaupt um ein Bekenntnis handelt. Immerhin hat es eine gewisse Logik, wenn manche reformierten Gemeinden aus diesem Grund auf ein gottesdienstliches Glaubensbekenntnis verzichten. Denn welchen „anderen“ gegenüber sollte hier etwas kenntlich gemacht werden? Den übrigen Gottesdienstteilnehmern, die neben mir dieselben Worte „bekennen“? Oder am Ende nur Gott gegenüber? Dass manche beim Aussprechen des Glaubensbekenntnisses die Hände falten, ihre Augen schließen und die Gemeinde das Ganze mit einem „Amen“ beschließt, könnten dann Zeichen in diese Richtung sein. Also mehr eine Art Gebet. Aber „Bekenntnis“?
Wir werfen einen ersten Blick drauf:
„Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.“
Mir fällt zunächst auf, dass in diesem Text das Wort „bekennen“ gar nicht vorkommt, und frage mich, ob es da nicht konsequenter wäre, beim gottesdienstlichen Glaubens„bekenntnis“ eher von einer Selbstvergewisserung des Glaubens zu sprechen? Von mir aus auch vor den Ohren Gottes, also im Gebet. Damit kein Missverständnis aufkommt: Gelegentlich kann solch eineSelbstvergewisserung ja durchaus notwendig sein. Wer von uns wäre denn niemals verunsichert in seinem Glauben? Wer von uns kennte denn nicht auch den Zweifel und die Anfechtung? Wer von uns wäre denn nicht auch immer wieder von sehr grundsätzlichen Fragen umgetrieben? Da ist es schon sinnvoll, dass man sich – wenigstens von Zeit zu Zeit – klarmacht: „Ich weiß, woran ich glaube.“ Um es mit einem bekannten Kirchenlied zu sagen.
Aber auffallend ist doch auch, dass die Worte unseres gottesdienstlichen Glaubensbekenntnisses im Gespräch mit anderen, also wirklich einmal „vor den Menschen“, so gut wie gar keine Rolle spielen. Wer von uns bediente sich denn, wenn es im Alltag wirklich einmal zu einem Austausch über Glaubensdinge kommt, tatsächlich jener Formulierungen, die uns im Gottesdienst so routiniert über die Lippen kommen? Wer von uns antwortete denn etwa auf die harmlose Frage, weshalb wir uns zur Kirche halten, mit den Worten: „Weil ich an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde glaube“? Von dem „eingeborenen Sohn“, dem Geborensein „von der Jungfrau Maria“ oder der „Auferstehung der Toten“ ganz zu schweigen. Es ist offenbar eine ganz besondere Sache, oder sollen wir sagen: eine ganz besondere Herausforderung, sich im Alltag des Lebens zu seinem christlichen Glauben zu bekennen. Also, wenn man so will, seine eigenen Worte des Glaubens zu finden.
Dabei kann es nun allerdings doch hilfreich sein, sich immer wieder auf die Worte zu besinnen, die andere weit vor uns gewählt haben, um ihrem Glauben Ausdruck zu geben. Nicht indem wir sie wieder und wieder gedankenlos nachplappern, sondern indem wir uns vornehmen, über ihre einzelnen Aussagen einmal in Ruhe nachzudenken. Es könnte ja sein, dass uns diese alten Worte, die einem manchmal so vorkommen, als seien sie geradezu in Stein gemeißelt, am Ende gar nicht mehr so steinern und unzugänglich vorkommen. Dass sie durchaus lebendig werden und uns geradezu inspirieren, eben dann auch unsere eigenen Worte des Glaubens zu finden. Vorausgesetzt, wir verstehen, was wir da sonntags im Gottesdienst – vor wem auch immer – bekennen.
Genau darum soll es im Folgenden gehen.
II. „ICH GLAUBE AN GOTT“
Aufbruch in ein Abenteuer
1. „Ich“ und „ich“ sind zweierlei
„Ich kann da natürlich nur für mich sprechen.“ Katharina macht ein irgendwie endgültiges Gesicht. Wir befinden uns gerade in einer Planungsrunde für den nächsten Betriebsausflug. Die Vorstellungen darüber, wo es diesmal hingehen soll, gehen deutlich auseinander. Hart stehen sich eine Duisburger Hafenrundfahrt, der Allwetterzoo in Münster und eine zünftige Bergische Kaffeetafel gegenüber. Katharina, weil ursprünglich vom Niederrhein stammend, hat soeben ihr Plädoyer für das heimatliche Duisburg gehalten. „Aber ich kann da natürlich nur für mich sprechen.“ Leider sind wir mit dieser Feststellung um keinen Deut weitergekommen. Aber das steht auf einem anderen Blatt.
Dass man „nur für sich“ sprechen kann, scheint mittlerweile zu einer Art Dogma geworden zu sein. Sätze, die Allgemeingültigkeit beanspruchen, werden mehr und mehr empört zurückgewiesen: „Bitte niemals ,man‘ sagen! Grundsätzlich nur Ich-Sätze!“ Und wer sich gar auf die Suche nach der Wahrheit aufmacht, muss sich nicht selten sagen lassen, dass eine solche Suche allenfalls bei einem selbst landen könne, weil eben jeder seine eigene Wahrheit habe. Meine Wahrheit muss noch lange nicht deine sein. Das hängt offenbar mit einer Entwicklung zusammen, in der es kaum noch ein „Wir“ zu geben scheint, unsere Gesellschaft also weniger eine alle verbindende Gemeinschaft, sondern mehr eine lose Ansammlung vieler „Ichs“ ist.
Was Wunder, wenn jedermann meint, ständig sein Ich nach vorne bringen zu müssen. Wie viele Menschen begegnen uns, die eigentlich von nichts anderem als sich selbst erzählen. Egal, ob es um die Gesundheit, den Urlaub, das berufliche Fortkommen oder die Enkelkinder geht – jeder scheint nur noch seine eigenen Belange im Blick zu haben. Man hat manchmal den Eindruck, als sei man geradezu umzingelt von Leuten, die offenbar für gar nichts anderes als sich selbst ein Interesse haben. Ganze Bücherstapel zur „Ich-Kultur“ und unzählige kommerzielle Angebote zur persönlichen Selbst-Optimierung tun ein Übriges. Der viel gepriesene moderne Individualismus hat offenbar eine neue Generation von Ich-Menschen hervorgebracht. „Aber ich kann da natürlich nur für mich sprechen.“
Und nun fängt auch noch das Glaubensbekenntnis mit „ich“ an: „Ich glaube …“ Das klingt nach dem Bisherigen ziemlich zeitnah, weil ja womöglich auch im Glauben nur jeder für sich sprechen kann. Aber wenn dem tatsächlich so wäre, dann müssten wir im Grunde Millionen und Abermillionen von individuellen, womöglich völlig verschiedenen Glaubensbekenntnissen haben. Das ist aber nicht der Fall. Das Glaubensbekenntnis wird vielmehr Sonntag für Sonntag von unendlich vielen verschiedenen Menschen im gleichen Wortlaut gesprochen. Und das nun schon seit über eineinhalb tausend Jahren. Wir schließen daraus: „Ich“ und „ich“ sind offenbar zweierlei. Es gibt ein „Ich“, das in der Tat „nur für sich sprechen kann“. Und es gibt ein „Ich“, das sich bewusst in ein größeres Ganzes einfügt. Genau zu einem solchen „Ich“ scheint das „Ich“ des Glaubensbekenntnisses zu gehören. Wer hier „ich“ sagt, tut es im Chor mit anderen, im Verbund mit der weltweiten Christenheit.
Das erinnert an mancherlei „Ichs“ in der Bibel. Wie oft begegnet uns dieses Wort nicht allein in den Psalmen. Vor allem dort, wo einzelne Menschen ihre sehr persönliche Situation – sei’s ihre Not, sei’s ihr Glück – vor Gott bringen. „Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir“ (Psalm 130,1). „Ich will den Herren loben allezeit; sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein“ (Psalm 34,2). Aber diese „Ichs“ sind immer eingebettet in einen größeren Zusammenhang, nämlich in den Glauben Israels. Manchmal kommt es dadurch zu dem scheinbar kuriosen Sachverhalt, dass in ein und demselben Text, etwa in Psalm 118, „ich“ und „wir“ unvermittelt ineinander übergehen. Singular und Plural scheinen gar keine grundsätzliche Alternative zu sein. Man kann sich diese Kuriosität unschwer damit erklären, dass der Entstehungsort der Psalmen wohl nicht das „stille Kämmerlein“, sondern der öffentliche Gottesdienst gewesen ist, in dem sich der Einzelne auch mit seinen sehr persönlichen Anliegen aufgehoben wusste. Das biblische „Ich“ ist also keinesfalls mit dem „Ich“ des neuzeitlichen Individuums zu verwechseln. Selbst der im Bauch des Fisches völlig isolierte Jona betet mit seinem „Ich“ noch Worte aus dem Psalmengut seines Volkes (vgl. Jona 2ff.).
Das „Ich“, mit dem das Glaubensbekenntnis anfängt, steht nun offensichtlich genau in dieser biblischen Tradition. Aber wer weiß das heute schon noch? In Zeiten, in denen das „Ich“ eine ziemlich andere Bedeutung gewonnen hat, besteht doch zumindest die Gefahr, dass das „Ich glaube“ einem religiösen Individualismus Vorschub leistet, bei dem dann am Ende jeder glauben kann, was er für richtig hält. Der Theologe Karl Barth hat einmal gewarnt: „Ein Satz, der mit ,ich‘ anfängt, ist selten gut – selbst wenn das Beste und Schönste hinterher kommt.“ Manche neueren Glaubensbekenntnisse haben daraus die Konsequenz gezogen, nicht mit „ich“, sondern mit „wir“ zu beginnen. So etwa das Bekenntnis der indonesischen Batakkirche von 1951, das bei jedem einzelnen seiner achtzehn Artikel in fast monotoner Gleichmäßigkeit mit einem „wir glauben und bekennen“ einsetzt.
In Erinnerung an das biblische „Ich“ könnte man dem „Ich“ unseres Glaubensbekenntnisses aber vielleicht doch noch einen guten individuellen Sinn abgewinnen. Er könnte darin bestehen, dass auch ein Glaube, der in eine größere Gemeinschaft eingebunden ist, immer noch persönlich zu verantworten ist. Größere Zusammenhänge hin oder her – irgendwann sind wir in der Tat gefragt, wo wir denn im Glauben wirklich selber stehen. Etwa im Gespräch oder gar in einer Auseinandersetzung mit Menschen anderer Überzeugung nützt es ja herzlich wenig, darauf hinzuweisen, dass man sich dem Bekenntnis der alten Kirchenväter, der Reformatoren oder gar der Batakkirche verbunden weiß. Es gibt Situationen, in denen es nicht anders geht, als unverstellt und unvertretbar nichts anderes als eben „ich“ zu sagen: „Ich glaube.“ Aber was ist das – Glauben?
2. Nicht wissen? Von wegen
„Glauben heißt: nicht wissen.“ Mit der ihm eigenen Unerschütterlichkeit versucht Henry unserem Gespräch über Gott und die Welt ein vorläufiges Ende zu setzen. Wir sitzen in der Kneipe gegenüber und sind einmal wieder bei einem unserer Lieblingsthemen: warum Kirche, warum Glaube, warum überhaupt Religion? Henry gehört zu denen, die sich die Welt vor allem – wie er es nennt – „mittels Fakten“ zu erschließen suchen. Möglichst auf eindeutiger wissenschaftlicher Basis. Dass es indes gerade in der Wissenschaft immer wieder sogenannte „Fakten“ gibt, die sich schon bald wieder als Irrtümer herausstellen, ficht ihn nicht weiter an. „Glauben heißt: nicht wissen.“ Er, Henry, halte es grundsätzlich mit dem Wissen. Da wisse man, was man habe. Sonst müsse er am Ende auch noch für wahr halten, dass da jemand über Wasser gelaufen sei. Nein, den gesunden Menschenverstand an den Nagel zu hängen, könne nun wirklich niemand von ihm verlangen. – „Prost Gemeinde!“
Henry ist mit dieser Einstellung bei Weitem nicht allein. Immer wieder macht man die Beobachtung, dass bereits dem Wort „Glauben“ so eine Art Minderwert anhaftet. Glauben ist eben nur glauben. So etwas Ähnliches wie meinen, wähnen oder bloß vermuten. „Ich glaube, wir müssen die dritte Straße links nehmen“, sagt Regine neben mir auf dem Beifahrersitz. „Es könnte aber auch die vierte sein. Ich weiß es nicht mehr so genau.“ Wir sind auf der Fahrt zu einer Geburtstagsfeier. „Und was erwartet uns diesmal essensmäßig?“, frage ich zurück. „Ich glaube, wie immer: Chili con Carne. Anschließend Himbeer-Mascarpone“, erwidert Regine. Sie hätte statt „glauben“ genauso gut „annehmen“ oder „vermuten“ sagen können. Glauben ist eben nicht Wissen, um mit Henry zu sprechen.
Unser Glaubensbekenntnis spricht nun auch an prominenter Stelle von „glauben“: „Ich glaube“. Lateinisch: „credo“. Dieses erste Wörtchen im Glaubensbekenntnis hat ihm auch seinen Kurznamen gegeben. Im innerkirchlichen Sprachgebrauch, etwa im Rahmen der gottesdienstlichen Liturgie, ist meistens vom „Credo“ die Rede. Wie so manches aus der Welt der Religion so hat auch dieses Wort mittlerweile seinen ganz eigenen Weg in die Banalitäten des Alltags gefunden. „Mein Credo lautet: Weniger arbeiten, mehr leben“, lässt uns beispielsweise Barbara Karlich in ihrer Show im österreichischen Fernsehen wissen. Inzwischen kann man unter dem Firmenschild „Credo“ u. a. Seifen, Nagelzangen oder sogar ganze Garagen-Schwingtore käuflich erwerben. In der Profanität der übrigen Warenwelt scheint „Credo“ dem einen oder anderen Produkt geradezu einen gewissen Mehrwert zu verleihen. Verrückt. Jedenfalls haben wir allen Anlass, dem „ich glaube“ unseres Glaubensbekenntnisses nun doch ein wenig näher auf die Spur zu kommen.
Wenn das Glaubensbekenntnis von „glauben“ spricht, so greift es damit vor allem auf das biblische Verständnis des Glaubens zurück. Das Wort kommt im Alten wie im Neuen Testament ziemlich häufig vor. Was aber schon auf den ersten Blick auffällt: Nirgendwo wird es im Sinne von „meinen“ oder „vermuten“ verwandt. „Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit“, lesen wir beispielsweise schon auf einer der ersten Seiten (1.Mose 15,6). Was ist der Hintergrund? Abraham vernimmt von Gott eine geradezu unglaubliche Verheißung. Er soll im hohen Alter endlich Vater werden. Er hätte diese Verheißung – wäre er Henrys Fakten-Weisheit gefolgt – eigentlich rasch ins Reich der Phantasie verbannen können. Aber er „glaubte dem Herrn“, wie es heißt. Sein Glaube hat hier offenbar gar nichts mit irgendeiner Mutmaßung zu tun, sondern ist schlicht Ausdruck seines Vertrauens. Genauer gesagt: seines Gottvertrauens.
Das hebräische Ursprungswort für „Glauben“ („aman“, aus dem später unser „Amen“ hervorgeht) meint so viel wie „fest“, „beständig“, „treu“ oder eben „vertrauensvoll sein“. Wenn also Abraham „dem Herrn glaubt“, so geht es gar nicht um seine Meinung, auch nicht um seine Meinung über Gott, sondern darum, dass er sich an Gottes Verheißung „festmacht“, ihm vertraut. Der Glaube meint also eine bestimmte Beziehung, ein unbedingtes Vertrauensverhältnis zu Gott. Das ist so ähnlich wie unter Menschen. Er zu ihr: „Ich liebe dich.“ Sie zu ihm: „Ich glaube dir.“ Äußert sie etwa nur eine Meinung oder eine bloße Vermutung? Nein, etwas unendlich Größeres und Schöneres als das: Vertrauen.
Das Motiv des Vertrauens zieht sich nun wie ein roter Faden durch die ganze Bibel hindurch. Im Neuen Testament lesen wir z. B. von einem heidnischen Hauptmann, der Jesus um die Heilung seines kranken Knechts bittet. Er solle „nur ein Wort“ sprechen. Jesu Botschaft an die Umstehenden: „Solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden“ (Matthäus 8,10). Der Hauptmann wird also nicht wegen seiner korrekten theologischen Ansichten über Gott gelobt. Wie auch? Er gehört ja offensichtlich einer anderen Religion an. Er wird wegen seines unbedingten Vertrauens gelobt.
Sowohl an Abraham als auch an dem Hauptmann wird deutlich: Wer glaubt, wer vertraut, verlässt sich auf einen anderen. Dabei darf man das „Sich-Verlassen“ durchaus wörtlich nehmen. In ihrem Glauben verlassen sie in gewisser Weise ein Stück ihrer „selbst“: Abraham seine Heimat, der Hauptmann seine Religion. Ähnlich wie die Propheten, die um ihres Auftrags willen ihr gesellschaftliches Ansehen verlieren, oder die Jünger, die ihre bürgerliche Existenz hinter sich lassen, um dem Ruf Jesu zu folgen. Wer Gott vertraut, „verlässt sich“ geradezu wörtlich. Nicht um sich selbst aufzugeben, sondern um sich woanders „fest“ zu machen. „Wenn man völlig darauf verzichtet hat, aus sich selbst etwas zu machen“, sagt Dietrich Bonhoeffer, „dann wirft man sich Gott ganz in die Arme. Und ich denke, das ist Glaube.“
Und doch ist das nicht alles. Die Menschen in der Bibel, die es mit dem Glauben aufnehmen, vertrauen nämlich nicht einfach blindlings. So wie es in einem vermeintlich frommen Kirchenlied heißt: „Laß ruhn zu deinen Füßen dein armes Kind: es will die Augen schließen und glauben blind“ (EG 376,2). Der biblische Glaube ist grundsätzlich nicht blind, sondern sehend. Abraham ist ja nicht gänzlich verborgen, worauf er sich einlässt. Er hat die Verheißung auf Land, Nachkommenschaft und Segen. Auch den Jüngern wird bei ihrer Berufung gesagt, was auf sie zukommt. Wer glaubt, stürzt sich also nicht einfach in ein unbekanntes Abenteuer. In allem Vertrauen geht es auch um bestimmte, unverwechselbare Inhalte. Inhalte, um die man in der Tat auch wissen muss. „Glauben heißt: nicht wissen“? Von wegen. Vielmehr gilt – um es mit einem anderen Kirchenlied zu sagen – „Ich weiß, woran ich glaube“ (EG 357). Deshalb sagt das Glaubensbekenntnis ja auch nicht einfach nur „ich glaube“, sondern „ich glaube an“. Aber an was genau?
3. Glaube an Gott. Doch an welchen?
„An“ irgendetwas glauben viele. Udo Jürgens etwa glaubte – zumindest in einem seiner Lieder – „an die Liebe“. Der Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt wollte, obwohl er nach eigenem Bekunden auch immer mit dem Schlechten rechnete, unbedingt „an das Gute im Menschen“ glauben. Unzählige Ratgeber für ein gelingendes Leben empfehlen, vor allem „an sich selbst“ zu glauben. Während die FDP-Politikerin Daniela Kluckert freimütig bekennt: „Ich glaube an den Wettbewerb.“ Von Kaiser Wilhelm II. ist überliefert, dass er angesichts der Erfindung des Automobils ausgerufen haben soll: „Ich glaube an das Pferd.“ An irgendetwas glauben also viele.
Unser Glaubensbekenntnis spricht in dem Zusammenhang nicht von „Liebe“, vom „Guten im Menschen“ oder von „sich selbst“, sondern von Gott: „Ich glaube an Gott“. Doch auch das tun viele. Nach einer jüngeren Umfrage des Nachrichtenmagazins DER SPIEGEL glauben immerhin noch 55 Prozent der Deutschen „an einen Gott“. Das Problem ist allerdings, dass jeder dieser Millionen von Menschen unter „Gott“ womöglich etwas anderes versteht. Nach Martin Luther kann „Gott“ ja manches sein. Für die meisten sei es schlicht der „Mammon“. Doch das sei nicht der einzige Gott, den es in der Welt gebe. Denn „auch, wer darauf traut und trotzt, dass er große Kunst, Klugheit, Gewalt, Gunst, Freundschaft und Ehre hat, der hat auch einen Gott“. Kurz: „Worauf du nun dein Herz hängst und verlässest, das ist eigentlich dein Gott.“ Mit dem bloßen Satz „Ich glaube an Gott“ ist also noch gar nicht gesagt, um welchen Gott es hier geht.
Etwa das sogenannte „Dritte Reich“ führte – zumindest in seiner Anfangszeit – die Rede von „Gott“ durchaus im Munde. Man hielt den Führer für „gottgesandt“. Und Menschen, die sich von der Kirche abgewandt hatten, aber dennoch an „ein höheres Wesen“ glaubten, galten offiziell als „gottgläubig“. In Heinrich Bölls Satire „Doktor Murkes gesammeltes Schweigen“ wird der Vorschlag gemacht, das Wort „Gott“ durch „jenes höhere Wesen, das wir verehren“ zu ersetzen. Immerhin eine Formulierung, die manches offenlässt. Die ARD-Moderatorin Katrin Bauerfeind antwortet auf die Frage, ob sie an „eine göttliche Macht“ glaube: „Ja, wenn’s hilft, auch das. Das hat aber keinen Namen und ist eher so ein X.“ Der Glaube an Gott nicht mehr als „so ein X“, also im Grunde eine Leerformel, die je nach Bedarf alles und nichts bedeuten kann?
Um dieser Beliebigkeit zu entgehen, sagt das Glaubensbekenntnis nun allerdings mehr als nur „ich glaube an Gott“. Deshalb folgt diesem kurzen Eingangssatz ein relativ ausführlicher Text. Ja, es geht im christlichen Glauben an Gott nicht nur um Vertrauen, sondern auch um Inhalte, und zwar um unverwechselbare. Es geht um diesen und keinen anderen Gott. Der christliche Glaube glaubt also nicht nur „an einen Gott“. Er glaubt an den Gott, der uns in der biblischen Botschaft Alten und Neuen Testaments in einzigartiger und gleichzeitig überaus vielfältiger Weise entgegentritt. Glaube also doch ein „Für-wahr-Halten“, um mit Henry zu sprechen? Ja, sofern der Glaube jene Botschaft, also schlicht das Evangelium, für sich als wahr und verbindlich anerkennt. Nein, sofern er meint, auch gleich alle menschlichen und zeitbedingten Ausdrucksformen jener Botschaft gleichauf für wahr halten zu müssen. Niemand muss im Glauben seinen ihm von Gott geschenkten Menschenverstand an den Nagel hängen.
Weil es im Glaubensbekenntnis um diesen und eben keinen anderen Gott und deshalb auch um unverwechselbare Glaubensinhalte geht, ist auch Henrys weiterem Lehrsatz zu widersprechen, wonach Glauben „nicht wissen“ heißt. Die Botschaft der Bibel, die im Glaubensbekenntnis ja nur in ein paar gebündelten Sätzen zusammengefasst ist, muss ja grundsätzlich gewusst sein, bevor ich sie als wahr und verbindlich anerkenne. Ohne Kenntnis dieser Botschaft – in welchem Umfang auch immer – ist ein christlicher Glaube eigentlich gar nicht möglich. Die junge Christenheit hat seinerzeit daraus die Konsequenz gezogen, vor jeder Taufe eine Unterweisung vorzunehmen. Zahlreiche Texte im Neuen Testament weisen darauf hin, etwa die Geschichte von dem Kämmerer aus Äthiopien (Apostelgeschichte 8,26-40). Oder die vom Gefängniswärter in Philippi. Bevor dieser sich mit seiner ganzen Familien taufen lässt, heißt es, dass die Apostel ihm „das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren, sagten“ (Apostelgeschichte 16,32).
Es hat deshalb bis heute seinen guten Grund, wenn in der Kirche neben der Verkündigung und der Seelsorge auch die Lehre, die „Katechese“ im christlichen Glauben, ausgeübt wird – in welcher Form und mit welchen Methoden auch immer. Vom kirchlichen Kindergarten über den Kindergottesdienst, den Konfirmanden- oder Kommunionunterricht, den Religionsunterricht an den Schulen, den Erwachsenengesprächskreisen oder Vortragsangeboten in den kirchlichen Akademien bis hin zu den persönlichen Vorbereitungsgesprächen etwa bei Taufen oder Trauungen. Wer es mit dem christlichen Glauben aufnimmt, sollte in der Tat wissen, worauf er sich einlässt. Und bevor man hier gleich wieder „Schule“ oder „typisch protestantische Verkopfung“ wittert, sollte man sich klarmachen, dass Lernen manchmal auch richtig Spaß machen kann. Immerhin sprechen die biblischen Zeugen immer wieder davon, dass es ihnen geradezu „Lust“ (Psalm 1,2) bereitet, sich mit dem Wort Gottes näher zu beschäftigen.
Und dann könnte es sein, dass daraus so etwas wie eine lebenslange Neugier wird. Denn niemand wird behaupten, dass man mit einem einmaligen Unterricht allen Tiefen und Untiefen der biblischen Botschaft schon auf die Spur gekommen ist. Gewiss ist und bleibt das Vertrauen der erste Schritt. Es könnte aber sein, dass dann das Abenteuer des Glaubens erst richtig beginnt. Wenn man denn Glauben nicht so sehr als einen festen Standpunkt, sondern – mit Abraham und den vielen anderen – mehr als ein Unterwegssein versteht.
Innehalten, Nachdenken und Fragen ausdrücklich erlaubt.
III. „DEN VATER“
Heilsame Irritation
1. Von stumpfen Nasen, blauen Augen, Rossen und Rindern
An das Foto kann sich Georg noch gut erinnern. Jahrelang hing es seinerzeit in der Wohnstube neben der Anrichte. Schwarz-weiß in schmalem Goldrahmen. Ein junger, ernst dreinblickender Mann in Wehrmachtsuniform, den Kopf leicht geneigt. „Dein Vater“, sagte seine Mutter manchmal und blieb dann vielleicht für einen Moment in der Mitte des Zimmers stehen. „Er ist im Krieg geblieben.“ Obwohl Georg seinen Vater nie zu Gesicht bekommen hatte, war ihm zeit seiner Kindheit sein Vater immer gegenwärtig gewesen. „Dein Vater …“, so begannen manche Erzählungen der Mutter. Geschichten, die sich wiederholten und die Georg im Laufe der Jahre fast auswendig kannte. „Dein Vater hat immer so gerne Grünkohl mit Speck gegessen.“ Oder: „Dein Vater konnte ja so furchtbar laut lachen.“ Mitunter auch, wenn sich die Gelegenheit bot: „Was dein Vater ja nun so gar nicht leiden konnte, das war Unpünktlichkeit.“ Wenn Georg später einmal etwa mit einem „Gut“ aus der Schule nach Hause kam, schien ihm das größte Lob, das seine Mutter zu vergeben hatte, zu sein: „Darüber hätte sich dein Vater aber gefreut.“ Gerne sah ihn die Mutter auch ein bisschen länger von der Seite an: „Deine Nase, Georg. Genau wie dein Vater.“
Was ein Vater ist, weiß jedes Kind. Ganz einfach, weil jeder Mensch neben einer Mutter eben auch einen Vater hat. Unabhängig davon, welche Erfahrungen wir im Einzelnen mit ihm gemacht haben. Gute oder weniger gute. Auch Georg, der seinen Vater nie wirklich erlebt hat, hat einen Vater. Und auch die vielen Kinder, deren Väter sich irgendwie aus dem Staub gemacht haben, haben einen Vater. Selbst wenn dieser vielleicht nur noch als Abwesender präsent ist. Zudem gibt es immerhin noch genügend andere Familien, in denen Väter anzutreffen sind. Nein, was ein Vater ist, muss man niemandem lange erklären.
Insofern scheint es auf den ersten Blick keiner näheren Erläuterung bedürftig, wenn das Glaubensbekenntnis Gott „Vater“ nennt, eben weil bereits jedes Kind weiß, was unter einem „Vater“ zu verstehen ist. Doch was ist, wenn das eine Kind solche und ein anderes Kind eine völlig andere Vatererfahrung in seinem Leben gemacht hat? Es sind ja wahrhaftig nicht alle Väter gleich. Da mag es liebevolle oder tyrannische, fürsorgliche oder gleichgültige, strenge oder tolerante, zärtliche oder zur Gewalt neigende geben. Welche dieser verschiedenen Vatererfahrungen soll denn nun maßgeblich sein, wenn es darum geht, das Bekenntnis zu Gott als „dem Vater“ zu verstehen?
Das Wort „Vater“ ist ein Beziehungsbegriff. Ohne Kind kein Vater. Die besondere Beziehung eines Vaters zu seinem Kind zeigt sich, folgen wir etwa den Erkenntnissen des Sozialpsychologen Erich Fromm, vor allem an der besonderen Art, sein Kind zu lieben. Während die Mutterliebe, so Fromm, „ihrem Wesen nach an keine Bedingung geknüpft“ ist, so ist es bei der Liebe des Vaters zu seinem Kind gerade umgekehrt: „Ich liebe dich, weil du meinen Erwartungen entsprichst, weil du deine Pflicht erfüllst, weil du mir ähnlich bist.“ Unschwer fühlt man sich an Franz Kafkas erschütternden „Brief an den Vater“ erinnert. Voller Bitterkeit beschreibt er darin, wie er zeitlebens vergeblich um die Aufmerksamkeit und Zuneigung seines Vaters gebuhlt habe. Zum Glück gibt es aber natürlich auch andere Väter. Heutzutage nicht wenige, die sozusagen auch die „mütterliche Seite“ an sich entdecken. Mittlerweile sind die Vatererfahrungen überaus vielfältig. Das mag ein Fortschritt sein. Wenn es allerdings darum geht, nun auch Gott als einen „Vater“ zu begreifen, mag es auch ein Problem sein.
Denn solange wir es in unserem Leben vor allem mit einem liebevollen und fürsorglichen, mit Erich Fromm gesprochen: „mütterlichen“ Vater zu tun gehabt haben, mag es für die meisten Menschen mit der Vorstellung von Gott als „Vater“ ja noch hingehen. Wer glaubte nicht gerne an einen liebevollen, umsichtigen und beschützenden „Vater im Himmel“? Zahllose fromme Erzählungen, Bilder, Kindergebete und Lieder zeugen davon, wie etwa das alte Abendlied von Nikolaus Herman:
„Dir sei Dank, dass du uns den Tag
vor Schaden, G’fahr und mancher Plag
durch deine Engel hast behüt’
aus Gnad und väterlicher Güt.“ (EG 467,2)
Doch was ist, wenn ich in meinem Leben eine ganz andere Vatererfahrung gemacht habe? Wenn mein leiblicher Vater vielleicht ein egozentrischer, despotischer und gewalttätiger, sozusagen „kafkaesker“ Haustyrann war? Soll ich mir dann auch Gott, den „Vater“, als einen finsteren, strafenden und brutalen Gesellen vorstellen? Und ist es nicht zumindest nachvollziehbar, wenn Menschen mit bedrückenden Vatererfahrungen das Bekenntnis zu Gott als dem „Vater“ nur schwer über die Lippen kommen will? Selbst der gelegentlich gemachte Vorschlag, in einem solchen Fall, Gott einfach nicht „Vater“, sondern „Mutter“ zu nennen, löst das Problem ja nicht wirklich. Zumindest solange es eben auch Mütter gibt, die einem nicht immer nur guttun.