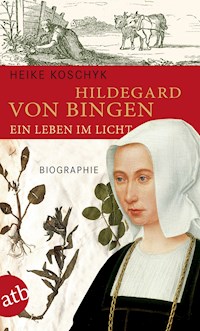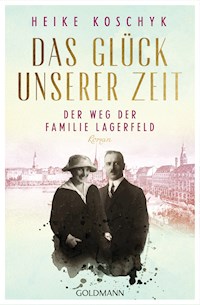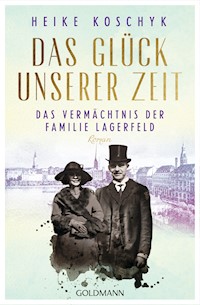
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Das Glück unserer Zeit
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Hamburg 1925: Otto Lagerfeld steht am Grab seiner geliebten Frau Theresia auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Ihn quälen Trauer und die Ungewissheit über das Schicksal seiner Familie. Wird sein Bruder Paul zur Vernunft kommen und Verantwortung übernehmen? Kann er selbst seiner Tochter Thea eine sichere Zukunft bieten? Und was wird aus der Marke Glücksklee, wenn er keine Investoren für die neue Fabrik findet? Otto stürzt sich in die Arbeit. Auf einer Berlinreise stößt er mit der jungen, ehrgeizigen Elisabeth zusammen. Zum ersten Mal seit Theresias Tod fühlt er sich unbeschwert. Doch Elisabeth ist nicht leicht zu beeindrucken, und auf Otto wartet in Hamburg eine tragische Nachricht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 602
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Hamburg 1925: Otto Lagerfeld steht am Grab seiner geliebten Frau Theresia auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Ihn quälen Trauer und die Ungewissheit über das Schicksal seiner Familie. Wird sein Bruder Paul zur Vernunft kommen und Verantwortung übernehmen ? Kann er selbst seiner Tochter Thea eine sichere Zukunft bieten ? Und was wird aus der Marke Glücksklee, wenn er keine Investoren für die neue Fabrik findet ? Otto stürzt sich in die Arbeit. Auf einer Berlinreise stößt er mit der jungen, ehrgeizigen Elisabeth zusammen. Zum ersten Mal seit Theresias Tod fühlt er sich unbeschwert.
Doch Elisabeth ist nicht leicht zu beeindrucken, und auf Otto wartet in Hamburg eine tragische Nachricht …
Mehr Informationen zu Heike Koschyk finden Sie am Ende des Buches.
HEIKE KOSCHYK
DAS GLÜCK UNSERER ZEIT
DAS VERMÄCHTNIS DER FAMILIE LAGERFELD
ROMAN
OriginalausgabeDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe August 2022
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur GmbH
Umschlagmotiv: Hamburg: mauritius images / Michelle Bridges / Alamy
Papierstruktur/Himmel: FinePic®, München
Pärchen: Collage © Christian Brinkmann
nach einer Vorlage von Gordian Tork
Tintenkleckse: shutterstock/Melodist, Vlada Art
Frack des Mannes: shutterstock/LiliGraphie
Pelzmantel: alamy stock photo/Classic Stock
Redaktion: Angela Troni
LK · Herstellung: ik
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-27310-1V001www.goldmann-verlag.de
1 BADEN-BADEN
August 1966
Es war halb zehn, als Otto Lagerfeld die abschüssige Hahnhofstraße von seinem Haus hinunter in Richtung der Altstadt ging. Seitlich der Wege schimmerte das taufeuchte Gras in der Morgensonne. Auf dem schmiedeeisernen Parktor des ehemaligen Schlosshotels Hahnhof hockten Spatzen und gaben ein Pfeifkonzert.
Das Gebäude stand seit Jahren leer. Eine Schande für einen so geschichtsträchtigen Ort wie diesen, dachte er. Vor einem Jahrzehnt hatten in den Räumen sogar Konrad Adenauer und der französische Premierminister eine wichtige Konferenz abgehalten. Es hieß, Madame Mendès-France habe unter ihrem eleganten schwarzen Pelz ein Collier mit taubeneigroßen Perlen getragen, als sie dem Zug am fahnengeschmückten Bahnhof entstieg. So erzählte es zumindest der Bahndienstbeamte, der damals die verklemmte Zugtür öffnen durfte und heute pensioniert war.
Auch er selbst war pensioniert. Er, der ehemalige Generaldirektor der Glücksklee Milchgesellschaft mit zuletzt drei Werken in Neustadt in Holstein, Bad Essen und Marktbreit.
Und auch er erzählte gerne von seiner Vergangenheit. Nur dass es hier bis auf die Nachbarn niemanden gab, mit dem er sich austauschen konnte. Obwohl er gewiss mehr zu berichten hatte als nur von einem Blick in das Dekolleté einer Ministerpräsidentengattin.
Otto passierte die russische Kapelle und nahm die Lichtentaler Straße in Richtung des Kurparks. Hinten am Gausplatz bog gerade der Oberleitungsbus ein. Doch mit seinen bald fünfundachtzig Jahren war er rüstig genug, die zwanzig Minuten zur Konditorei und Confiserie Rumpelmayer zu Fuß zu gehen.
Er war immer stolz auf seine stabile Gesundheit gewesen. Selbst den Schlaganfall, den er vor gut fünfundzwanzig Jahren erlitten hatte, sah man ihm nicht mehr an. Von all seinen Brüdern lebte er am längsten, und nur Lisbeth, im Januar als Letzte seiner Geschwister verstorben, war mit ihren siebenundachtzig Jahren älter als er.
Mit den Kindern und Enkelkindern seiner Brüder Paul und Joseph hielt er immer noch Kontakt. Ebenso mit seinen Töchtern Christel und Thea. Mit seinem Sohn Karl, der bis vor wenigen Jahren noch jeden Sommer in Baden-Baden verbracht hatte, mit seinen Neffen Kurt und Herbert. Es war ihm wichtig, dass sich die Familie, die in aller Welt zerstreut lebte, nicht verlor. Er war der Kitt, der alle zusammenhielt. Aber was, wenn er eines Tages nicht mehr lebte ? Würden die Kontakte der anderen untereinander ohne ihn allmählich einschlafen ?
Als Otto den Eingang zum Kurpark erreichte, blieb er stehen und schöpfte Atem. Von den Rosenbeeten strömte ein betörender Duft herüber. Es war wärmer geworden. Viel zu warm für seinen Kreislauf.
Die Konditorei hatte ihre Pforten gerade erst geöffnet. Zwei Kellner stellten die Stühle auf der überdachten Terrasse auf und wischten die Feuchtigkeit von den Tischplatten, bevor sie die gestärkten Deckchen darauf legten. Dazu die Speisekarte und die Preisliste für die Schokoladenbonbons und Früchtekonserven aus eigener Herstellung.
Otto wartete, bis sein Lieblingsplatz an der Hauswand rechts des Einganges eingedeckt war, und setzte sich auf einen der Stühle. Er war der erste Gast, und er liebte die Morgenstunden, die noch so viel Ruhe und Kraft in sich bargen. Früher war er immer der Erste im Büro gewesen. Es ging nichts über das ungestörte Arbeiten, bevor die Welt um einen herum allmählich erwachte.
»Guten Morgen, Herr Generaldirektor«, sagte der Kellner und machte eine knappe Verbeugung. »Wie geht es Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin ?«
»Danke, gut«, erwiderte Otto. Er freute sich über die Anrede, hatte den Titel sogar ins Telefonbuch eintragen lassen, obwohl er bereits seit neun Jahren im Ruhestand war. »Meine Frau ist wieder einmal in Paris bei unserem Sohn Karl.«
»Paris, oh, là, là ! Dann genießen Sie nun also Ihre Zeit als Strohwitwer ?«
»Ich gebe mir Mühe.«
Der Kellner nickte freundlich und nahm Ottos Bestellung entgegen. Eine Scheibe Schwarzbrot mit Käse, dazu Rührei und ein Kännchen Kaffee, so wie jeden Morgen.
Das Kännchen brachte er wenig später mit einer Zeitung, die er Otto unaufgefordert hinlegte. Dazu ein weiteres, kleineres Kännchen mit Kaffeesahne. Der Mann kannte seine Kunden, Otto wusste es zu schätzen, es gab nicht mehr viele Kellner von diesem Schlag.
In gewohnter Vorfreude goss Otto den dampfenden Kaffee in die Tasse und sog das herbe Aroma ein. Dann gab er etwas Kaffeesahne hinzu und beobachtete, wie sich die weißen Kreise mit dem Rühren des Löffels allmählich verloren.
Die Glücksklee-Kondensmilch, so befand er nach dem ersten Schluck, schmeckte besser. Auch heute noch, gut sechzig Jahre nachdem er sie als evaporierte Vollmilch in Dosen von der Firma Carnation zum ersten Mal gekostet hatte, gab er sie gerne in seinen Kaffee. Obwohl er sich vor dem Umzug nach Baden-Baden geschworen hatte, nie wieder einen einzigen Tropfen davon anzurühren.
Da Otto spürte, dass ihn die Art, wie man ihn aus der Firma gestoßen hatte, noch immer kränkte, lenkte er seine Gedanken auf schönere Dinge.
Er schnitt das Käsebrot, das der Kellner vor ihm abgestellt hatte, und dachte an die Feier zum fünfzigjährigen Jubiläum des Milchwirtschaftsverbandes in Schlangenbad bei Wiesbaden. Damals, vor drei Jahren, hatten sich alle gefreut, ihn wiederzusehen. Die ehemaligen Konkurrenten von Nestlé und der Libby Gesellschaft. Der Verbandspräsident. Und natürlich der derzeitige Geschäftsführer der Glücksklee Milchgesellschaft, sein alter Weggefährte Alfons van Acken, der auch schon in den Siebzigern war. Sie alle hatten ihm die Hände geschüttelt und ihn gefragt, wie es ihm gehe. Und ob ihm Baden-Baden gefalle.
Es sei sehr schön, hatte er gesagt, vor allem die hübschen Villen aus dem 19. Jahrhundert entlang der Lichtentaler Allee und der Weg durch den Park entlang der Oos bis zur Klosterwiese. Es gebe sogar einen Ort nach dem Vorbild italienischer Renaissancegärten, der heiße Paradies. Überhaupt die Umgebung ! Im Schwarzwald könne man herrlich wandern.
Sie hatten ihm auf die Schulter geklopft und ihm zu der Entscheidung gratuliert.
»Genießen Sie Ihren Ruhestand, Herr Lagerfeld, den haben Sie sich redlich verdient.«
Otto trank einen Schluck Kaffee und hielt die Tasse unbewegt in der Hand, bevor er sie endlich abstellte. Wären wir doch nur in Hamburg geblieben !
Er vermisste Hamburg so sehr, dass es beinahe wehtat. Die Stadt war seine Heimat, war es schon immer gewesen. Selbst als er als Kaufmann in Amerika oder Russland gelebt hatte, war die weltoffene Hansestadt immer sein Ziel. Er liebte die Elbe von Altona bis Groß Flottbek und Blankenese, wo er die meiste Zeit seines Lebens gewohnt hatte, das Tuten der Schiffe, die sich in den Hafen schoben. Und wie gerne war er in der Speicherstadt am Freihafen, in der er seine ersten Lehrjahre verbracht hatte. Oft spazierte er den Weg von der Börse am Kanal entlang, ebenso von den Geschäften der Altstadt bis zum Jungfernstieg und sah auf die von Parks und eleganten Villen umschlungene Alster, an deren nördlicher Spitze sie zuletzt gewohnt hatten.
Doch mit seiner Pensionierung hatte seine Frau die Zügel übernommen. Weil Baden-Baden nur wenige Zugstunden von Paris entfernt lag, von wo aus ihr Sohn Kollektionen für Chloé, Fendi und Krizia entwarf, und weil es zudem eine mondäne Kurstadt war, hatte es sie beide hierher verschlagen. Und nun fuhr Ebbe bei jeder Gelegenheit fort, um Karl zu besuchen, während er selbst hier die Zeit totschlug, indem er Leserbriefe an Tageszeitungen verfasste, Briefe an die Angehörigen in aller Welt schrieb und den Familienstammbaum vervollständigte.
Er spürte den körperlichen Verfall, das konnten auch die regelmäßigen Spaziergänge nicht verhindern. Inzwischen zählte er die Tage.
Während er allmählich welkte, blühte Ebbe auf wie ein junges Mädchen. Im vergangenen Jahr war sie mit bunten Kleidern aus Paris zurückgekommen und mit einem Turban auf dem Kopf.
»Das ist jetzt modern«, hatte sie gesagt. »Davon verstehst du nichts.«
Da mochte sie recht haben. Für ihn war Mode etwas, das eine Person vorteilhaft kleiden sollte. Aber ein exzentrischer Turban tat das nicht. Vor allem nicht bei einer Frau von Mitte sechzig. Ebbe hatte sogar Französischunterricht genommen, weil es ihr peinlich war, dass sie sich weit weniger gut unterhalten konnte, als ihre Gesprächspartner dachten. Vielleicht hätte Karl nicht so sehr aufschneiden sollen, wenn er von seiner Mutter sprach.
Ihn, seinen Vater, erwähnte der Junge kaum noch. Aber gewiss hatte er selbst Schuld daran. Für den Lebensweg seiner Töchter hatte er mehr Verständnis aufgebracht.
Otto trank den Kaffee aus und schob die ungelesene Tageszeitung zur Seite. Dann winkte er dem Kellner und trat den Weg zurück zur Wohnung an.
Das Zweifamilienhaus in der Hahnhofstraße hatte er 1959 erbauen lassen. Es war weniger elegant, eher praktisch, denn für die letzten Jahre wollte er nicht allzu verschwenderisch sein. Es lag ein Stück nach hinten versetzt, war quadratisch gebaut, mit einem Walmdach und einer Garage im Keller, zu der eine abschüssige Zufahrt führte, was für Autos ohne angezogene Handbremse – wie er aus leidvoller Erfahrung wusste – leicht zum Verhängnis werden konnte.
Der Innenausbau hingegen war von erlesener Qualität. Der Parkettboden aus Tropenholz in der Stube hatte ein halbes Vermögen gekostet. Gleiches galt für die Möbel in Ebbes Zimmer: die Frisierkommode, den opulenten Kleiderschrank mit den handbestickten Lavendelsäckchen, das Bett. Die französischen, im Muster der Tapete gehaltenen Vorhangstoffe aus Chintz hatten so viel gekostet wie ein ganzer Sessel. Er selbst hatte für sein Zimmer nur die dunklen Möbel aus der Hamburger Wohnung genommen.
Otto hängte den Schlüssel an den Haken und betrat die Stube, wo er den Sessel vor das große Panoramafenster schob, von dem aus man über die Parkanlagen an der Oos bis zum Kloster Lichtenthal sehen konnte. Es war ein schöner Blick. Die bewaldeten Berge des Schwarzwaldes lagen in dunklem Grün, über ihnen spannte sich der klar blaue Himmel.
In diesem Moment fühlte Otto sich so müde wie noch nie in seinem Leben. Wenn ich jetzt ginge, dachte er, dann wäre es wohl in Ordnung. Alles war geregelt. Das Testament war geschrieben und wurde von Rechtsanwalt Barker verwahrt. Die letzten Wünsche als Handreichung hatte er an seinen Neffen Kurt geschickt, damit der wusste, was zu tun war, wenn er starb. Seinen Kindern Thea, Christel und Karl, die in der ganzen Welt verstreut lebten, wollte er mit den Formalitäten nicht zur Last fallen.
Er wünschte sich ein schlichtes Begräbnis. Es hatte ja niemand etwas davon, wenn er in einem teuren Holzsarg lag, der ohnehin irgendwann zerfallen würde.
Eine Weile saß Otto still da und sah hinaus, hing seinen Gedanken nach. Dann lächelte er.
Wenn er auf sein Leben zurückblickte, dann konnte er zufrieden sein. Er hatte ein langes Leben gehabt, und es war vieles geschehen, dass es für drei reichte.
Als ein Gratulant ihn zum achtzigsten Geburtstag fragte, ob er glücklich gewesen sei trotz der vielen Arbeit und der schweren Zeiten – immerhin hatte er zwei Weltkriege überstehen müssen –, da konnte er nicht anders, als es zu bejahen. Auch wenn die harten Momente überwogen.
Am schlimmsten war für ihn gewesen, als er seine erste Frau Theresia verloren hatte und nach einer sehr kurzen Ehe wieder allein war mit dem Baby, das lange in der Brutanstalt des Altonaer Kinderhospitals lag, damit es an Gewicht zunahm.
Es waren die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg gewesen. Das Land war in einem erbärmlichen Zustand, der sich durch die hohen Reparationsforderungen des Versailler Friedensvertrages stetig verschlechterte. Zerrissen von den unterschiedlichsten Strömungen und Parteien, die versprachen, die hohe Arbeitslosigkeit und den Hunger zu beenden, und stattdessen die Bevölkerung aufeinanderhetzten und in Wirtschaftsfragen unklug agierten. Und so schwankte man von einer Krise in die nächste, wobei die hohe Inflation das Land am schwersten traf.
In jenen Jahren hatte er alle Hände voll zu tun gehabt, um die Firma vor dem Untergang zu bewahren und sie dann, nach der Währungsumstellung, wieder aufzubauen. Wäre die gute Seele Frau Riek nicht da gewesen, die sich bereits im Haus der Familie Feigl um Theresia gekümmert hatte, er hätte nicht gewusst, wie er all das schaffen sollte.
Damals – im Alter von erst dreiundvierzig Jahren – hatte er gedacht, er würde nie wieder lachen können.
2 HAMBURG
April 1925
Der Regen löste sich aus den tiefhängenden Wolken. Erst allmählich, dann immer stärker fiel er auf die Wege, Grünflächen und Beete des Ohlsdorfer Friedhofes. Vertrieb den Morgennebel, der sich über die Gräber gelegt hatte.
Otto hörte das Trommeln der Tropfen auf seinem Hut, fühlte die Nässe, die von der Krempe auf den Kragen seines Hemdes und weiter in den Nacken rann. Sein Blick war starr auf das Grab gerichtet, auf den glänzenden Stein, der den Namen seiner viel zu früh verstorbenen Frau trug.
»Alles Gute zum Hochzeitstag, meine liebste Theresia.«
Das Rosenbouquet zitterte in seinen Händen. Er schluckte heftig und rief sich zur Raison. Zum wiederholten Mal fragte er sich, wie Gott es hatte zulassen können, dass sie nur sieben Monate nach der Hochzeit von ihm gehen musste, wo sie doch ein ganzes gemeinsames Leben vor sich liegen sahen.
Drei Jahre war es nun her. Und er vermisste Theresia an jedem einzelnen Tag.
Vor seinem inneren Auge sah er sich wieder im Taxi durch die Nacht zur Entbindungsklinik fahren. Er erinnerte sich an ihr im Licht der vorbeihuschenden Straßenlaternen schmerzverzerrtes Gesicht. An den unruhigen Blick, mit dem sie ihn anschaute.
»Es ist zu früh, Otto. Ich habe furchtbare Angst um unser Kind.«
Er hatte sie fester an sich gezogen und ihr in einer hilflosen Geste über die Hand gestrichen. »Alles wird gut, du wirst sehen.«
Damals hatte er nicht ahnen können, dass am Ende nur das Kind überleben würde. Das Mädchen wurde im November drei Jahre alt und stand nun stumm und unbeweglich neben ihm. Den viel zu großen Mantel bis an den Hals zugeknöpft, die Hände zum Gebet gefaltet. Er hatte ihr den Namen seiner Mutter gegeben: Theresia. Aber weil ihm die Wucht des Namens für das Kind zu groß erschien, nannte er sie nur noch Thea.
Otto blinzelte die aufsteigenden Tränen fort und ließ den Blick über die erblühenden Rhododendren schweifen, über die Eichen, die den freien Platz rechts und links des Grabes umstanden. Die Luft war kühl und dunstig, die Rasenflächen standen in sattem Grün.
Es war ein schöner Ort für eine letzte Ruhestätte. Ein großer, gepflegter Park voll diskreter Nischen, in denen man sich seiner Trauer hingeben konnte, ohne von Spaziergängern gestört zu werden.
Irgendwann würde auch er hier liegen.
Als Theresia starb, hatte er gleich zehn Plätze gebucht, damit am Ende alle seine Lieben in der Ewigkeit vereint waren. Seine Eltern, die beide auf die achtzig zugingen und trotz zunehmender Gebrechlichkeit noch immer recht fidel waren. Seine unverheirateten Schwestern Tilla und Lisbeth, die bei den Eltern in der Voßstraße wohnten und sich um deren Wohlergehen kümmerten.
Die restlichen vier Plätze hatte er für den Fall reserviert, dass sich weitere Familienmitglieder anschließen wollten. Dabei hatte er vor allem an seinen Bruder Paul in New York gedacht, an dessen Frau Gertrud und deren Söhne Herbert und Kurt, die in Deutschland auf den Vater warteten. Gertrud hatte Amerika 1914 mit den Kindern verlassen, wenige Tage vor Ausbruch des Weltkrieges. Paul hatte es nicht mehr rechtzeitig über den Atlantik geschafft. Er sei aufgehalten und zurückgeschickt worden, hatte er geschrieben, er komme nach, sobald der Krieg vorbei sei.
Danach hatte er nur noch vereinzelt Nachrichten zu Weihnachten geschrieben, und schließlich kam gar nichts mehr.
Der Regen lief kitzelnd in seinen Kragen, und Otto wischte mit der Hand die Tropfen vom Nacken.
Die letzte Postkarte war vor drei Jahren eingetroffen. Paul hatte von den Schwierigkeiten geschrieben, eine Arbeit zu finden, und Otto sah ihn schon irgendwo im Straßengraben sitzen, die Hand bettelnd vorgestreckt, auf Münzen hoffend oder auf ein Stück Brot. Als er selbst vor neunzehn Jahren einige Wochen in New York verbrachte, hatte er die Not in den Armenvierteln an der Lower East Side mit eigenen Augen gesehen. Die vielen in Lumpen gekleideten Bettler, von denen nicht wenige spurlos verschwanden, ohne dass jemand nach ihnen fragte.
Der Gedanke, Paul könne etwas zugestoßen sein, quälte ihn sehr.
Er hätte dem Bruder gerne die Heimkehr ermöglicht, obwohl er nach der großen Inflation vor zwei Jahren selbst kaum noch das Geld für eine Schiffspassage besaß. Doch er hätte sein letztes Hemd dafür gegeben, dass Herbert und Kurt, die nun bald ins Jugendalter kamen, ihren Vater wiedersahen.
Weil er die Ungewissheit nicht länger aushielt, hatte er vor einiger Zeit eine Detective Agency damit beauftragt, mehr über Pauls Verbleib herauszufinden. Es war die Idee von Joseph gewesen, dem ältesten der Brüder, der mit seiner Frau Margaret und den beiden Kindern in Portland lebte und nach einer berufsbegleitenden Fortbildung nun als Jurist arbeitete.
»Paul hat mich vor sechs Jahren noch gebeten, als Leumund für seinen Einbürgerungsantrag auszusagen, weil er als Deutscher sonst keine Arbeitsstelle bekäme«, hatte Joseph geschrieben. »Er ist also offiziell registriert.«
In diesem Moment spürte Otto, wie seine Tochter ihn am Ärmel zog.
»Papa, es regnet.«
Er wandte sich ihr zu. Von den dunkelbraunen Locken tropfte der Regen, und sie hatte den Mund schmollend verzogen.
Unwillkürlich musste Otto lächeln. Aus den rehbraunen Augen sah ihm seine verstorbene Frau entgegen. Und doch gab es tausend Dinge, die Thea von Theresia unterschieden. Während seine Frau ein scheues, sanftes Wesen hatte, besaß ihre gemeinsame Tochter eine ansteckende Fröhlichkeit und war derart lebhaft, dass das Kindermädchen Frau Riek manchmal Mühe hatte, sie zu bändigen.
»Ist gut, Theachen«, sagte er.
Otto legte das Rosenbouquet vor dem Grabstein ab und hielt in einem letzten Gedenken inne. Dann nahm er seine Tochter an der Hand, und sie gingen den schmalen Pfad zurück zum Hauptweg, wo Frau Riek mit aufgespanntem Schirm auf sie wartete.
»Sie sehen blass aus, Herr Lagerfeld«, stellte die Kinderfrau besorgt fest und reichte ihm den Schirm. »Wollen Sie sich nicht lieber freinehmen und mit uns beiden nach Hause fahren ?«
»Nein«, sagte Otto bestimmt. Er nahm den Schirm entgegen und hielt ihn so, dass sie alle drei darunter Platz fanden. »Die Arbeit wartet, ich bin schon viel zu spät dran. Ich bringe Sie aber noch zum Bus.«
Frau Riek nickte. Sie kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass eine Entgegnung zwecklos war.
Otto konnte ohne Arbeit nicht sein. Vor allem nicht in einer schwierigen Situation wie dieser.
Erst gestern hatte er erfahren, dass mehrere Tausend Kisten Carnation-Kondensmilch im Wert von einhunderttausend Reichsmark, die sein Exportmitarbeiter Carl Wübbens für die Niederlassung in Harbin bestellt hatte, nicht mehr aufzufinden waren.
Scheinbar hatte irgendjemand beim chinesischen Zoll geschlafen oder vielleicht auch nur die Hand aufgehalten, weshalb man die Kisten an einen ihrer Korrespondenten vor Ort übergeben hatte, ohne vorher das Geld einzufordern. Und dieser behauptete nun, die Lieferung niemals erhalten zu haben.
Wübbens, der seit dem vergangenen Jahr im chinesischen Harbin lebte, hatte zugesichert, sich um die Sache zu kümmern, und Otto hoffte, es möge ihm gelingen.
Wenn nicht, dann wäre alle Arbeit, die er seit seiner Rückkehr aus sibirischer Kriegsgefangenschaft in den Aufbau seines Unternehmens Lagerfeld & Co. gesteckt hatte, welches er gemeinsam mit seinem Bruder Hans führte, umsonst gewesen.
Als das Taxi vor dem August-Heerlein-Stift, An der Alster 52, hielt, in dem das Büro von Lagerfeld & Co. lag, hatte der Regen weiter an Kraft gewonnen. Auf der Straße hatten sich tiefe Pfützen gebildet, in denen Blütenblätter trieben wie führerlose Kähne. Otto stieg aus und wich vor einem Fahrradfahrer zurück, der über den schlammig gewordenen Weg schlingerte.
Den Hut tief ins Gesicht gezogen, hastete er durch den Regenschleier zu dem herrschaftlichen Gebäude mit dem säulenumrahmten Portal. Mit einer energischen Bewegung riss er die Tür auf und wäre beinahe mit zwei älteren Damen zusammengestoßen, die erschrocken zurückwichen.
»Entschuldigung, die Damen !«, sagte Otto und lupfte seinen Homburger, von dessen Krempe das Wasser nur so heruntertropfte.
»Aber Herr Lagerfeld, Sie sind ja vollkommen durchnässt«, bemerkte die größere der beiden und richtete ihren aus der Mode gekommenem Topfhut. »Sie sollten achtgeben, dass Sie sich keine Grippe holen.«
»Nun bin ich ja im Trockenen, werte Frau Konsul«, antwortete er höflich und hielt den Damen die Tür auf. »Ich hoffe, Sie haben einen Schirm dabei ? Es gießt junge Katzen und Hunde.«
»Wie bitte ?«, fragte die Frau Konsul, die unter dem Vordach stehen blieb und einen Blick in den Himmel warf. »Katzen und Hunde ?«
»Das sagt man so im fernen Amerika«, hörte Otto ihre Begleiterin raunen, während er die Tür wieder losließ. »Der Herr Lagerfeld ist weit gereist. Venezuela, Kolumbien, New York und San Francisco. Sogar in Sibirien soll er gelebt haben.«
Die Tür fiel ins Schloss, und es war wieder still im Treppenhaus. Nur Ottos Schritte hallten von den gekachelten Wänden wider, als er die Stufen zu den oberen Stockwerken erklomm und den Gang zu den Büroräumen durchmaß. Rasch, bevor eine der Bewohnerinnen die Tür aufreißen und ihn in ein Gespräch verwickeln konnte.
Das August-Heerlein-Stift war voll einsamer Witwen und Jungfrauen, die ihrem Lebensende entgegensahen und sich fürchterlich langweilten. Alles Damen aus gebildeten Kreisen, denen man Freiwohnungen gewährte, weil ihre verbliebenen Mittel gerade so ausreichten, um den Lebensunterhalt zu bestreiten.
Als die Regierung nach dem verlorenen Krieg zum Wiederaufbau des Landes und zur Begleichung der Reparationsforderungen seitens der Siegermächte vermehrt Geld druckte und daraufhin eine galoppierende Inflation einsetzte, war das Stiftungsvermögen auf ein Nichts zusammengeschrumpft. Die Verwalter hatten sich gezwungen gesehen, die ungenutzten Räume zur Vermietung an Firmen freizugeben, um den Bestand zu sichern.
Otto hatte sofort zugegriffen. Günstiger konnte man nicht an eine derart exquisite Adresse kommen, noch dazu mit Blick über die Alster. Und die Damen zeigten sich begeistert über die neuen Mieter, die so viel zu erzählen hatten.
Aber an manchen Tagen war die Zeit zu knapp für einen Plausch. So wie heute.
Die Firma Lagerfeld & Co. hatte ihre Räume im Stock C, Wohnung dreiundzwanzig und vierundzwanzig, zusammen mit dem Generaldepot für die Chartreuse-Liköre aus Tarragona, das sein Bruder Johannes, den alle nur Hans nannten, von ihrem Vater übernommen hatte. Es waren sehr kleine Wohnungen, die nur aus einem Zimmer und einer Abstellkammer bestanden. Dazu eine Kochnische und ein Bad, in denen sie Liköre und Milchkonserven lagerten, und ein Vorraum für die Garderobe.
Als Otto die Firma vor sechs Jahren gemeinsam mit Hans gegründet hatte, da erhoffte er sich, bald in ein stattlicheres Büro zu ziehen, mit einem extra Raum für die Buchhaltung und die Spedition. Aber auch an ihnen war die Inflation nicht spurlos vorbeigegangen. Bald konnten sie die am Zoll auf Abholung wartende Ware, die man in Amerika eigens für sie mit dem Glücksklee-Etikett versehen hatte, nicht mehr zahlen, weil der Dollar von Tag zu Tag an Wert gewann. Am Ende mussten sie für einen Warenwert von einem Dollar rund vier Billionen Mark hergeben und bekamen dafür nicht einmal eine Kiste Kondensmilch. In jenen Tagen entließen sie etliche Angestellte, und das mühsam ausgebaute Netz an Vertretern dünnte aus, weil es sich kaum noch jemand leisten konnte, durch die Lande zu reisen.
Hätte Otto nicht das Haus im Sülldorferweg nördlich des Blankeneser Bahnhofes besessen, dessen Kredit durch die immense Geldentwertung mit einem Schlag abbezahlt war, sie hätten vor dem Nichts gestanden.
Inzwischen hatte sich die Lage wieder stabilisiert, allmählich ging es voran. Weil Otto unermüdlich durch Deutschland gereist war, um neue Vertreter anzuwerben, hatten sie in den vergangenen Monaten sogar ein sattes Plus gemacht.
Das Harbin-Geschäft sollte nun die Krönung werden. Noch in der vergangenen Woche hatte es so ausgesehen, als wäre Carl Wübbens mit seinem Bemühen erfolgreich, die alten Kunden aus den Wladiwostoker Zeiten zu reaktivieren. Es wäre die größte Lieferung der vergangenen Jahre und hätte der Firma mit einem Schlag ein Vermögen eingebracht. Otto hatte sich bereits am Ziel seiner Träume gesehen. Er wollte seiner Tochter sogar eine dieser Gliedergelenkpuppen mit echtem Haar schenken, die es bei Steinberg & Co. am Neuen Wall zu kaufen gab. Und nun drohte ausgerechnet das Harbin-Geschäft ihr Untergang zu werden.
Als Otto die Tür öffnete, las er in der Miene seiner Angestellten, dass sich an der Dramatik der Lage nichts geändert hatte. Der Lehrjunge und der Herr von der Spedition blickten ihm mit müden Gesichtern entgegen, und Wilhelm Dylewski, den er aus seiner Zeit als Lebensmittelbeschaffer beim Rheinisch-Westfälischen Städteverband mitgebracht hatte, gab sogar einen lauten Stoßseufzer von sich.
»Keine Nachricht aus Harbin ?«, fragte Otto ihn, während er den tropfnassen Mantel an den Garderobenhaken hängte.
»Schon, aber keine gute«, antwortete stattdessen Hans, der durch die Verbindungstür aus dem Bereich des Chartreuse-Depots getreten war. Sein Glasauge schien vor Aufregung ein wenig verrutscht. »Wübbens behauptet, die Ware sei wie vom Erdboden verschluckt.«
»Was soll das heißen ?«, hakte Otto nach. »Mehrere Tausend Kisten Dosenmilch können ja nicht so einfach verschwinden ! Irgendjemand muss sie doch fortgebracht haben.«
»Auf den Frachtpapieren steht die Unterschrift unseres Korrespondenten. Aber der behauptet, Wübbens habe sie gefälscht.«
»Er lügt !«
Eine beklemmende Stille trat ein, endlich gab Hans ein Schnauben von sich. »Hast du schon mal daran gedacht, dass dein verehrter Wübbens dich übers Ohr gehauen hat ?«
»Niemals.«
Otto presste die Lippen aufeinander. In all den Jahren hatte er gelernt, dass man sich bei der Besetzung einer Niederlassung nur auf fähige Männer verlassen durfte, weil sonst die ganze Firma leicht zum Einsturz kam. Carl Wübbens war schon in Wladiwostok sein engster Mitarbeiter gewesen, zudem hatten die beiden viele Jahre gemeinsam in sibirischer Kriegsgefangenschaft verbracht. Er konnte nicht glauben, dass sich der Mann, der ihm stets ein guter Freund gewesen war, vom Wert der Ware hatte verführen lassen. Wübbens, ausgerechnet ! »Ich vertraue ihm.«
»Du vertraust einem Menschen, den du auf der Flucht in Sibirien zurückgelassen hast«, entgegnete Hans. »Du weißt nicht, was danach geschehen ist. Der Krieg hat aus nicht wenigen Männern seelische Krüppel gemacht.«
»Wer auch immer die Verantwortung für den Verlust trägt«, mischte sich Dylewski ein und lehnte sich mit einem Stöhnen im Stuhl zurück, »die Ware bekommen wir ganz sicher nicht wieder. Lagerfeld & Co. ist erledigt ! Die American Milk Products Corporation will uns für den Schaden haftbar machen. Wenn wir den ausstehenden Betrag nicht bis zum Ende des Monats anweisen, werden sie ihn einklagen. Woher zum Himmel sollen wir einhunderttausend Reichsmark nehmen ?«
»Uns bleiben noch acht Tage.« Otto atmete tief durch. »Vielleicht geschieht ja doch ein Wunder.«
»Und wenn wir uns weigern, die Summe zu begleichen ?«, schlug Hans vor. »Was können wir denn dafür, dass sie die Ware ohne Bezahlung abgegeben haben. In Hamburg bekommen wir schließlich auch keine einzige Dose ohne Vorkasse aus dem Zoll. Kein Gericht der Welt wird uns die Schuld dafür auflasten.«
Otto schüttelte den Kopf. »Das wäre nicht ehrenhaft. Wir haben die Ware bestellt, und einer unserer Korrespondenten hat das quittiert. Außerdem wären wir dann die Generalvertretung für die Carnation-Dosenmilch los.«
»Aber die Firma wäre gerettet ! Es gibt auch noch andere Lieferanten aus Amerika. Libby’s zum Beispiel. Oder Bordens.«
»Nein«, sagte Otto fest. »Kein Kondensmilchhersteller der Welt will eine Handelsfirma unter Vertrag nehmen, die sich um die Zahlung einer Lieferung drückt. Es wäre das Ende für unsere eigene Marke, die Glücksklee.« Er sah seinen jüngeren Bruder ernst an. »Hast du denn unseren Traum vergessen, unser großes Ziel ? Die Glücksklee-Dosenmilch hat das Potenzial, zum größten Verkaufsschlager des ganzen Landes zu werden. Hausfrauen, Mütter, Versorgungsämter ! Und mit Einführung der gezuckerten Kondensmilch unter dem Namen Goldstern decken wir obendrein den Süßwarenmarkt ab. Nun ist dieser Traum vielleicht wieder in die Ferne gerückt, aber wir dürfen ihn nicht vorschnell begraben. Wir haben die Arbeitskraft, die Verbindungen und den Geschäftssinn.«
»Es war dein Traum, Otto. Nicht meiner. Ich bin dafür, auszusteigen und noch einmal neu zu starten. Schließlich haben wir nach wie vor das Chartreuse-Depot. Und sicher finden wir auch noch einen anderen Artikel, der sich in Deutschland gewinnbringend vertreiben lässt.«
»Aber kein Artikel hat dasselbe Potenzial wie amerikanische Kondensmilch«, widersprach Otto. »Sie ist von unvergleichlicher Qualität. Wenn erst in der breiten Bevölkerung bekannt ist, was man alles damit tun kann – Kaffee weißen, Süßspeisen und Mayonnaisen verfeinern, Säuglinge ernähren –, dann wird sie sich rasch wachsender Beliebtheit erfreuen. Ja, es stimmt, der Weg ist holpriger als erwartet, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir es damit sehr weit bringen werden.«
Hans atmete tief ein und rieb sich über das Gesicht. »Auf dem Firmenkonto liegt nicht einmal ein Viertel des eingeforderten Betrages. Wir müssten Schulden aufnehmen, um die Forderung der Amerikaner zu begleichen, und das will ich nicht. Gerade jetzt, da ich geheiratet habe. Meine Frau bringt mich um, wenn ich ihr das erzähle.«
»Dann werde ich dem Inhaber der Carnation Milk Company nach Delaware kabeln«, schlug Otto vor, »und Elbridge Stuart an die guten alten Zeiten erinnern. Daran, wie ich den Umsatz in Sibirien versechsfacht habe. Vielleicht finden wir gemeinsam eine Lösung.«
»Für die Exporte ist aber das Kontor in New York zuständig«, warf Dylewski ein. »Und da hat inzwischen nicht mehr nur die Carnation das Sagen, sondern auch die Pet Milk Company. Da wird der alte Stuart nicht viel ausrichten können.«
»Ich will es zumindest versuchen«, sagte Otto und nahm hinter seinem Schreibtisch Platz. »Mister Stuart ist ein Kaufmann vom alten Schlag. Bei aller Arroganz, mit der man seit dem Weltkrieg auf uns Deutsche blickt: Er weiß, dass es keinen besseren Verkäufer gibt als mich. Es ist in seinem Interesse, uns nicht untergehen zu lassen.«
Damit nahm er den Hörer von der Gabel und ließ sich mit dem Telegrafenamt verbinden.
In den folgenden Tagen hob Otto stets den Kopf, wenn er jemanden über den Gang laufen hörte. Bald war er geübt darin, die Schritte zu unterscheiden. Jene, die zu den Damen der benachbarten Wohnungen gehörten, die sich langsam vortastend bewegten oder energisch trippelnd. Der Telegrammbote dagegen hatte einen raschen Schritt, wobei er leicht humpelte. Immer wenn er an der Tür klopfte, sprang Otto auf und eilte ihm entgegen, um jedes Mal enttäuscht wieder Platz zu nehmen, weil die überbrachte Nachricht nicht die sehnlich erwartete war.
In der Nacht wälzte er sich im Bett und rang um eine Lösung. Wenn Stuart ihm nicht zur Seite sprang, dann gab es nur einen Weg, die Firma zu retten: Er selbst müsste Geld bei der Bank aufnehmen und mit dem Haus bürgen, das er 1921 für Theresia und sich erworben hatte.
Ihre Familienburg …
Was, wenn es am Ende doch schiefging ? Natürlich könnte er mit Thea zu seinen Eltern in die Voßstraße ziehen, wo auch seine Schwestern Tilla und Lisbeth wohnten. Aber wer würde sie dann versorgen ? Schon jetzt gab er den größten Teil für ihren Unterhalt dazu, weit mehr als sein Bruder Hans.
Der Gedanke daran, was der Vater wohl dazu sagen würde, ließ ihn wach liegen.
Tönnies Johann Otto Lagerfeld hatte sein Leben lang nur gearbeitet und es mit seiner Weinhandlung und der Generalvertretung des Liqueur des Pères Chartreux zu einem gewissen Wohlstand gebracht, der, nachdem er das Geschäft im Jahr 1919 an seinen jüngsten Sohn Hans übergeben hatte, nun merklich schrumpfte. Ein Umstand, der nicht etwa an Hans’ mangelndem Fleiß lag, sondern an den Auswirkungen des Weltkrieges. Was den Vater nicht daran hinderte, spitze Bemerkungen darüber zu machen.
Gemeinsam vermochten sie die drohende Armut der Eltern abzuwenden. Mit dem Ende der Dosenmilch-Vertretung wäre sie jedoch besiegelt.
Versagt, dachte er, in Vaters Augen hätte ich versagt.
Am Tag bevor das Ultimatum auslief, entschied Otto sich dazu, alles zu riskieren. Weil die Bank ihm einen derart großen Kredit gewiss nicht ohne eine ausgiebige Prüfung bewilligen würde, beschloss er, die Amerikaner zunächst um Aufschub zu bitten. Er war gerade dabei, den entsprechenden Text zu formulieren, als der Telegrammbote nach kurzem Klopfen den Kopf in sein Büro steckte.
»Herr Lagerfeld ? Ein Telegramm aus New York. Wenn Sie mir bitte hier den Empfang quittieren.«
New York. Nicht Delaware, wo die Zentrale der Carnation lag.
Unschlüssig starrte Otto auf das Kuvert, das als Absender das Exportkontor der American Milk Products Corporationtrug. Schließlich zog er das Schreiben hervor und las den anderen den Text in deutscher Übersetzung vor.
WESTERNUNIONTELEGRAM
NEWYORK, April 29, 1925
Auf Anweisung von Herrn Stuart teilen wir Ihnen mit, dass der Ausfall laut Zusage unserer Versicherung von der Police gedeckt ist. Unter der Voraussetzung, dass Sie sämtliche Geschäfte mit dem Ausland aussetzen und sich künftig ausschließlich um den Verkauf in Deutschland konzentrieren, verzichten wir auf eine Ausgleichszahlung.
Hochachtungsvoll
P. R. McKee
Jubel brach los, Hans klopfte Otto anerkennend auf die Schulter, und Dylewski ergriff seine Hand, um sie wie eine Pumpe auf und ab zu schütteln.
»Das haben Sie prima gemacht, mein lieber Herr Lagerfeld.«
Weil Otto an jenem Tag noch lange mit Hans zusammensaß und auf den Erfolg anstieß, kam er erst spät nach Hause. Frau Riek wärmte ihm das Abendessen auf, und er dankte dem Herrgott, dass sie mit einem Seemann verheiratet war und sich während der mehrere Monate währenden Abwesenheit ihres Mannes auch abends um Thea und um den Haushalt kümmerte.
»Die Post habe ich Ihnen auf den Sekretär gelegt«, sagte Frau Riek und wünschte ihm eine gute Nacht.
Nach dem Essen warf Otto einen Blick in Theas Zimmer. Die Kleine schnaufte leise, er trat an ihr Bett und betrachtete zärtlich ihr Gesicht. Seit das Hamburger Landgericht ihn auf Vorschlag der Handelskammer zum ehrenamtlichen Handelsrichter ernannt hatte, kam es immer häufiger vor, dass er seine Tochter mehrere Tage nicht sah. Meist verließ er das Haus noch vor dem Morgengrauen und betrat es erst wieder, wenn sie bereits zu Bett gegangen war. Er selbst brauchte nicht viel Schlaf. Nur manchmal, wenn der Tag zu lang geworden war, nickte er in der Bahn nach Blankenese ein und wurde sogar einmal vom Schaffner geweckt, der an der Endstation durch die Reihen ging.
Sachte zog Otto die Tür wieder zu. Dann setzte er sich an den Sekretär und ging im Licht der Tischlampe die private Post durch, die Frau Riek ihm hingelegt hatte.
Als er den Umschlag mit dem New Yorker Poststempel sah, schoss sein Puls in die Höhe. Dieser Brief, an seine Privatadresse gerichtet, konnte nur einen Absender haben. Und tatsächlich entdeckte er auf der Rückseite den Namen der Detective Agency, die er vor Wochen beauftragt hatte.
Hastig schob er den Brieföffner ins Kuvert und riss es auf, entfaltete das Schreiben mit bebenden Fingern.
Der Inhalt bestand aus der Kopie eines offiziellen Dokuments und einem kurzen Schreiben, das Otto mit ungläubigem Kopfschütteln las.
Reference: Whereabouts Paul Lagerfeld
We herewith present the details.
Resident: Yonkers, New York. 15, Hancock Avenue
Profession: Selling ship paintings
Yonkers im Bundesstaat New York …
Es klang nach Ländlichkeit, nach trutzigen Häuschen mit Veranden und Vorgärten. Nach einem Zuhause und nicht nach einer Notunterkunft auf dem Weg zurück in die Heimat.
Die anfängliche Erleichterung darüber, dass sein Bruder noch lebte, schlug in Verärgerung um. Nein, bei dem Bezeichneten mochte es sich vielleicht um einen Mann namens Paul Lagerfeld handeln, aber derjenige war niemals sein Bruder.
Otto betrachtete die beigelegte Kopie einer Volkszählung aus dem Jahr 1920. Damals hatte Paul angeblich in der St. Lawrence Avenue in der Bronx gelebt, gemeinsam mit einer in New York geborenen Frau namens Josephine, deren Vater den Angaben nach ebenfalls aus Deutschland stammte. Besagte Josephine aber war ganz offiziell Pauls Frau, eine verheiratete Lagerfeld !
Das ist unmöglich, dachte Otto. Paul war nach wie vor mit Gertrud verheiratet. Und als ob es nicht noch schlimmer kommen könnte, hatte dieser Paul einem weiteren Dokument zufolge mit der im gemeinsamen Haushalt lebenden Frau inzwischen sogar Kinder, einen dreijährigen Jungen namens Theodore und eine Tochter, Dorothy, die fünf Jahre alt war.
Otto rieb sich die Stirn. Schwankend zwischen Empörung und Ratlosigkeit überflog er noch einmal die dem Anschreiben beiliegenden Dokumente.
Der in Yonkers lebende Paul Lagerfeld hatte nicht nur dasselbe Alter wie sein Bruder, er war auch in Hamburg geboren und trug der Detective Agency zufolge ebenfalls den Zweitnamen Johannes.
Es war kein Zweifel möglich. Während sich Frau und Söhne hier in Hamburg um sein Wohlergehen sorgten und noch immer auf seine Heimkehr hofften, hatte Paul sich längst ein neues Leben erschaffen.
Mit einem Kopfschütteln lehnte Otto sich im Stuhl zurück. Es war unfassbar ! Sein eigener Bruder, der rebellische Paul, war ein Bigamist.
»Die arme Gertrud«, flüsterte er. Wie sollte er ihr das nur beibringen ? Wie seinen Neffen Herbert und Kurt ? All ihr Hoffen, all ihr Sehnen nach dem Vater, dem Ehemann – vergeblich.
Otto spürte eine heiße Wut in sich aufsteigen. Wie konnte Paul ihnen das nur antun !
3 BOBERG
Wenn Gertrud am frühen Morgen beim Klingeln des Weckers aufschreckte, hoffte sie manchmal, aus diesem Alptraum zu erwachen. Dann blieb sie reglos im Bett liegen, die Lider fest geschlossen, und stellte sich vor, wieder in Groß Flottbek zu sein. In der herrlichen Villa an der Ecke zur Parkstraße, vor deren Fenstern Brokatvorhänge und Gardinen aus französischer Spitze hingen. In ihrem Elternhaus mit den Kronleuchtern, den Mahagonimöbeln und dem Service aus feinstem chinesischem Porzellan, mit dem das Personal den Tisch auch unter der Woche eindeckte. Mit dem stets nach der neuesten Mode gefüllten Kleiderschrank.
In ihren Träumen war ihr Vater noch immer der erfolgreiche Korkhändler Cornelius Schmidt, der über ein unerschöpflich scheinendes Vermögen verfügte und der jedem seiner verbliebenen drei Kinder ein Erbe von mindestens dreihunderttausend Mark versprochen hatte.
Doch wenn das Morgenlicht sich durch die nackten Fenster stahl und hellrot durch Gertruds Lider drang, dann wusste sie, dass die Realität eine andere war. Ihr Vater hatte den Korkhandel nach Ende des Weltkrieges verkauft und die Villa gleich mit. Das Geld hatte er zur Bank gebracht, wo es angeblich so sicher war wie in Abrahams Schoß, und sie waren zur Miete ins Pinneberger Quellental gezogen, von wo aus der Vater sich nach einem neuen, kleineren Haus umsehen wollte.
Gertrud war nur ungern aus dem wohlhabenden Groß Flottbek weggezogen. »Was, wenn Paul mir schreiben will ? Er kennt ja nicht einmal die neue Adresse !«
»Der Postbote wird alle Briefe an die Lagerfelds in die Voßstraße weiterleiten«, hatte ihre Mutter geantwortet. »Dafür habe ich gesorgt.«
Das Haus im Quellental war hübsch gewesen, wenn auch nicht ganz so mondän. Aber das hatte sie nicht gestört. Irgendwann, wenn Paul aus Amerika zurückkam, würde der Vater ihr einen Teil des Erbes vorab auszahlen, das hatte er versprochen. Von dem Geld würden sie sich dann ein eigenes Haus kaufen. Sie würde die Fenster mit denselben Gardinen aus französischer Spitze behängen und von ihrem eigenen Porzellan essen.
Gertrud seufzte. Wie unbeschwert sie damals gewesen war. Wie naiv.
Aber wer hätte auch ahnen können, dass die Inflation das gesamte Vermögen innerhalb weniger Monate vernichten würde. Dass die vielen Millionen bald nur noch einen Laib Brot wert waren. Und schließlich nicht einmal mehr das.
Ihre Mutter, die auf einem Bauernhof in Dithmarschen aufgewachsen war und sich seit ihrer Zeit als Dienstmagd in London Mary nannte, reagierte ganz pragmatisch. Während der Vater auf den das ganze Land knebelnden Friedensvertrag von Versailles schimpfte und auf die Unfähigkeit der verhandelnden Politiker, trug Mary Stück für Stück das Silberbesteck und die Kristallgläser zum Schwarzmarkt und kehrte mit Kartoffeln, Rüben und manchmal sogar mit einem Huhn zurück.
Sie war es auch, die damals, als sie von einem auf den anderen Tag ihre Mietwohnung verloren, ein Zimmer in Boberg auftat, einem kleinen Dorf am nördlichen Geestrand des Elbtals hinter der Hamburger Stadtgrenze, wo sie nun zu fünft leben würden: die Eltern Schmidt, Gertrud und ihre beiden Söhne.
Es war ein kalter Februartag, als sie mit ihren wenigen Habseligkeiten vor dem reetgedeckten ehemaligen Bauernhaus der Eheleute Vorrath standen.
»Hier sollen wir wohnen ?«, rief Gertrud entsetzt aus.
Es war so furchtbar einfach und ärmlich, dass sie es kaum aushalten mochte.
Der Vater hatte seinen einzigen Anzug mit Weste und breit gebundener Krawatte angezogen. Man müsse stets den allerbesten Eindruck hinterlassen, hatte er gesagt, egal in welcher Lage. Jetzt betrachtete er das Haus, schob mit einem Aufseufzen die Schiebermütze nach hinten und strich sich über den gezwirbelten Oberlippenbart.
»Nun denn«, sagte er endlich und betätigte den Türklopfer.
»Ab jetzt müsst ihr mit anpacken«, sagte Mary zu Gertrud, als sie nach der kühlen Begrüßung durch die Hausherrin das gemietete Zimmer bezogen.
»Was bedeutet das ?«
»Du wirst ab heute den Haushalt der Vorraths in Ordnung halten. Und die beiden Jungs stechen im Weidemoor Torf, damit es im Haus warm bleibt.«
»Ich soll für andere putzen ?« Gertrud stellte empört die Koffer ab. Sie sah sich in dem Zimmer um, das eher ein zugiger Wintergarten war, in dem nur ein Bett und ein Schrank standen, dazu zwei nackte Matratzen, aus denen Rosshaar quoll. »Was für ein schäbiger Ort. Ist es denn nicht genug der Demütigungen ?«
»Es wird Zeit, dass du von deinem hohen Ross herunterkommst«, entgegnete Mary, die bettelarm gewesen war, bevor sie ihren Mann kennenlernte. »Wir hätten es weit schlimmer treffen können. Hier in Boberg gibt es viele Bauern, bei denen wir Eier, Milch und Kartoffeln bekommen, so müssen wir wenigstens nicht hungern. Und hast du nicht den Buchenrauch gerochen, der aus der großen Räucherei herüberzieht ? Sogar aus Hamburg kommen die Schlachter hierher, um ihre Würste und Schinken räuchern zu lassen. Da fällt, wenn du ganz lieb fragst, sicher mal ein Stück für uns ab.«
Gertrud sah ihre Mutter entsetzt an. »Wie kannst du jetzt ans Essen denken ? Sieh dir nur mal die stockfleckigen Tapeten an und die gesprungenen Fensterscheiben. Wie sollen hier bloß fünf Personen Platz finden ? Nein, Mutter, das geht nicht, hörst du ? In diesem Zimmer wohne ich keinen einzigen Tag.«
Mary stützte die Hände in die breiten Hüften, und als sie antwortete, klang ihre Stimme scharf und unerbittlich. »Du kannst es dir nicht leisten, krüsch zu sein. Es sei denn, du bevorzugst ein Leben auf der Straße.«
Gertrud war den Tränen nahe, und sie war drauf und dran, sich mit ihrer Mutter zu überwerfen. Doch dann beobachtete sie durch die Scheiben ihre beiden Jungen, die den Garten erkundeten und sich dabei lachend anstießen. Also schluckte sie die Tränen herunter und versprach, sich zusammenzureißen.
Kurt wurde also in der Grundschule Boberg eingeschult, und Herbert kam auf die weiterführende Schule in Bergedorf. Gertrud kochte, putzte und bügelte, während sie versuchte, die Streitigkeiten zu ignorieren, die das Vermieterehepaar lautstark austrug. Dabei stellte sie sich insgeheim immer auf die Seite des Hausherrn. Walter Vorrath, ein feister kleiner Mann, der mit Regenmänteln handelte, war zwar wortkarg und oft auch pampig, aber wenn man höflich blieb, war gut mit ihm auszukommen. Seine Frau Käthe hingegen mochte sie nicht. Sie war laut und schrill und behandelte ihre Untermieter mit Geringschätzung.
»Du liebe Güte, Sie sind sogar zu dumm zum Putzen«, sagte sie, als Gertrud einmal tiefe Kratzer im Spülbecken hinterließ. »Sie können froh sein, dass mein Mann Sie und Ihre Bagage leiden kann. Ich hätte Sie längst vor die Tür gesetzt.«
Gertrud verkniff sich eine Antwort. Das Wort Bagage traf in ihren Augen eher auf Käthe Vorraths Familie zu. Deren Bruder, der Altonaer Stadtverordnete Werner Dietz, war Führer der Völkischen und führte sich bei seinen Besuchen immer wie ein Flegel auf. Seit er während eines Abendessens betrunken und polternd zu ihr in die Küche gekommen war und sie in die Ecke gedrängt hatte, um mit schwitzigen Händen über ihre weiblichen Rundungen zu fahren, ging sie ihm geflissentlich aus dem Weg.
Als Anfang April die Streitigkeiten der Eheleute eskalierten und zunehmend in Handgreiflichkeiten endeten, verzogen sich die Jungen immer öfter ins Freie, und Gertrud flehte den Herrgott an, er möge dem Gezanke endlich ein Ende bereiten.
Und als hätte der Herrgott ihre Gebete erhört, zog Käthe Vorrath, nachdem eines Abends jede Menge Porzellan geflogen und ein Stuhl zu Bruch gegangen war, mit einem bis zum Platzen gefüllten Koffer aus.
»Nun hast du endlich erreicht, was du wolltest«, schrie sie über den Flur. »Ich reiche die Scheidung ein. Aber glaub ja nicht, dass du ungeschoren davonkommst. Ich werde dich für all die Misshandlungen büßen lassen !«
Kurz darauf flog die Tür so heftig ins Schloss, dass es durch das ganze Haus dröhnte.
Die Familie atmete auf, weil nun endlich Ruhe eingekehrt war. Auch Herr Vorrath schien aufzuleben. Er holte sogar sein altes Motorrad hervor und ließ Kurt darauf eine Runde drehen, ganz ohne Hilfe, und ihr Sohn lachte dabei über das ganze Gesicht wie seit vielen Monaten nicht mehr.
Da Herr Vorrath nun weniger Platz benötigte, überließ er Gertrud und den Jungen das Schlafzimmer, wo sie nun endlich ein richtiges Bett und einen eigenen Kleiderschrank hatten. Um den Mietaufschlag zahlen zu können, schickte sie die Kinder zum Arbeiten auf den benachbarten Bauernhof. Schließlich waren sie inzwischen alt genug, etwas zum Lebensunterhalt beizutragen.
Draußen erklang jetzt das Brummen eines Mähdreschers, und Gertrud öffnete die Augen. Das fahle Morgenlicht drang durch die zugezogenen Gardinen, und sie setzte sich im Bett auf.
Voller Zuneigung betrachtete sie ihre Söhne, die neben ihr tief und fest schliefen. Auf der Stirn des bald zwölfjährigen Kurt prangte eine schlecht verheilte Platzwunde, die er sich bei einer Prügelei auf dem Schulhof zugezogen hatte. Wieder einmal, dachte Gertrud sorgenvoll. Es kam häufiger vor, dass er verdreckt und mit aufgeschürften Knien von der Schule nach Hause kam, das ausgeprägte Kinn stolz vorgereckt, weil er sich den Sticheleien seiner neuen Mitschüler entgegengestellt hatte. Er erinnerte sie an den jungen Paul, der ebenfalls keiner Rauferei aus dem Weg gegangen war.
Wie brav hingegen war der ein Jahr ältere Herbert, der still und in sich gekehrt war und keinen Ärger machte.
Ihr Blick fiel auf das Hochzeitsfoto, das sie auf den Nachttisch gestellt hatte, damit Herr Vorrath ihr die Geschichte von der treu wartenden Ehefrau glaubte, deren geliebter Gatte aus Amerika zurückkommen würde, sobald er genügend Geld zusammenhatte. Obwohl sie längst ahnte, dass sie ihn niemals wiedersehen würde.
»Paul …«, flüsterte sie, und es kostete sie einige Mühe, die aufsteigende Traurigkeit herunterzuschlucken.
Er war ein so hübscher junger Kerl. Das Haar dicht und dunkel, die Lippen geschwungen und mit einem ausgeprägten Amorbogen. Als sie ihn kennenlernte, war er unbändig und wild gewesen. Ein Mann, nach dem sich die anderen Frauen umdrehten. Und sie, Gertrud geborene Schmidt, hatte ihn sich geschnappt !
Elf Jahre war es her, dass sie sich in Portland von ihm verabschiedet hatte. Es war eine lange Zeit, viel zu lang für einen Mann wie Paul. Es wäre dumm anzunehmen, dass er seit so vielen Jahren enthaltsam lebte.
»Wie konntest du mich nur so im Stich lassen«, flüsterte sie.
Mit dem Handrücken wischte sie die Tränen fort, die ihr die Wange hinabkullerten.
Sie musste weiterleben, es nützte ja nichts.
Im Mai trat völlig unverhofft ein neuer Mann in Gertruds Leben, und zunächst wusste sie kaum, wie ihr geschah.
Es war ein Sonntag, und sie wanderte mit Kurt und Herbert durch das kleine Wäldchen und am Quellbach und den Sümpfen vorbei bis zum Geestrand des Elbtals. Die Jungen ließen ihre selbstgebauten Drachen steigen, als ihnen Kurts Lehrer entgegenkam, dessen stahlblaue Augen sie schon beim Aufnahmegespräch in Verlegenheit gebracht hatten.
Während die Kinder weiterliefen, blieb Gertrud stehen, um Erich Lüdke zu begrüßen, dabei zeigte sie ihr kokettes Lachen, von dem sie geglaubt hatte, es sei längst unter all dem Elend vergraben. Bald entspann sich eine Unterhaltung über die recht ordentlichen schulischen Leistungen ihres Sohnes, der ein kluger Kopf sei und Talent in technischen Dingen habe.
»Wirklich ? Ich dachte, er sei ein furchtbarer Raufbold.«
»Das ist wahr. Aber dahinter verbirgt sich ein fähiger junger Mann, der noch nicht weiß, wohin mit seiner aufgestauten Bitterkeit. Ich denke, ihm fehlt der Vater.«
Gertrud blickte ihn überrascht an. So hatte bis auf seinen Patenonkel Otto noch nie jemand von Kurt gesprochen.
Sie sah zu den Kindern, die nur noch zwei ferne Punkte waren. »Ich denke, ich sollte jetzt gehen.«
»Warum ? Lassen Sie die Jungs ruhig laufen. Hier verliert man keinen. Jetzt, da die Dünen nur noch Sandhügel sind.«
»War es denn mal anders ?«
»Und ob. Anfang des Jahrhunderts waren sie noch bis zu zehn Meter hoch.«
»Zehn Meter ?«, staunte Gertrud, und Erich Lüdke nickte.
»Einen Teil des Sandes hat die Ziegelei mit dem hiesigen Ton verarbeitet, einen anderen hat man für den Bau des Eisenbahndamms verwendet. Aber den Großteil der Dünen hat die Stadt Hamburg abtragen lassen, um die Marschgebiete vor dem Hochwasser zu schützen. Wussten Sie das nicht ?«
Gertrud schüttelte den Kopf. Sie hätte Herrn Lüdkes Erklärungen ewig lauschen können. Er sah gut aus, ein richtiger Mann mit strammen Muskeln, gar nicht wie ein Lehrer. Etwas regte sich in ihr, das sie längst vergraben glaubte. Doch er war gewiss fünf, sechs Jahre jünger als sie.
»Wenn Sie möchten, nehme ich Sie gerne mal auf eine Wanderung mit und erzähle Ihnen alles über die Geschichte des Elburstromtals.«
»Ich weiß nicht, ob sich das schickt …«
»Meine liebe Frau Lagerfeld«, sagte er augenzwinkernd, »es ist doch nur eine Exkursion.«
Gertrud spürte, wie ihre Wangen zu glühen begannen. »Meinen Sie wirklich ?«
»Aber sicher. Nächsten Sonntag um dieselbe Zeit ?«
Eine Woche später lief Gertrud wieder zu den Dünen, dieses Mal ohne ihre Söhne. Und tatsächlich wartete Kurts Lehrer genau an der Stelle, an der sie sich beim letzten Mal verabschiedet hatten.
Sie gingen ein Stück durch das Wäldchen, und Erich Lüdke zeigte ihr einen erhöht liegenden Platz, von dem aus man auf die verlassene Ziegelei sehen konnte und über die Schafweiden und Heidelandschaften zu den Tälern der Geest. Dabei ließen sie stets einen gewissen Abstand zwischen sich, damit ja keiner der Wanderer auf die Idee kam, dass es sich um etwas anderes handeln könne als um ein sachliches Gespräch zwischen dem Lehrer und der Mutter eines Schülers.
Zwei Mal trafen sie sich wieder, und immer hatte der Lehrer etwas Neues, das er ihr zeigen konnte. Mal war es der Turm, den der Korbflechter Wihnalek ganz aus Flaschen gebaut hatte – mit Ornamenten, Spitzbogenfenstern und Uhrentürmchen – und der noch in diesem Jahr wegen Einsturzgefahr abgerissen werden sollte. Mal führte er sie an den Zaun eines Sommerhauses, in dessen Gärten fremdländische Vögel in Volieren standen und laut kreischten und krakeelten. Doch nie kam Erich ihr näher als eine Handbreit.
Erst beim traditionellen Vogelschießen, das am Tag vor den Sommerferien stattfand, berührten sich beim Polkatanzen zum ersten Mal ihre Körper. Gertrud dachte, ein Blitz durchfahre sie, und sie sah ihm in die Augen, viel zu lange, sodass sie sich gleich auch zum nächsten Lied und sogar zum dritten miteinander im Kreis drehten.
Weil bei dem Fest auch der Schlachter mit der Friseursgattin und der Tischler mit der Frau des Gastwirts zur Kapellmusik tanzte, ging ihre Annäherung im allgemeinen Trubel unter. So merkte auch niemand, dass sie sich bei Einbruch der Dunkelheit in den Park davonstahlen, wo sie – zu Gertruds Enttäuschung – nun wieder sittsam nebeneinanderher gingen. Immerhin bot er ihr das Du an, wenn auch nur, solange niemand dabei war.
Da Erich während der ersten Ferienwochen eine Reise des Jugendwanderbundes nach Schwerin, Wismar, Boltenhagen und Grevesmühlen begleitete, sahen sie sich erst Mitte Juli wieder. Er lud sie in den Garten des örtlichen Gasthofs ein und berichtete mit glühenden Augen von der Schönheit der mecklenburgischen Ostseeküste.
Als der Kuchen serviert wurde und Erich ihr eine Serviette reichte, wobei er wie zufällig über ihre Hand strich, schoss ein Wallen durch Gertruds Körper. Am liebsten hätte sie Erich direkt an sich gezogen. Doch weil die Mutter von Kurts Klassenkameradin Gerda ebenfalls im Café Platz genommen hatte und ihnen bitterböse Blicke zuwarf, verabschiedeten sie sich rasch wieder voneinander, kaum dass der Kuchen verzehrt war.
Unter den Augen der klatschsüchtigen Frauen im Ort war, das erkannte Gertrud, ein vorsichtiges Kennenlernen nicht möglich. Und so dachte sie daran, mit der Vierländer Bahn nach Hamburg zu fahren und Erich jene Welt zu zeigen, der sie einst angehört hatte. Den Jungfernstieg und den Neuen Wall. Die hübschen Cafés an der Alster, wo ein Stück Kuchen zwar ein Vermögen kostete, aber wo es sich ungestört von fremden Blicken plaudern ließ.
Vielleicht würden sie auch eine Kahnfahrt machen und sich irgendwo in den Alsterauen im Schutz der Uferbewachsung endlich küssen.
4 HAMBURG
»Iss ordentlich, Theachen. Und hör auf, so herumzuzappeln.«
Tilla zückte die Serviette und tupfte der Kleinen mit gestrengem Blick über die Lippen.
Schmunzelnd nahm Otto eine weitere Gabel von der Buttercremetorte, die Lisbeth mit Kondensmilch von Glücksklee zubereitet hatte und die trotz des Schattenplatzes bereits zerlief.
Seine beiden Schwestern hatten weder einen Ehemann noch Kinder und sich im Lauf der Jahre diese betuliche Art angeeignet, die jungfräuliche Tanten für gewöhnlich an den Tag legten. Selbst ihre bald dreijährige Nichte, die mit der übergroßen Schleife im Haar und dem blütenweißen Sommerkleid entzückend aussah, behandelten sie wie eine kleine Erwachsene. Es schien ihnen von größter Notwendigkeit, dass Thea wusste, wann man Bitte und Danke zu sagen hatte und wie man Buttercremetorte aß, ohne sich den Mund zu verschmieren.
Die Kleine ertrug es mit stoischer Ruhe. So wie sie es auch ertrug, wenn ein heftiger Regen sie am Spielen hinderte. Die Tanten waren eben die Tanten, eine Art Naturgewalt, deren Treiben man sich zu ergeben hatte.
Artig blieb sie auf dem Gartenstuhl sitzen und wartete, bis die Erwachsenen mit dem Kuchenessen fertig waren und sie endlich die Schmetterlinge jagen durfte, die durch die üppig blühenden Hortensienbeete flogen.
Ja, seine Tochter fühlte sich wohl bei ihren Großeltern und Tanten. Und es war ihm auch immer wichtig gewesen, dass Thea sich als Teil einer großen Familie verstand. Einer Familie, die zusammenhielt, egal welcher Sturm an den Grundfesten des Lebens rütteln mochte.
»Na, mien Jung«, fragte der Vater in seine Gedanken hinein, »wie läuft das Geschäft ?«
»Hervorragend. Seit wir Werbeanzeigen geschaltet haben, hat sich der Umsatz der Glücksklee-Milch noch einmal enorm gesteigert. Ich fahre kommende Woche ins Rheinland, wo ich einen meiner alten Kontakte aus der Zeit der Lebensmittelbeschaffung dazu bewegt habe, mich einem Großhändler vorzustellen. Und wir planen schon bald die Einführung von gezuckerter Kondensmilch unter dem Namen Goldstern.«
Der Vater strich sich mit einem Nicken über den weißen Spitzbart. »Meine Hochachtung, Otto ! Du kannst sehr stolz auf deine Leistung sein.«
Otto lächelte. Doch weil ihn sein Vater gelehrt hatte, stets am Boden zu bleiben und sich vom Geld nicht den Charakter verderben zu lassen, zeigte er nicht allzu offensichtlich, wie sehr ihn das Lob freute.
»Umso schöner ist es«, fuhr der Vater fort, »dass du in alter hanseatischer Tradition der Gesellschaft etwas zurückgibst. Wie läuft es denn als ehrenamtlicher Handelsrichter ? Gibt es gerade einen Fall, bei dem du hinzugezogen wirst ?«
In der Frauenrunde wurde das Gespräch gerade lebhafter, und Otto beugte sich zum Vater, um ihm zu antworten.
»Ja. Es geht um die Rügepflicht nach den Grundsätzen von Treu und Glauben. Ein Käufer hat eine Ladung chinesisches Holzöl erhalten, deren Gewicht deutlich überschritten war …«
»Nein, das gibt es ja nicht !«, rief die Mutter in diesem Moment aus.
Der Vater sah seine Frau tadelnd an. »Was ist denn hier los ? Können wir uns nicht einmal ungestört unterhalten ?«
»Wir reden von Gertrud«, sagte diese entschuldigend. Sie nickte Thea zu, die aufmerksam und mit gespitzten Ohren lauschte. »Geh nur spielen, mein Kind. Wir Erwachsenen haben etwas zu bereden.«
Mit einem Schmollmund erhob sich Thea von ihrem Stuhl und lief in Richtung des Hortensienbeetes davon.
»So«, sagte der Vater endlich. »Jetzt mal raus mit der Sprache. Was ist mit Gertrud ?«
»Tilla hat sie in einem Alstercafé mit einem fremden Mann poussieren sehen«, erzählte Lisbeth. »Sie war aufgerüscht wie eine Primadonna.«
»Sie wird einen Bekannten getroffen haben.«
»Von wegen !«, empörte Tilla sich. »Schöne Augen hat sie ihm gemacht. Und dieser Kerl hat ihre Hand gehalten.«
Otto beugte sich überrascht vor. »Hast du sie darauf angesprochen ?«
»Und ob. Sie ist mir frech gekommen !« Tilla verzog den Mund. »Ich habe sie gefragt, wieso sie sich hier so aufführe, schließlich sei sie eine verheiratete Frau ! Und was wohl Paul dazu sagen würde, wenn er eines Tages nach Hause kommt und sie mit einem anderen sieht. Gertrud ist aufgesprungen, du hättest mal sehen sollen, wie aufgeregt sie war. ›Was macht dich so sicher, dass er zurückkehrt ?‹, hat sie gerufen. ›Ich habe lange genug gewartet. Paul ist tot, begreift es doch endlich !‹ Und dann ist sie weinend fortgelaufen.«
»Gertrud tut mir leid«, flüsterte Lisbeth. »Sie wartet nun schon so lange auf ihn. Und wir wissen ja, wie Paul ist. Ich glaube nicht, dass er zurückkommt, wahrscheinlich fährt er längst wieder über die sieben Weltmeere. Am besten wäre es doch, sie ließen sich scheiden.«
»Scheiden ?« Der Vater runzelte die Stirn und lehnte sich zurück. Ihn durfte man ohnehin nicht auf Paul und Gertrud ansprechen. »Kommt nicht in Frage. Wat Gott tohoopsett hett, dat schall de Minsch nich trennen«, fiel er in das Plattdeutsch seiner Jugend zurück. »Aber in einem hat Gertrud recht. Seit Jahren haben wir kein Lebenszeichen mehr von Paul erhalten, nicht einmal uns, seinen Eltern, hat er geschrieben. Wir sollten ihn für tot erklären lassen, das wäre für alle Beteiligten gewiss das Beste.«
Die Mutter schlug in sichtlichem Entsetzen die Hände vor den Mund. »Wie kannst du nur so etwas sagen !«
Otto setzte zu einer Antwort an, doch dann hielt er inne. Wenn er nun erzählte, dass Paul noch äußerst fidel war, dann würde sie auch erfahren, dass er inzwischen wieder geheiratet und ihr sogar zwei weitere Enkel geschenkt hatte.
Nein. Bei allem Verständnis, das sie ihrem abtrünnigen Sohn immer entgegengebracht hatte: Niemals durfte seine Mutter erfahren, dass Paul ein Bigamist war. Für sie als gläubige Katholikin wäre es mehr als nur ein Ehebruch. Unzucht, eine schwere Sünde.
Aber er durfte nicht länger tatenlos bleiben, er musste etwas unternehmen, um die Sache endlich aus der Welt zu schaffen. Für die Mutter, für Gertrud und für seine beiden Neffen.
Otto beugte sich vor und legte ihr die Hand auf den Arm. »Ich werde mich um die Angelegenheit kümmern. Das verspreche ich dir.«
Am Abend, als Thea in ihrem Bettchen lag, setzte sich Otto an den Sekretär und strich über das vor ihm liegende, jungfräulich weiße Blatt Papier. Dann tauchte er die Feder in das Glas mit der Tinte und begann zu schreiben.
Hamburg, 19. Juli 1925
Mein lieber Paul,
ja, ich bin es, Dein Bruder Otto. Vielleicht wunderst Du Dich, woher ich Deine Adresse habe, aber dazu später mehr.
Erst einmal möchte ich Dir schreiben, wie sehr ich mich darüber gefreut habe zu erfahren, dass Du noch am Leben bist. Natürlich frage ich mich, warum Du nichts mehr von Dir hast hören lassen. Ich nehme an, es ist die Entfernung, die sich langsam auch ins Leben, in die Herzen schleicht, sodass der Wunsch, zur Feder zu greifen, irgendwann einmal versiegt.
Wie viele Jahre ist es inzwischen her, dass wir uns gesehen haben ? Es muss 1912 gewesen sein, als ich, aus Russland kommend, Station in Hamburg gemacht habe. Ich erinnere mich noch gut an die gemeinsamen Stunden am Elbstrand. An unsere Unterhaltungen über Deine Zukunft als werdender Vater. Eine Zukunft, die Euch nach Amerika geführt hat, wo Gertrud Dir Herbert und ein Jahr später Kurt gebar.
Die beiden sind großartige Kinder, Paul. Und ich kann nicht begreifen, was Dich davon abhält, Kontakt zu ihnen zu halten.