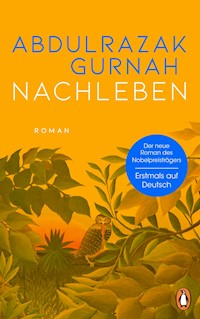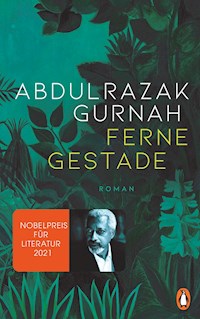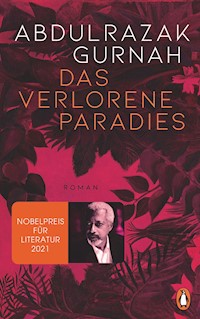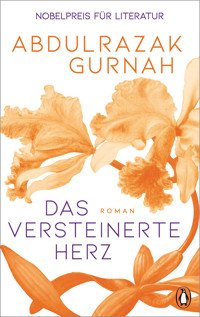
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Erstmals auf Deutsch: Gurnahs bewegender Coming-of-age-Roman über Verrat, Migration und die Suche nach dem Platz im Leben
Salim ist sieben und ein kleiner Träumer. Sein Leben ruht auf einigen scheinbar unerschütterlichen Säulen: der täglichen Routine von Schule und Koranunterricht, den geliebten Büchern und seinem angebeteten Onkel, der sich ihm – anders als sein Vater – nicht ständig entzieht. Aber es sind die 1970er-Jahre und folglich keine guten Zeiten für Träumer, denn der Geist des Wandels fegt über Sansibar. Plötzlich ist Salims Vater verschwunden und eine Revolution, Gewalt und Korruption erschüttern die Insel. Erst im Rückblick, als Teenager und Student, der sich seinen Weg durch die fremde und abweisende Stadt London bahnt, beginnt Salim zu begreifen, welche Schatten seine Familie in der Zeit des Umbruchs beherrschten. Salim sucht nach Antworten auf das, was damals geschah, und muss sich der Wahrheit über jene Menschen stellen, die ihm am nächsten standen.
So kraftvoll wie berührend schreibt Abdulrazak Gurnah über den Einfluss der Geschichte auf unser Leben und erschafft dabei Charaktere, die man so schnell nicht vergisst.
»Die Eleganz und Souveränität, mit der Gurnah schreibt, sein Verständnis dafür, wie leise, langsam und wiederholt ein Herz brechen kann, machen diesen Roman zu einer tiefen Quelle der Freude.« Guardian
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Ähnliche
Erstmals auf Deutsch: Gurnahs bewegender Coming-of-age-Roman über Verrat, Migration und die Suche nach dem Platz im Leben
Salim ist sieben und ein kleiner Träumer. Sein Leben ruht auf einigen scheinbar unerschütterlichen Säulen: der täglichen Routine von Schule und Koranunterricht, den geliebten Büchern und seinem angebeteten Onkel, der sich ihm – anders als sein Vater – nicht ständig entzieht. Aber es sind die 1970er-Jahre und folglich keine guten Zeiten für Träumer, denn der Geist des Wandels fegt über Sansibar. Plötzlich ist Salims Vater verschwunden und eine Revolution, Gewalt und Korruption erschüttern die Insel. Erst im Rückblick, als Teenager und Student, der sich seinen Weg durch die fremde und abweisende Stadt London bahnt, beginnt Salim zu begreifen, welche Schatten seine Familie in der Zeit des Umbruchs beherrschten. Salim sucht nach Antworten auf das, was damals geschah, und muss sich der Wahrheit über jene Menschen stellen, die ihm am nächsten standen.
So kraftvoll wie berührend schreibt Abdulrazak Gurnah über den Einfluss der Geschichte auf unser Leben und erschafft dabei Charaktere, die man so schnell nicht vergisst.
»Die Eleganz und Souveränität, mit der Gurnah schreibt, sein Verständnis dafür, wie leise, langsam und stetig ein Herz brechen kann, machen diesen Roman zu einer tiefen Quelle der Freude.« Guardian
ABDULRAZAKGURNAH (geb. 1948 im Sultanat Sansibar) wurde 2021 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Er hat bislang zehn Romane veröffentlicht, darunter »Paradise« (1994; dt. »Das verlorene Paradies«; nominiert für den Booker Prize), »By the Sea« (2001; »Ferne Gestade«; nominiert für den Booker Prize und den Los Angeles Times Book Award), »Desertion« (2006; dt. »Die Abtrünnigen«; nominiert für den Commonwealth Writers› Prize) und »Afterlives« (2020; dt. »Nachleben«; nominiert für den Walter Scott Prize und den Orwell Prize for Fiction). Gurnah ist Professor emeritus für englische und postkoloniale Literatur an der University of Kent. Er lebt in Canterbury. Seine Werke erscheinen auf Deutsch im Penguin Verlag.
ABDULRAZAKGURNAH
DAS VERSTEINERTE HERZ
ROMAN
Aus dem Englischen von Eva Bonné
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel Gravel Heart bei Bloomsbury, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe 2017 bei Abdulrazak Gurnah
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Kristine Kress
Umschlaggestaltung: Favoritbuero, München
Umschlagabbildung: Collection of the New-York Historical Society, USA
© New York Histo
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-31542-9V001
www.penguin-verlag.de
»Die Liebe beginnt mit der Erinnerung an einen Segen;
danach entwickelt sie sich gemäß den Fähigkeiten des Empfängers, sprich seinen Verdiensten.«
Abu Said Ahmad Ibn Isa-al-Kharraz: Kitab al-Sidq (Das Buch der Wahrhaftigkeit, 899)
ERSTER TEIL
1 ZUCKERWATTE
Mein Vater wollte mich nicht. Als ich das merkte, war ich noch ziemlich jung. Ich hatte keine Ahnung, was mir vorenthalten wurde, und bis ich den Grund erriet, sollte noch viel Zeit vergehen. In gewisser Hinsicht war meine Ahnungslosigkeit ein Segen. Wäre ich, als ich es merkte, schon älter gewesen, hätte ich vielleicht besser damit leben können, das allerdings in Heuchelei und Hass. Vielleicht hätte ich Gleichgültigkeit vorgeschützt, auf meinen abwesenden Vater geschimpft und ihm die Schuld an allem gegeben, was war und anders hätte sein können. In meiner Verbitterung hätte ich mir vielleicht eingeredet, ohne Vaterliebe zu leben wäre nichts Besonderes und am Ende sogar leichter. Väter sind nicht immer einfach, vor allem, wenn sie selbst ohne Vaterliebe auskommen mussten; in dem Fall haben sie gelernt zu glauben, ein Vater bekomme immer seinen Willen, so oder so. Und wie alle Menschen haben auch Väter damit zu kämpfen, dass das Leben gnadenlos voranschreitet; oft haben sie kaum genug Kraft für ihr eigenes trostbedürftiges Ich, geschweige denn Liebe für das Kind, das in ihrem Leben aufgetaucht ist wie aus dem Nichts.
Ich kann mich jedoch an eine Zeit erinnern, in der es anders war, in der mein Vater nicht in einem winzigen Zimmer saß und mich mit eisigem Schweigen strafte, sondern mit mir lachte, mich durchkitzelte und in die Höhe warf. Die Erinnerung war ohne Ton und Sprache, aber ich hütete sie wie einen Schatz. In dieser anderen Zeit war ich vermutlich ein kleines Kind, ein Baby, denn als ich mir ein klares Bild von meinem Vater machen konnte, war er schon der stille Mann von später. In den drallen Gliedmaßen der Kinder sammeln sich alle möglichen Erinnerungen und werden im Laufe des Lebens zum Problem; ob ihre Anordnung stimmt, bleibt ungewiss. Manchmal vermutete ich, dass ich mir das mit dem Kitzeln nur ausgedacht hatte, um mich selbst zu beruhigen, und dass einige Erinnerungen gar nicht meine eigenen waren. Ich hegte den Verdacht, andere Menschen könnten sie mir eingepflanzt haben, in guter Absicht und bei dem Versuch, die Lücken in meinem und ihrem Leben zu füllen. Sie erhöhten unseren ebenso planlosen wie langweiligen Alltag, indem sie ihm Struktur und Spannung andichteten und sich selbst weismachten, die Gegenwart habe sich in der Vergangenheit schon abgezeichnet. An diesem Punkt fragte ich mich, wer ich eigentlich war, bezog ich doch mein gesamtes Wissen über mich selbst aus den Schilderungen anderer Personen. Die eine erzählte mir dies, die andere das, und ich war gezwungen, mich der beharrlicheren von beiden zu beugen. Hin und wieder bekam ich die Gelegenheit, mich für jene Version meines jüngeren Ich zu entscheiden, die mir besser gefiel.
Manchmal erschienen mir meine Grübeleien schuldbeladen und zwanghaft. Ich meinte mich erinnern zu können, wie mein Vater neben mir auf der sonnigen Küchenschwelle saß. Aus seiner Faust ragte ein Holzstäbchen mit rosa Zuckerwatte, in die ich gerade mein Gesicht versenkte. Das Bild erschien mir wie ein in der Zeit erstarrter Moment ohne Vorgeschichte, Auflösung oder Folgen. Wie hätte ich ihn erfinden können? Trotzdem war ich mir nicht sicher, ob er wirklich passiert war. Mein Vater sah mich an und lachte auf seine typische, atemlose Weise, legte sich die Hände an die Rippen, krümmte sich und konnte anscheinend gar nicht mehr aufhören. Er sagte etwas, was ich heute nicht mehr höre. Vielleicht hatte er gar nicht mit mir gesprochen, sondern mit jemand anderem. Vielleicht galten sein Lachen und seine Worte meiner Mutter.
Vermutlich trug ich ein kleines Unterhemd, das kurz unter dem Bauchnabel endete. Abgesehen davon war ich wohl nackt. Ich weiß das sogar ziemlich genau, weil ich ein Foto von mir gesehen habe, das mich in der Standardtracht des kleinen Jungen aus den Tropen zeigt und auf dem ich unbekümmert in unserer Straße stehe. Einem Mädchen hätte man niemals erlaubt, so herumzulaufen, aus Angst, seine Keuschheit und sein Anstand könnten Schaden nehmen. Was aber nicht bedeutete, dass ihm später im Leben irgendetwas erspart blieb. Ja, ich bin mir sicher, so ein Bild gesehen zu haben, das verschwommene, unvollständig entwickelte, wahrscheinlich mit einer Kastenkamera aufgenommene Foto eines halb nackten einheimischen Jungen von drei oder vier Jahren, der in jämmerlicher Passivität in die Linse starrt. Gut möglich, dass ich eine leise Panik empfand. Ich war ein ängstliches Kind, und die auf mich gerichtete Kamera hatte mich bestimmt verstört. Auf dem verblichenen Bild waren meine Gesichtszüge kaum zu erkennen, und nur Menschen, die mit meinem Aussehen sehr vertraut waren, hätten mich überhaupt identifizieren können. Der Abzug war zu hell, um den Schorf an meinen Knien, die Insektenstiche an meinen Armen oder den Rotz unter meiner Nase zu zeigen, aber scharf genug für das winzige, zu jenem Zeitpunkt unversehrte Bündel zwischen meinen Beinen. Ich kann höchstens vier gewesen sein, denn noch trafen die Erwachsenenwitze über den kleinen Abdalla, der demnächst seine Kappe verlieren würde, nicht ins Schwarze. Beim Gedanken an die bevorstehende Beschneidung wanden kleine Jungen sich vor Grausen, und wenn eine alte Frau ihnen an die Hoden fasste und in gespieltem Entzücken erschauderte und nieste, war das gar nicht mehr lustig, sondern der blanke Hohn.
Ich bin mir also sicher, dass das Foto vor meinem fünften Geburtstag aufgenommen wurde, als ich noch nicht zur Koranschule ging. In dem Jahr durfte ich zum ersten Mal mit meinen Eltern Taxi fahren. Eine Taxifahrt war ein besonderes Ereignis, meine Mutter machte viel Aufhebens darum und versprach, am Ziel würde es ein Picknick mit Vitumbua, Katlesi und Samosas geben. Das Taxi hielt vor dem Krankenhaus. »Es wird nicht lange dauern«, sagte mein Vater, »gleich geht es weiter.« Ich nahm seine Hand und folgte ihm hinein. Noch bevor ich wusste, wie mir geschah, war mein kleiner Abdalla seine Kofia los und der Ausflug ein Albtraum aus Schmerzen, Verrat und Enttäuschung. Man hatte mich betrogen. Tagelang musste ich mit weit gespreizten Beinen dasitzen und Luft an meinen bandagierten Penis lassen, während meine Mutter, mein Vater und die gesamte Nachbarschaft zufrieden lächelnd auf mich hinunterblickten. Abdalla kichwa wazi.
Kurz nach diesem traumatischen Vertrauensverlust wurde ich in der Koranschule angemeldet. Zum Unterricht musste ich eine Kofia und einen wadenlangen Kanzu tragen und darunter kurze Hosen, damit meine Hände nicht auf Wanderschaft gingen, wie Jungshände es eben tun. Sobald ich gelernt hatte, meine Nacktheit zu bedecken – vor allem, nachdem sie durch Täuschung und Verstümmelung in mein Bewusstsein gerückt worden war –, hätte ich meinen Körper nie wieder so unbefangen präsentieren oder in einem knappen Hemdchen auf der Schwelle sitzen können. Aus dem Grund bin ich mir sicher, dass ich erst vier war, als mein Vater Masud und ich in der Sonne saßen und er mich mit Zuckerwatte fütterte. Die Zärtlichkeit dieses Moments hing mir noch lange nach.
Die Schwelle gehörte zu dem Haus, in dem ich zur Welt gekommen war und meine gesamte Kindheit verbracht hatte. Ich verließ es erst, als mir keine andere Wahl mehr blieb, und danach, in der Zeit meiner Verbannung, rief ich mir jeden Zentimeter davon in Erinnerung. Ob aus verlogener Nostalgie oder echter Sehnsucht, weiß ich nicht, aber im Geiste lief ich noch jahrelang durch die Zimmer und atmete die verschiedenen Gerüche ein. Gleich hinter der Eingangstür lag die Küche. Dort gab es weder Steckdosen noch Einbauregale oder einen Elektroherd, nicht einmal eine Spüle. Es handelte sich um eine einfache, unmoderne Küche, düster und mit rauen, vom Holzkohlerauch verrußten Wänden. »Wie das Maul einer Bestie«, sagte meine Mutter immer. Der Ruß durchdrang alle frischen Kalkschichten und machte sich früher oder später als Grauschleier erneut bemerkbar. In der Ecke neben dem Eingang befand sich ein Wasserhahn, unter dem wir das Geschirr spülten und unsere Kleidung wuschen. Der billige Zementboden darunter war löchrig und bröckelig vom steten Tropfen des Wassers. Links von der Tür lag eine Matte, die selbst nach vielen Jahren noch nach Pflanzenfasern roch und auf der wir saßen, wenn wir aßen oder wenn meine Mutter Gäste empfing. Fremde Männer betraten das Haus nie, zumindest nicht, als meine Mutter jünger war, und selbst später blieb es die Ausnahme. So lebten wir, als ich ein kleiner Junge war. Irgendwann wurde die Matte dann durch einen Tisch und Stühle ersetzt und dieses und jenes erneuert, um die Küche sauberer und moderner wirken zu lassen.
Eine Tür trennte den Eingangsraum vom Rest des Hauses, dem Innenbereich aus zwei Zimmern, einem schmalen Flur und einem Bad. Meine Eltern und ich schliefen im größeren der beiden Räume. Mein Kinderbett liebte ich sehr. Eine der Seiten ließ sich hochklappen, und wenn das Brett oben und das Moskitonetz festgesteckt war, kam ich mir vor wie im Bauch eines schwebenden Schiffs. Bis heute fühle ich unter einem Moskitonetz diese Art von Geborgenheit. Wenn meine Mutter viel zu tun hatte und ich ihr im Weg stand, brachte sie mich in mein Bettchen, weil sie wusste, dass ich dort gut aufgehoben war. Manchmal bat ich sogar darum, tagsüber hineinzudürfen, und dann lag ich hinter dem Brett und träumte stundenlang davon, in einem Geheimversteck und vor allen Gefahren sicher zu sein. Als ich zehn war, passte ich immer noch bequem hinein, und später schlief meine Schwester Munira darin.
Das kleinere Zimmer gehörte Onkel Amir, dem Bruder meiner Mutter. Durch den Flur gelangte man in einen schmalen Hinterhof, gerade breit genug für eine Wäscheleine. Hinter der Hofmauer schloss sich das Grundstück des Nachbarn an, ein unverheirateter, stiller Mann, der mit seiner Mutter zusammenlebte. Er war so schweigsam, dass ich lange Zeit nicht einmal seinen Namen wusste. Die Leute sprachen weder mit ihm noch über ihn. Seine Mutter verließ das Haus nie; ob sie krank war oder ob das zurückgezogene Leben ihr Angst vor der Welt eingeflößt hatte, wusste ich aber nicht. Unsere Nachbarn hatten keinen elektrischen Strom, und ihr Haus war stets so düster, dass ich, wenn ich mit einer Schüssel Pflaumen hinübergeschickt wurde – Pflaumen waren damals etwas Besonderes –, im Halbdunkel kaum ihre Gesichter erkennen konnte. Nie drangen aus ihrem Hof Geräusche herüber, nur ganz selten war das leise Husten eines Mannes zu hören oder das Scheppern von Töpfen. Wenn ich nachts auf die Toilette musste, versuchte ich, die Augen geschlossen zu halten und meinen Weg zu ertasten. Ich wagte es nicht, zur Hintertür zu blicken, weil ich mir vorstellte, wie im trüben Schein einer Öllampe eine riesige, schemenhafte Gestalt hinter der Hofmauer aufragte.
Vor dem Haus gab es weder einen Garten noch einen Gehweg; alle Gäste traten direkt von der Straße ein. Wenn die Tür an heißen Tagen offen stand, blies die träge Brise den Vorhang tief in die Küche hinein. Als mein Vater und ich an jenem sonnigen Tag mit der Zuckerwatte auf der Schwelle saßen und draußen das Leben vorüberzog, standen unsere Füße also wahrscheinlich auf der Straße – vorausgesetzt, meine Beine waren schon lang genug. Die stille Gasse war mit Mühe breit genug für zwei Fahrräder. Das Blechdach unseres Hauses und das des Hauses gegenüber stießen in der Mitte fast zusammen und bildeten eine dämmrige, kühle Kammer, die jeden Fremden durch ihre intime Abgeschlossenheit verprellt hätte. Das Sonnenlicht fiel durch die Lücke zwischen den Dächern ein und streifte unsere Türschwelle nur kurz; das muss der Zuckerwattemoment gewesen sein.
Kein Auto hätte durch diese Gasse gepasst, aber das war auch gar nicht vorgesehen. Das ganze Viertel war für das Schlurfen und Tappen menschlicher Füße gebaut worden, für Schultern, die aneinanderstoßen, für Stimmen, Gemurmel und höfliche Grüße, Flüche und Gebrüll. Was wir brauchten, wurde durch Muskelkraft und auf Handkarren herangeschafft. Die Straße war nicht so gerade, wie man es von einer richtigen Straße erwartet hätte, und die alten Pflastersteine waren abgenutzt durch die Jahre, den ständigen Verkehr und das Wasser, das in der Regenzeit darüber lief. Wenn spätabends schnelle Schritte auf das Pflaster schlugen, klang das immer sehr bedrohlich. Kurz hinter unserem Haus machte die Gasse einen ersten und dahinter einen zweiten Knick nach rechts. Abgesehen von den breiteren Straßen, die ins Landesinnere führten, krümmten unsere Wege sich mal hierhin und mal dorthin und passten sich dem Leben an, wie die Leute es damals führten. In unserem Viertel gab es zu der Zeit noch keine Villen mit Einfahrten und ummauerten Gärten, die Bewohner gingen einem eher bescheidenen Alltag nach. So sah es aus, als ich ein Kind und unsere Gasse ruhig, leer und noch nicht so verdreckt und überfüllt war wie später.
Das Haus der Nachbarn von gegenüber, ein Ehepaar, war so klein wie das unsrige, und die Türen standen einander gegenüber wie in einem Spiegel. Er wurde von allen nur Mahsen gerufen, ganz ohne Anrede, und sie war Bi Maryam. Mahsen, ein dünner, kleiner Mann, der als Kind wahrscheinlich sehr unter seinen Altersgenossen gelitten hatte, arbeitete als Bote für die Stadtverwaltung. Bote war eine offizielle, aber leicht irreführende Bezeichnung, denn eigentlich hatte er niemandem etwas zu überbringen. Stattdessen erledigte er für die Beamten und die Schreibkräfte alles Mögliche: eine Akte holen, einen Gast hinausbegleiten, kalte Getränke, eine Zigarette oder ein Brötchen besorgen, auf den Markt gehen, einen kaputten Ventilator zum Elektriker tragen – im Büroalltag rissen die Aufgaben nie ab.
Manche der Beamten und Schreibkräfte waren nicht einmal halb so alt wie er, doch Mahsen beklagte sich nie. Er war ein sanfter, leiser Mann, der immer lächelte. Seine Höflichkeit war grenzenlos und seine Frömmigkeit nicht von dieser Welt. Wenn er von der Arbeit nach Hause ging, grüßte er jeden, der ihm entgegenkam, und alle, die in seine Richtung blickten, wurden – je nach Vertrautheitsgrad, Geschlecht und Alter – mit einem Lächeln, einem Winken oder einem Händeschütteln bedacht. Er erkundigte sich nach der Gesundheit des einen und nach der Familie des anderen, und falls er unterwegs Neuigkeiten aufgeschnappt hatte, reichte er sie freigiebig weiter. Er stand jeden Morgen vor der Dämmerung auf, ging als einer der wenigen zum Fadschr in die Moschee, ließ im Laufe des Tages kein einziges der fünf Gebete aus und verhielt sich dabei so diskret, als hätte er etwas zu verbergen. Wäre er unbescheidener gewesen, hätten die anderen ihn als Frömmler verspottet. Selbst zu Kindern war er freundlich, im Gegensatz zu den anderen Erwachsenen, die junge Menschen mit Argwohn und Ablehnung betrachteten, ihnen Bosheit unterstellten und jederzeit mit einem Streich rechneten. Mahsen genoss einen tadellosen Ruf, wobei böse Zungen sich manchmal fragten, ob in seinem Kopf alles in Ordnung war.
Bi Maryam achtete weniger auf Diskretion und war in vielerlei Hinsicht das Gegenteil von ihrem Mann. Sie war stämmig, misstrauisch und streitlustig. Immerzu wies sie andere auf Mahsens Frömmigkeit und Großmut hin, gerade so, als könnte irgendwer daran zweifeln. »Ein Mann des Glaubens«, verkündete sie bei jeder Gelegenheit, »ein Auserwählter, seht nur, mit wie viel Gesundheit und gutem Aussehen Gott ihn beschenkt hat. Ihr mögt neidisch sein, aber wenn der Herr ihn irgendwann zu sich ruft, wird er seinen gerechten Lohn empfangen!«
Sie verdiente etwas dazu, indem sie Brötchen und Pfannkuchen für die örtlichen Cafés buk, außerdem hatte sie zu allem eine Meinung, die sie gern kundtat, am liebsten so laut, dass alle Nachbarn und Passanten es hören konnten und auch sollten. Sie gab den Kranken gute Ratschläge, äußerte sich zu fremden Reiseplänen, wusste, wie man Fisch richtig grillt und was an den Gerüchten über irgendeine bevorstehende Verlobung dran war. Vor ihrer Tür verfielen alle Kinder in einen Laufschritt, aus Angst, angehalten und mit einer Aufgabe betraut zu werden. Eigenen Nachwuchs hatten Mahsen und Bi Maryam nicht. Bi Maryams größte Befürchtung war es, missverstanden zu werden, was die Leute offenbar immer und in böser Absicht taten. Mahsen selbst schien unter ihrer Stimme und ihren Ansichten weniger zu leiden. Mein Vater sagte einmal, wahrscheinlich sei er längst taub geworden und könne sie nicht mehr hören, andere meinten, es liege daran, dass Mahsen ein Heiliger sei. Manche glaubten, Bi Maryam kenne sich mit Medizin aus, sie misstrauten ihr, aber meine Mutter erklärte mir, das sei reine Unwissenheit. Sie selbst fürchtete Bi Maryam nur für ihre Streitlust und ihre schlechte Laune.
Bevor ihm die Dinge entglitten waren, hatte mein Vater jahrelang im Büro der Wasserbehörde in Gulioni gearbeitet. Jobs in der öffentlichen Verwaltung waren sicher und hoch angesehen. Ich war damals noch jung und kenne diesen Abschnitt seines Lebens nur aus Erzählungen. In meinen späteren Erinnerungen arbeitet er an einem Marktstand oder sitzt untätig in seinem Zimmer herum. Sehr lange hatte ich keine Ahnung, was schiefgelaufen war, und nach einer Weile fragte ich nicht mehr nach. Es gab so vieles, was ich nicht wusste.
*
Der Vater meines Vaters, Maalim Yahya, war Lehrer. Ich habe ihn nie kennengelernt, weil er noch vor meiner Geburt zum Arbeiten in die Golfstaaten ging, aber einmal habe ich ihn auf einem Foto gesehen. Ich besuchte die Schule, an der er unterrichtet hatte, und im Büro des Direktors hingen mehrere Gruppenaufnahmen des Kollegiums. Jedes Jahr wurde eine angefertigt, sie bedeckten fast eine ganze Wand, allerdings war die Tradition irgendwann aufgegeben worden, denn aus der jüngeren Zeit existierten keine mehr. Die Lehrer, die während meiner Zeit dort unterrichteten, waren auf den Bildern ebenso wenig zu sehen wie der Direktor. Die Fotos boten einen flüchtigen Blick in eine mythische Vergangenheit, auf ernste Männer in langärmeligen weißen Button-Down-Hemden oder in Kanzu und Sakko. Die meisten lebten nicht mehr. Einige – welche, hätte ich beim Anblick der Gruppenbilder nicht erraten können – waren während der Revolution umgekommen. Dass damals auch Lehrer gestorben waren, wussten wir nur gerüchtehalber. Der Direktor hatte die Schule ebenfalls besucht und war von Maalim Yahya unterrichtet worden. Er deutete auf ein Foto.
»Dein Großvater. Er war meistens sehr streng«, sagte er. In Bezug auf einen Lehrer galt die Beschreibung streng oder scharf als Kompliment. Lehrer, denen es an Strenge mangelte, waren per Definition schwach und ließen sich von den Kindern auf der Nase herumtanzen. »Hinter seinem Rücken haben die Schüler ihn Maalim Chui genannt«, erzählte der Direktor, »weil er sie angestarrt und mit Krallenhänden in die Luft geschlagen hat wie ein Tiger. Die Drohgebärde war so komisch, dass die Jungs am liebsten gelacht hätten. Aber sie lachten nie, denn wenn er wütend wurde, verstand er keinen Spaß mehr.« Als der Direktor mir den starren Blick und die Krallen demonstrierte, musste ich lachen. »Wenn wir etwas falsch gemacht hatten und er uns auf diese bestimmte Art ansah«, fuhr er in ernstem Ton und mit grimmiger Miene fort, wie um seine Autorität wiederzugewinnen, »machten wir uns fast in die Hose. Damals wurden wir beim geringsten Anlass geschlagen. Wer diesen Blick erntete, konnte sich also auf eine Kopfnuss einstellen, die aber natürlich weniger schlimm war als die Prügel, die andere Lehrer uns verpassten. Im Vergleich zu uns früher seid ihr eine verweichlichte Generation.«
Ich war in sein Büro bestellt worden, weil der Direktor mich für meinen Aufsatz über eine Radtour aufs Land loben wollte. Das Thema, das man uns vorgegeben hatte, stammte aus dem Englischbuch: »Wie hast du die Ferien verbracht?« Unter der Frage fand sich eine Zeichnung, die wahrscheinlich unsere Fantasie anregen sollte. Zwei lachende Kinder, ein Junge und ein Mädchen, jagten am Strand einem Ball hinterher. Ihre blonden Haare flatterten im Wind, während eine Frau mit kurzen hellen Haaren und ärmelloser Bluse ihnen lächelnd zuschaute. Eine weitere Zeichnung zeigte zwei andere Kinder, oder vielleicht auch dieselben. Diesmal spielten sie vor einem Haus, der Wind blies ihnen die Haare ins Gesicht, und im Hintergrund waren Bäume, eine Windmühle, ein Esel und ein paar Hühner zu sehen. Wie hatten wir die Ferien verbracht? Bestimmt nicht wie die Kinder aus dem Schulbuch, denen die Haare ins Gesicht flogen, wenn sie Urlaub am Meer machten oder den Bauernhof ihres Großvaters besuchten und in einem alten Spukhaus neben einer Mühle Abenteuer erlebten. Für uns bedeuteten Ferien nur, dass die staatliche Schule geschlossen blieb, denn von der Koranschule und Gottes Wort gab es keine Pause, außer an Idd und Maulid, oder wenn man krank war und im Bett bleiben musste. Kopfweh, Bauchschmerzen oder eine nässende Schürfwunde am Knie waren keine Ausrede, blutende Verletzungen hingegen schon. An gewöhnlichen Tagen gingen wir vormittags in die Grundschule und nachmittags in die Koranschule. In den Ferien verbrachten wir unsere Zeit komplett in der Koranschule, nicht am Meer, wo unsere krausen Locken ohnehin nicht im Wind geflattert hätten, und auch nicht auf dem Bauernhof unseres Großvaters, hätte er einen besessen.
Im Gegensatz zu vielen anderen Jungen aus meiner Klasse war ich mit der Koranlektüre gut vorangekommen. Als ich den Aufsatz über die Radtour schrieb, hatte ich die Koranschule bereits abgeschlossen. Ich war entkommen, mit anderen Worten hatte ich den Koran zwei Mal durchgelesen, von Anfang bis Ende. Jahrelang hatte der Lehrer mich jeden einzelnen Vers und jede Seite vortragen lassen und meine Aussprache korrigiert, bis ich mich nicht mehr verhedderte. Seither konnte ich flüssig und mit der korrekten Betonung aus dem Koran vorlesen, ohne jedoch viel vom Inhalt zu verstehen. Die Geschichten kannte ich auswendig, ich liebte die Geschichten, weil die Lehrer sie zum Anlass nahmen, uns von den Strapazen und Triumphen des Propheten zu berichten. In der Koranschule von Msikiti Barza gab es einen, der besonders gekonnt erzählte. Manchmal, wenn sich ein wichtiges religiöses Ereignis jährte, stand er auf und bat uns, Tafeln und Bücher beiseitezulegen und einfach nur zuzuhören. In dem Fall musste uns niemand mehr ermahnen, still zu sein. Der Lehrer erzählte uns von der Geburt des Propheten, der Himmelfahrt und dem Einzug in Medina. Am besten gefiel mir die Geschichte von dem Engel, der dem Schafe hütenden Waisenjungen in den Hügeln von Mekka erscheint, ihm die Brust öffnet und sein Herz mit frischem Schnee wäscht. Egal, wie oft ich sie schon gehört hatte, sie faszinierte und rührte mich jedes Mal. Ein mit frischem Schnee gereinigtes Herz. Auf den Hügeln von Mekka war Schnee wohl nur schwer zu finden; wahrscheinlich hatte der Engel ihn aus den Wolken mitgebracht.
Und was taten die der Koranschule entkommenen Kinder nun in den Ferien? Nichts Besonderes. Sie schliefen aus, streiften den ganzen Tag lang durch die Straßen, saßen schwatzend herum, spielten Karten oder gingen schwimmen, was nicht als Urlaubsreise zählte, weil das Meer nur einen kurzen Fußmarsch entfernt war. Niemand erlebte etwas Aufregendes, und falls doch, war es höchstwahrscheinlich verboten und durfte in keinem Schulaufsatz erwähnt werden. Aber weil ich mich nicht über die absurde Aufgabenstellung beschweren, sondern einen Aufsatz schreiben sollte, erfand ich eine Geschichte über eine Radtour aufs Land. Ich benannte die Bäume, die mir Schatten spendeten, beschrieb den Jungen, der mir den Weg wies, als ich mich verirrt hatte, das Mädchen, das verschwand, bevor ich nach seinem Namen fragen konnte, und den blendend weißen Sandstrand, der mich am Ziel erwartete.
Mein Lehrer mochte den Aufsatz und zeigte ihn dem Direktor, der mir wiederum auftrug, in meiner schönsten Handschrift eine Kopie anzufertigen – in der Schule gab es keine Schreibmaschine – und sie zur allgemeinen Bewunderung ans Anschlagbrett zu hängen. Deswegen hatte er mich in sein Büro bestellt; um mich für meine Leistung zu loben. Als ihm kein Lob mehr einfiel und ich, statt mit den Füßen zu scharren und auf meine Entlassung zu warten, immer noch geduldig lächelnd vor ihm stand, zeigte er mir das Gruppenfoto, als wäre es ein Abschiedsgeschenk. Nimm das, aber geh. Mein Großvater Maalim Yahya stand am äußersten Rand und hinter seinen sitzenden Kollegen, ein großer, dünner, asketisch wirkender Mann, der den Blick des Fotografen ertrug wie eine Folter. Oder vielleicht litt er an den schlimmen Kopfschmerzen, die manchmal auch meinen Vater befielen. Meine Mutter hatte mir einmal erzählt, mein Vater habe die Kopfschmerzen von seinem Vater geerbt, der in dieser Hinsicht schwer geschlagen sei. Auf dem Foto trug Maalim Yahya einen Kanzu und darüber ein Sakko, sichtbares Zeichen für seinen Status als Staatsdiener. Mein Vater sah ihm kein bisschen ähnlich und kam wohl eher nach der Mutter, meiner Großmutter, die ich aber weder kennengelernt noch je auf einem Foto gesehen hatte.
Zu der Zeit ließ keine anständige Frau sich fotografieren, fürchtete sie doch, ihr Mann könnte, falls andere das Bild zu sehen bekamen, entehrt sein. Aber es steckte noch mehr dahinter, denn manchmal verweigerten auch Männer ein Foto. Beide Geschlechter hegten den Verdacht, ein Teil ihres Wesens könnte ihnen genommen und in die Aufnahme gebannt werden. Noch in meiner Kindheit – und ich kam lange nach dem Gruppenfoto auf die Welt – wurden die fotografierenden Kreuzfahrttouristen mit Argwohn beobachtet, und wenn einer stehen blieb und seine Kamera hob, fingen die Anwohner aufgeregt zu rufen an, um ihn zu stören und zu verjagen. Sobald der Tourist verschwunden war, entspann sich eine Diskussion zwischen jenen, die um ihre Seele fürchteten, und anderen, die über so viel Aberglauben nur die Nase rümpfen konnten. Aus diesen Gründen hatte ich nie ein Foto von meiner Großmutter gesehen; ob mein Vater nach ihr kam, konnte ich nicht beurteilen. Doch als ich Maalim Yahya auf dem Gruppenbild sah, musste ich feststellen, dass ich ihm hinsichtlich Körperbau und Teint ähnelte. Über diese Ähnlichkeit freute ich mich sehr, verband sie mich doch mit Menschen und Ereignissen, von denen mein Vater mich durch sein beharrliches Schweigen abgeschnitten hatte.
Das Foto im Büro des Direktors war auf den Dezember 1963 datiert und damit am Ende des Schuljahres entstanden, kurz vor der Revolution. Kurze Zeit später würde Maalim Yahya seinen Job verlieren und nach Dubai gehen. Seine Frau und die beiden Töchter folgten ihm, mein Vater blieb allein zurück. Sie kamen nie wieder, nicht einmal für einen kurzen Besuch, und so konnte ich mir abgesehen von dem Gruppenfoto kein Bild von der Familie meines Vaters machen. Aber ich war damals sehr jung und wäre nie darauf gekommen, dass ich eins haben sollte. Meine Welt bestand aus mir, meiner Mutter und meinem Vater. Die Gesprächsfetzen, die ich als Kind aufschnappte, waren unterhaltsam, aber die darin erwähnten Menschen blieben mir fremd.
*
Über die Herkunft meiner Mutter wusste ich ein bisschen mehr. Meine Mutter hieß Saida und stammte aus gut situierten Verhältnissen. Ihre Familie war nicht reich gewesen, aber reich genug, um ein Stück Ackerland zu besitzen und ein Haus in der Nähe des Gerichtsgebäudes. Während Saidas Kindheit hatte in dem Viertel die Oberschicht residiert, Leute mit Verbindungen in die Regierung des Sultans, die abgeschieden hinter hohen Gartenmauern lebten, und auch europäische Kolonialoffiziere mit einer Vorliebe für arabische Villen mit Meerblick. Wenn Letztere ihre feierlichen imperialen Rituale begingen, trugen sie weiße, mit Fantasieorden geschmückte Leinenuniformen, federbesetzte Korkhelme und Schwerter in kostbaren Scheiden. Sie traten auf wie Eroberer, verliehen sich pompöse Titel und hielten sich für Aristokraten. Beide Gruppen glaubten, sie seien von der Natur bevorzugt, schließlich hatte diese sie nobel erschaffen und ihnen das Recht verliehen zu herrschen, und natürlich auch die entsprechende Bürde.
Der Vater meiner Mutter, Ahmed Musa Ibrahim, war ein gebildeter und weit gereister Mann, der für derlei größenwahnsinniges patrizisches Gehabe nichts übrig hatte. Er sprach lieber über Gerechtigkeit, Freiheit und das Recht auf Selbstverwirklichung. Am Ende sollte er für diese Haltung teuer bezahlen. Er hatte zwei Jahre lang das Makaree College in Uganda besucht und anschließend für ein Jahr Gesundheitsmanagement an der Universität von Edinburgh studiert. Zwischen den Studiengängen hatte er mehrere Wochen bei einem Freund gewohnt, der an der amerikanischen Universität von Kairo Pädagogik studierte. Anschließend hatte er Beirut besucht und auf dem Rückweg nach London drei Wochen in Istanbul verbracht. Die Jahre in Kampala und Edinburgh und seine zahlreichen Reisen in berühmte Städte verliehen ihm eine Aura von Glamour und Kultiviertheit, und wenn er von den Sehenswürdigkeiten erzählte, die ihm unterwegs aufgefallen waren, verfiel sein Publikum in andächtiges Schweigen. Wenigstens erzählte meine Mutter es so; angeblich hatte sein Wort großes Gewicht. Er arbeitete in einem Labor des Gesundheitsministeriums, nicht weit von seinem Zuhause entfernt. In erster Linie engagierte er sich für die Kampagne zur Ausrottung der Malaria, doch er unterstützte auch Projekte zur Eindämmung von Cholera und Ruhr, analysierte Proben und gab Seminare. Manche Leute sprachen ihn mit Doktor an und baten ihn um medizinischen Rat, woraufhin er sie lachend darauf hinwies, dass er eine Art Rattenfänger sei und sich mit Leistenbrüchen, Hämorrhoiden, Bruststechen und Fieber nicht auskenne.
Von ihm existiert ebenfalls ein Foto. Es wurde hinter dem Gebäude der Gesundheitsbehörde aufgenommen, gleich neben dem Tor zu dem Hof, wo die Dienstwagen parkten. Er trägt darauf einen weißen Leinenanzug, bei dem nur der mittlere Jackettknopf geschlossen ist, und einen roten, in keckem Winkel aufgesetzten Tarbusch. Sein Kopf ist leicht zur Seite geneigt, sodass sich zwischen Quaste und Tarbusch eine Lücke ergibt. Er hat den rechten Unterschenkel vor den linken gesetzt, was die Aufmerksamkeit auf seine braunen Schuhe lenkt, und stützt sich mit dem rechten Arm an den unverwechselbaren Neembaum neben dem Tor. Im Hintergrund ragt ein riesiger Flammenbaum auf und überschattet die Straße vor dem Gebäude. Mit seiner launigen, fröhlichen Pose führte mein Großvater seine Modernität vor, immerhin war er ein Kosmopolit, der einige der größten Metropolen der Welt bereist hatte: Kairo, Beirut, London, Edinburgh und sogar Istanbul. In Atatürks Türkischer Republik galt der Tarbusch als rückständig und war abgeschafft worden, andernorts (Ägypten, Irak, Tunesien) kam er während der 1950er aus der Mode oder geriet zum Symbol der korrupten Baschas, Beys und geschlagenen Truppen des arabischen Nationalismus, aber diese Information hatte den Vater meiner Mutter zum Zeitpunkt des Fotos anscheinend noch nicht erreicht. In seinen Augen stand der Tarbusch für eine kultivierte islamische Moderne, er war weltlich und ein praktischer Ersatz für den mittelalterlichen Turban. Der weiße Leinenanzug wirkte da schon zweideutiger: einerseits war er ein Zugeständnis an Europa, ähnlich wie die braunen Schuhe in einer Sandalen tragenden Gesellschaft, andererseits war er weiß, und mit Demut getragenes Weiß ist die Farbe von Huldigung, Gebet, Pilgerschaft, Reinheit und Hingabe. Die unbeholfen gekreuzten Beine und das unsichere, halb entschuldigende Lächeln auf dem vollen, pausbäckigen Gesicht befreiten das Foto von jeder Eitelkeit. Fast schien der Porträtierte sich zu fragen, ob er es mit der Kostümierung zu weit getrieben hatte.
Ahmed Musa Ibrahim gehörte einem losen Zirkel aus anti-kolonialen Intellektuellen an, Menschen wie er, die sich für das Weltgeschehen interessierten und von Saad Zaghlul Pascha gehört hatten, dem ägyptischen Staatsmann (daher der Tarbusch), und auch von Gandhi, Nehru, dem tunesischen Aufrührer Habib Bourguiba und Marschall Tito – allesamt nationalistische Anführer, die sich von Imperialisten verschiedenster politischer Couleur nicht einschüchtern ließen. Die antikolonialen Intellektuellen, mit denen Saidas Vater verkehrte, wollten so modern sein wie die von ihnen verehrten Nationalisten. Sie wollten selbst über ihr Schicksal bestimmen und die allgegenwärtigen, selbstgerechten, Zurückhaltung heuchelnden Briten loswerden. Wer wie Saidas Vater direkt mit ihnen zu tun hatte, wusste genau, dass ihr selbstironisches Auftreten in Wahrheit nur die blasierte, herablassende Arroganz kaschieren sollte, mit der sie anderen Menschen begegneten, vor allem gebildetenEingeborenen wie ihm, die besser in Untertänigkeit und Ignoranz verharren sollten. O ja, er kannte sie. Sie schmunzelten über Babu-Geschichten von Einheimischen, die sich wie ein Imperator Seth vergeblich um Modernität bemühten – Diplom in Gesundheitsmanagement (nicht bestanden) –, und lobten sich dann ganz bescheiden für die unendliche Geduld, mit der sie, die selbst ernannten Herrscher, ihre Untertanen behandelten. Was hätten sie sonst tun sollen? Und wenn sie mit ihren manipulativen und rücksichtslosen Methoden konfrontiert wurden … nun ja, manchmal erforderte Güte eben eine gewisse Grausamkeit.
»Niemand hat die Briten gebeten herzukommen«, sagte die Mutter meines Vaters. »Sie sind trotzdem hier, weil sie gierig sind und von dem Wunsch getrieben, mit ihrer Anwesenheit die ganze Welt zu beglücken.«
Sie sagte das in den 1950ern, in einem kolonisierten Land – ganz bestimmt nicht der richtige Ort für solche Worte. Die britischen Verwalter verdrängten nach Kräften, dass sie Eroberer waren und mittels Zwang und Strafe regierten, und betrachteten jeden in diese Richtung gehenden Kommentar als aufwieglerisch. Das Empire liebte den Begriff, dabei waren Worte wie diese beinahe schon überholt: aufwieglerisch, gewählte Regierung, konstitutionelle Macht. Die Zeit der Briten war abgelaufen. Es kam zu hitzigen Debatten bis spät in die Nacht, lautstarken Diskussionen im Café und politischen Versammlungen, auf denen die Aktivisten hasserfüllte Reden schwangen. Während die politischen Grenzen neu gezogen wurden, verheimlichten Freunde ihre Ansichten voreinander oder zerstritten sich ganz. In dieser aufregenden, geradezu berauschenden Zeit standen die britischen Polizisten machtlos am Rand der jubelnden Menge, blickten finster drein und wussten: Das Ende der Mabeberu samt ihrer Lakaien und Handlanger war gekommen.
In so einer Zeit konnte Saidas Vater gar nicht anders, als sich in die Politik einzumischen. In den Jahren vor der Unabhängigkeit kündigte er seinen Job, weil er nicht mehr für eine Kolonialregierung arbeiten konnte, deren Umsturz er eigentlich plante. Sein Anstellungsvertrag schloss derlei Aktivitäten explizit und aus guten Gründen aus, und wenn er dagegen verstieß, würde er ins Gefängnis kommen. Also zog er sich auf sein Stück Land zurück und baute Gemüse an, das er auf dem Markt verkaufte, beziehungsweise bezahlte er andere dafür, dass sie ihm, während er mit in die Seite gestemmten Armen daneben stand, die harte Arbeit abnahmen. Es mochte so aussehen, als täte er nichts, erklärte er seiner Familie, aber wenn er nicht dort sei, würden die Arbeiter sofort aufhören und sich unter dem nächsten Baum schlafen legen. »Wir haben einfach keine Disziplin«, sagte er, »das ist unser größtes Problem.«
Er wurde zum inoffiziellen Berater einer politischen Partei und engagierte sich bei der Wählerregistrierung und der Alphabetisierungskampagne. Er warb für die Partei, trat bei örtlichen Spendenveranstaltungen auf und organisierte lärmende Demonstrationen, die die Kolonialverwaltung ebenso provozierten wie den politischen Gegner. Alle nahmen ihn als Aktivisten wahr, und schon gab es Gerüchte, er würde irgendwann in der Zukunft einen Ministerposten bekleiden. Doch was die Gestaltung des eigenen Schicksals betraf, ging die Rechnung am Ende nicht so auf, wie er und seine intellektuellen Parteifreunde es sich erhofft hatten. Er kam bei der Revolution um, weil er sich für die falsche Partei eingesetzt hatte.
Meine Mutter wusste das alles aus erster Hand, denn als ihr Vater abgeholt wurde, war sie schon vierzehn. Wenn sie über ihn sprach, klang ihre Stimme immer sehr getragen. Die Geschichten, die er seinen Kindern möglicherweise erzählt hatte, erwähnte sie nie, auch keine lustigen Erlebnisse, bei denen er vielleicht gestolpert war, sich Obstsalat auf die Hose gekippt, eine teure Glasschüssel zerbrochen oder das Auto rückwärts gegen einen Baum gesetzt hatte. Nur selten bekam ich das Foto von dem pausbäckigen, lächelnden Mann zu sehen, der für Mohammed Abdel Wahab geschwärmt und beim Mitsingen so kehlig geklungen hatte wie der berühmte Musiker; der, wann immer Elvis Presley im Radio lief, die Luftgitarre schwang, die Hüften kreisen ließ und auf den Zehenballen wippte wie der King. Stattdessen sprach sie über seine Persönlichkeit, seine politischen Aktivitäten, seine Freigiebigkeit, seine akkurat gebügelten Sakkos und darüber, wie sehr die Leute ihn geschätzt hatten. Die Trauer saß so tief, dass sie alle alltäglichen Erinnerungen verdrängt und ihn zu einer tragischen Figur erhoben hatte.
Auf die Geschichte von seiner Verhaftung kam Saida immer wieder zurück. Als die Unruhen ausbrachen, schärfte ihr Vater ihnen ein, nicht zu schreien und sich nicht zu widersetzen, sollten sich Soldaten oder andere bewaffnete Männer dem Haus nähern. Womit zu rechnen war, schließlich galt er als prominenter Wahlkämpfer der anderen Partei. Alle außer ihm sollten sich in einem Zimmer im hinteren Teil des Hauses verbarrikadieren. Es gab Gerüchte über brutale Überfälle, und er wollte verhindern, dass seine Frau und seine Kinder seelische oder körperliche Verletzungen davontrugen. Ja, einige Leute waren schlimm in die Irre geführt worden, aber noch bestand kein Anlass, hysterisch zu werden. Falls sie zu ihnen nach Hause kämen, würde er mit ihnen reden. Er würde einfach abwarten, bis die Lage sich wieder beruhigt hatte. Als der Jeep vor dem Haus hielt, wurden Saida und ihr kleiner Bruder Amir in das Zimmer im hinteren Teil des Hauses gescheucht, aber dann weigerte ihre Mutter sich, ihren Mann allein zu lassen, und ihm blieb keine Zeit, mit ihr zu streiten.
Die Kinder hörten, wie die Soldaten mit Gewehrkolben gegen die Tür hämmerten, aber es gab kein Geschrei, nur Gemurmel, genau so, wie ihr Vater es angekündigt hatte. Später erzählte ihre Mutter, sie habe jeden der vier Soldaten persönlich gekannt. Sie sprach sie mit Namen an, einen nach dem anderen, damit sie sich erinnern würden. Sie verriet mir die Namen, weil auch ich mich erinnern sollte, was ich aber immer vermieden habe. Die Verhandlungen führten zu nichts. Saidas Eltern war nicht klar gewesen, wie brutal die Sieger vorgehen würden und wie schnell Grausamkeit neue Grausamkeit hervorbringt. Die Revolutionäre nahmen ihren Vater mit, Saida sah ihn nie wieder. Es gab weder einen Leichnam noch eine offizielle Bestätigung seines Todes. Er war einfach so verschwunden. »Ich kann es nicht beschreiben«, sagte meine Mutter. An der Stelle musste sie jedes Mal innehalten. Das Haus der Familie wurde beschlagnahmt und ging an den Staat, der es an einen eifrigen Funktionär weitergab, oder vielleicht auch an dessen Mätresse oder Cousin. Die Beschlagnahmungen wurden im Radio angekündigt: Alle konfiszierten Häuser seien augenblicklich zu räumen. Saidas Mutter gehörte zu den Leuten, die zu verängstigt waren, um sich der Anweisung zu widersetzen. Sie ließen alles zurück, was sie nicht tragen konnten, und kamen bei der Großmutter unter. Die Großmutter war eigentlich eine Tante von Saidas Mutter, ein Verwandtschaftsverhältnis, für das es kein Wort gab, nur eine Umschreibung, also wurde sie zu ihrer Großmutter, zu Bibi.
»Du kannst dir nicht vorstellen, was das für Zeiten waren«, sagte meine Mutter bei einem ihrer Versuche, die damalige Lage zu schildern. »Der Terror, die Verhaftungen, die Morde, die Demütigungen. Die Leute machten sich mit Schreckensnachrichten und Gerüchten über neue Gräueltaten und Verbote gegenseitig verrückt. Aber doch, du kannst es dir vorstellen, du musst es versuchen. Uns trennen von der Grausamkeit nur ein paar Worte, also musst du unbedingt versuchen, es dir vorzustellen.«
In den ersten Wochen, erzählte sie, waren sie überzeugt, dass sie für immer in dieser Panik leben würden. Die Menschen taten, was sie konnten, um den Männern mit den Gewehren zu beweisen, dass sie gehorsame, harmlose, bemitleidenswerte Wesen ohne jeden Funken Trotz oder Rebellentum waren. Von ihnen ging keine Gefahr aus, nicht einmal im Traum dachten sie daran, die neuen Herrscher zu verärgern. Es dauerte eine Weile, aber irgendwann wurde das Leben unter dem Terror erträglich. Anfangs fürchteten sie sich vor den Gefahren auf der Straße und blieben daheim, alle außer Bibi, die nach den Nachbarn sah und manchmal zum Laden eines Bekannten ging, der sie mit Lebensmitteln versorgte. Jeder konnte sehen, dass sie eine einfältige alte Frau war, die zu terrorisieren sich nicht lohnte. Später wagten sich auch die anderen hinaus und fanden eine veränderte Stadt vor. Die Straßen waren still, manche Häuser standen leer oder hatten neue Bewohner. An den Straßenecken lungerten bewaffnete Männer in fremden Uniformen herum, manche betraten einfach die Läden und nahmen sich, was sie wollten. Die Familie lernte, jeden Blickkontakt und jede Provokation zu meiden und wegzuschauen, wenn es zu Grausamkeiten in der Öffentlichkeit kam.
»Nach einer Weile«, erzählte meine Mutter, »war es, als würde all das gar nicht wirklich passieren und als wäre darüber zu sprechen eine heillose Übertreibung. Also verstummten wir, woraufhin die Realität sich weiter entfernte und noch unwirklicher wurde, noch unvorstellbarer. Irgendwann sagten alle, es sei an der Zeit, die Vergangenheit loszulassen und nach vorn zu blicken, gerade so, als wäre sie der Erinnerung nicht wert. Aber sie lässt einen nicht los.
Unsere Bibi wohnte in Kikwajuni. Der Eingangsbereich ihres Hauses diente als Küche, wie bei uns heute, nur dass es bei ihr so dunkel und eng war wie in einer Höhle. Sie verkaufte selbst gebackenes Sesambrot und kochte über einem offenen Feuer, weil sie es ihr ganzes Leben so gemacht hatte. Die Wände waren schwarz vom Holzrauch, und sie selbst wirkte so verschrumpelt und verschmiert, als hätte der schwarze Qualm sie gedörrt. Ihr Brot war berühmt, was vielleicht am Holzrauch lag. Ihre Kundschaft bestand aus den Jungen und Mädchen der Nachbarschaft, die nachmittags und am frühen Abend in Bibis Küche geschickt wurden. Bibi kannte sie alle und erkundigte sich stets nach ihren Müttern und Geschwistern. Sie betrieb ihr Geschäft auf die altmodische Weise, nahm die Münzen entgegen, ohne nachzuzählen, und weigerte sich, die Preise zu erhöhen. Bei größeren Bestellungen gab es einen Rabatt, und wenn ein Kind krank war, legte sie ein Brot oder zwei als Geschenk obendrauf. Irgendwie schaffte sie es, uns alle zu ernähren.
An die Küche schloss sich das Zimmer an, in dem wir alle schliefen. In dem kleinen, ummauerten Hof hinter dem Haus gab es eine Waschgelegenheit und einen leicht erhöhten Stand, auf dem Bibi, die sich vor Skorpionen fürchtete, das Feuerholz lagerte. Als hätten Skorpione Höhenangst! Sie fürchtete die Skorpione sehr. Eigentlich hatte sie nur ein einziges Mal einen gesehen, als Kind, und auch das nur kurz. Er war aus einem Lappen herausgefallen, den sie vom Boden aufgehoben hatte, und sofort in einem Mauerriss verschwunden. Für den Rest ihres Lebens hielt sie nach Skorpionen Ausschau, denen sie die Fähigkeit zuschrieb, anderen Wesen magische Schmerzen zuzufügen.
Als wir nach Babas Verhaftung zu ihr kamen, nahm sie uns ohne zu zögern auf und tröstete uns, so gut sie konnte. Wir seien, das sagte sie immer wieder, ihre einzigen Verwandten auf der Welt. Zu der Zeit war sie schon über dreizehn Jahre verwitwet und ihr einziger Sohn seit zehn Jahren tot. Meine Mutter war die Tochter von Bibis jüngerer Schwester, und nun, da die Schwester nicht mehr lebte, wurde sie Bibis Tochter. Bibi zeigte es uns immer wieder, auf ihre ganz eigene, beruhigende, zurückhaltende Weise. Meine Mutter bewunderte Bibi sehr. ›Wallahi‹, sagte sie, ›die Frau ist ein Engel.‹ Bibi schärfte uns ein, dass wir nach dieser langen Reihe von Schicksalsschlägen keine Zeit zum Herumjammern hätten. Irgendeine höhere Macht würde schon wissen, was das alles zu bedeuten hatte; man selbst könne nur alhamdulillah sagen und weitermachen. Während wir laut schluchzten, weinte sie stumm, wärmte Wasser für unser Bad auf und überließ uns ihr Bett. Sie selbst schlief auf dem Boden. Die Kokosfaserfüllung der Matratze war alt und klumpig, das Zimmer stickig und klein. Sie hatte uns nicht mehr zu bieten, aber es war besser als nichts. Als meine Mutter protestierte, weil sie sich so für uns aufopferte, schimpfte Bibi, das gehe sie gar nichts an. Ein Kind dürfe seiner Mutter wohl kaum ihre Liebe vorwerfen. Wenn die hagere, runzlige, energische Bibi, die ihr Leben lebte, als wäre diese Welt ein besserer Ort, morgens auf den Markt ging, um Gemüse und die Zutaten für ihr Brot einzukaufen, konnte sie keinen Schritt tun, ohne dass jemand ihren Namen rief, sie grüßte und ihr Gutes wünschte.
Nach einer Weile haderte meine Mutter damit, dass wir Bibi so zur Last fielen. Sie war es nicht gewohnt, von anderen abhängig zu sein. Sie war immer von ihren Liebsten umgeben gewesen, von Lachen und Hausangestellten. Ihr Ehemann hatte sie geliebt, Zufriedenheit und Zuneigung hatten sie rundlich werden lassen. Sie hatte in einem gemütlichen Zimmer im Obergeschoss geschlafen, wo die ganze Nacht lang eine Brise durchs offene Fenster hereingeweht war, aber nun lebte sie in beengten Verhältnissen und konnte nicht einmal sich oder ihre Kinder sauber halten. Das alles war neu für sie. Sie schlief in einem Seilbett mit Kokosmatratze, in der es vor üblen, von unserem Blut geschwellten Wanzen nur so wimmelte. Wenn wir eine zerdrückten, stank sie wie eine faulige Wunde oder verwesendes Fleisch. In unserem Zimmer roch es nach Schweiß und Qualm, und in manchen Nächten fand meine Mutter überhaupt keinen Schlaf, weil wir Kinder strampelten und Bibi auf dem Boden neben uns schnarchte. Doch die größte Prüfung war der unbeleuchtete, von Kakerlaken bewohnte Waschraum mit der Latrine. Manchmal gestand sie uns im Flüsterton, wie sehr das Ding sie anekelte, wovon wir Bibi natürlich nichts sagen durften. Sie bemühte sich vergebens, unsere Situation zu verbessern. Wegen ihrer Hilflosigkeit fühlte sie sich nutzlos. Sie half in der Küche, so gut sie konnte, aber weil sie diese Art von Arbeit nicht gewohnt war, stand sie Bibi im Weg oder hielt sie mit Fragen und Vorschlägen auf. Der Rauch war ihr zu viel, und ihm Gegensatz zu Bibi fehlte es ihr zum Brotbacken an Ausdauer und Talent.
Und dann irgendwann meldete sich ein ehemaliger Häftling bei uns und bestätigte den Tod meines Vaters. Der Mann sprach Bibi auf der Straße an und raunte ihr zu, er habe es von einem Zeugen erfahren, der es, das schwöre er bei Gott, mit eigenen Augen gesehen habe. Wir wussten nicht, ob der Zeuge nur ›es‹ gesagt oder genauer beschrieben hatte, was unserem Vater angetan worden war. So gab Bibi es an uns weiter, und wir fragten nicht nach, weil meine Mutter sofort in verzweifeltes Heulen ausgebrochen war. Sie schluchzte stundenlang und klammerte sich an uns, ihre weinenden Kinder. Sobald sie sich beruhigt hatte, ließ sie sich von uns wieder anstecken und umgekehrt, und so ging es immer weiter, bis wir alle drei vollkommen erschöpft waren. In den darauffolgenden Tagen war sie vor Trauer wie erstarrt. Sie war am Boden zerstört, weinte stumm vor sich hin und wollte nicht wahrhaben, was sie eigentlich schon seit Wochen wusste. Dann, eines Morgens, trat sie mit geschwollenen Augen und hängenden Schultern vor uns und verkündete ihren Plan. Er war natürlich von Anfang an aussichtslos.
Sie schämte sich dafür, zu einem hilflosen Opfer von Umständen geworden zu sein, die sie weder ändern und noch erträglicher machen konnte. Ihre Stimme war vom Weinen heiser und belegt. Im Leben war ihr immer alles in den Schoß gefallen, aber jetzt war sie nutzlos und überfordert, ein schniefendes Wrack ohne Rückgrat. Damals ging es vielen Menschen so, sie waren zu beschämt von der eigenen Schwäche, um Empörung zu fühlen, sich aufzulehnen oder auch nur zu wissen, was man gegen dieses monströse Unrecht tun könnte. Sie brachten nichts weiter zustande als ein gedämpftes, ohnmächtiges Grummeln, und auch das nur, wenn niemand zuhörte. Tausende waren auf der Flucht, weil sie kein Geld und keine Arbeit mehr hatten; ihnen blieb nichts übrig, als sich der Gnade eines Bruders oder Cousins auszuliefern, der das Glück hatte, an einem anderen Ort zu leben, oben an der Küste oder in Übersee. Sie werde dasselbe tun, sagte meine Mutter, und unsere Bekannten und Verwandten in Mombasa um Hilfe bitten. Die Zeiten waren unruhig, ihre Existenz war zerstört, und nun trieb ihr Überlebenswille sie zu rücksichtslosem Handeln. Sie hasse den Gedanken, ihre Kinder im Stich zu lassen – das sagte sie, und bei ihren Worten krampfte sich mein Herz zusammen –, allein die Vorstellung sei schlimmer als alles, was sie bislang erlebt habe, aber sie wolle nicht für immer eine Last bleiben. Sie werde fortgehen und ihr Glück versuchen, und später werde sie uns nachholen. Es wäre ja nicht für immer, nur für ein paar Monate, und danach würden wir alle wieder vereint sein. Tagelang redete sie so. Bibi hätte sie auf die Unsinnigkeit ihrer Worte hinweisen können, ließ es aber bleiben. Sie hätte sagen können, dass das Leben manchmal eben so spielt, ›reiß dich zusammen und kümmere dich um dich und deine Kinder‹, aber auch das tat sie nicht. Sie murmelte vor sich hin, kochte das Essen und setzte unser Badewasser auf.
Doch noch bevor meine Mutter ihren Notfallplan umsetzen konnte, bevor sie auf ihr Gerede und auf ihre Schwüre, sie werde ihre Kinder nie vergessen, komme, was da wolle, Taten folgen ließ, wurde sie plötzlich krank. Es war, als hätte eine böse Macht eingegriffen. Sie saß auf einem Hocker im Hof und zerrieb Kokosnüsse für den mittäglichen Maniokeintopf – eine ihrer wenigen Küchenpflichten –, als sie wie von einem wuchtigen Schlag getroffen schwankte und um Atem rang. Sie sackte kraftlos zusammen und konnte nicht einmal um Hilfe rufen. So fanden wir sie, keuchend und am Boden. Ich glaube nicht, dass sie wusste, was sie niedergestreckt hatte. Sie erlangte das Bewusstsein nie wieder, zumindest nicht so weit, dass wir sie verstanden hätten. An einem Fieber litt sie nicht, weder war ihre Temperatur gestiegen, noch hatte sie vorher Bauchschmerzen gehabt, es gab überhaupt keine Warnzeichen, weißt du, gar keine …«
Meine Mutter deutete hinter sich und verstummte.
»Da waren nur Bibi und wir Kinder, und natürlich wussten wir nicht, was wir tun sollten. Meine Mutter war ohnmächtig geworden und zitterte am ganzen Leib. Uns fiel nichts Besseres ein, als sie ins Krankenhaus zu bringen. Im Taxi saß Bibi auf der einen Seite meiner Mutter und ich mit Amir auf der anderen. Wir hatten sie aufrecht zwischen uns geklemmt, als müssten wir um jeden Preis verhindern, dass sie zusammensackte oder zur Seite kippte. Der Weg war nicht weit, doch das Taxi durfte das Kliniktor nicht passieren, also stützten wir unsere Mutter, so gut wir konnten. Wir stützten ihren schlaffen Körper und sprachen kein Wort.
Wir schleppten uns zur Notaufnahme, aber dort konnte uns niemand weiterhelfen. Als Bibi zu erklären versuchte, was passiert war, ging die einzige diensthabende Krankenschwester seelenruhig weiter; sie ging an uns vorbei, als wären wir Luft. Ich konnte nicht fassen, dass eine Krankenschwester sich so benahm. Weil sie nicht zurückkam, setzten wir uns zu mehreren Dutzend anderen Leuten, die auf einen Arzt warteten. Wir setzten uns auf eine Betonbank und schwiegen wie alle anderen auch, und währenddessen stützen wir unsere zitternde, stöhnende Mutter. Der Saal war groß und die Tür weit geöffnet, aber der Gestank von Krankheit und Verfall wollte sich einfach nicht verziehen. Dort warteten Menschen jeden Alters: eine müde alte Frau, die mit geschlossenen Augen an der Schulter einer jüngeren lehnte, ihrer Tochter vielleicht; ein Baby mit entzündeten, verklebten Augen, das im Arm seiner Mutter ununterbrochen weinte; junge Frauen ohne sichtliche Beschwerden; Männer und Frauen im Würgegriff einer der vielen Krankheiten, wie sie Menschen in den armen Ländern dieser Welt befallen.
Ein Pfleger erschien, doch als Bibi an ihn herantrat und ihn auf uns aufmerksam machen wollte, winkte er ab. Den Wartenden war es nicht gestattet, ihre Krankengeschichte vorzubringen, und falls sie es trotzdem versuchten, hob er die Hand und zeigte gebieterisch auf die Betonbänke. Wer hartnäckig blieb und nicht sofort gehorchte, wurde barsch zurechtgewiesen und fortgeschickt. Der Pfleger zog sich in eine Glaskabine zurück, wo er mit gequälter Miene Papiere ordnete und sich vor den Leuten versteckte, denen er nicht helfen konnte. Als am frühen Nachmittag immer noch kein Arzt aufgetaucht war, sagte der Pfleger, alle sollten nach Hause gehen, eine Aspirin nehmen und am nächsten Tag wiederkommen. Die Sprechstunde war vorbei, die Ambulanz geschlossen. ›Wahrscheinlich fühlt der Bereitschaftsarzt sich heute nicht gut. Geht nach Hause, da kann man nichts machen, kommt morgen wieder, dann wird er bestimmt hier sein. Ich muss jetzt abschließen.‹
Bibi machte sich auf die Suche nach einem Taxi, und wir brachten meine Mutter nach Hause. Im Laufe der Nacht bekam sie immer schlechter Luft. Sie konnte auch nicht mehr reden, nur manchmal stieß sie unvermittelt ein Keuchen aus oder verzerrte Laute, aus denen wir Worte herauszuhören versuchten. Am Morgen atmete sie so flach, dass wir es kaum noch wagten, sie zu bewegen oder sie anzusprechen aus Angst, sie könnte versuchen zu antworten. Die Laute waren unerträglich, aber allein lassen konnten wir sie natürlich auch nicht. Wenige Stunden später starb sie. Sie bekam keine Luft mehr. Ihr Herz streikte. Ich war vierzehn und Amir zehn. Ich war erleichtert, weil meine Mutter nicht mehr litt. Es mag furchtbar klingen, aber als es endlich vorbei war, fühlte ich mich erleichtert.