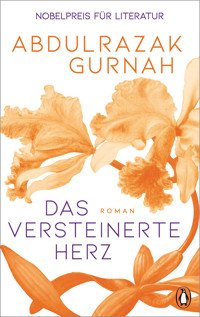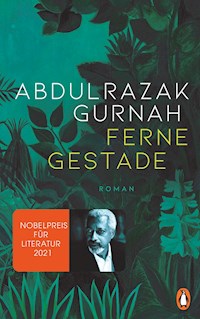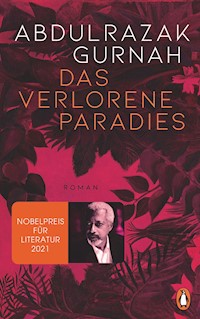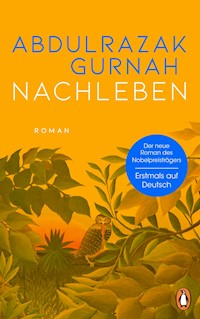
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Der aktuelle Roman des Literaturnobelpreisträgers erstmals auf Deutsch: Eine erschütternde, generationsübergreifende Saga über Krieg und Liebe zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Ilyas ist elf, als er sein Zuhause an der ostafrikanischen Küste verlässt und für die deutschen Kolonialtruppen zwangsrekrutiert wird. Jahre später findet er die Hütte seiner Familie verlassen und seine kleinen Schwester Afiya bei Fremden, die sie schlecht behandeln. Auch ein anderer junger Mann kehrt in diesen Tagen zurück: Hamza hatte sich freiwillig den deutschen Truppen angeschlossen. Mit nichts als den Kleidern am Leib sucht er nun Arbeit und Sicherheit – und findet die Liebe der klugen Afiya. Während das Schicksal die jungen Menschen zusammenführt, während sie sich verlieben und versuchen, mit den dunklen Schatten der Vergangenheit zu leben, rückt aus Europa ein weiterer Weltkrieg in bedrohliche Nähe.
Abdulrazak Gurnah wurde 2021 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. »Nachleben« war nominiert für den Walter Scott Prize und den Orwell Prize for Fiction.
»Gurnah erzählt verdammt großartige Geschichten.« DIE ZEIT
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 481
Ähnliche
Buch
Ilyas ist elf, als er aus Not sein bitterarmes Zuhause an der ostafrikanischen Küste verlässt und von einem Soldaten der deutschen Kolonialtruppen zwangsrekrutiert wird. Jahre später kehrt er in sein Dorf zurück, doch seine Eltern sind tot. Ilyas macht sich auf die Suche nach seiner kleinen Schwester Afiya, die bei Verwandten untergekommen ist, wo sie wie eine Sklavin gehalten wird und niemand ihre Talente sehen will. Auch ein anderer junger Mann kehrt nach Hause zurück: Hamza war von seinen Eltern als Kind verkauft worden und hatte sich freiwillig den deutschen Truppen angeschlossen. Mit nichts als den Kleidern am Leib sucht er nun Arbeit und Sicherheit – und findet die Liebe der klugen Afiya. Während das Schicksal die jungen Menschen zusammenführt, während sie leben, sich verlieben und versuchen, das Vergangene zu vergessen, rückt aus Europa der nächste Weltkrieg bedrohlich näher …
»Nachleben«, der jüngste Roman des Nobelpreisträgers Abdulrazak Gurnah, ist die ebenso kluge wie bestürzende Geschichte von Menschen, die im Schatten der kolonialen Weltordnung um ihre Unversehrtheit kämpfen.
Autor
Abdulrazak Gurnah (geb. 1948 im Sultanat Sansibar) wurde 2021 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Er hat bislang zehn Romane veröffentlicht, darunter »Paradise« (1994; dt. »Das verlorene Paradies«), »By the sea« (2001; dt. »Ferne Gestade«; beide nominiert für den Booker Prize) und »Desertion« (2006; dt. »Die Abtrünnigen«; nominiert für den Commonwealth Writers’ Prize). Gurnah ist Professor emeritus für englische und postkoloniale Literatur der University of Kent. Er lebt in Canterbury.
Eva Bonné (geb. 1970) studierte amerikanische und portugiesische Literaturwissenschaft in Hamburg, Lissabon und Berkeley. Seither übersetzt sie Literatur aus dem Englischen, u.a. von Michael Cunningham, Rachel Cusk und Anne Enright. Sie lebt in Berlin.
»Herzzerreißend und eindrucksvoll.« TIME
»Ein Roman, der mit seinem Humor, seiner Großmut und seiner klaren Vision der unendlichen Widersprüche der menschlichen Natur zum Lesen und Immer-wieder-Lesen einlädt.« Evening Standard
»Gurnah erzählt verdammt großartige Geschichten. Die Sprache ist provozierend einfach, betont schnörkellos und unprätentiös, von einer so schlichten Schönheit, die sich nur jemand erlaubt, der sich nichts beweisen muss.« DIE ZEIT
www.penguin-verlag.de
ABDULRAZAKGURNAH
NACHLEBEN
ROMAN
Aus dem Englischen von Eva Bonné
Die Originalausgabe erschien 2020unter dem Titel Afterlives bei Bloomsbury, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2020 by Abdulrazak Gurnah
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Favoritbuero, München
Coverabbildung: Bridgeman Images
Satz: Uhl + Massopust GmbH, Aalen
ISBN 978-3-641-29438-0V004
www.penguin-verlag.de
EINS
1
Khalifa war sechsundzwanzig Jahre alt, als er den Kaufmann Amur Biashara kennenlernte. Zu der Zeit arbeitete er in einer kleinen Privatbank, die zwei Brüdern aus Gujarat gehörte. Von Indern geführte Privatbanken waren die einzigen, die sich auf das Gebaren der einheimischen Kaufleute einließen und Geschäfte mit ihnen machten; alle größeren Geldinstitute legten Wert auf Dokumente, Sicherheiten und Garantien, was den einheimischen Kaufleuten nicht immer passte. Sie verließen sich lieber auf ihre Netzwerke, auf Verbindungen, die für das Auge unsichtbar waren. Die Brüder hatten Khalifa eingestellt, weil er väterlicherseits mit ihnen verwandt war. Verwandt ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber sein Vater stammte ebenfalls aus Gujarat, und manchmal war das Verwandtschaft genug. Khalifas Mutter kam vom Land. Sein Vater hatte sie bei der Arbeit auf der Farm eines indischen Großgrundbesitzers kennengelernt, zwei Tagesreisen von der Stadt entfernt, in der er fast sein gesamtes Erwachsenenleben verbracht hatte. Khalifa sah nicht wie ein Inder aus, beziehungsweise nicht wie jene Inder, die man in diesem Teil der Welt zu sehen gewohnt war, denn Haut, Haare und Nase hatte er von seiner afrikanischen Mutter geerbt; aber wenn es ihm gelegen kam, berief er sich gern auf seine Abstammung. »Ja, doch, mein Vater war Inder. Sieht man mir gar nicht an, was? Er hat meine Mutter geheiratet und war ihr immer treu. Manche Inder vergnügen sich mit Afrikanerinnen, die sie dann, sobald sie für eine indische Ehefrau bereit sind, einfach sitzenlassen, aber mein Vater ist immer bei meiner Mutter geblieben.«
Khalifas Vater Qassim war in einem kleinen Dorf in Gujarat zur Welt gekommen, wo es Reiche und Arme gab, Hindus, Muslime und sogar ein paar Habescha-Christen. Qassims Familie war muslimisch und arm, er selbst ein fleißiger, an Entbehrungen gewöhnter Junge. Zunächst besuchte er die Moscheeschule in seinem Dorf, später dann eine staatliche Einrichtung in der nächstgelegenen Stadt, wo Gujarati gesprochen wurde. Sein Vater reiste als Steuereintreiber durchs Land; dass Qassim zur Schule ging, um später ebenfalls als Steuereintreiber oder in einem anderen achtbaren Beruf zu arbeiten, war seine Idee gewesen. Qassims Vater lebte nicht mit der Familie zusammen und besuchte sie höchstens zwei- oder dreimal im Jahr, während seine Mutter sich um die blinde Schwiegermutter und die fünf Kinder kümmerte. Qassim war der Älteste und hatte noch einen Bruder und drei Schwestern. Zwei davon, die beiden jüngsten, waren früh gestorben. Hin und wieder schickte der Vater Geld, aber im Grunde waren sie in ihrem Dorf auf sich allein gestellt und mussten jede Arbeit annehmen, die ihnen angeboten wurde. Als Qassim alt genug war, ermutigten ihn seine gujaratisprachigen Lehrer, sich für ein Stipendium an einer englischen Schule in Bombay zu bewerben, und ab dem Moment wendete sich das Schicksal. Sein Vater und andere Verwandte nahmen einen Kredit auf, damit er während seiner Zeit in Bombay möglichst gut unterkam. Nach einer Weile verbesserte sich seine Situation und er konnte zur Untermiete bei der Familie eines Schulfreundes wohnen, der ihm einen Job als Nachhilfelehrer für jüngere Kinder vermittelte. Mit den zusätzlichen Annas, die er auf diese Weise verdiente, kam er über die Runden.
Kurz nach dem Schulabschluss bot man ihm eine Stelle als Buchhalter bei einem Großgrundbesitzer an der afrikanischen Küste an. Die Einladung erschien ihm wie ein Segen, eröffnete sie ihm doch die Möglichkeit, sich seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen und vielleicht sogar ein Abenteuer zu erleben. Sie hatte ihn über den Imam des Dorfes erreicht. Die Vorfahren des Großgrundbesitzers waren vor langer Zeit aus ebenjenem Dorf ausgewandert, und wann immer sie einen Buchhalter brauchten, bestellten sie ihn von dort. Damit wollten sie sichergehen, dass sich ein besonders loyaler und dienstbarer Mensch um ihre Geschäfte kümmerte. Jedes Jahr im Fastenmonat schickte Qassim dem Imam eine bestimmte Summe, die der Großgrundbesitzer von seinem Lohn einbehalten hatte und die für seine Familie bestimmt war. Er sollte niemals nach Gujarat zurückkehren.
Diese Geschichte seiner entbehrungsreichen Kindheit erzählte Qassim seinem Sohn Khalifa oft. Er erzählte sie, weil alle Väter solche Geschichten erzählen und weil er sich wünschte, dass der Junge Ehrgeiz entwickelte. Er brachte ihm das Lesen und Schreiben im lateinischen Alphabet und die Grundrechenarten bei. Als Khalifa ein bisschen älter war, ungefähr elf, schickte er ihn zu einem Privatlehrer in die Nachbarstadt, der ihn in Mathematik, Buchführung und Englisch unterrichten sollte. Es handelte sich dabei um Vorhaben und Pläne, die Qassim aus Indien mitgebracht, im eigenen Leben aber nie verwirklicht hatte.
Khalifa war nicht der einzige Schüler des Privatlehrers. Insgesamt waren sie zu viert, und alle waren indischer Abstammung. Sie wohnten im Haus ihres Lehrers und schliefen unter der Treppe im Flur, wo sie auch ihre Mahlzeiten einnahmen. Das Obergeschoss durften sie nicht betreten. Der Klassenraum war ein kleines Zimmer mit Bodenmatten und einem vergitterten Fenster hoch oben in der Wand, so hoch, dass sie nicht nach draußen sehen konnten; dafür konnten sie den Abwasserkanal riechen, der hinter dem Haus verlief. Vor und nach dem Unterricht hielt der Lehrer den Raum verschlossen, überhaupt behandelte er ihn wie ein Heiligtum, das sie jeden Morgen vor der ersten Stunde fegen und putzen mussten. Unterricht fand frühmorgens statt, und dann noch einmal spätnachmittags, solange es noch hell war. Dazwischen wollte der Lehrer essen und Mittagsruhe halten, und abends unterrichtete er nicht, um Kerzen zu sparen. In den freien Stunden arbeiteten die Jungen auf dem Markt und am Strand, oder sie streiften durch die Straßen. Khalifa ahnte ja nicht, mit wie viel Wehmut er später an diese Zeit zurückdenken würde.
Er war im selben Jahr zu dem Privatlehrer gezogen, als die Deutschen in die Stadt kamen, und er blieb für fünf Jahre dort. Es war die Zeit des Abushiri-Aufstandes, als arabische und suahelische Küstenkaufleute und Karawanenhändler sich dem deutschen Herrschaftsanspruch über das Gebiet widersetzten. Aber die Deutschen, die Briten, die Franzosen, die Belgier, die Portugiesen, die Italiener und alle anderen hatten längst ihre Konferenzen abgehalten, ihre Landkarten gezeichnet und ihre Verträge unterschrieben, und so fiel der Widerstand nicht weiter ins Gewicht. Die Revolte wurde von Oberst Wissmann und seiner neu gebildeten Schutztruppe niedergeschlagen. Drei Jahre nach dem gescheiterten Abushiri-Aufstand, als Khalifas Zeit bei dem Privatlehrer zu Ende ging, zettelten die Deutschen einen weiteren Krieg an, diesmal gegen die Hehe im fernen Süden des Landes. Auch sie weigerten sich, die Deutschen als neue Herrscher anzuerkennen, und wie sich herausstellte, waren sie ausdauernder als Abushiri. Sie fügten der Schutztruppe unerwartet schwere Verluste zu, woraufhin diese noch entschlossener und grausamer gegen sie vorging.
Zur Freude seines Vaters bewies Khalifa ein großes Talent für Lesen, Schreiben und Buchführung. Auf Anraten des Privatlehrers schrieb der Vater der Bankiersfamilie aus Gujarat, die in derselben Stadt lebte. Der Lehrer entwarf einen Brief, den er Khalifa nach Haus mitgab. Khalifas Vater schrieb den Entwurf ab und überreichte ihn einem Kutscher, der ihn dem Lehrer überbrachte, der ihn wiederum an die Bankiersbrüder weitergab. Alle waren sich einig, dass die Empfehlung des Lehrers hilfreich sein würde.
Sehr verehrte Herren, schrieb der Vater, hätten Sie in Ihrem geschätzten Unternehmen eine Stelle für meinen Sohn frei? Er ist ein fleißiger junger Mann und ein talentierter, wenn auch unerfahrener Buchhalter, der das lateinische Alphabet und die Grundlagen des Englischen beherrscht. Er wäre Ihnen sein Leben lang dankbar. Ihr bescheidener Bruder aus Gujarat.
Einige Monate später bekamen sie eine Antwort, allerdings nur, weil der Privatlehrer zu den Brüdern gegangen war und sie, um seinen guten Ruf zu retten, bekniet hatte. In dem Brief stand: Schicken Sie ihn her, und wir versuchen es mit ihm. Falls er sich gut macht, bieten wir ihm eine Stelle an. Wir Muselmanen aus Gujarat müssen zusammenhalten. Denn wer würde auf uns achtgeben, wenn wir es nicht selbst tun?
Khalifa konnte es gar nicht erwarten, von seiner Familie wegzukommen, die immer noch auf dem Land des Großgrundbesitzers wohnte. Sein Vater war dort als Buchhalter angestellt, und während sie auf die Antwort der Bankiersbrüder warteten, half Khalifa ihm bei der Arbeit: Löhne erfassen, Aufträge schreiben, Ausgaben auflisten und Beschwerden über Zustände entgegennehmen, auf die er keinen Einfluss hatte. Die Landarbeit war schwer, die Bezahlung der Leute dürftig. Oft hatten sie mit Fieber, Schmerzen und Hunger zu kämpfen. Viele Arbeiter versorgten sich teilweise selbst und bestellten ein kleines, ihnen zugeteiltes Stück Land. Auch Khalifas Mutter Mariamu hielt es so und baute Tomaten, Spinat, Okraschoten und Süßkartoffeln an. Der Garten lag gleich neben dem beengten Häuschen der Familie. Manchmal fand Khalifa sein armseliges Leben dort so langweilig und deprimierend, dass er sich nach der Zeit bei dem strengen Privatlehrer zurücksehnte. Als die Antwort der Bankiersbrüder eintraf, war er zur Abreise bereit und fest entschlossen, sich zu bewähren und die Stelle zu bekommen. Er sollte sie elf Jahre lang behalten. Falls die Brüder sich über sein Aussehen wunderten, ließen sie es sich nicht anmerken, sie sprachen Khalifa auch nie darauf an, anders als einige der indischen Bankkunden. Ja doch, er ist einer von uns, ein Guji wie wir, antworten die Brüder dann.
Khalifa war nur ein einfacher Angestellter, der Zahlen ins Kassenbuch eintrug und die Akten auf dem neuesten Stand hielt. Andere Aufgaben durfte er nicht übernehmen. Er bezweifelte, dass er das volle Vertrauen seiner Arbeitgeber genoss, aber so lief das im Geldgeschäft nun einmal. Die Brüder Hashim und Gulab verliehen Geld, was im Grunde, wie sie Khalifa erklärten, die Hauptaufgabe aller Banken war. Doch anders als die großen Häuser führten sie für ihre Kunden keine Privatkonten. Die Brüder waren fast gleich alt und sahen einander sehr ähnlich: Beide waren klein und stämmig und hatten ein freundliches Gesicht, breite Wangenknochen und einen sorgsam gestutzten Schnauzbart. Ihre wenigen Kunden, ausgesuchte Geschäftsmänner und Finanziers aus Gujarat, legten ihre Gewinne bei den Brüdern an, und diese verliehen das Geld gegen Zinsen an örtliche Händler und Kaufleute weiter. Jedes Jahr am Geburtstag des Propheten veranstalteten sie ein großes Maulid-Fest mit Lesung im Garten ihrer Villa und teilten Essen an alle aus, die kamen.
Khalifa arbeitete seit zehn Jahren für die Brüder, als Amur Biashara ihm einen Vorschlag unterbreitete. Er kannte den Kaufmann, weil der mit der Bank Geschäfte machte. Mehr als einmal hatte Khalifa ihm mit Informationen ausgeholfen, die er sich ohne das Wissen der Brüder angeeignet hatte, Angaben zu Provisionen und Zinsen beispielsweise, die es dem Kaufmann erlaubten, bessere Verträge abzuschließen. Amur Biashara bezahlte Khalifa dafür. Genau genommen bestach er ihn. Die Summen waren immer klein und die Vorteile, die Amur Biashara daraus zog, ziemlich bescheiden; doch er hatte einen Ruf als Halsabschneider zu verlieren, und außerdem konnte er Geschäften unter der Hand nicht widerstehen. Dass Khalifa stets nur geringe Beträge annahm, half ihm dabei, sein schlechtes Gewissen zu beruhigen, denn immerhin hinterging er seine Arbeitgeber. Er redete sich ein, er sammle lediglich Berufserfahrung, und dazu gehörte eben auch eine Kenntnis von den Grauzonen des Geschäfts.
Ein paar Monate nachdem die kleine Abmachung zwischen Khalifa und Amur Biashara zustande gekommen war, beschlossen die Bankiersbrüder, ihr Geschäft nach Mombasa zu verlegen. Zu der Zeit wurde die Eisenbahnlinie zwischen Mombasa und Kisumu gebaut, und die Kolonialpolitik in Britisch-Ostafrika, wie es damals hieß, förderte die Ansiedlung von Europäern. Die Brüder sahen in dem Umzug eine Chance, und sie waren nicht die einzigen indischen Kaufleute und Gewerbetreibenden, die so dachten. Amur Biashara wollte seine Firma vergrößern, und so stellte er Khalifa ein, weil der im Gegensatz zu ihm selbst das lateinische Alphabet beherrschte. Der Kaufmann hoffte, von Khalifas Wissen profitieren zu können.
Mittlerweile hatten die Deutschen alle Revolten in Deutsch-Ostafrika unter Kontrolle gebracht, oder wenigstens glaubten sie das. Sie waren mit Abushiri, den Protesten an der Küste und dem Widerstand der Karawanenhändler fertig geworden. Nach langem Kampf hatten sie die Rebellion niedergeschlagen, Abushiri gefangen genommen und 1889 gehängt. Die Schutztruppe – eine Armee aus Askari genannten afrikanischen Söldnern unter dem Kommando von Oberst Wissmann und seinen deutschen Offizieren – bestand zu der Zeit aus entlassenen nubischen Soldaten, die für die Briten gegen die Mahdi im Sudan gekämpft hatten, und aus Shangaan, Zulu-Rekruten aus dem südlich gelegenen Portugiesisch-Ostafrika. Die deutsche Verwaltung inszenierte Abushiris Hängung als öffentliches Spektakel, wie auch viele weitere Hinrichtungen in den folgenden Jahren. Fest entschlossen, der Region Ordnung und Zivilisation zu bringen, errichtete sie in der Festung von Bagamoyo, einer von Abushiris früheren Hochburgen, einen deutschen Kommandoposten. Bagamoyo war der Endpunkt der alten Karawanenroute und der wichtigste Hafen der Küste. Indem sie den Ort eroberten und besetzt hielten, bewiesen die Deutschen ihre Kontrolle über die Kolonie.
Trotzdem gab es noch viel für sie zu tun, denn auf ihrem Weg ins Hinterland begegneten ihnen weitere Völker, die kein Interesse daran hatten, deutsche Untertanen zu sein: die Nyamwezi, die Chagga, die Meru. Am meisten Ärger machten die Hehe im Süden. Unterworfen wurden sie erst nach acht Jahren Krieg, während derer ihr Widerstand ausgehungert, zermalmt und niedergebrannt wurde. Die siegreichen Deutschen schnitten dem Hehe-Anführer Mkwawa den Kopf ab und schickten ihn als Trophäe nach Deutschland. Fortan galten die Askari der Schutztruppe, die inzwischen durch Rekruten aus den bezwungenen Völkern verstärkt wurde, als erfahrene Zerstörungsmacht. Sie waren stolz auf ihren schlimmen Ruf, und den Offizieren und Verwaltern von Deutsch-Ostafrika kam das gerade recht. Noch ahnten sie nichts vom Maji-Maji-Aufstand, der sich in der Zeit, als Khalifa für Amur Biashara arbeitete, im Süden und Westen erheben, zur größten aller Rebellionen ausweiten und die Deutschen und ihre Askari-Armee zu noch größerer Grausamkeit anstacheln würde.
In jenen Jahren führte die deutsche Verwaltung neue Vorschriften und Regeln für den Handel ein. Amur Biashara erwartete, dass Khalifa ihn in diesen Fragen vertrat. Er erwartete, dass Khalifa die von der Verwaltung herausgegebenen Dekrete und Berichte las und alle nötigen Zoll- und Steuerformulare ausfüllte, aber abgesehen davon ließ er sich nicht in die Karten sehen. Ständig führte er irgendetwas im Schilde, und nach einer Weile war Khalifa kein einfacher Buchhalter mehr, sondern ein Assistent, der alles erledigte, was von ihm verlangt wurde. Manchmal weihte der Kaufmann ihn ein, manchmal nicht. Khalifa schrieb Briefe und ging in die Verwaltungsbüros, um diese oder jene Lizenz abzuholen, er sammelte Tratsch und Informationen und versorgte alle Amtsleute, die der Kaufmann bei Laune halten wollte, mit kleinen Geschenken und Schmiergeldern. Anscheinend vertraute der Kaufmann auf ihn und seine Verschwiegenheit, soweit man bei Amur Biashara überhaupt von Vertrauen sprechen konnte.
Aber Amur Biashara war kein schwieriger Arbeitgeber. Er war ein kleiner, eleganter Mann mit sanftem, leisem Auftreten, der regelmäßig die örtliche Moschee besuchte. War jemandem ein kleineres Unglück widerfahren, beteiligte er sich an der Spendensammlung, und nie verpasste er die Bestattung eines Nachbarn. Durchreisende Fremde hätten ihn für nichts weniger gehalten als ein bescheidenes, wenn nicht gar lammfrommes Mitglied der Gesellschaft, doch die Einheimischen wussten es besser und tuschelten bewundernd über seine halsabschneiderische Art und seinen vermeintlichen Reichtum. Seine Geheimniskrämerei und seine Rücksichtslosigkeit in geschäftlichen Angelegenheiten gehörten für sie zu den grundlegenden Eigenschaften eines erfolgreichen Kaufmanns. Er betreibe seine Firma wie eine Intrige, pflegten die Leute zu sagen. Khalifa hielt ihn eher für einen Piraten, dem kein Handel zu schäbig war: Schmuggel, Geldverleih, das Horten von knappen Waren, dazu der übliche Import unterschiedlicher Güter. Was immer gerade gebraucht wurde, Amur Bishara konnte es liefern, und weil er niemandem vertraute und manche Transaktionen besonders diskret ablaufen mussten, führte er seine Firma im Kopf. Khalifa hatte den Eindruck, dass es dem Kaufmann großes Vergnügen bereitete, Schmiergelder zu verteilen oder krumme Geschäfte zu machen, und dass es ihn freute, wenn sich etwas durch heimliche Zahlungen regeln ließ. Immerzu war er dabei, Geldbeträge zu überschlagen und sein Gegenüber abzuschätzen. Nach außen gab er sich sanft, und wenn er wollte, konnte er sogar gütig sein, aber Khalifa wusste, zu welcher Strenge er fähig war. Nach einigen Jahren bei Amur Biashara hatte er verstanden, wie hart das Herz des Kaufmanns in Wirklichkeit war.
Khalifa schrieb also die Briefe, zahlte die Schmiergelder, schnappte alle Informationen auf, die der Kaufmann beiläufig fallen ließ, und war halbwegs zufrieden. Er hatte eine Schwäche für Gerüchte, die er mit Eifer aufnahm und weiterverbreitete, und glücklicherweise hatte Amur Biashara gar nichts dagegen, dass er, statt am Schreibtisch zu sitzen, plaudernd auf der Straße stand oder seine Zeit im Café verbrachte, denn es war besser zu wissen, was geredet wurde, als im Dunkeln zu tappen. Khalifa hätte gern mehr beigetragen und sich in alle Geschäftsgeheimnisse einweihen lassen, doch dazu würde es wohl nie kommen. Er kannte ja nicht einmal die Zahlenkombination des Tresors; brauchte er ein Dokument, musste er den Kaufmann darum bitten. Amur Biashara bewahrte einen Haufen Geld in dem Tresor auf, und wenn Khalifa oder sonst jemand zugegen war, öffnete er die Tür nie ganz. Wollte er etwas herausholen, stellte er sich davor und schirmte das Rad mit dem Körper ab, und dann zog er die Tür einen Spaltbreit auf und griff so verstohlen hinein wie ein Dieb.
Khalifa war seit über drei Jahren bei Bwana Amur, als er vom plötzlichen Tod seiner Mutter erfuhr. Sie war mit Ende vierzig völlig unerwartet gestorben. Khalifa eilte nach Hause und fand seinen unglücklichen Vater in einem denkbar schlechten Zustand vor. Obwohl Khalifa ein Einzelkind war, hatte er seine Eltern in der Vergangenheit nur selten besucht, und nun war er überrascht, den Vater so abgekämpft und schwach zu sehen. Der Mann war krank, hatte aber keine Gelegenheit gehabt, einen Heiler aufzusuchen und sich erklären zu lassen, was ihm fehlte. Es gab in der Gegend keine Ärzte, und das nächste Krankenhaus befand sich in der Küstenstadt, in der Khalifa jetzt wohnte.
»Du hättest mir eine Nachricht schicken sollen. Dann wäre ich früher gekommen und hätte dich zu mir geholt«, sagte er.
Sein Vater war entkräftet und zitterte am ganzen Leib. Nun, da er nicht mehr arbeiten konnte, saß er den ganzen Tag vor seinem Zwei-Zimmer-Häuschen auf dem Land des Großgrundbesitzers und starrte vor sich hin.
»Ich bin erst seit ein paar Monaten so schwach«, erzählte er Khalifa. »Ich habe immer geglaubt, ich würde als Erster gehen, aber jetzt ist deine Mutter mir zuvorgekommen. Sie hat einfach die Augen zugemacht und ist eingeschlafen und nicht wieder aufgewacht. Was soll ich denn jetzt anfangen?«
Khalifa blieb vier Tage, und an den Symptomen erkannte er, dass sein Vater schwer an Malaria erkrankt war. Er hatte hohes Fieber und konnte kein Essen bei sich behalten, seine Augen waren gelblich und sein Urin rot verfärbt. Khalifa wusste aus eigener Erfahrung, wie gefährlich die Mücken auf dem Land sein konnten; nach jeder Nacht im kleinen Zimmer seines Vaters waren seine Hände und Ohren völlig zerstochen. Am Morgen des vierten Tages wachte er auf und sah, dass sein Vater noch schlief. Er schlich hinaus und ging hinters Haus, um sich zu waschen und einen Tee aufzusetzen. Während er darauf wartete, dass das Wasser kochte, lief ihm plötzlich ein kalter Schauder über den Rücken; er rannte ins Haus zurück und sah, dass sein Vater nicht schlief, sondern gestorben war. Khalifa stand eine Weile da und blickte auf den Mann hinunter, der im Leben so energisch und kämpferisch gewesen war und jetzt im Tod so hager und geschrumpft wirkte. Er deckte den Leichnam zu und lief ins Büro des Verwalters, um Hilfe zu holen. Der Leichnam wurde in eine kleine Dorfmoschee in der Nähe des Anwesens gebracht. Mit der Hilfe von anderen, die sich mit den Ritualen auskannten, wusch Khalifa ihn gemäß der Tradition. Später am selben Nachmittag beerdigten sie ihn auf dem Friedhof hinter der Moschee. Die wenigen Habseligkeiten, die seine Eltern ihm hinterlassen hatten, gab Khalifa dem Imam mit der Bitte, sie an Bedürftige zu verteilen.
Nach seiner Rückkehr in die Stadt und in den darauffolgenden Monaten fühlte Khalifa sich, als wäre er ein undankbarer, nutzloser Sohn und ganz allein auf der Welt. Dieses Empfinden traf ihn vollkommen unvorbereitet. Er hatte den größten Teil seines Lebens ohne seine Eltern verbracht, erst beim Privatlehrer, dann bei den Bankiersbrüdern und zuletzt beim Kaufmann, aber nie hatte er dabei ein schlechtes Gewissen gehabt oder geglaubt, er würde sie vernachlässigen. Doch ihr plötzliches Ableben ereilte ihn wie eine Katastrophe, und auf einmal kam er sich vor wie ein Verdammter. Er vergeudete sein Leben in einer fremden Stadt, in einem Land im permanenten Kriegszustand; schon jetzt gab es Berichte von einem neuen Aufstand im Südwesten.
Da wandte sich Amur Biashara an ihn.
»Du bist nun schon seit einigen Jahren bei mir … seit wie vielen eigentlich? Drei? Vier?«, fragte er. »Du warst immer respektvoll und fleißig. Ich weiß das zu schätzen.«
»Ich danke Ihnen«, sagte Khalifa und wusste nicht genau, ob er jetzt mit einer Gehaltserhöhung rechnen sollte oder mit seiner Entlassung.
»Ich weiß, der Verlust deiner Eltern war ein schwerer Schlag für dich. Ich konnte sehen, wie sehr er dir zugesetzt hat. Möge Gott ihren Seelen gnädig sein. Und weil du nun schon so lange voller Hingabe und Bescheidenheit für mich gearbeitet hast, wäre es wohl nicht vermessen von mir, dir einen guten Rat zu geben«, sagte der Kaufmann.
»Den nehme ich gern an«, sagte Khalifa und dachte bei sich, dass er anscheinend nicht entlassen wurde.
»Du bist wie ein Sohn für mich, deswegen ist es meine Pflicht, dir eine Orientierung zu bieten. Es ist an der Zeit, dich zu verheiraten, und ich glaube, ich kenne eine geeignete Braut. Eine Verwandte von mir ist seit Kurzem verwaist, ein anständiges Mädchen, das außerdem noch geerbt hat. Ich schlage dir vor, dich um sie zu bemühen. Ich würde sie ja selbst heiraten«, fügte der Kaufmann lächelnd hinzu, »aber ich bin mit meinem Leben zufrieden, wie es ist. Du hast mir viele Jahre lang gut gedient, und dies wäre ein passender Schritt.«
Khalifa wusste, dass der Kaufmann ihm die junge Frau zum Geschenk machen wollte und sie selbst wohl kaum ein Mitspracherecht hatte. Angeblich war sie ein anständiges Mädchen, aber aus dem Mund eines hartherzigen Kaufmanns bedeuteten diese Worte nicht viel. Khalifa willigte trotzdem in die Vereinbarung ein, zum einen, weil er nicht zu widersprechen wagte, zum anderen, weil er es selbst so wollte; doch in bangen Momenten stellte er sich seine Zukünftige als einen ruppigen, fordernden Menschen mit unangenehmen Angewohnheiten vor. Er würde sie nicht vor der Hochzeit kennenlernen, in der Tat nicht einmal bei der Hochzeit selbst. Die Zeremonie war schlicht. Der Imam fragte Khalifa, ob er Asha Fuadi zur Frau nehmen wolle, und er sagte Ja. Bwana Amur Biashara, ihr ältester männlicher Verwandter, stimmte in ihrem Namen zu, und damit war die Sache erledigt. Nach der Zeremonie gab es Kaffee, anschließend begleitete Khalifa den Kaufmann zum Haus der jungen Frau und stellte sich vor. Das Haus war Asha Fuadis Erbe, nur dass sie es nicht antreten konnte.
Asha war zwanzig, Khalifa einunddreißig. Ashas Mutter war Amur Biasharas Schwester gewesen. Der Kummer der letzten Zeit überschattete Ashas Augen noch immer. Sie hatte ein hübsches, ovales Gesicht und eine ernste, feierliche Art. Khalifa fühlte sich sofort zu ihr hingezogen, doch ihm war klar, dass sie seine Umarmungen wahrscheinlich nur über sich ergehen ließ. Es dauerte eine Weile, bis sie seine Leidenschaft erwidern und ihm ihre Geschichte erzählen konnte und er sie vollkommen verstand. Nicht, dass die Geschichte ungewöhnlich gewesen wäre, ganz im Gegenteil; sie handelte von der ganz gewöhnlichen Piraterie der Kaufleute dieser Welt. Anfangs hatte Asha gezögert, weil sie ihrem neuen Mann noch nicht vertraute und nicht wusste, wem seine Loyalität galt, dem Kaufmann oder ihr.
»Onkel Amur hat meinem Vater Geld geliehen. Nicht einmal, sondern regelmäßig«, erzählte sie. »Amur hatte keine Wahl, denn mein Vater war mit seiner Schwester verheiratet und gehörte zur Familie. Wenn er um etwas bat, musste Amur es ihm geben. Onkel Amur hatte wenig Zeit für ihn, außerdem war er der Meinung, mein Vater könne nicht mit Geld umgehen, was wohl stimmte. Ich habe mehrmals gehört, wie meine Mutter es ihm ins Gesicht gesagt hat. Am Ende hat Onkel Amur verlangt, dass mein Vater ihm als Sicherheit für den Kredit das Haus überschreibt … unser Haus, dieses Haus. Mein Vater gehorchte, ohne meiner Mutter davon zu erzählen. So regeln die Männer das Geschäftliche, heimlich und verstohlen, als wäre den leichtsinnigen Frauen nicht zu trauen. Wenn meine Mutter davon gewusst hätte, hätte sie es niemals zugelassen. Es ist doch boshaft, Geld an einen Schuldner zu verleihen, der es nie zurückzahlen kann, und ihm dann das Haus wegzunehmen. Das ist Diebstahl! Nichts anderes hat Onkel Amur mit mir und meiner Familie gemacht.«
»Wie viel war dein Vater ihm schuldig?«, fragte Khalifa, nachdem Asha länger geschwiegen hatte.
»Das spielt doch keine Rolle«, sagte sie knapp. »Wir hätten es niemals zurückzahlen können. Er hat nichts hinterlassen.«
»Er ist sehr plötzlich gestorben. Vielleicht hat er geglaubt, er hätte noch Zeit.«
Sie nickte. »So oder so hat er seinen Tod nicht besonders gut geplant. Während der langen Regenzeit im vergangenen Jahr bekam er einen Fieberschub wegen seiner Malaria. Es passierte jedes Jahr, aber diesmal war es schlimmer als je zuvor, und er hat es nicht überlebt. Ihn in diesem Zustand zu sehen, war wirklich erschreckend. Möge Gott seiner Seele gnädig sein. Meine Mutter hatte von seinen Geschäften keine Ahnung, aber wir erfuhren schon bald, dass er hohe Schulden hatte und uns nicht einmal genug geblieben war, um wenigstens eine symbolische Zahlung zu leisten. Seine männlichen Verwandten kamen zu uns und verlangten ihren Teil des Erbes, das ja eigentlich nur aus dem Haus bestand, und da stellte sich heraus, dass es Onkel Amur gehört. Alle waren sehr schockiert, besonders meine Mutter. Uns war nichts auf der Welt geblieben, gar nichts. Schlimmer noch, wir hatten nicht einmal unser Leben, weil Onkel Amur als unser ältester männlicher Verwandter jetzt unser Vormund war. Er würde über unser Schicksal entscheiden. Meine Mutter hat sich vom Tod meines Vaters nie erholt. Sie war schon seit vielen Jahren krank und hatte ständig Schmerzen. Ich habe es auf die Trauer geschoben und mir gedacht, dass sie nicht so krank war, wie sie behauptete, sondern sich dem Unglück ergeben hatte. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum es ihr so schlecht ging. Vielleicht hat sie irgendwer mit einem Fluch belegt, oder vielleicht war sie vom Leben enttäuscht. Manchmal hatte sie eine Erscheinung und sprach mit fremder Stimme, dann wurde ein Heiler gerufen, obwohl mein Vater dagegen war. Nach seinem Tod verwandelte ihr Unglück sich in lähmende Trauer, und in ihren letzten Lebensmonaten kamen neue Leiden dazu, Rückenschmerzen und ein Gefühl, innerlich zerfressen zu werden. Es ging weit über die Trauer hinaus, und da wusste ich, dass auch sie bald sterben würde. In den Tagen vor ihrem Tod hat sie sich schreckliche Sorgen um mich gemacht und Onkel Amur angefleht, sich um mich zu kümmern. Er hat es ihr versprochen.« Asha sah ihren Mann ernst und sehr lange an, dann sagte sie: »Also hast du mich bekommen.«
»Oder du mich«, sagte Khalifa und lächelte gegen ihre Verbitterung an. »Ist es wirklich so schlimm?«
Sie zuckte die Achseln. Khalifa wusste, warum Amur Biashara diese Heirat gewollt hatte, oder wenigstens konnte er es sich denken. Zunächst einmal hatte der Kaufmann damit die Verantwortung von sich geschoben, und gleichzeitig hatte er verhindert, dass Asha sich auf eine unschickliche Verbindung einließ, ganz egal, ob sie so etwas geplant hatte oder nicht. Er dachte eben wie ein mächtiger Patriarch. Utamsitiri: Khalifa würde sie vor der Schande bewahren und den Familiennamen rein halten. Er war nichts Besonderes, aber der Kaufmann kannte ihn gut und wusste, dass er ihren Namen und somit auch den von Amur Biashara vor einer möglichen Entehrung schützen würde. Eine stabile Ehe mit einem abhängigen Angestellten wie Khalifa würde die geschäftlichen Interessen des Kaufmanns wahren und die Sache mit dem Haus sozusagen in der Familie bleiben.
Doch selbst nachdem Khalifa die Geschichte gehört und begriffen hatte, welches Unrecht seiner Frau angetan worden war, konnte er es Amur Biashara gegenüber nicht zur Sprache bringen. Das Ganze war eine Familienangelegenheit, und er gehörte nicht wirklich zur Familie. Stattdessen überzeugte er Asha, selbst mit dem Onkel zu reden und ihren Anteil einzufordern. »Wenn er will, kann er sehr korrekt sein«, sagte er, und er wollte es selbst glauben. »Ich kenne ihn ziemlich gut. Ich habe ihn bei der Arbeit erlebt. Du musst ihn beschämen und für deine Rechte einstehen, denn andernfalls wird er so tun, als wäre alles in bester Ordnung.«
Am Ende sprach sie mit ihrem Onkel. Khalifa war nicht dabei, und als der Onkel ihn später höflich danach fragte, spielte er den Unwissenden. Der Onkel hatte Asha versichert, er habe sie in seinem Testament bedacht, und damit sei alles geklärt. Mit anderen Worten hatte er auf irgendwelche Diskussionen um das Haus keine Lust.
*
Khalifa und Asha heirateten Anfang 1907. Der Maji-Maji-Aufstand lag in den letzten Zügen, und seine grausame Niederschlagung hatte viele afrikanische Leben und Existenzen gekostet. Die Rebellion hatte in Lindi begonnen und sich auf Dörfer und Städte im ganzen Südwesten des Landes ausgeweitet. Sie dauerte drei Jahre an, und je klarer das Ausmaß des Widerstands gegen die deutsche Herrschaft wurde, desto brutaler und unbarmherziger fiel die Reaktion der Kolonialmacht aus. Als die deutschen Kommandanten erkannten, dass der Revolte mit militärischen Mitteln allein nicht beizukommen war, gingen sie dazu über, die Bevölkerung durch Hunger zu unterwerfen. In den Regionen, die sich erhoben hatten, erklärte die Schutztruppe die komplette Bevölkerung zum Feind. Sie brannte Dörfer nieder, zerstörte Äcker, plünderte Vorratslager und versengte und terrorisierte ganze Landstriche, und am Straßenrand hingen afrikanische Leichen von den Galgen. Khalifa und Asha lebten in einem anderen Teil des Landes und erfuhren von den Vorgängen nur durch Hörensagen; weil in ihrer Stadt von der Rebellion nichts zu merken war, blieb es bei verstörenden Gerüchten. Seit der Hinrichtung Abushiris hatte es keinen Aufstand mehr gegeben, aber die drohende Rache der Deutschen war allgegenwärtig.
Die Hartnäckigkeit, mit der die Menschen sich gegen ihren neuen Status als Untertanen von Deutsch-Ostafrika wehrten, hatte die Deutschen überrascht, vor allem, da sie an den Hehe im Süden und den Chagga und Meru in den Bergen des Nordostens ein Exempel statuiert hatten. Nach dem Maji-Maji-Aufstand waren Hunderttausende Menschen verhungert, viele weitere starben an ihren Kriegsverletzungen oder wurden öffentlich hingerichtet. Manche Befehlshaber von Deutsch-Ostafrika hielten diese Folgen für unvermeidbar. Früher oder später würden sie alle umkommen, und bis dahin würde das Kaiserreich dafür sorgen, dass die afrikanische Bevölkerung die geballte Faust der deutschen Macht zu spüren bekam und lernte, das Joch der Knechtschaft bereitwillig zu tragen. Mit jedem vergehenden Tag wurde es fester auf den Nacken der widerspenstigen Untertanen gedrückt. Die Kolonialverwaltung verstärkte ihren Einfluss und nahm an Größe und Reichweite stetig zu. Deutsche Siedler kamen und nahmen fruchtbares Land in Besitz. Immer mehr Zwangsarbeiter bauten Straßen, gruben Abwasserkanäle und legten Alleen und Gärten an, die der Erholung der Kolonisatoren und dem guten Ruf des Kaiserreichs dienten. Die Deutschen waren als Nachzügler in diesen Teil der Welt gekommen, aber sie wollten sich auf lange Sicht dort einrichten und sich so wohl wie möglich fühlen. Ihre Kirchen, Säulengänge und zinnenbewehrten Festungen sollten ihnen nicht bloß ein zivilisiertes Leben ermöglichen, sondern auch die gerade erst unterworfenen Untertanen einschüchtern und alle Kontrahenten beeindrucken.
Doch der jüngste Aufstand ließ einige Deutsche umdenken. Ganz offensichtlich reichte Gewalt allein nicht aus, um eine Kolonie zu erobern und zu erschließen, und so wurden Krankenhäuser geplant und Kampagnen gegen Malaria und Cholera ins Leben gerufen. Ursprünglich sollten sie vor allem die Gesundheit und das Wohlergehen von Siedlern, Verwaltern und der Schutztruppe sicherstellen, später wurden sie dann auf die einheimische Bevölkerung ausgeweitet. Außerdem gründete die Kolonialverwaltung neue Schulen. In Khalifas Stadt gab es bereits eine weiterführende Einrichtung, die junge Afrikaner zu Beamten und Lehrern ausbildete, doch sie nahm nur eine kleine Zahl von Schülern an und blieb der einheimischen Elite vorbehalten. Aber nun eröffneten Schulen, die vielen jungen Untertanen eine grundlegende Bildung vermitteln wollten, und einer der Ersten, die ihre Kinder dort anmeldeten, war Amur Biashara. Sein Sohn Nassor war neun Jahre alt gewesen, als Khalifa beim Kaufmann angefangen hatte, und vierzehn, als er eingeschult wurde. Ein bisschen spät, aber das machte nichts, schließlich sollten die Kinder dort keine Algebra lernen, sondern ein Handwerk, und Nassor war genau im richtigen Alter, um mit einer Säge zu hantieren, Ziegelsteine zu verlegen oder einen schweren Hammer zu schwingen. Der Kaufmannssohn lernte den Umgang mit Holz. Er besuchte die Schule vier Jahre lang, und danach konnte er lesen und schreiben und war ein geschickter Zimmermann.
Während dieser Jahre lernten auch Khalifa und Asha dazu. Khalifa erfuhr, dass Asha eine energische und eigensinnige Frau war, die gern viel um die Ohren hatte und wusste, was sie wollte. Anfangs hatte er ihre Tatkraft bewundert und ihr strenges Urteil über die Nachbarn belächelt. Sie waren neidisch, sie waren boshaft, sie waren Gotteslästerer. »Ach, komm schon, übertreib nicht so«, widersprach er manchmal, woraufhin sie missbilligend die Stirn runzelte. Sie übertreibe kein bisschen, sagte sie. Sie habe ihr ganzes Leben unter diesen Menschen verbracht. Dass Asha oft den Namen Gottes anrief und aus dem Koran zitierte, hatte ihr Mann zunächst für eine Eigenheit gehalten, wie sie von vielen Leuten gepflegt wurde, aber nach einer Weile verstand er, dass sie nicht ihr Wissen und ihre Kultiviertheit zur Schau stellen wollte, sondern tatsächlich fromm war. Er hielt sie für unglücklich und wollte ihr das Gefühl geben, dass sie nicht allein war. Er wollte von ihr begehrt werden, wie er sie begehrte, aber sie blieb beherrscht und zurückhaltend. Manchmal hatte er den Eindruck, dass sie ihn lediglich ertrug und seine Leidenschaft und seine Umarmungen aus reinem Pflichtgefühl über sich ergehen ließ.
Asha wiederum erfuhr, dass sie stärker war als er, obwohl es eine ganze Weile dauerte, bis sie es sich wirklich eingestehen konnte. Sie wusste, was sie wollte – wenn nicht immer, dann doch sehr oft, und in dem Fall blieb sie standhaft, während ihr Mann sich leicht von Worten beeinflussen ließ, manchmal sogar von den eigenen. Die Erinnerung an ihren Vater, dem sie so viel Respekt zu erweisen versuchte, wie ihre Religion es verlangte, beeinträchtigte ihre Sicht auf ihren Mann, und so fiel es ihr immer schwerer, Nachsicht mit Khalifa zu haben. Manchmal gelang es ihr nicht, dann herrschte sie ihn übertrieben schroff an und bedauerte es später. Er war zuverlässig, aber er hörte zu viel auf ihren Onkel, der mit seiner verlogenen und scheinheiligen Art nichts anderes war als ein Dieb und ein Heuchler. Ihr Mann ließ sich zu schnell abspeisen und zu oft ausnutzen; aber weil das anscheinend Gottes Wille war, würde sie sich Mühe geben und zufrieden sein. Seine endlosen Geschichten fand sie ermüdend.
In den ersten Ehejahren erlitt Asha drei Fehlgeburten. Nach der dritten binnen drei Jahren wurde sie von ihren Nachbarinnen überredet, eine Kräuterfrau aufzusuchen, eine Mganga. Die Mganga sagte ihr, sie solle sich auf den Boden legen, und dann bedeckte sie Asha von Kopf bis Fuß mit einer Kanga. Anschließend setzte sie sich daneben, summte leise vor sich hin und murmelte Worte, die Asha nicht verstand. Nach einer Weile verkündete die Mganga, Asha sei von einem Unsichtbaren besessen, der verhindere, dass ein Kind in ihr heranwachse. Man könne ihn überzeugen, von Asha abzulassen, müsse aber zuvor seine Forderungen herausfinden. Asha solle ihm gestatten, durch sie zu sprechen, was aber nur funktioniere, wenn sie sich vollständig von ihm in Besitz nehmen lasse.
Die Mganga holte eine Helferin und sagte Asha, sie solle sich wieder auf den Boden legen. Die Frauen bedeckten sie mit einem schweren Tuch aus Kattun, und dann beugten sie sich über ihren Kopf und begannen zu summen und zu singen. So verging eine ganze Zeit. Während die Mganga und die Helferin sangen, zitterte und bebte Asha immer heftiger, und zuletzt stieß sie unverständliche Laute aus. Der Ausbruch gipfelte in einem spitzen Schrei, und dann sprach Asha mir klarer, seltsam fremdartiger Stimme: »Ich werde diese Frau verlassen, wenn ihr Mann verspricht, mit ihr auf den Hadsch zu gehen, regelmäßig die Moschee zu besuchen und keinen Tabak mehr zu schnupfen.« Die Mganga krächzte triumphierend und flößte Asha eine beruhigende Kräutertinktur ein, die sie einschlafen ließ.
Als die Mganga Khalifa später in Ashas Beisein von dem Unsichtbaren und seinen Forderungen erzählte, nickte er höflich und bezahlte sie für ihre Dienste. »Mit dem Schnupftabak höre ich sofort auf«, sagte er, »außerdem werde ich die Waschung vornehmen und in die Moschee gehen, und auf dem Rückweg erkundige ich mich über den Hadsch. Bitte, befreien Sie uns sofort von diesem Teufel.«
Khalifa gab den Schnupftabak tatsächlich auf, er ging sogar ein paarmal in die Moschee, aber den Hadsch erwähnte er nie wieder. Asha wusste, Khalifa gab sich wohlwollend, aber eigentlich glaubte er ihr nicht und lachte sie insgeheim vielleicht sogar aus. Dass sie sich auf die ketzerische, von ihren Nachbarinnen vorgeschlagene Behandlung eingelassen hatte, machte alles nur noch schlimmer. Sein pausenloses Gerede war lästig, aber nicht zu ändern; doch dass Khalifa nur unregelmäßig betete, störte sie sehr, und vor allem wünschte sie sich den Hadsch. Dass ihr Mann den Wunsch im Stillen verspottete, entfremdete ihn immer weiter von ihr. Sie wollte es nicht noch einmal auf eine Schwangerschaft anlegen und fand Mittel und Wege, Khalifa in seiner Erregung zu bremsen und seinen unangenehmen Annäherungsversuchen auszuweichen.
Nassor Biashara hatte inzwischen ausgelernt und verließ die deutsche Berufsschule im Alter von achtzehn Jahren. Den Geruch von Holz fand er berauschend. Amur Biashara verhätschelte seinen Sohn sehr. Er ließ den Jungen nicht in der Firma mithelfen, genauso wenig, wie er Khalifa in die Einzelheiten seiner Geschäfte einweihte. Er zog es vor, allein zu arbeiten. Als Nassor sich selbstständig machen wollte und seinen Vater bat, ihm eine eigene Tischlerei zu finanzieren, kam der Kaufmann der Bitte gern nach; zum einen, weil es nach einer guten Geldanlage klang, und zum anderen, weil er seinen Sohn auf diese Weise vorläufig aus der Firma heraushalten konnte. Später wäre immer noch genug Zeit, ihn in den Geschäften zu unterweisen.
Die Kaufleute der alten Schule liehen und verliehen das Geld auf Vertrauensbasis. Manche von ihnen kannten sich nur durch Briefe oder gemeinsame Bekannte. Das Geld wanderte von Hand zu Hand – Schuldscheine wurden getauscht, Waren unbesehen gekauft und weiterverkauft. Die persönlichen Verbindungen reichten bis nach Mogadischu, Aden, Maskat, Bombay, Kalkutta und an andere legendäre Orte. In den Ohren der Stadtbewohner klangen diese Namen wie Musik, vielleicht weil die meisten noch nie so weit gereist waren. Natürlich konnten sie sich denken, dass es dort in der Ferne genauso viel Not, Hunger und Armut gab wie überall auf der Welt, trotzdem konnten sie der fremden Schönheit der Namen nicht widerstehen.
Dass die Geschäfte der alten Kaufleute auf Vertrauensbasis abgewickelt wurden, bedeutete aber noch lange nicht, dass sie einander wirklich vertraut hätten. Aus dem Grund erledigte Amur Biashara die Buchhaltung in seinem Kopf und nicht auf dem Papier. Doch am Ende ließ ihn seine Gerissenheit im Stich. Möglicherweise war es reines Pech oder das Schicksal oder Gottes Wille, jedenfalls erkrankte er ganz plötzlich an einer der furchtbaren Epidemien, die damals, bevor die Europäer mit ihren Medikamenten und ihrer Hygiene kamen, noch viel öfter ausgebrochen waren. Wer hätte ahnen können, wie viele Krankheiten in dem Dreck lauerten, mit dem zu leben die meisten Leute gewohnt waren? Der Kaufmann erkrankte an einer dieser Epidemien, trotz der Europäer. Wenn die Zeit eines Menschen gekommen ist, ist sie nun einmal gekommen. Vielleicht war verschmutztes Wasser die Ursache, oder verdorbenes Fleisch oder der Biss eines giftigen Ungeziefers, jedenfalls wachte der Kaufmann eines Morgens mit Fieber und Erbrechen auf und konnte das Bett nicht mehr verlassen. Er war kaum ansprechbar und starb fünf Tage später. In diesen fünf Tagen erlangte er das Bewusstsein nicht wieder, und so nahm er seine Geheimnisse mit ins Grab. Bald darauf wurden seine Gläubiger vorstellig, und ihre Papiere waren in bester Ordnung. Die anderen, die ihm Geld schuldeten, hielten sich bedeckt, und auf einmal erwies sich das Vermögen des alten Kaufmanns als viel kleiner denn gedacht. Vielleicht hatte er wirklich vorgehabt, Asha ihr Haus zurückzugeben, vielleicht war er einfach nie dazu gekommen, aber im Testament wurde sie nicht erwähnt. Jetzt gehörte das Haus Nassor Biashara, wie auch alles andere, was übrig blieb, nachdem seine Mutter, seine beiden Schwestern und die Gläubiger sich ihren jeweiligen Anteil genommen hatten.
2
Kurz vor Amur Biasharas plötzlichem Tod kam Ilyas in die Stadt. Er hatte ein an den Direktor einer großen deutschen Sisalfabrik adressiertes Empfehlungsschreiben in der Tasche. Der Direktor, der gleichzeitig auch Miteigentümer der Fabrik war, konnte sich für eine so unwichtige Angelegenheit natürlich keine Zeit nehmen, deswegen gab Ilyas das Schreiben im Vorzimmer ab und wurde gebeten zu warten. Ein Bürogehilfe brachte ihm ein Glas Wasser und horchte ihn ein wenig aus, um sich ein Bild von dem Fremden und seinen Absichten zu machen. Nach einer Weile kam ein junger Deutscher aus dem Büro und bot Ilyas prompt eine Stelle an. Der Assistent, er hieß Habib, werde ihm helfen, sich zurechtzufinden. Habib brachte Ilyas zu einem Lehrer namens Maalim Abdalla, der ihm ein Zimmer bei einer befreundeten Familie vermittelte, und so hatte Ilyas gleich an seinem ersten Tag in der Stadt eine Anstellung und eine Unterkunft gefunden. »Später hole ich dich ab und mache dich mit ein paar Leuten bekannt«, sagte Maalim Abdalla, und tatsächlich kam er noch am selben Nachmittag vorbei und nahm Ilyas mit auf einen Stadtspaziergang. Sie besuchten zwei Cafés, um Kaffee zu trinken, zu plaudern und Ilyas vorzustellen.
»Unser Bruder Ilyas ist hier, um in der großen Sisalfabrik zu arbeiten«, erklärte Maalim Abdalla. »Er ist ein Freund des Direktors, des großen Deutschen persönlich. Deutsch spricht er, als wäre es seine Muttersprache. Vorläufig ist er bei Omar Hamdani untergebracht, aber der Herr Direktor wird sicher schon bald eine Unterkunft finden, die eines so wichtigen Mitarbeiters würdig ist.«
Ilyas lächelte, widersprach und zog den Lehrer seinerseits auf. Sein fröhliches Lachen und seine bescheidene Art führten dazu, dass die Leute sich in seiner Gegenwart wohlfühlten und er schnell neue Freundschaften schloss. So war das immer. Später zeigte Maalim Abdalla ihm den Hafen und das deutsche Viertel. Als er auf die Boma deutete, fragte Ilyas, ob dies der Ort sei, an dem man Abushiri gehängt habe, aber Maalim Abdalla verneinte. Abushiri sei in Pangani gehängt worden, denn hier gebe es nicht genug Platz für eine größere Menschenmenge. Die Deutschen hatten aus der Hinrichtung ein Spektakel mit vielen Zuschauern gemacht, wahrscheinlich sogar mit einer Musikkapelle und einem Truppenaufmarsch. Dafür hätte es sicherlich einen großen Platz gebraucht. Der Spaziergang endete vor Khalifas Haus, das der Lehrer fast jeden Abend aufsuchte, um sich zu unterhalten und die neuesten Gerüchte zu erfahren.
»Du bist ebenfalls willkommen«, sagte Khalifa zu Ilyas. »Jeder Mensch braucht eine Baraza, einen Treffpunkt für den Abend, um Kontakte zu pflegen und auf dem Laufenden zu bleiben. In unserer Stadt gibt es nach der Arbeit nicht viel anderes zu tun.«
Ilyas und Khalifa freundeten sich rasch an und sprachen nach wenigen Tagen ganz offen miteinander. Ilyas erzählte Khalifa, wie er als Kind von zu Hause weggelaufen und einige Tage ziellos herumgeirrt war, bevor ein Askari von der Schutztruppe ihn am Bahnhof entführt und in die Berge mitgenommen hatte. Dort war er befreit und auf eine deutsche Missionsschule geschickt worden.
»Haben sie dich gezwungen, zu beten wie ein Christ?«, fragte Khalifa. Sie schlenderten gerade am Meer entlang und konnten von niemandem gehört werden, trotzdem schwieg Ilyas und presste die Lippen aufeinander, was völlig untypisch für ihn war. »Du wirst doch niemandem was verraten, wenn ich es dir sage, oder?«, fragte er.
»Also haben sie es getan«, rief Khalifa fröhlich. »Sie haben dich zur Sünde gezwungen!«
»Erzähl niemandem davon«, sagte Ilyas in flehentlichem Ton. »Andernfalls hätte ich die Schule verlassen müssen, also habe ich mich verstellt. Sie waren sehr zufrieden mit mir. Ich wusste ja, dass Gott die Wahrheit in meinem Herzen sehen konnte.«
»Mnafiki«, sagte Khalifa, der noch nicht aufhören wollte, den Freund zu ärgern. »Heuchler wie dich erwartet im Jenseits eine besondere Strafe. Willst du mehr darüber wissen? Nein, warte … Sie ist unaussprechlich, aber früher oder später bekommst du sie ohnehin am eigenen Leib zu spüren.«
»Gott weiß, was tief in meinem Herzen vor sich ging«, sagte Ilyas, legte sich eine Hand an die Brust und lächelte ebenfalls, nun da Khalifa das Ganze ins Scherzhafte gezogen hatte. »Ich habe damals auf einer Kaffeeplantage gewohnt und gearbeitet. Sie gehörte demselben Deutschen, der mich zur Schule geschickt hat.«
»Wurde bei euch auch gekämpft?«, fragte Khalifa.
»Ich weiß nicht, was vorher war, aber als ich dort ankam, waren die Gefechte vorbei«, sagte Ilyas. »Alles war sehr friedlich. Es gab neue Farmen und Schulen, sogar neue Städte. Die Einheimischen haben ihre Kinder in die Missionsschule geschickt und auf den deutschen Plantagen gearbeitet. Wenn es doch einmal Ärger gab, lag es an schlechten Menschen, die Unruhe stiften wollten. Der Farmer, der mich zur Schule geschickt hat, gab mir auch den Brief mit, durch den ich an die neue Stelle gekommen bin. Der Direktor ist ein Verwandter von ihm.«
Später erzählte Ilyas: »Ich weiß nicht, was mit meinen Eltern passiert ist. Ich war nie wieder in meinem Dorf. Als ich in diese Stadt gekommen bin, habe ich gemerkt, dass es gar nicht so weit entfernt ist. Eigentlich wusste ich natürlich schon vorher, dass ich in der Nähe meiner alten Heimat sein würde, aber ich habe versucht, den Gedanken zu verdrängen.«
»Du solltest sie besuchen«, sagte Khalifa. »Wann bist du von dort weggegangen?«
»Vor zehn Jahren«, sagte Ilyas. »Was will ich dort?«
»Du solltest hinfahren«, sagte Khalifa, denn er erinnerte sich daran, dass er seine Eltern vernachlässigt hatte und wie schlecht es ihm deshalb gegangen war. »Fahr hin und besuch deine Familie. Wenn dich jemand mitnimmt, dauert die Reise höchstens ein oder zwei Tage. Es ist nicht richtig, einfach so den Kontakt abzubrechen. Du solltest hinfahren und ihnen sagen, dass es dir gut geht. Wenn du willst, komme ich mit.«
»Nein«, wehrte Ilyas ab, »du ahnst ja nicht, was für ein elender und schrecklicher Ort das ist.«
»In dem Fall kannst du ihnen zeigen, was aus dir geworden ist! Es ist dein altes Dorf, und deine Familie ist deine Familie, egal, wie du darüber denkst«, sagte Khalifa voller Überzeugung, und Ilyas geriet ins Wanken.
Er runzelte kurz die Stirn, dann hellte sein Blick sich langsam auf. »Ich fahre hin«, sagte er und war plötzlich selbst ganz angetan von der Idee. So war er eben, und Khalifa war gerade dabei, diese Seite von ihm kennenzulernen. Sobald er von einer Sache überzeugt war, stürzte sich Ilyas blindlings hinein. »Ja, du hast recht. Aber ich werde allein reisen. Ich habe schon oft darüber nachgedacht, doch dann habe ich es immer wieder aufgeschoben. Ich habe jemanden wie dich gebraucht, der den Mund nicht halten kann und mich überredet.«
Khalifa fand einen Kutscher, der in die Richtung des Dorfes fahren und Ilyas ein Stück mitnehmen würde. Außerdem gab er seinem Freund den Namen eines Händlers mit auf den Weg, der in der Nähe des Dorfes an der Hauptstraße wohnte. Falls nötig, würde Ilyas dort übernachten können. Ein paar Tage später saß Ilyas als Passagier auf einem Eselkarren, der über die Küstenstraße gen Süden rumpelte. Der Fahrer war ein alter Belutsche, der die Läden entlang der Strecke mit Waren versorgte. Diesmal hatte er nicht viel auszuliefern. Sie hielten an zwei Läden, dann bogen sie auf eine bessere Straße ins Landesinnere ab und kamen so schnell voran, dass sie den von Khalifa erwähnten Kontakt schon am Nachmittag erreichten. Der Kontakt entpuppte sich als ein Inder namens Karim, der mit frischen Lebensmitteln handelte. Er kaufte sie den Einheimischen ab und organisierte ihren Transport in die Stadt. Bananen, Maniok, Kürbisse, Süßkartoffeln, Okraschoten – unempfindliches Gemüse, das die zweitätige Reise unbeschadet überstand. Der Belutsche fütterte und tränkte den Esel und schien sich dann im Flüsterton mit dem Tier zu unterhalten. Anschließend teilte er Ilyas mit, es sei noch früh genug, die Heimreise anzutreten und in einem der Läden zu übernachten, die sie auf der Hinfahrt beliefert hatten; der Esel sei ebenfalls einverstanden. Karim schaute zu, wie der Belutsche das Gemüse auf seinen Karren lud, trug ein paar Zahlen ins Geschäftsbuch ein und kopierte sie dann auf einen Zettel, den der Fahrer den Käufern auf dem Markt aushändigen sollte.
Nachdem der Belutsche davongefahren war, erklärte Ilyas, was er wollte, doch Karim sah ihn skeptisch an. Der Händler blickte kurz gen Himmel, zog eine Uhr aus der Westentasche, ließ mit einer eleganten Geste den Deckel aufschnappen und wackelte dann traurig mit dem Kopf.
»Morgen früh«, sagte er. »Für heute ist es zu spät. Es sind nur noch anderthalb Stunden bis zum Maghrib, und bevor ich einen Fahrer gefunden habe, wird es schon fast dunkel sein. Du willst doch nicht nachts reisen! Das gibt nur Ärger. Da kann man sich leicht verirren oder auf schlechte Menschen treffen. Du kannst gleich morgen in aller Frühe losfahren. Ich werde noch heute mit einem Kutscher sprechen, aber jetzt ruhst du dich erst einmal aus. Du bist willkommen, wir haben sogar ein Gästezimmer. Komm.«
Er führte Ilyas in einen kleinen Raum mit gestampftem Lehmboden, der direkt an den Laden angrenzte. Der Laden und auch das Gästezimmer hatten klapprige, rostige Wellblechtüren mit eisernen Vorhängeschlössern, die anscheinend mehr der Form halber dort hingen als aus Sicherheitsgründen. In dem kleinen Raum stand ein mit Seilen bespanntes Bettgestell, darauf lag eine Matte, in der es vor Wanzen wahrscheinlich nur so wimmelte. Ilyas bemerkte das fehlende Moskitonetz und seufzte resigniert. Das Gästezimmer war wohl eher etwas für abgehärtete Handelsreisende; aber nun blieb ihm keine Wahl. Er konnte ja schlecht verlangen, dass Karim einen Fremden in seine Privatwohnung einlud.
Ilyas hängte seine Segeltuchtasche an den Türrahmen und ging noch einmal hinaus, um sich umzusehen. Karims Haus stand auf der anderen Seite des Hofs, ein massives Gebäude mit zwei vergitterten Fenstern an der Vorderseite, jeweils rechts und links von der Tür. Drei Stufen führten zur Veranda hinauf. Karim saß dort auf einer Matte, und als er Ilyas entdeckte, winkte er ihn heran. Sie unterhielten sich eine Weile über die Stadt, über den verheerenden Choleraausbruch auf Sansibar und übers Geschäft, und dann trat ein kleines Mädchen von sieben oder acht Jahren aus dem Haus und brachte ihnen ein Holztablett, auf dem zwei kleine Kaffeetassen standen. Als es dämmerte, zog Karim abermals die Uhr heraus und warf einen Blick darauf.
»Zeit für das Maghrib-Gebet«, sagte er. Er rief, und kurz darauf erschien das kleine Mädchen mit einem schweren Wassereimer, den Karim ihr lachend aus der Hand nahm. Er stieg die drei Stufen hinunter und stellte den Eimer seitlich davon auf eine mit Steinen gepflasterte Fläche, die wohl zum Waschen der Füße gedacht war. Er bedeutete dem Gast mit einer Geste, dass er ihm den Vortritt lassen wollte, doch Ilyas lehnte entschlossen ab. Karim machte den Anfang und vollzog die Waschung vor dem Gebet, und als Ilyas an der Reihe war, ahmte er nach, was er bei Karim gesehen hatte. Sie begaben sich in den Innenhof, und wie es die guten Sitten verlangten, forderte Karim Ilyas auf, das Gebet zu leiten. Ilyas lehnte abermals ab, ebenso höflich wie bestimmt, und überließ Karim die Führung.
Ilyas wusste nicht, wie man betet, er kannte ja nicht einmal die Worte. Er war noch nie in einer Moschee gewesen. In seinem Heimatdorf gab es keine, genauso wenig wie auf der Kaffeeplantage, wo er später so viele Jahre gelebt hatte. In einem der benachbarten Bergdörfer stand eine Moschee, aber weder in der Schule noch auf der Plantage hatte ihm jemand gesagt, er solle dort hingehen. Ab einem gewissen Punkt war es ihm dann zu spät oder zu beschämend erschienen, das Beten noch lernen zu wollen. Mittlerweile war Ilyas ein erwachsener Mann, der in einer Sisalfabrik arbeitete und in einer Stadt mit vielen Moscheen wohnte, aber auch dort forderte ihn niemand zum Gebet auf. Er hatte immer geahnt, dass er früher oder später in eine peinliche Lage geraten würde, und nun war es so weit; Karim wollte mit ihm beten und ihm blieb nichts übrig, als alle Gesten zu imitieren, so gut er konnte, und zu murmeln, als spräche er heilige Worte aus.
Wie versprochen bestellte Karim einen Fahrer, der Ilyas am nächsten Morgen in sein altes, gar nicht weit entferntes Dorf bringen würde. Nach einer unruhigen Nacht verließ Ilyas das Gästezimmer, sobald er draußen im Hof die ersten Geräusche hörte. Während er auf den Fahrer wartete, bot man ihm zum Frühstück eine Banane und einen Becher schwarzen Tee an. Das kleine Mädchen fegte den Innenhof, von der Mutter war keine Spur zu sehen. Ilyas’ zweiter Kutscher war ein Jugendlicher, der sich sehr auf den Ausflug freute und während der Fahrt von den Streichen erzählte, die er und seine Freunde den Nachbarn in der letzten Zeit gespielt hatten. Ilyas hörte höflich zu und lachte, wann immer es angebracht schien, aber bei sich dachte er: Bauerntrottel.
Nach etwa einer Stunde erreichten sie das Ziel. Der Junge sagte, er werde an der Straße warten, weil der Weg ins Dorf zu schmal für den Karren sei. Der Pfad zweigte an der Stelle ab, an der sie angehalten hatten. Ilyas kannte sich aus. Er lief in Richtung seines alten Zuhauses los, und alles wirkte so ungepflegt und vertraut, als wäre er erst vor ein paar Monaten zum letzten Mal hier gewesen. Das Dorf war klein, nur eine Ansammlung von strohgedeckten Hütten mit winzigen Ackerflächen dahinter. Bevor er sein Elternhaus erreichte, sah er eine Frau, deren Namen er vergessen hatte, deren Gesicht ihm aber bekannt vorkam. Sie saß auf einer gerodeten Fläche vor ihrer Hütte aus Lehm und Flechtwerk und war gerade dabei, eine Matte aus Kokosblättern zu weben. Zu ihren Füßen stand ein Kochtopf auf drei großen Steinen, zwei Hühner pickten auf dem Boden herum. Als Ilyas sich näherte, richtete sie ihre Kanga und bedeckte sich das Haupt.
»Shikamoo«, sagte er.
Sie erwiderte den Gruß, musterte ihn und seine Städterkleidung von oben bis unten und wartete ab. Er konnte ihr Alter nicht erraten, aber falls sie diejenige war, für die er sie hielt, hatte sie Kinder in seinem Alter. Einer ihrer Söhne hieß Hassan, das fiel ihm plötzlich wieder ein; früher hatte er mit dem Jungen gespielt. Ilyas’ Vater hieß ebenfalls Hassan, deshalb konnte er sich an den Namen erinnern. Die Frau saß auf einem tiefen Hocker und machte keine Anstalten, aufzustehen oder auch nur zu lächeln.
»Ich bin Ilyas. Früher habe ich dort drüben gewohnt«, sagte er, und dann nannte er ihr die Namen seiner Eltern. »Leben sie immer noch hier?«
Sie antwortete nicht, und auf einmal war er sich nicht sicher, ob sie ihn gehört oder überhaupt verstanden hatte. Er wollte gerade weitergehen und sich im Dorf umsehen, als ein Mann aus der Hütte trat. Er war älter als die Frau, kam zögerlich auf Ilyas zu und betrachtete ihn aus der Nähe, als hätte er schlechte Augen. Sein Gesicht war runzlig und unrasiert, er wirkte gebrechlich und krank. Ilyas wiederholte seinen Namen, und auch die Namen seiner Eltern. Der Mann und die Frau tauschten einen Blick, woraufhin sie das Wort ergriff.