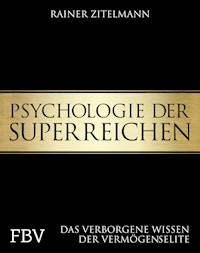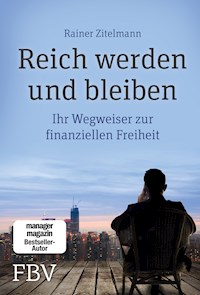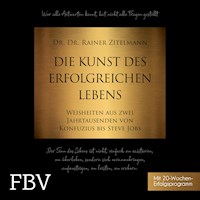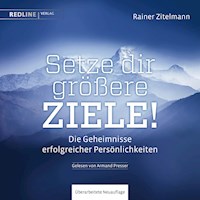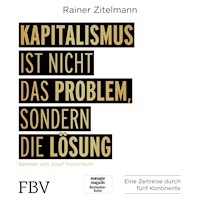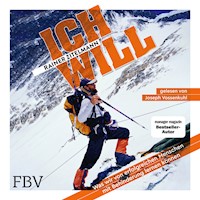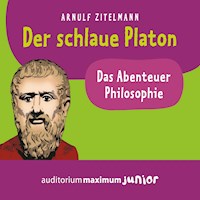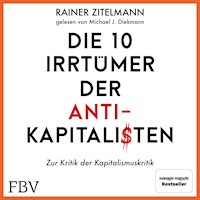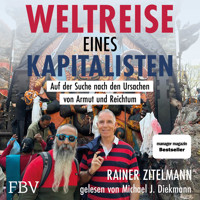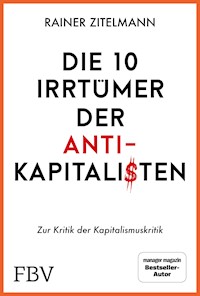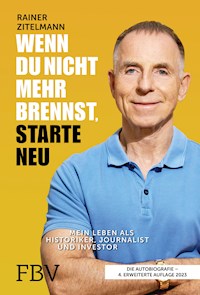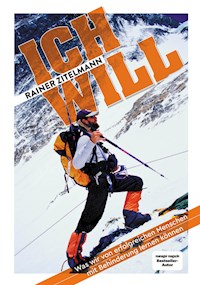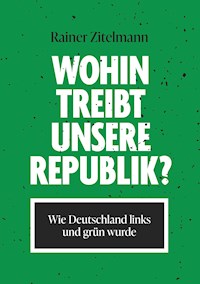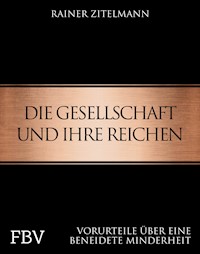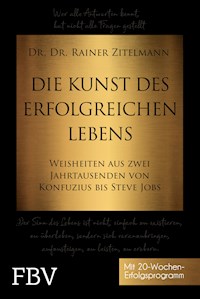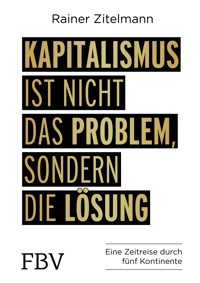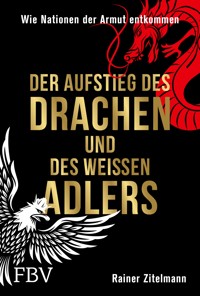
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Nach 50 Jahren Entwicklungshilfe ist klar: Dieses Konzept im Kampf gegen die Armut ist gescheitert. Aber was hilft? Rainer Zitelmann zeigt am Beispiel von Vietnam und Polen, wie Nationen der Armut entkommen. Beide Länder waren Opfer verheerender Kriege, bei denen Millionen Menschen starben; in beiden Ländern wurden sozialistische Planwirtschaften errichtet, die das zerstörten, was der Krieg noch nicht zerstört hatte: Vietnam war eines der ärmsten Länder der Welt und Polen eines der ärmsten Länder Europas. Zitelmann schildert in dem spannenden Buch mit vielen überraschenden Details, wie Vietnam und Polen durch Wirtschaftsreformen den Kampf gegen die Armut gewannen und den Lebensstandard der Menschen sensationell verbesserten – und was andere Volkswirtschaften daraus lernen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 253
Ähnliche
Rainer Zitelmann
DER AUFSTIEG DES DRACHEN UND DES WEISSEN ADLERS
Rainer Zitelmann
DER AUFSTIEG DES DRACHEN UND DES WEIßEN ADLERS
Wie Nationen der Armut entkommen
FBV
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Originalausgabe, 1. Auflage 2023
© 2023 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Ansgar Graw
Korrektorat: Anja Hilgarth
Umschlaggestaltung: Monika Tomaszewska
Umschlagabbildung: Shutterstock / iLoveCoffeeDesign, noct work
Satz: Zerosoft
eBook by tool-e-byte
ISBN Print 978-3-95972-710-5
ISBN E-Book (PDF) 978-3-98609-367-9
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-98609-368-6
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
Vorwort
1. Was gegen Armut hilft – und was nicht
2. Polen: Der Aufstieg des weißen Adlers
Ein geschundenes Land
Sozialismus in Polen
Politischer Wandel
Balcerowicz und die ökonomischen Reformen
Was können wir aus der polnischen Erfahrung lernen?
Polen dürfen die Gründe für ihren Erfolg nicht vergessen
Was die Polen über den Kapitalismus denken
Was die Polen über reiche Menschen denken
3. Vietnam: Doi Moi – der Aufstieg des Drachen
Ein Land im Krieg
Sozialistische Planwirtschaft im Norden und im Süden
Lebensbedingungen in den 80er-Jahren
Der VI. Parteitag und die Doi-Moi-Reformen
Öffnung nach außen – Vietnam profitiert von der Globalisierung
Wie die Reformen das Alltagsleben der Menschen verbesserten
Ergebnisse einer Umfrage über die Doi-Moi-Reformen
Frauen in Vietnam spielen eine wichtige Rolle
Es bleibt viel zu tun: Das Problem der Staatsbetriebe und der Korruption
Vietnam: Ökonomische Reformen – aber Einparteienherrschaft
Pragmatismus und Gegenwartsorientierung sind Ursachen des Erfolges
Wie die Vietnamesen Reiche sehen
Wie die Vietnamesen den Kapitalismus sehen
4. Resümee: Wohlstand und Armut von Nationen
Der Autor
Anmerkungen
Literatur
Vorwort
Ich habe mehrere Bücher über Reichtum geschrieben - warum schreibe ich jetzt ein Buch über Armut? Weil ich in meinen Forschungen zu dem vermeintlich paradoxen Ergebnis gekommen bin, dass nur eine Gesellschaft, die Reichtum zulässt und Reichtum positiv sieht, Armut überwinden kann.
Repräsentative Meinungsumfragen, die ich in zahlreichen Ländern habe durchführen lassen, zeigen, dass die Menschen besonders in zwei Ländern Reichtum und Reiche im Vergleich positiver sehen: in Polen und in Vietnam. Zugleich sind dies auch Länder, in denen die Menschen - trotz der unterschiedlichen politischen Systeme - den Begriff »Kapitalismus« sehr viel positiver beurteilen als ihre Zeitgenossen in den meisten anderen Ländern.
Und es sind zwei Länder, die in den vergangenen Jahrzehnten außerordentlich stark an wirtschaftlicher Freiheit gewonnen haben. Die amerikanische Heritage Foundation erstellt seit 1995 ein Ranking der wirtschaftlichen Freiheit - man kann es auch Kapitalismus-Skala nennen -, und in keinem Land vergleichbarer Größe nahm die wirtschaftliche Freiheit in diesem Zeitraum so sehr zu wie in Polen und Vietnam.
Beide Länder verbindet jedoch noch mehr: Sie waren der Schauplatz schrecklicher Kriege, in denen Abermillionen Menschen ihr Leben ließen - der Zweite Weltkrieg in Polen und der Indochinakrieg in Vietnam. Nach den Kriegen wurden in beiden Ländern sozialistische Planwirtschaften errichtet, die das zerstörten, was der Krieg noch nicht zerstört hatte. Vietnam war eines der ärmsten Länder der Welt und Polen eines der ärmsten Länder Europas. Ich schildere in diesem Buch das Leben in diesen Ländern in den Zeiten der Planwirtschaft, und Sie werden sehen, wie bitterarm die Mehrheit der Menschen dort war.
Die Vietnamesen begannen 1986 mit marktwirtschaftlichen Reformen, die man Doi-Moi-Reformen nennt. Wenige Jahre später entschloss sich auch Polen zu marktwirtschaftlichen Reformen. In beiden Ländern führten diese Reformen zu einem bemerkenswerten Wirtschaftswachstum und einer dramatischen Verbesserung des Lebensstandards. Ich werde dies mit Zahlen und Statistiken zeigen sowie anhand von Lebensberichten der Menschen in diesen Ländern.
Das Buch beginnt mit einem Kapitel, in dem ich zeige, was nicht gegen Armut hilft, nämlich Entwicklungshilfe. In den beiden folgenden Kapiteln analysiere ich, wie Kapitalismus den Polen und den Vietnamesen geholfen hat, ihren Lebensstandard zu verbessern und der Armut zu entkommen. Ich denke, viele andere Länder könnten davon eine Menge lernen.
Ich danke meinen Freunden in Polen und Vietnam, die mir bei diesem Buch geholfen haben. Le Chi Mai aus Hanoi hat für mich Übersetzungen und Interviews gemacht, und ich danke Nguyen Quoc Minh-Quang, Vu Dinh Loc, Nguyen Trong Hoa, Lam Duc Hung und Nguyen Thi Quat für diese Interviews. Dem Rechtsanwalt Dr. Oliver Massmann, der seit 25 Jahren in Hanoi tätig ist und maßgeblich an der Formulierung des Freihandelsabkommens zwischen den USA und Vietnam beteiligt war, danke ich für seine Informationen. Dinh Tuan Minh, Vertreter eines liberalen Thinktanks, hat mir bei einem Gespräch in Hanoi manche wichtigen Zusammenhänge erklärt. Besonders danke ich Professor Andreas Stoffers, dem Leiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Vietnam, der für mich zahlreiche Kontakte hergestellt hat.
In Polen haben mir mein Verleger Krzysztof Zuber (Wydawnictwo Freedom Publishing) und mein Berater Marcin Chmielowski geholfen - Danke dafür! Zu danken habe ich auch dem ehemaligen Finanzminister von Polen, Professor Leszek Balcerowicz, dessen Reformen ein wesentlicher Grund für Polens wirtschaftliche Gesundung und Aufstieg waren. Danken möchte ich zudem Marcin Zieliński (Forum Obywatelskiego Rozwoju) und Marek Tatała (Fundacja Wolności Gospodarczej), Mateusz Machaj (Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa) sowie Alicja Wancerz-Gluza (Mitbegründerin des Karta-Zentrums) und Tomasz Borkowski.
Mein Dank gilt auch meinen Freunden Dr. Christian Hiller von Gaertringen und Dr. Gerd Kommer, die das Buch kritisch gelesen haben, Ansgar Graw, der es hervorragend lektoriert hat, und Sebastian Taylor, der es ins Englische übersetzt hat.
Ich bewundere die Menschen in Polen und Vietnam, und mich verbindet mit ihnen auch etwas sehr Persönliches: Denn die beiden längsten und wichtigsten Beziehungen in meinem Leben hatte ich mit Monika, deren Eltern aus Polen kamen, und Trang, deren Eltern aus Vietnam stammen.
Rainer Zitelmann, März 2023
1. Was gegen Armut hilft - und was nicht
Frank Bremer hat sein Leben dem Kampf gegen die Armut verschrieben, sich in 30 Ländern in Afrika, Zentralasien, der Karibik und dem Indischen Ozean mit Entwicklungshilfe befasst und war an Projekten in den Bereichen ländliche Entwicklung und Umwelt beteiligt. Nach mehr als 50 Jahren Engagement in der Entwicklungshilfe zieht Bremer eine bittere Bilanz: »Entwicklungshilfe ist ein Vorhaben, das für ein nicht erreichbares Ziel - die Armutsminderung - für eine falsch ausgewählte Zielgruppe - die afrikanischen Kleinbauern - mit einer nicht funktionierenden Methode - der Hilfe zur Selbsthilfe - in einem untauglichen Format - dem Projekt - wirkungslose Aktivitäten durchführt, das wie Strohfeuer außer schönen Erinnerungen bei allen Beteiligten keine nachhaltigen Spuren hinterlässt, den größten Teil der Mittel für die Projektdurchführung verwendet und damit viel Geld für eine ursprünglich gute Idee verschwendet.«1
Das klingt sehr hart - und ich werde später anhand von Forschungen zeigen, was an diesem Urteil überspitzt ist und was zutrifft. Um es vorweg zu sagen: Der Kampf gegen die Armut bleibt eine der wichtigsten Aufgaben für die Menschheit - aber Entwicklungshilfe (das politisch korrekte Wort dafür lautet inzwischen »Entwicklungszusammenarbeit«) ist dafür das falsche Mittel. Oft hat sie nichts bewirkt und manchmal sogar das Gegenteil dessen, was beabsichtigt war.
Bremer gibt in seinem Buch »50 Jahre Entwicklungshilfe - 50 Jahre Strohfeuer« einen Dialog zwischen dem Chef einer Dorfgemeinschaft und einem deutschen Entwicklungshelfer (»Selbsthilfeexperten«) wieder, das zwar fiktiv ist, aber Originalformulierungen aus den tatsächlich stattgefundenen Gesprächen verwendet und auf Jahrzehnten von praktischen Erfahrungen in diesem Bereich basiert. Die Fortschrittskontrolle für dieses Projekt hatte Bremer durchgeführt. Ich zitiere den Dialog in voller Länge - C ist der Chef der Dorfgemeinschaft und S der Selbsthilfeexperte:
»C: Sir, wir benötigen einen kleinen Damm für unsere Viehtränke und unsere Landwirtschaft in der Trockenzeit.
S: Das ist ein sehr sinnvolles Ziel, aber lassen Sie mich erklären, was Sie zuerst brauchen. Sie müssen Ihre Managementkapazitäten verbessern, um ein Problem wie den Damm anzugehen; deswegen benötigen Sie Analyseinstrumente, Meetings und Training, wie man Meetings abhält und mit Gruppendynamik umgeht, sowie Überlegungen, wie Frauen beteiligt werden können; Sie brauchen Techniken für Verhandlungen und Entscheidungsfindungen, die Sie durch die Beratung unserer Experten lernen können, Sie brauchen ...
C: Oh Sir, das scheint viel Zeit zu kosten. Wenn frisches Wasser zu lange im Mund bleibt, wird es zu Speichel. Und unser Damm?
S: Einen Schritt nach dem anderen, Sie müssen prozessorientiert denken. Glauben Sie mir, unsere Selbsthilfespezialisten wissen, was Sie benötigen, um Ihren Damm zu bekommen.
C: Okay, wenn wir das alles gemacht haben: Bekommen wir dann unseren Damm?
S: Das ist möglich. Aber bevor Sie ein Großprojekt wie den Damm angehen, sollten Sie klein anfangen, z.B. einen von Hand gegrabenen Brunnen, ohne Pumpe und Seilwinde oder so.
C: Sir, wir haben genug Brunnen und Bohrlöcher, sogar mit Handpumpen. Wir brauchen einen Damm.
S: Fragen Sie mal die Frauen im Dorf. Bestimmt gibt es welche, die noch keinen Brunnen haben.
C: Okay, der Bettler hat keine Wahl. Wir graben den Brunnen. Bekommen wir dann den Damm?
S: Das hängt von Ihnen ab. Fifty-fifty-Beteiligung in cash, zudem Bereitstellung von Arbeit und Baumaterial; cash im Voraus zu bezahlen.
C: 50 Prozent, Sir? Das ist zu viel für die meisten Familien.
S: Möglich, aber wenn Sie nicht 50 Prozent beitragen, wird Ihr ownership feeling nicht stark genug sein für die Nachhaltigkeit. 49 Prozent sind nicht genug.
C: Okay, Sie kriegen die 50 Prozent. Bekommen wir dann unseren Damm?
S: Das hängt von vielen Faktoren ab: Können wir die anderen 50 Prozent finanzieren? Ist es technisch machbar? Haben wir genug Zeit? Anyway, denkt immer daran, dass für euch der Lernprozess wichtiger ist als das Ergebnis. Wir sehen uns im nächsten Meeting.«2
Bremer versichert: Was wie eine Karikatur klinge, habe sich so abgespielt. Im Ergebnis sei kein einziges Rückhaltebecken realisiert worden, dafür sei aber die Zielgruppe theoretisch belehrt worden, wie man sich selbst helfen könne. Das Konzept »Hilfe zur Selbsthilfe« wird oft mit dem Spruch erklärt: »Anstatt den Armen Fische zu schenken, zeigen wir ihnen, wie man angelt.« Bremer hält nichts von solchen Weisheiten, auch wenn sie auf den ersten Blick plausibel klingen: »Überall auf der Welt wissen die Menschen, die am Wasser leben, wie man fischt, ob mit Angeln, Netzen, Reusen oder Speeren, und wie man Fisch durch Räuchern, Trocknung oder in Salzlake haltbar macht.«3 Dafür brauchen sie keine Entwicklungshelfer.
Natürlich, der Spruch ist nicht wörtlich zu nehmen, sondern als Beispiel gedacht, aber Bremer kritisiert das Prinzip der Entwicklungshilfe, das auf sogenannten »Projekten« beruht. Obwohl heute so viel von Nachhaltigkeit geredet werde, seien diese Projekte in den seltensten Fällen nachhaltig. Kaum jemand beschäftige sich damit, was beispielsweise zehn Jahre nach dem Auslaufen eines solchen Projektes daraus geworden sei. Wer durch die afrikanischen Landschaften fahre, sehe immer wieder vor sich hin rostende und wie Grabkreuze wirkende Schilder von Projekten als letzte Zeichen, dass da mal was war, manchmal sogar von mehreren Gebern am selben Ort. Selbst für die Demontage der Schilder sei nach Projektende kein Geld vorhanden - bestenfalls würden Dorfschmiede sie für die Herstellung von Kochtöpfen verwenden.
Während der Laufzeit waren viele Projekte in gewisser Weise erfolgreich, da genug Geld für Material, Betriebsmittel, Fahrzeuge und hohe Gehälter vorhanden war. Doch wenn diese Bezuschussung auslief, zeigte sich, dass diese hoch subventionierten Projekte durchweg unwirtschaftliche Strohfeuer waren, von denen schon kurz nach ihrem Ende nichts übriggeblieben sei.4
Bremer kennt sich besonders gut im westafrikanischen Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) aus, dem weltweit größten Exporteur von Kakao. 1977 schrieb der studierte Ethnologe, Soziologe und Entwicklungsökonom seine Doktorarbeit über die Geschichte der Kakaoproduktion in der Elfenbeinküste, wo er heute lebt. Seine bittere Bilanz der Entwicklungshilfeprojekte für dieses Land: Mit Ausnahme eines Forstprojektes habe keine der 24 abgeschlossenen Maßnahmen eine nachhaltige Wirkung gehabt. »Sie waren hinsichtlich dieses Kriteriums somit Fehlschläge oder eben Strohfeuer, die insgesamt 125 Millionen Euro gekostet haben.«5
Ein anderes Beispiel ist der Aufbau und Unterhalt einer Veterinärapotheke in Burundis früherer Hauptstadt Bujumbura. Das Projekt dauerte mit ein und derselben entsandten Fachkraft 22 Jahre an. Aber die Apotheke war kurz nach dem Auslaufen der Förderung schon nicht mehr funktionsfähig und wurde geschlossen. »Das passiert«, so Bremer, »wenn sich die Entwicklungshilfe auf privatwirtschaftliches Terrain begibt, aber auf Bedarfsanalysen, Geschäftspläne und Rentabilitätsrechnungen verzichtet und so mit Steuergeldern eine subventionierte Spielwiese für entsandte Fachkräfte einrichtet.«6
Wenn die Finanzierung auslaufe, werde das Projekt abgeschlossen, was aber die Entwicklungshelfer keineswegs daran hindere, ein paar Jahre später im selben oder einem anderen Land ein ähnliches Projekt aufzulegen, dessen Scheitern man von Anfang an vorhersagen könne.
Bremers Fazit fällt daher niederschmetternd aus: »So geht das seit 50 Jahren, und von dieser Art Projekt lebt die ganze internationale Entwicklungshilfeindustrie, die mit öffentlichen Mitteln finanziert wird. Die vermeintlich begünstigten armen Bauern, die von den Projekten erreicht werden sollten, sind an dessen Ende nicht weniger arm und wieder sich selbst überlassen. Dafür wurden aber viele Arbeitsplätze für entsandte Fachkräfte und ihre Betreuer in den Zentralen geschaffen.«7
William Easterly, Professor für Ökonomie und Afrikastudien an der New York University, hält Entwicklungshilfe ebenfalls für weitgehend nutzlos, oft sogar für kontraproduktiv. Eines der Beispiele aus seinem Buch »Wir retten die Welt zu Tode«: In zwei Jahrzehnten wurden in Tansania zwei Milliarden USD an Entwicklungshilfemitteln für den Straßenbau ausgegeben. Aber das Straßennetz ist nicht besser geworden. Weil die Straßen nicht instandgehalten wurden, verfielen sie schneller, als die Geldgeber neue bauen konnten, berichtet Easterly. Was sich hingegen wirkungsvoll in Tansania entwickelte, war eine gigantische Bürokratie. »Für seine Geldgeber, die das Empfängerland mit tausend Missionen von Entwicklungshilfevertretern im Jahr überfluten, produzierte Tansania jedes Jahr 2.400 Berichte.« Die Entwicklungshilfe habe also nicht geliefert, was die Armen benötigten (Straßen), sondern stattdessen vieles, was den Armen wenig nützt.8
Dambisa Moyo stammt aus Sambia und lebt seit Anfang der 1990er-Jahre in den USA, wo sie zunächst mit einem Stipendium ihr Studium fortsetzte. An der American University in Washington, D.C. studierte sie Chemie und absolvierte nach ihrem Bachelor dort ein MBA-Programm in Finanzwirtschaft. Sie machte außerdem an der Kennedy School of Government der Universität Harvard einen Master-Abschluss und erwarb von der Universität Oxford einen Ph.D. in Volkswirtschaftslehre. In ihrem Buch »Dead Aid« rechnet Moyo mit der Entwicklungshilfe ab: Eine Studie der Weltbank belege, dass mehr als 85 Prozent der Fördergelder für andere Zwecke verwendet wurden als ursprünglich vorgesehen, oft umgeleitet in unproduktive Projekte.9 Selbst da, wo die Mittel in an sich sinnvolle Projekte fließen, werden die kurzfristig positiven Folgen von negativen Langzeitfolgen konterkariert, zum Beispiel weil durch Hilfsprojekte lokale Firmen in den Ländern zerstört werden.
Oft sind es modische Themen, die gefördert werden, so etwa Ökofarmen: Sie blieben, so Bremer, »zwölf Jahre lang eine folgenlose Spielwiese für entsandte Experten und ihre Fachgutachter für die in diesen Jahren in Mode gekommene ökologische bzw. standortgerechte Landwirtschaft. Insgesamt sind mit diesen Projekten ca. 20 Millionen Euro in den Savannensand gesetzt worden.«10
Die Öffentlichkeit in den Geberländern interessiert das nicht. Die Projekte sind weit weg - und ob sie etwas bewirken, wird höchstens in der Wissenschaft hinterfragt. Die Politiker und die Medien befassen sich verständlicherweise eher mit den Themen, die die Wähler und Leser in den Geberländern beschäftigten und interessieren - und nicht mit der Frage, ob die Milliardensummen für die Entwicklungshilfe sinnvoll verwendet werden. Allenfalls fragen manchmal Politiker oder Medien kritisch nach, ob es zum Beispiel sinnvoll ist, dass Deutschland an China hohe Zahlungen an Entwicklungshilfe gibt - allein im Jahre 2017 waren es 630 Millionen Euro.11
Befürworter der Entwicklungshilfe verweisen gerne darauf, dass die Armut in den vergangenen Jahrzehnten massiv zurückgegangen ist: 1981 lag die Quote der Menschen, die in extremer Armut lebten, noch bei 42,7 Prozent, im Jahr 2000 war sie bereits auf 27,8 Prozent gesunken und 2021 lag sie unter 10 Prozent.12 Das ist ein toller Erfolg - doch der kam nicht wegen, sondern trotz der Entwicklungshilfe zustande.
Vor allem ist der Rückgang der Zahl der Armen weltweit auf die Entwicklung in zwei bevölkerungsreichen Staaten in Asien - China und in geringerem Ausmaß Indien - zurückzuführen. Über China habe ich in meinen Büchern »Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung« und »Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten« ausführlich geschrieben. Ich möchte an dieser Stelle deshalb nur so viel wiederholen: Noch Ende der 1950er-Jahre starben beim größten sozialistischen Experiment der Menschheitsgeschichte - Maos »Großem Sprung nach vorne« - etwa 45 Millionen Chinesen, die meisten an Hunger. Und auch 1981, nach dem Ende von Maos sozialistischer Planwirtschaft, lebten 88 Prozent der Chinesen in extremer Armut. Erst durch die Einführung des Privateigentums und kapitalistische Reformen ist die Zahl der Chinesen, die in extremer Armut leben, auf heute etwa 0,5 Prozent gesunken.
Auch Vietnam, noch Anfang der 90er-Jahre das ärmste Land der Welt, hat durch die seit 1986 einsetzenden marktwirtschaftlichen Doi-Moi-Reformen die Zahl der armen Menschen von 80 Prozent auf unter 5 Prozent gesenkt - dazu schreibe ich mehr in Kapitel 3.
Doch kommen wir zurück zur Entwicklungshilfe. Ist das von Autoren wie Frank Bremer, William Easterly und Dambisa Moyo gezeichnete Bild zu einseitig? Im Jahr 2000 fand eine Studie der amerikanischen Ökonomen Craig Burnside und David Dollar13 über »Aid, Policies, and Growth« viel Beachtung. Sie versuchten den Nachweis zu erbringen, dass unter bestimmten Voraussetzungen - insbesondere wenn die Nehmerländer gut regiert würden - Entwicklungshilfe zum Wachstum beitrage.
Der Ökonom Tomi Ovaska überprüfte die Ergebnisse in einem 2003 veröffentlichten Aufsatz (»The Failure of Development Aid«) und stellte Berechnungen für 86 Entwicklungsländer in den Jahren 1975 bis 1998 an. Er kam zum Ergebnis, dass sich Entwicklungshilfe sogar negativ auf das Wachstum auswirke. »Insbesondere stellte sich heraus, dass sich bei einem Anstieg der Entwicklungshilfe um 1 Prozent des BIP das jährliche reale Pro-Kopf-BIP-Wachstum um 3,65 Prozent verringert.«
Auch konnte er in den Daten keine Bestätigung für die These von Burnside und Dollar finden, wonach eine bessere Qualität der Regierung zu einer größeren Effektivität der Entwicklungshilfe führe.14 Er gelangte daher zu einer anderen Empfehlung: »Entwicklungsländer bei der Schaffung von einem mit freien Märkten kompatiblen wirtschaftlichen Umfeld zu unterstützen, ist ein viel versprechender und potenziell kosteneffizienter Weg, die individuellen Anstrengungen und die Kreativität in diesen Ländern freizusetzen.«15
Der bereits zitierte William Easterly verwendete in einem ebenfalls 2003 veröffentlichten Beitrag (»Can Foreign Aid Buy Growth?«) die gleichen Daten wie Burnside und Dollar, fügte weitere hinzu und kam zu dem Ergebnis, dass auch der Befund, Entwicklungshilfe habe bei guten politischen Rahmenbedingungen einen positiven Effekt, einer näheren Überprüfung nicht standhält.16 Eine ausführliche statistische Untersuchung, die über einen Zeitraum von 24 Jahren reichte - von 1970 bis 1993 - kam zu dem Ergebnis, dass Entwicklungshilfe für das wirtschaftliche Wachstum der Länder nichts gebracht hat.17
Auch Easterly weist auf das Problem hin, dass die Ergebnisse von Projekten nur selten mit einem Abstand von drei oder zehn Jahren nach ihrer Beendigung geprüft würden. »Die Weltbank überprüft nur fünf Prozent ihrer Darlehen drei bis zehn Jahre nach der letzten Auszahlung darauf, ob sie Auswirkungen auf die Entwicklung hatten.«18 Letztlich bedeutet dies, dass man sich für die Auswirkungen der Entwicklungshilfe nicht interessiert oder dass man in Anbetracht der Ergebnisse bewusst nicht näher hinschaut.
Vier Jahre später veröffentlichte Easterly einen weiteren Beitrag zum Thema: »Was Development Assistance a Mistake?« In den vergangenen 42 Jahren seien 568 Milliarden USD (in Dollarwert des Jahres 2007) nach Afrika geflossen, aber das Wachstum des realen Bruttoinlandsproduktes pro Einwohner sei nicht messbar gewesen. Das oberste Viertel aller Empfängerländer von Entwicklungshilfe habe in diesen 42 Jahren 17 Prozent des Bruttoinlandsproduktes als Hilfe empfangen, doch das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes pro Kopf habe nahe null gelegen.19 Die Länder dagegen, die hohes Wachstum verzeichneten, vor allem Indien, China und Vietnam, hätten vergleichsweise wenig Entwicklungshilfe erhalten.20 Seine Gesamtbilanz der Entwicklungshilfe fällt vernichtend aus: »eine Fokussierung auf die Kreditvergabe und nicht auf die Ergebnisse dieser Kredite; eine Überfülle an Berichten, die niemand liest; ein Hang zu großtuerischen Rahmenplänen und Weltgipfeln; moralische Ermahnungen an alle, anstatt dass eine Agentur die Verantwortung für irgendetwas übernimmt; ausländische technische Experten, denen niemand zuhört; Krankenhäuser ohne Medikamente und Schulen ohne Schulbücher; Straßen und Wassersysteme, die gebaut, aber nicht instand gehalten werden; durch Entwicklungshilfe finanzierte Regierungen, die trotz Korruption und Misswirtschaft an der Macht bleiben, und so weiter.«21
Was wirklich helfe, seien nicht Experten mit der Anmaßung von Wissen, sondern spontane Entwicklungen des Marktes, Entwicklungen, die von unten kommen müssten.22 Die freie Marktwirtschaft, so erklärt Easterly in seinem Buch »Wir retten die Welt zu Tode«, funktioniere, aber sie könne nicht von oben verordnet werden.23
Kapitalismus entsteht - anders als Sozialismus - eben nicht durch staatliche Verordnungen und zentrale Planung, sondern als spontaner, dezentraler Prozess. Die Konsequenz aus dieser Erkenntnis ist für Easterly eine größere Bescheidenheit: »Der Westen kann folglich für arme Länder keine umfassenden Reformen zuwege bringen, die durch geeignete Gesetze und Institutionen für funktionierende Märkte sorgen. Wie wir gesehen haben, beruhen die Regeln, nach denen die Märkte arbeiten, auf einer komplexen Bottom-up-Suche nach den sozialen Normen, Beziehungsnetzwerken und formellen Gesetzen und Institutionen, die den größten Nutzen bringen. Doch damit nicht genug. Diese Normen, Netzwerke und Institutionen reagieren auf veränderte Umstände und wandeln sich.«24
Um das zu demonstrieren, bringt Easterly ein Beispiel aus China: In dem kleinen Dorf Xiaogang in der Provinz Anhui - dem Herzen der chinesischen Reisanbauregion - hielten 1978 etwa 20 Familien ein Geheimtreffen ab. Die Menschen waren verzweifelt, denn die Kollektivierung der Landwirtschaft und die Abschaffung des Privateigentums hatten - wie schon zuvor in der Sowjetunion - zu Hunger und extremer Armut geführt. In vielen Dörfern Chinas gingen die Menschen deshalb dazu über, das Privateigentum de facto wieder einzuführen, obwohl das eigentlich verboten war. Sie teilten das Land auf, und jeder durfte das behalten, was er auf seinem Stück Land erwirtschaftete.
Zwar hielten die Dorfbewohner ihre Absprache geheim, aber die Reisproduktion nahm so stark zu und das Ergebnis war so spektakulär, dass sie es nicht dauerhaft verbergen konnten. Als die Bewohner anderer Dörfer davon erfuhren, machten sie es den Bewohnern von Xiaogang nach.25 Zu dieser Zeit hatte Deng Xiaoping seine marktwirtschaftlichen Reformen in China begonnen, und der Staat hielt die Menschen nicht mehr davon ab, nach besseren, marktwirtschaftlichen Lösungen zu suchen.
Doch schon lange bevor das offizielle Verbot von privater Landwirtschaft 1982 aufgehoben wurde, gab es überall in China spontane Initiativen von Bauern, die das private Eigentum entgegen dem sozialistischen Glaubensbekenntnis faktisch wieder einführten.26 Das Ergebnis war sehr positiv: Die landwirtschaftliche Produktion stieg rapide an, die Menschen mussten nicht mehr hungern. Und 1983 war fast die gesamte Landwirtschaft in China entkollektiviert. Das große sozialistische Experiment Maos, dem so viele Millionen Menschen zum Opfer gefallen waren, war beendet. In diesem Buch werde ich am Beispiel von Vietnam und Polen zeigen, dass Regierungen eine wichtige Rolle spielen, die von ihnen »verordneten« Reformen aber manchmal nur das sanktionierten, was sich schon »von unten« entwickelt hatte.
In dem renommierten »Journal of Economic Surveys« veröffentlichte 2009 der dänische Ökonom Martin Paldam von der University of Aarhus einen Aufsatz mit dem Titel: »The Aid Effectiveness Literature: The Sad Results of 40 Years of Research«. Der Ökonom hatte 97 wissenschaftliche Studien zur Wirksamkeit von Entwicklungshilfe unter die Lupe genommen. Er führte mehrere Metaanalysen durch, das sind statistische Verfahren, die Ergebnisse mehrerer Studien zur selben Fragestellung zusammenfassen und auswerten. Sein Befund: »Unsere drei Metaanalysen der Literatur über die Wirksamkeit von Entwicklungshilfe haben keinen Nachweis für einen signifikant positiven Effekt von Entwicklungshilfe ergeben. Wenn es also eine Wirkung gibt, so muss diese lediglich gering sein. Entwicklungshilfe richtig zu leisten hat sich als ein schwieriges Unterfangen erwiesen.«27
Die deutschen Ökonomen Axel Dreher und Sarah Langlotz von der Universität Heidelberg sind im Juni 2017 noch einmal der gleichen Fragen nachgegangen und haben die Auswirkungen von Entwicklungshilfe auf 96 Empfängerländer in dem Zeitraum von 1974 bis 2009 untersucht. Ihr Ergebnis war, dass die bilaterale Hilfe das Wirtschaftswachstum nicht steigern kann. In den Jahren des Kalten Krieges, so ein weiteres Ergebnis, hatte Entwicklungshilfe sogar einen negativen Effekt auf das Wirtschaftswachstum. »Wir untersuchten auch die Auswirkungen der Entwicklungshilfe auf Ersparnisse, Konsum und Investitionen und können weder in der Gesamtstichprobe noch in unseren Unterstichproben eine Auswirkung der Entwicklungshilfe feststellen.«28
Die Autoren entschuldigen sich fast dafür, dass sie diese deprimierenden Ergebnisse überhaupt veröffentlichen, sehen sich jedoch dazu verpflichtet, da viele Veröffentlichungen von einer gutmeinenden Einäugigkeit der Autoren gegenüber dem Thema geprägt sind: »Dennoch halten wir es für wichtig, diese Ergebnisse aufzuzeigen und zu veröffentlichen. Denn die über die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit veröffentlichte Literatur ist tendenziell überoptimistisch, was an der institutionellen Voreingenommenheit der Autoren dieser Literatur und der bekannten Voreingenommenheit von Fachzeitschriften liegt, die (nur) signifikante Ergebnisse veröffentlichen.«29
Entwicklungshilfe hilft offenbar nicht dauerhaft bei der Bekämpfung der Armut. Damit ist nicht humanitäre Unterstützung gemeint, etwa bei Naturkatastrophen oder Hungersnöten. Solche Hilfen sind richtig und wichtig. Aber das ist nicht das, was mit Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit gemeint ist.
Wenn Entwicklungshilfe schon nicht beim wirtschaftlichen Wachstum hilft, dann vielleicht aber bei der Entwicklung demokratischer Strukturen in einer Gesellschaft? Auch dies ist nicht der Fall, wie eine im April 2005 veröffentlichte Studie belegt. Die Autoren Simeon Djankov und Jose G. Montalvo untersuchten Daten von 108 Empfängerländern über einen Zeitraum von fast 40 Jahren, und das Ergebnis war, dass »Entwicklungshilfe eine negative Wirkung auf die Demokratie hat«.30 Wenn die Ergebnisse von zahlreichen wissenschaftlichen Studien so eindeutig sind, warum hält sich dann dennoch so zäh die Überzeugung, Entwicklungshilfe sei der beste Weg, um Nationen aus der Armut zu befreien? Ich denke, es ist das, was ich den Nullsummenglauben nenne. Viele Menschen glauben, arme Länder seien nur arm, weil die reichen Länder ihnen etwas weggenommen haben. Die Folgerung: Die reichen Länder müssten etwas von ihrem Reichtum abgeben, dann werde es den armen Ländern besser gehen.
Doch das ist eine Illusion, weil die Nullsummenspiel-Annahme, auf dem dieser Glaube basiert, falsch ist. Mit Nullsummenspiel wird in der Wirtschaftssoziologie eine Konstellation beschrieben, in der die Summe der Auszahlungen an die Spieler null ergibt. Der Gewinn eines Spielers ist automatisch der Verlust eines anderen. Nicht-Nullsummenspiele dagegen sind solche Spiele, bei denen die Summe der Auszahlungen an die Spieler nicht konstant ist. In solchen Spielen können beide Parteien gewinnen oder verlieren oder eine Partei kann gewinnen, ohne dass die andere verliert usw. Forscher meinen, der Nullsummenglaube habe seine Wurzeln in vorkapitalistischen Gesellschaftsformen, in denen Situationen mit begrenzten Ressourcen die Norm waren. »Wenn begehrte Ressourcen begrenzt sind, bedeutet deren Verteilung, dass sie bald aufgebraucht sein werden.«31
Der amerikanische Ökonom Paul H. Rubin hat gezeigt, dass »folk economics«, also volkstümliche oder laienhafte Vorstellungen vom Wirtschaftsleben, ganz auf die Frage der Verteilung des Reichtums fokussiert sind, nicht jedoch auf dessen Erzeugung.32 »Der entscheidende Punkt: Das volkstümliche Wirtschaftsdenken beschränkt sich auf eine Ökonomie des Verteilens, nicht auf eine Ökonomie des Schaffens von Wohlstand. Naive Menschen oder Wirtschaftslaien betrachten Preise als Instrumente zur Verteilung von Wohlstand, aber verstehen nicht den Einfluss, den diese auf die Allokation von Ressourcen und die Produktion von Gütern sowie Dienstleistungen haben. Im volkstümlichen Wirtschaftsdenken ist die Menge der - insgesamt oder von jedem Einzelnen - gehandelten Güter fix und unabhängig vom Preis. Zudem ist jeder Einzelne auf die Verteilung von Vermögen und Einkommen konzentriert ... und nicht auf Effizienzgewinne durch ökonomische Aktivitäten.«33
Rubin führt diese Art des Denkens auf Prägungen im menschlichen Gehirn zurück, die er evolutionsbiologisch erklärt:34 Über Millionen Jahre gab es kaum Wachstum und technische Effizienzsteigerungen. Das Tempo von Änderungen war so langsam, dass der einzelne Mensch diese im Laufe seines Lebens kaum wahrnehmen konnte. Jeder Mensch lebte in einer Welt mit einer konstanten Technologie, und es gab keinen Vorteil für Menschen, die ein Verständnis für Wachstum hatten - eben weil es dieses Wachstum praktisch nicht gab. Es gab auch kaum Arbeitsteilung, sieht man einmal von der Teilung der Arbeit zwischen Jungen und Erwachsenen sowie zwischen Männern und Frauen ab. Handel war kein Ausdruck systematischer Arbeitsteilung, sondern eher ein Ergebnis des Zufalls - jemand hatte zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas im Überfluss, was der andere brauchen konnte.
Wenn Menschen in solchen Gesellschaften Vor- oder Nachteile hatten, dann basierten diese tatsächlich meistens darauf, dass der eine den anderen übervorteilte. Daher, so Rubin, strebten die Menschen danach, Situationen zu vermeiden, in denen sie von anderen übervorteilt werden konnten.
In vorkapitalistischen Gesellschaften beruhte der Reichtum der einen tatsächlich oft auf Raub und Machtausübung, also den Verlusten der anderen. Das Marktsystem basiert jedoch nicht auf Raub und ist kein Nullsummenspiel. Es beruht darauf, dass derjenige reich wird, der die Bedürfnisse möglichst vieler Konsumenten befriedigt. Das ist die Logik des Marktes. Und das für kapitalistische Systeme charakteristische Wirtschaftswachstum ermöglicht es, dass manche Menschen und auch ganze Nationen reicher werden - ohne dass dies auf Kosten anderer Menschen und Nationen geschieht, die gleichsam automatisch ärmer würden. Dies möchte ich in diesem Buch am Beispiel von zwei Ländern zeigen, die beide noch vor 30 Jahren sehr arm waren - Polen und Vietnam.
2. Polen: Der Aufstieg des weißen Adlers
Schlangestehen hatte sich im sozialistischen Polen zu einer regelrechten »Wissenschaft« entwickelt, wie es Iwona Kienzler in ihrem Buch »Życie w PRL. I strasznie i śmiesznie« über den Alltag unter der Herrschaft der kommunistischen Arbeiterpartei beschreibt: Da Warteschlangen an der Tagesordnung waren und man oft mehrere Stunden anstehen musste - beim Kauf von Möbeln oder Haushaltswaren sogar über mehrere Tage hinweg -, entstanden einige findige Systeme. Eines davon war die sogenannte ›Warteschlangenliste‹. Sie kam zum Einsatz, wenn die Wartezeit nicht Stunden, sondern Tage betrug. In diesem Fall wurden alle Wartenden in eine Liste aufgenommen, damit die Leute nicht die ganze Zeit über anwesend sein mussten. Die Liste wurde alle paar Stunden vorgelesen und die Anwesenheit abgefragt. Wer sich nicht anwesend meldete, wurde von der Liste gestrichen.
Der Zeitplan für die Aufnahme in die Liste wurde im Voraus bekannt gegeben. Bei einer Wartezeit über mehrere Tage hatte man sich drei- bis viermal am Tag zu melden. Manche nahmen sich dafür Urlaubstage, andere baten ihre Vorgesetzten darum, sich kurzzeitig von der Arbeit entfernen zu dürfen, oder man bezahlte andere Personen dafür, sich stellvertretend für einen zu melden (man nannte das »einen Schlangesteher anheuern«). Die Warteschlangenliste lag in der Obhut eines selbsternannten Warteschlangen-Ausschusses.35
Ein anderes Beispiel aus dem Buch »80-te. Jak naprawdę żyliśmy w ostatniej dekadzie PRL« (Die 1980er-Jahre: Wie wir im letzten Jahrzehnt des kommunistischen Polens wirklich lebten) von Joanna Solska: Um effektiver einkaufen zu können, wurde Missbrauch getrieben mit den Privilegien, die schwangeren Frauen und Frauen mit Kindern zustanden: »Geschäfte waren Orte, in denen sich der Gegensatz zwischen theoretischem und realem Sozialismus manifestierte. In der Theorie wurden Frauen von dem System respektiert und erhielten Privilegien, wenn sie Kinder hatten oder schwanger waren. Eines dieser Vorrechte war die Möglichkeit, einkaufen zu können, ohne dabei anstehen zu müssen. So marschierten Frauen mit Kindern einfach in die Geschäfte (manche liehen sich die Kinder von Freunden aus) und gingen direkt zur Kasse. Je knapper ein Produkt war, desto mehr Frauen mit Kindern kamen. Und während sie alle Bestände in dem Laden aufkauften, kam der Rest der Leute in der Schlange kaum voran.«36