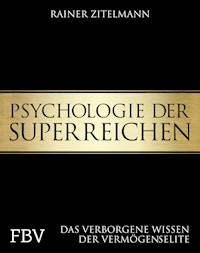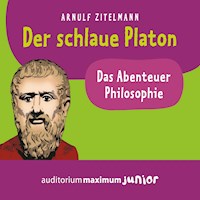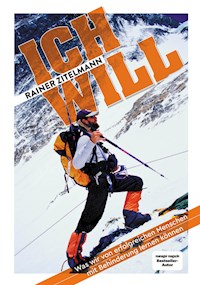21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Der Markt hat versagt, wir brauchen mehr Staat – das behaupten insbesondere seit dem Ausbruch der Finanzkrise vor zehn Jahren Politik, Medien und Intellektuelle. Rainer Zitelmann, mehrfacher Bestsellerautor, vertritt die Gegenthese: Mehr Kapitalismus tut den Menschen gut. Er begibt sich auf eine Reise durch die Kontinente und Geschichte und zeigt: In Ländern, wo der Staat an Einfluss verliert und die Menschen dem Markt mehr vertrauen, steigt der Wohlstand und geht die Armut zurück. Zitelmann findet Belege für seine These in Afrika, Asien, Europa sowie Nord- und Südamerika. Er vergleicht die Entwicklung in Ost- und Westdeutschland und in Nord- und Südkorea nach dem Zweiten Weltkrieg, im kapitalistischen Chile und im sozialistischen Venezuela. Starben in China Ende der 50er-Jahre noch 45 Millionen Menschen an einer durch sozialistische Experimente ausgelösten Hungersnot, ist das Land heute die führende Exportnation der Welt. Der Kapitalismus hat gewaltige Probleme gelöst – und dies immer wieder in der Geschichte der Menschheit. Die größte Gefahr für unseren Wohlstand ist, dass diese Lehre in Vergessenheit gerät. Ein hochaktuelles Buch in einer Zeit, in der der Staat sich immer öfter mit planwirtschaftlichen Methoden in das Leben der Menschen und Unternehmen einmischt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Ähnliche
Rainer Zitelmann
KAPITALISMUS IST NICHT DAS PROBLEM, SONDERN DIE LÖSUNG
Eine Zeitreise durch fünf Kontinente
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
6. Auflage 2024
© 2018 by FinanzBuch Verlag
ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Redaktion: Ansgar Graw
Korrektorat: Leonie Zimmermann, Hella Neukötter
Umschlaggestaltung: Manuela Amode, München
Satz: Digital Design, Eka Rost
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
eBook: ePubMATIC.com
ISBN Print 978-3-95972-088-5
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96092-152-3
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96092-153-0
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
INHALT
Vorwort zur 4. Auflage
Einleitung: Das Experimentierfeld der Geschichte
1. China: Von der Hungersnot zum Wirtschaftswunder
2. Kapitalismus hilft Afrika besser als Entwicklungshilfe
3. Wie Ulbricht mit dem Trabi den Mercedes überholen wollte
4. Nord- und Südkorea: Der Markt ist sogar weiser als Kim Il-sung
5. Thatcher und Reagan reformieren England und Amerika
6. Warum geht es den Menschen in Chile besser als in Venezuela?
7. Schweden – der Mythos vom nordischen Sozialismus
8. Menschen geht es dort besser, wo wirtschaftliche Freiheit herrscht
9. Die Finanzkrise – eine Krise des Kapitalismus?
10. Warum Intellektuelle den Kapitalismus nicht mögen
11. Plädoyer für kapitalistische Reformen
Anmerkungen
Danksagung
Über den Autor
Literatur
VORWORT ZUR 4. AUFLAGE
Dies ist schon die 4. Auflage dieses Buches. Inzwischen ist es unter dem Titel »The Power of Capitalism« auch in englischer Sprache erschienen, in Südkorea war es auf Platz 1 bei den Sachbuch-Bestsellern, eine italienische Ausgabe findet viel Beachtung in den Medien des Landes und demnächst erscheint das Buch auch in Spanien. Das gewaltige Interesse hat jedoch einen wenig erfreulichen Grund: Der Kapitalismus gerät weltweit immer stärker unter Beschuss.
Ein Argument, das in der aktuellen Debatte immer wieder bemüht wird, lautet: Der Kapitalismus ist verantwortlich für die Umweltzerstörung, weil der Kapitalismus auf Wachstum beruht. Tatsächlich hat der Kapitalismus zu einem ungeheuren Wirtschaftswachstum geführt. Als der Kapitalismus sich zu entwickeln begann, lebten noch 90 Prozent der Menschen weltweit in extremer Armut, heute sind es weniger als 10 Prozent. Und dies, obwohl sich die Weltbevölkerung seitdem mehr als versiebenfacht hat.
Aber ist nicht die Zerstörung der Umwelt der Preis für dieses Wachstum? Natürlich führt die industrielle Entwicklung zu Umweltproblemen, niemand wird das bestreiten. Doch die Behauptung, dass Wachstum automatisch zu einer immer schlimmeren Zerstörung der Umwelt führe, ist falsch. Der Environmental Performance Index (EPI) der Yale Universität umfasst 16 Indikatoren aus den Bereichen Umweltgesundheit, Luftqualität, Wasser, Biodiversivität, natürliche Ressourcen und Energie. Sie sollen sowohl den aktuellen Zustand als auch die Dynamik des Ökosystems abbilden. Auffallend ist ein enger Zusammenhang zwischen dem Reichtum eines Staates und dem Abschneiden beim Umweltschutz. Die meisten entwickelten kapitalistischen Länder erreichen hohe Umweltstandards. Jene Länder mit der schlechtesten Bewertung im EPI sind durchgehend arm. Sie haben sowohl gering ausgeprägte Investitionskapazitäten für Infrastruktur, einschließlich Wasser- und Sanitärversorgung, als auch tendenziell schwache Umweltaufsichtsbehörden.
Entgegen der allgemein vorherrschenden Wahrnehmung haben die industrielle Entwicklung und der technische Fortschritt erheblich zur Entlastung der Umwelt beigetragen. Wie Indur Goklany in seinem Buch »The Improving State of the World« und Steven Pinker in dem Kapitel »Umwelt« seines Buches »Aufklärung jetzt« belegen, leben wir heute nicht nur länger, gesünder und in bislang unerreichtem Wohlstand, sondern auch auf einem vergleichsweise sauberen Planeten.
Die Heritage Foundation erstellt jedes Jahr einen »Index der wirtschaftlichen Freiheit« – ausführlich gehe ich darauf im achten Kapitel dieses Buches ein. Die Wissenschaftler haben dabei auch den Zusammenhang von Umweltqualität und wirtschaftlicher Freiheit gemessen. Das Ergebnis ist eindeutig: Die wirtschaftlich freiesten Länder der Welt haben im Schnitt mit einem Score von 76,1 die höchste Umweltqualität, gefolgt von den Ländern, die überwiegend frei sind, mit einem Score von 69,5. Die wirtschaftlich unfreien bzw. überwiegend unfreien Länder haben dagegen die schlechtesten Scoring-Werte für die Umweltqualität von unter 50.
Kapitalismuskritiker setzen auf den Staat als den besten Umweltschützer. Staatliche Regeln zum Umweltschutz sind wichtig. Aber staatliche Regulierung, von Kapitalismuskritikern als Allheilmittel für die Umweltprobleme genannt, führt oft zum Gegenteil des Erwünschten. Kaum ein Land der Welt gibt sich so umweltbewusst wie Deutschland, die Kosten der sogenannten »Energiewende« in Deutschland sollen sich bis 2025 konservativ geschätzt auf fast 500 Milliarden Euro summieren.
Doch das Ergebnis der Anstrengungen ist ernüchternd, wie eine Analyse von McKinsey zeigt: »Deutschland verfehlt den Großteil seiner selbstgesteckten Ziele für die Energiewende bis 2020. Gleichzeitig ist mittelfristig nach dem beschlossenen Atom- und Kohleausstieg die Versorgungssicherheit gefährdet, wenn die abgeschalteten Kapazitäten nicht rechtzeitig flexibel ersetzt werden und der Ausbau der Transportnetze schneller vorankommt.«
Im Mittelpunkt der Forderungen der Umweltschützer stand lange Zeit das Abschalten der Kernkraftwerke. Der Ausstieg aus der Kernenergie hat jedoch dazu geführt, dass Deutschland im Hinblick auf die CO2-Emission im internationalen Vergleich schlecht dasteht. Kernkraftwerke der neuen Generation sind heute zudem sehr viel sicherer als frühere Kernkraftwerks-Generationen. Seriöse Berechungen zeigen, dass es unmöglich ist, den weltweiten Energiebedarf allein mit Sonne oder Windkraft und aus anderen erneuerbaren Quellen zu decken, wie viele Klimaaktivisten dies fordern. Aufgeklärte Umweltschützer fordern heute daher, auf Kernenergie im Kampf gegen den Klimawandel zu setzen. Doch genau dies wird in Deutschland von der Politik verhindert, nicht vom Kapitalismus. Dieses Beispiel, das durch viele andere ergänzt werden könnte, zeigt: Staatliche Umweltpolitik ist oft – wenn auch nicht immer – wirkungslos, manchmal führt sie sogar zum Gegenteil des Gewünschten, also zu einer Verschlimmerung der Umweltprobleme.
Auch ist die Vorstellung falsch, dass der Kapitalismus automatisch zu immer größerer Ressourcenverschwendung führen muss. Ein Beispiel ist das Smartphone, eine der umweltfreundlichsten Entwicklungen des Kapitalismus. Das kleine Gerät ersetzt in einem Produkt viele Geräte, die früher Ressourcen verbraucht haben, u. a. das Telefon, die Kamera, den Taschenrechner, das Navigationssystem, das Diktiergerät, den Wecker, die Taschenlampe und viele weitere Geräte. Es trägt auch zur Einsparung von Papier bei, weil viele Menschen ihre Notizen nur noch digital machen oder beispielsweise das iPhone statt eines Kalenders benutzen, um Termine einzutragen. Ganz zu schweigen vom Briefpapier und den Briefumschlägen, die entbehrlich sind wegen der Kommunikation via E-Mail oder WhatsApp.
Welches andere System diejenigen wollen, die »system change« statt »climate change« fordern, sagen sie meistens nicht konkret. Aber es soll jedenfalls kein marktwirtschaftliches System sein, sondern der Staat soll die entscheidende Rolle spielen. In der Vergangenheit sind alle Experimente mit solchen Systemen gescheitert – und für die Umwelt waren sie schädlicher als jedes kapitalistische System. Beispielhaft zeigt dies Murray Feshbach in seinem Buch »Ecological Disaster. Cleaning up the hidden Legacy of the Soviet Regime«.
Die Antikapitalisten werden erwidern, dass sie ein System wie in der Sowjetunion nicht anstreben. Aber sie können kein einziges real existierendes System auf diesem Planeten – in der gesamten Geschichte – nennen, das im Bereich des Umweltschutzes bessere Lösungen erbracht hat als der Kapitalismus.
Der Ansatz dieses Buches ist stets: Ich vergleiche nicht die Utopie einer perfekten Welt mit dem real existierenden Kapitalismus. Das wäre genauso fair, wie wenn ich Ihre Ehe mit der idealen romantischen Beziehung in einem Liebesroman vergleichen würde. Sie fänden diesen Vergleich vermutlich nicht fair. Genauso unfair ist es aber, Gedankenkonstrukte einer »besseren Gesellschaft« mit der Realität des Kapitalismus zu vergleichen. In diesem Buch gehe ich einen anderen Weg. Ich vergleiche Dinge, die man vergleichen kann, also zum Beispiel das Wirtschaftssystem in China unter Mao (als 88 Prozent der Chinesen in extremer Armut leben) mit dem heutigen China, wo dieses harte Schicksal nur noch 1 Prozent betrifft.
Obwohl alle sozialistischen Experimente ausnahmslos gescheitert sind, gewinnt der Sozialismus derzeit an Attraktivität, so etwa bei jungen Amerikanern. Woran es liegt, dass ein System, das noch nie funktioniert hat, immer wieder Menschen fasziniert, dazu hat Kristian Niemietz, Ökonom am Londoner Institute of Economic Affairs ein wichtiges Buch geschrieben, das ich Ihnen als Ergänzung zu diesem Buch empfehlen möchte. Der Titel lautet: »Socialism. The Failed Idea That Never Dies«.
Dr. Dr. Rainer Zitelmann, Juli 2020
EINLEITUNG:
DAS EXPERIMENTIERFELD DER GESCHICHTE
Unter dem Eindruck des Zusammenbruchs der sozialistischen Systeme Ende der 80er-Jahre war für viele Menschen weltweit die Überlegenheit der Marktwirtschaft offensichtlich. Dennoch haben sich latent oder offen antikapitalistische Ressentiments gehalten, die seit dem Ausbruch der Finanzkrise 2008 wieder erheblich an Zustimmung gewonnen haben. Politik, Medien und Intellektuelle sind sich in der Deutung dieser Krise weitgehend einig: Der Markt oder der Kapitalismus habe versagt, wir bräuchten deshalb mehr Staat.
Dieses Buch entstand aus Sorge darüber, dass wir vergessen, was die Basis unseres wirtschaftlichen Wohlstandes ist. Das Wort »Kapitalismus« weckt bei den meisten Menschen negative Assoziationen. Dies war auch schon vor der Finanzkrise so, aber inzwischen sind Verfechter einer konsequent marktwirtschaftlichen Orientierung immer mehr in die Defensive geraten und werden als »Marktradikale« denunziert.
Es gibt in der modernen Zeit grundsätzlich zwei Möglichkeiten, eine Wirtschaft zu organisieren: Im ersten Fall gibt es kein Privateigentum an Produktionsmitteln sowie Grund und Boden, sondern nur Staatseigentum. In Planungsbehörden wird festgelegt, was in welcher Menge produziert wird. Im zweiten Fall ist das Privateigentum garantiert und die Unternehmer produzieren im Rahmen einer rechtlichen Ordnung jene Güter, von denen sie glauben, dass die Konsumenten sie brauchen. Die Preise geben ihnen die Informationen darüber, ob sie mit ihrer Annahme richtiglagen, also ob sie das Richtige in der richtigen Menge produziert haben. Das erste System nennt man Sozialismus, das zweite Marktwirtschaft oder Kapitalismus. Ich verwende beide Begriffe synonym, spreche aber vom »Kapitalismus«, weil sich heute auch Gegner der Marktwirtschaft verbal zu ihr bekennen, in Wahrheit aber Mischsysteme meinen, die sie als »soziale« oder »ökologische« Marktwirtschaft bezeichnen.
Tatsächlich existiert in der Realität keines dieser Systeme – Kapitalismus oder Sozialismus – in Reinkultur. Selbst in sozialistischen Staaten wie der DDR oder sogar in Nordkorea gab oder gibt es neben dem Staatsauch Privateigentum und neben dem alles dominierenden Plan Elemente von Marktwirtschaft, legal oder illegal. Ohne diese Marktelemente hätte die Wirtschaft in diesen Ländern noch schlechter oder gar nicht mehr funktioniert. Zwar gibt es in sozialistischen Staaten dem Namen nach auch »Preise«, doch diese haben eine ganz andere Funktion als in einer Marktwirtschaft. Letztlich haben diese Pseudopreise mehr Ähnlichkeit mit Steuern, wie der Ökonom Zhang Weiying bemerkt.1
In den kapitalistischen Ländern existiert neben dem Privat- auch Staatseigentum und der Staat greift regulierend in die Wirtschaft ein oder verteilt durch Steuern die erzielten Erträge um, indem er den Reichen Geld wegnimmt und dies an die Mittelschicht oder die Ärmeren verteilt. Das kann sehr starke Ausmaße annehmen, wie etwa in den 70er- und 80er-Jahren in Schweden. Am Beispiel von Großbritannien werden wir sehen, wie schlecht eine Wirtschaft funktioniert, wenn der staatliche Anteil zu groß wird, und dass eine Voraussetzung für mehr Wohlstand ist, den Staat wieder in seine Schranken zu verweisen.
Der »reine Kapitalismus« existiert in keinem der Länder, die in diesem Buch dargestellt werden. Entscheidend ist das Mischungsverhältnis, also die Frage, wie stark die Rolle des Staates ist und wie viel Freiheit dem Unternehmer eingeräumt wird. Die These des Buches: Wird der Kapitalismus-Anteil in einer Wirtschaft erhöht, so wie das etwa in den letzten Jahrzehnten in China geschah, dann führt das in der Regel zu mehr Wachstum und der Mehrheit der Menschen geht es damit besser.
Es gibt viele Bücher, die theoretisch die Überlegenheit der einen oder der anderen Wirtschaftsordnung beweisen wollen. Dieses Buch ist kein theoretisches Werk, sondern ein anschauliches Buch zur Wirtschaftsgeschichte. Der Kapitalismus ist, anders als der Sozialismus, kein von Intellektuellen erdachtes System, sondern eine Wirtschaftsordnung, die sich evolutionär entwickelt hat, so wie sich Tiere und Pflanzen in der Natur entwickelt haben und weiterentwickeln, ohne dass es dafür eines zentralen, lenkenden Planes oder einer Theorie bedürfte. Eine der wichtigsten Erkenntnisse, die der Ökonom und Philosoph Friedrich August von Hayek hervorgehoben hat, lautet, der Ursprung von funktionierenden Institutionen liege »nicht in Erfindung oder Planung, sondern im Überleben der Erfolgreichen«2, wobei »die Auswahl durch Nachahmung der erfolgreichen Institutionen und Bräuche«3 erfolge.
Der größte Irrtum, der Sozialisten jeglicher Spielart mit den führenden Männern und Frauen der Zentralbanken vereint, ist die Überzeugung, dass einige dazu berufene Meisterdenker und -lenker (regelmäßig solche, die im Staatsdienst stehen) klüger seien und besser wüssten, was für die Menschen gut sei, als die Millionen Unternehmer, Investoren und Konsumenten, deren Einzelentscheidungen in der Summe denen einer Planbehörde, einer Zentralbank oder einer anderen staatlichen Lenkungsstelle überlegen sind.
Daher ist es nur von beschränktem Erfolg, wenn versucht wird, ein solches Marktsystem »von oben« zu verordnen, obwohl es ohne Impulse von Politikern naturgemäß auch nicht geht. Am Beispiel Chinas werden wir sehen, dass der Kapitalismus seine Kraft dort gerade deshalb entfaltete, weil er »von unten« wuchs und sich durchsetzte – was freilich ohne die Duldung von »oben«, also durch Politiker wie Deng Xiaoping, nicht möglich gewesen wäre. Deng und die anderen Reformer waren so klug, sich nicht ein neues, ideales System auszudenken, sondern erstens spontanen Entwicklungen in den Weiten dieses großen Landes ihren Lauf zu lassen, statt sie zu verbieten oder zu behindern, und sich zweitens in vielen Ländern umzuschauen, um in Augenschein zu nehmen, was dort funktioniert und was nicht – und dies dann im eigenen Land auszuprobieren.
Mein Ansatz in diesem Buch ist ebenfalls, einfach zu schauen, was funktioniert hat und was nicht. Ich vergleiche Länder, die man ganz gut vergleichen kann, weil sie die gleiche oder eine in vielen Punkten ähnliche Geschichte und Kultur haben: Nord- und Südkorea, die DDR und die Bundesrepublik Deutschland, Venezuela und Chile. Dieses Buch zeigt darüber hinaus, wie der Vormarsch des Kapitalismus und der Rückzug des Sozialismus in China aus einem bettelarmen Land, in dem noch vor 60 Jahren Dutzende Millionen verhungerten, die größte Exportnation der Welt machten, in der niemand mehr hungern muss.
Linke Kapitalismus- und Globalisierungsgegner glauben, der Kapitalismus sei das Problem, das zu Hunger und Armut auf der Welt führe. Am Beispiel Afrikas wird gezeigt, dass das Gegenteil richtig ist: Der Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Mehr Kapitalismus hilft Afrika wirksamer als mehr Entwicklungshilfe. Untersuchungen belegen, dass die Armut in jenen Entwicklungsländern, die stärker marktwirtschaftlich orientiert sind, nur 2,7 Prozent beträgt, in wirtschaftlich unfreien Entwicklungsländern dagegen 41,5 Prozent.4
In der Regel bedeutet mehr Staat weniger Zunahme an Wohlstand und manchmal sogar einen absoluten Rückgang des Wohlstandes für eine Gesellschaft. Mehr Kapitalismus führt zu einer schnelleren Zunahme des Wohlstandes für die meisten Menschen. Das wird unter anderem am Beispiel der kapitalistischen Länder England und USA belegt, wo in den 80er-Jahren die überzeugten Marktwirtschaftler Margaret Thatcher und Ronald Reagan den Staat aus der Wirtschaft zurückgedrängt und mehr Kapitalismus gewagt haben. Nach diesen Reformen ging es beiden Ländern wesentlich besser als davor. Manchmal ist es wichtig, einen ausufernden Wohlfahrtsstaat wieder deutlich zu stutzen, wie am Beispiel Schwedens in Kapitel 7 gezeigt wird.
All dies sind praktische Experimente aus den vergangenen 70 Jahren. Obwohl der Ausgang der Experimente immer wieder in die gleiche Richtung gewiesen hat – mehr Kapitalismus bedeutet mehr Wohlstand –, scheint die Lernfähigkeit der Menschen begrenzt. Der deutsche Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel meinte in seinen Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte: »Was die Erfahrung aber und die Geschichte lehren, ist dies, dass Völker und Regierungen niemals etwas aus der Geschichte gelernt und nach Lehren, die aus derselben zu ziehen gewesen wären, gehandelt haben.«5
Vielleicht ist dieses Urteil zu streng. Aber in der Tat sind die meisten Menschen nicht in der Lage, bestimmte historische Erfahrungen zu verallgemeinern. Aus den mannigfachen Beispielen, wo mehr Kapitalismus zu mehr Wohlstand führte (neben den in diesem Buch aufgeführten gäbe es etliche weitere, so etwa das Beispiel Indiens), wollen viele Menschen nicht die naheliegenden Lehren ziehen, ebenso wenig wie aus dem Scheitern aller jemals auf der Welt probierten Varianten des Sozialismus.
Auch nach dem Zusammenbruch der meisten sozialistischen Systeme Anfang der 90er-Jahre wird regelmäßig erneut irgendwo auf der Welt versucht, die sozialistischen Ideale umzusetzen. »Dieses Mal« soll es besser gemacht werden. Zuletzt geschah das in Venezuela und wieder einmal waren viele Intellektuelle in den westlichen Ländern wie den USA oder Deutschland verzückt von dem Experiment, den »Sozialismus im 21. Jahrhundert« zu verwirklichen.6 Die Folgen des Experiments waren – so wie bei anderen vorangegangenen sozialistischen Großversuchen – katastrophal.
Sogar in den USA träumen heute viele junge Menschen vom »Sozialismus«, wenngleich sie damit nicht ein System wie in der Sowjetunion meinen, sondern eine verklärte und missverstandene Form des skandinavischen Sozialismus. Dabei ist auch diese Variante in den 70er- und 80er-Jahren in Schweden gründlich gescheitert, wie in diesem Buch gezeigt wird.
Sorge bereitet mir weniger, dass in den nächsten Jahren in westlichen Industrieländern im großen Stil Verstaatlichungen vorgenommen werden könnten und ein offen sozialistisches System eingeführt würde. Viel gefährlicher ist, dass in westlichen Ländern der Kapitalismus Stück für Stück zurückgedrängt wird und der planende und umverteilende Staat eine immer wichtigere Rolle spielt. Die Zentralbanken führen sich wie Planungsbehörden auf, die ihre Aufgabe nicht mehr darin sehen, die Geldwertstabilität zu garantieren, sondern die Marktkräfte zu beseitigen. In Europa hat die Zentralbank den für die Marktwirtschaft entscheidend wichtigen Preismechanismus teilweise außer Kraft gesetzt, weil echte Marktzinsen praktisch abgeschafft wurden. Die maßlose Verschuldung der Staaten wurde dadurch nicht eingedämmt, sondern sogar noch erheblich verstärkt.
»Je länger die Phase der niedrigen Zinsen andauert«, warnt der Ökonom Thomas Mayer, »desto stärker werden die Preise für Vermögenswerte verzerrt und desto größer ist die Gefahr, dass der Ausstieg aus der Politik der niedrigen Zinsen einen erneuten Einbruch der Wirtschaft und eine weitere Finanzkrise zur Folge hat.«7 Diese Krisen, das kann man mit Sicherheit vorhersagen, werden von Politikern und Medien dann dem »Kapitalismus« zugeschrieben, obwohl sie in Wahrheit gerade aus einer Verletzung kapitalistischer Prinzipien resultieren. Wenn die Diagnose falsch ist, ist auch die Therapie falsch. Und diese Therapie heißt: noch mehr Staat, noch weniger Markt.
Früher haben die Sozialisten die Unternehmen einfach verstaatlicht. Heute wird die Planwirtschaft nicht mehr durch Verstaatlichungen eingeführt, sondern dadurch, dass die Politik den Unternehmen immer stärker hineinredet und sie durch Steuerpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Regulierung, Subventionen, Ge- und Verbote ihrer Handlungsfreiheit beraubt. So wurde beispielsweise in Deutschland die Energiewirtschaft Stück für Stück in eine Planwirtschaft umgewandelt.
All dies ist nur möglich, weil viele Menschen einfach nicht wissen oder vergessen haben, dass die Marktwirtschaft die Basis unseres Wohlstandes ist. Viele junge Menschen kennen sozialistische Systeme, wie sie bis Ende der 80er-Jahre in der Sowjetunion und in den Ostblockstaaten herrschten, nur noch aus den Geschichtsbüchern – wenn überhaupt. Kapitalismus oder freie Marktwirtschaft sind zu Negativbegriffen geworden.
In einer bereits im April 2011 veröffentlichten Umfrage hatte das Meinungsforschungsinstitut GlobeScan8 in verschiedenen Ländern gefragt, ob die Menschen folgender Aussage zustimmen: »Die freie Marktwirtschaft ist das beste System für die Zukunft der Welt.« In Großbritannien stimmten nur 19 Prozent der Befragten voll und ganz zu, obwohl gerade einmal drei Jahrzehnte zuvor Margaret Thatcher durch konsequent marktwirtschaftliche Reformen das Land aus einer dramatischen wirtschaftlichen Lage zu mehr Wachstum und Wohlstand geführt hatte. Die höchste Zustimmung in Europa gab es in Deutschland, aber auch hier stimmten uneingeschränkt nur 30 Prozent der Befragten zu. In Frankreich, einem Land, dessen Probleme viel damit zu tun haben, dass die meisten Menschen wenig von Marktwirtschaft halten, äußerten nur 6 Prozent volle Zustimmung.
Die Prozentsätze fielen beruhigenderweise deutlich höher aus, wenn man jene Befragten hinzuzählt, die dieser Aussage »somewhat« (etwas) beipflichteten: Dann waren es 68 Prozent in Deutschland, 55 Prozent in Großbritannien und 52 Prozent in Spanien. In Frankreich war dagegen die Ablehnung enorm: 57 Prozent lehnten die Marktwirtschaft ab. In den Vereinigten Staaten war die Zustimmung zum Markt, die 2002 noch bei 80 Prozent gelegen hatte, inzwischen auf 59 Prozent gefallen, bei einkommensschwachen Gruppen betrug sie sogar nur noch 45 Prozent. Diese Daten führte 2013 der Ökonom Samuel Gregg in seinem Buch »Becoming Europe« an, in dem er die Amerikaner warnte, den Weg der europäischen Wohlfahrtsstaaten zu gehen.
Insbesondere junge Amerikaner haben eine starke Affinität zu antikapitalistischen Ideen. Eine im Jahr 2016 von dem Institut YouGov durchgeführte Umfrage ergab, dass 45 Prozent der Amerikaner zwischen 16 und 20 für einen Sozialisten stimmen würden und 20 Prozent sogar für einen Kommunisten. Nur 42 Prozent der jungen Amerikaner sprachen sich für eine kapitalistische Wirtschaftsordnung aus (verglichen mit 64 Prozent der Amerikaner über 65 Jahren). Erschreckend ist übrigens, dass bei der gleichen Umfrage ein Drittel der jungen Amerikaner meinte, unter George W. Bush seien mehr Menschen getötet worden als unter Josef W. Stalin.9 Bei einer Umfrage des Gallup-Institutes im April 2016 erklärten 52 Prozent der Amerikaner, »dass unsere Regierung den Wohlstand durch hohe Steuern für Reiche umverteilen sollte«.10
Bei einer Erhebung von Infratest dimap in Deutschland im Jahr 2014 stimmten 61 Prozent der Befragten der Ansicht zu: »Unsere Demokratie ist keine echte Demokratie, da die Wirtschaft und nicht die Wähler das Sagen haben.«11 Immerhin 33 Prozent der Deutschen (in Ostdeutschland 41 Prozent) meinten, der Kapitalismus führe »zwangsläufig zu Armut und Hunger«12, und 42 Prozent (in Ostdeutschland 59 Prozent) stimmten der Aussage zu, der »Sozialismus/Kommunismus ist eine gute Idee, die bisher nur schlecht ausgeführt wurde«.13
Es scheint so, dass mit dem Abstand zum Zusammenbruch der sozialistischen Systeme in der westlichen Welt manches in Vergessenheit gerät und das Bewusstsein für die Überlegenheit der marktwirtschaftlichen Ordnung verloren zu gehen droht – insbesondere bei der jungen Generation, die im Geschichtsunterricht meist nur am Rande über die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse in sozialistischen Ländern informiert wurde.
In diesem Buch geht es nur um ein Thema: Welches System bringt einer Mehrheit von Menschen die größte Lebensqualität? Sie wird insbesondere, aber nicht nur vom Maß des wirtschaftlichen Wohlstandes bestimmt, sondern auch vom Maß politischer Freiheit. Demokratie und Kapitalismus sind in der Geschichte häufig zusammen aufgetreten, doch es gibt auch politisch unfreie Länder mit kapitalistischer Ordnung: Südkorea war keine Demokratie, als sich der Kapitalismus dort durchsetzte, sondern ist erst später eine geworden. Gleiches gilt für Chile. Und China ist bis heute ein politisch unfreies Land, obwohl es sehr erfolgreich den kapitalistischen Weg geht. Wenn in diesem Buch Länder miteinander verglichen werden, dann nur unter dem Aspekt der Wirtschaftsordnung und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Nicht weil die politische Freiheit weniger wichtig wäre, sondern weil dies einfach eine andere Fragestellung für ein anderes Buch wäre.
Dieses Buch hat bei allen Gegensätzen eine Gemeinsamkeit mit Thomas Pikettys »Das Kapital im 21. Jahrhundert«: Piketty kritisiert an der heutigen Wirtschaftswissenschaft, sie habe eine »kindliche Vorliebe für die Mathematik und für rein theoretische und oftmals sehr ideologische Spekulationen […], was zulasten der historischen Forschung und der Kooperation mit anderen Sozialwissenschaften geht«.14 Er plädiert, man solle »pragmatisch vorgehen und Methoden und Ansätze anwenden, mit denen auch die Historiker, Soziologen und Politikwissenschaftler arbeiten«. Sein Buch sei daher »sowohl ein historisches als auch ein ökonomisches Buch«.15 Ich selbst habe Geschichte und Politikwissenschaft studiert und in Geschichte und Soziologie promoviert. Daher ist es nicht verwunderlich, dass ich in diesem Buch historisch argumentiere.
Piketty bedauert vor allem, dass heute – so meint er jedenfalls – »Verteilungsfragen« nicht mehr im Mittelpunkt der Ökonomie und der Sozialwissenschaften stünden. Es sei »höchste Zeit, die Frage der Ungleichheit wieder in den Fokus der Wirtschaftsanalyse zu stellen« und »die Verteilungsfrage wieder in den Mittelpunkt der Analyse zu rücken«.16 Einerseits argumentiert er, die Schere zwischen Reich und Arm sei zu Beginn des 21. Jahrhunderts weiter auseinandergegangen, andererseits räumt er ein, es sei »nicht ausgemacht, dass die Vermögensungleichheiten insgesamt auf globaler Ebene wirklich zunehmen«.17 Die Datenbasis seines Buches und haarsträubende methodische Fehler seiner Vorgehensweise wurden an anderer Stelle ausführlich kritisiert.18 Inzwischen hat er selbst unter dem Eindruck der vernichtenden Kritik zentrale Thesen zurücknehmen müssen.19 Ich möchte hier nur darauf hinweisen, dass meine Fragestellung eine völlig andere und aus meiner Sicht für die Mehrheit der Menschen ungleich wichtigere ist als die von Piketty: Es ist gar nicht entscheidend, ob die »Vermögensungleichheit« zunimmt oder nicht, sondern ob der Lebensstandard der Menschen insgesamt durch die Entwicklung des Kapitalismus eher angehoben wird oder nicht.
Piketty beklagt, in den Jahren 1990 bis 2010 sei die Schere zwischen Arm und Reich mit Blick auf Einkommen und Vermögen auseinandergegangen. Tatsache ist jedoch, dass gerade in diesen Jahrzehnten Hunderte Millionen Menschen weltweit – dank der Ausbreitung des Kapitalismus – der bitteren Armut entronnen sind, besonders in China, aber auch in Indien und anderen Teilen der Welt.
Ist es für diese Hunderte Millionen Menschen entscheidend, dass sie nicht mehr hungern und der Armut entronnen sind oder dass sich – möglicherweise – im gleichen Zeitraum das Vermögen von Multimillionären und Milliardären noch stärker vermehrt hat als ihr Lebensstandard? Im ersten Kapitel dieses Buches werde ich zeigen: Dass in den vergangenen Jahrzehnten in China die Zahl der Millionäre und Milliardäre stark gestiegen ist und sich für Hunderte Millionen der Lebensstandard so sehr verbessert hat, sind nur zwei Seiten einer Medaille und die Folgen des gleichen Prozesses, nämlich der Entwicklung vom Sozialismus zum Kapitalismus, von der Plan- zur Marktwirtschaft.
Daran, dass die Armut weltweit durch die kapitalistische Globalisierung zurückgegangen ist, kann es keinen Zweifel geben. Kontrovers diskutiert wird, ob der steigende Wohlstand in ehemals unterentwickelten Ländern zugleich in den westlichen Industrienationen, also namentlich in Europa und den USA, bei den unteren Einkommensgruppen zu Wohlstandseinbußen geführt habe. Zunächst: Wenn dies so wäre, weil die Niedriglohnbezieher in entwickelten Ländern heute im direkten Wettbewerb mit den Arbeitern in aufstrebenden Ländern stehen, dann wären die antikapitalistischen Globalisierungskritiker im Westen vor allem Verteidiger einer privilegierten Situation der Menschen in Europa und den USA – obwohl sie sich doch eigentlich vor allem als Anwälte der Armen in den Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas verstehen. Die These von den »Globalisierungsverlierern« in Europa und den USA ist jedoch darüber hinaus umstritten, denn laut einer OECD-Untersuchung (OECD, Organization for Economic Cooperation and Development) aus dem Jahr 2011 gab es nur zwei OECD-Länder, in denen die ärmsten 10 Prozent der Bevölkerung geringere Realeinkommen zu verzeichnen hatten als Mitte der 80er-Jahre, nämlich Japan und Israel.20
Wenn man in den Medien immer wieder lesen kann, die Zahl der Armen in den entwickelten westlichen Industrieländern sei gestiegen, dann liegt das oft einfach daran, dass Armut in den zugrunde liegenden Studien relativ gemessen wird. Arm ist beispielsweise im offiziellen Armuts- und Reichtumsbericht der deutschen Bundesregierung, wer weniger als 60 Prozent des sogenannten Medianeinkommens verdient. Wie fragwürdig diese Definition ist, sieht man an einem Gedankenexperiment: Angenommen, bei gleichem Geldwert stiegen alle Einkommen um das Zehnfache. Untere Einkommensbezieher, die beispielsweise bisher 1.000 Euro im Monat hatten, bekämen nunmehr 10.000 Euro. Keiner müsste sich mehr sorgen. Das Leben wäre schön. Jedoch – nach der herrschenden Armutsdefinition gemäß der 60-Prozent-Formel – hätte sich nichts geändert. Immer noch gäbe es genauso viele »Arme« wie zuvor, obwohl deren Einkommen jetzt zehn Mal höher ist als zuvor.
Für Kapitalismuskritiker wie Piketty ist die Wirtschaft ein Nullsummenspiel, bei dem die einen (die Reichen) gewinnen, was die anderen (die Mittelschicht und die Armen) verlieren.21 Doch so funktioniert die Marktwirtschaft nicht. Kapitalismuskritiker beschäftigen sich immer mit der Frage, wie der Kuchen verteilt wird; ich beschäftige mich in diesem Buch damit, unter welchen Bedingungen der Kuchen größer oder kleiner wird.
Bitte entscheiden Sie am Beispiel eines weiteren Gedankenexperimentes, was Sie bevorzugen würden: Nehmen wir an, Sie lebten auf einer Insel, in der drei reiche Menschen je 5.000 Euro besitzen und 1.000 andere nur je 100 Euro. Das Gesamtvermögen der Inselbewohner beträgt also 115.000 Euro. Sie stünden vor folgenden Alternativen: Das Vermögen aller Inselbewohner wird durch Wirtschaftswachstum doppelt so groß und wächst auf 230.000 Euro. Bei den drei Reichen verdreifacht es sich jeweils auf 15.000 Euro, diese besitzen zusammen nunmehr 45.000 Euro. Bei den 1.000 anderen wächst es zwar auch, aber nur um 85 Prozent – jeder hat jetzt 185 Euro. Die Ungleichheit hat sich also deutlich erhöht.
Im zweiten Fall nehmen wir die 115.000 Euro und verteilen sie auf alle 1.003 Inselbewohner gleichmäßig, sodass jeder 114,65 Euro besitzt. Würden Sie es als Armer mit einem Ausgangsvermögen von 100 Euro vorziehen, in der Wachstums- oder in der Gleichheitsgesellschaft zu leben? Und was wäre, wenn durch eine Wirtschaftsreform, die zur Gleichheit führen soll, das Gesamtvermögen auf nur noch 80.000 Euro schrumpft, von denen dann jeder nur noch knapp 79,80 Euro erhält?
Natürlich kann man einwenden, das Beste sei, wenn sowohl die Wirtschaft und der allgemeine Lebensstandard wüchsen und gleichzeitig auch die Gleichheit zunähme. Tatsächlich hat der Kapitalismus genau dies sogar nach den Berechnungen von Piketty im 20. Jahrhundert geleistet. Dennoch ist das Gedankenexperiment sinnvoll, weil in der Antwort die unterschiedlichen Wertpräferenzen deutlich werden: Wem die Erhöhung der Gleichheit der Menschen untereinander bzw. der Abbau von Ungleichheit wichtiger ist als die Erhöhung des Lebensstandards für eine Mehrheit, wird sie anders beantworten als derjenige, der die Prioritäten umgekehrt setzt. Noam Chomsky, einer der führenden amerikanischen Linksintellektuellen, vertritt einen solchen Standpunkt, wenn er in seinem 2017 erschienenen Buch »Requiem für den amerikanischen Traum« schreibt, »dass es um die Gesundheit einer Gesellschaft umso schlechter bestellt ist, je mehr sie von Ungleichheit geprägt ist, egal, ob diese Gesellschaft arm oder reich ist«. Ungleichheit an sich sei bereits zerstörerisch.22
Wenn Sie sich vor allem für die Gleichheit interessieren, dann haben Sie das falsche Buch gekauft. Wenn Sie sich dafür interessieren, unter welchen Bedingungen es der Mehrheit der Menschen besser geht, wenn Sie also nicht die Meinung teilen, es sei »egal, ob die Gesellschaft arm oder reich ist«, dann begleiten Sie mich auf meiner Zeitreise durch fünf Kontinente, um Antworten zu finden. Karl Marx hatte recht, dass die Produktivkräfte (also Technik, Maschinen, Organisation des Produktionsprozesses usw.) und die Produktionsverhältnisse (also das Wirtschaftssystem) zusammenhängen und sich wechselseitig bedingen.23 Aber es ist nicht so, dass sich die Produktivkräfte zuerst entwickeln und sich danach die Produktionsverhältnisse ändern. Vielmehr ist die Änderung der Produktionsverhältnisse die entscheidende Ursache für die Entwicklung der Produktivkräfte.
Der Kapitalismus ist der Grund für ein ungeheures Wachstum des Lebensstandards, wie es ihn vor der Entwicklung der Marktwirtschaft in der ganzen Menschheitsgeschichte nicht gegeben hat. Seit den Ursprüngen der Menschheit vor etwa 2,5 Millionen Jahren benötigte es 99,4 Prozent der Menschheitsgeschichte, bis vor etwa 15.000 Jahren ein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der Weltbevölkerung von 90 internationalen Dollar erreicht wurde (der internationale Dollar ist eine Recheneinheit, die auf der internationalen Kaufkraft des Jahrs 1990 basiert). Bis zum Jahr 1750 brauchte es weitere 0,59 Prozent der Menschheitsgeschichte, um das Welt-BIP pro Kopf auf 180 internationale Dollar zu verdoppeln. Und dann, in weniger als 0,01 Prozent der Menschheitsgeschichte, von 1750 bis zum Jahr 2000, wuchs das Welt-BIP pro Kopf um das 37-Fache auf 6.600 internationale Dollar. In anderen Worten: 97 Prozent des Reichtums der Menschheit wurden in den vergangenen 250 Jahren, also in 0,01 Prozent der Menschheitsgeschichte, erzeugt.24 Die Lebenserwartung eines Menschen hat sich in diesem kurzen Zeitraum fast verdreifacht (1820 lag sie noch bei 26 Jahren). Die Menschen sind nicht plötzlich so viel intelligenter oder fleißiger geworden in dieser Zeit, sondern in den westlichen Ländern hat sich vor etwa 200 Jahren ein Wirtschaftssystem entwickelt, das allen anderen in der Menschheitsgeschichte überlegen ist – der Kapitalismus. Dieses auf Privateigentum, Unternehmertum, freier Preisbildung und Wettbewerb beruhende System, das die ungeheure wirtschaftliche und technische Entwicklung erst ermöglicht hat, ist in der Menschheitsgeschichte also noch sehr jung. Es ist erfolgreich, aber es ist auch verletzlich.
KAPITEL 1
CHINA: VON DER HUNGERSNOT ZUM WIRTSCHAFTSWUNDER
China galt seit Jahrtausenden als Land der Hungersnöte. Heute hungert niemand mehr in China, das 2016 vor den USA und Deutschland die größte Exportnation der Welt war.
Noch in der zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verhungerten 100 Millionen Chinesen. Naturkatastrophen waren eine Ursache, aber hinzu kamen in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts politische Gründe. Mao Zedong, der 1949 an die Macht gekommen war, wollte China zum sozialistischen Musterland machen. Um den Weg zum vermeintlichen Arbeiter- und Bauernparadies abzukürzen, verkündete er Ende 1957 den »Großen Sprung nach vorne«. China sollte laut Mao in 15 Jahren Großbritannien wirtschaftlich überholen, um damit die Überlegenheit des Sozialismus über den Kapitalismus zu beweisen. In der Parteizeitung wurde erklärt, Chinas Ziel bei dem »Großen Sprung« sei, »alle kapitalistischen Länder in recht kurzer Zeit zu überholen und zu einem der reichsten, fortschrittlichsten und mächtigsten Länder der Erde zu werden«.25
Der große Hunger
Das größte sozialistische Experiment der Geschichte begann damit, dass im ganzen Land Dutzende Millionen Bauern gezwungen wurden, ohne ausreichende Nahrung und Ruhepausen in gewaltigen Bewässerungsprojekten zu arbeiten. Bald schon war jeder sechste Chinese damit beschäftigt, Erde zu schaufeln, um gigantische Staudämme oder Kanäle zu errichten.26 Die Bauern standen für die Landwirtschaft nicht mehr zur Verfügung, was einer von mehreren Gründen war, dass sich Hungersnöte überall in China ausbreiteten. Die Parteifunktionäre gingen rücksichtslos vor, um alles aus den Menschen herauszuholen: Dorfbewohner wurden gefesselt, weil sie Gemüse gestohlen hatten, andere wurden niedergestochen, weil sie nicht hart genug arbeiteten. Widerspenstige Bauern wurden in Arbeitslager gesteckt. Militärpatrouillen durchkämmten mit Lederpeitschen bewaffnet die Dörfer, um den maximalen Arbeitseinsatz zu erzwingen.27
China war damals ein Bauernland, das überwiegend von der Landwirtschaft lebte. Die Bauern wurden in 24.000 Kollektive, sogenannte Volkskommunen, gepresst. Jede Form des Privatbesitzes wurde abgeschafft, die Bauern mussten ihre Höfe verlassen und wurden mit bis zu 20.000 Leidensgenossen in fabrikähnliche Baracken gepresst; im Durchschnitt waren es 8.000.
Für die erste Volkskommune, die in Henan gegründet wurde, hatte Mao persönlich die Charta redigiert, die er als »großen Schatz« anpries: Alle 9.369 Haushalte, die ihr angehörten, mussten »ihre Privatgrundstücke vollständig übergeben, […] ebenso ihre Häuser, Tiere und Bäume«. Sie mussten in großen Schlafräumen leben, »in Übereinstimmung mit den Prinzipien, dass dies für die Produktion und die Kontrolle nützlich ist«. Die Charta erklärte ausdrücklich, die Privathäuser sollten »abgerissen« werden, »wenn die Kommune Ziegelsteine, Dachziegel oder Bauholz braucht«.28
Mao liebäugelte sogar mit dem Gedanken, den Menschen ihre Namen zu nehmen und diese durch Nummern zu ersetzen. In Henan und anderen Mustergebieten trugen die Bauern bei der Feldarbeit Jacken, in deren Rückenpartien Nummern eingenäht waren. Den Bauern war es nicht nur untersagt, zu Hause zu essen, auch ihre Woks und ihre Kochherde wurden zerstört.29 Die Menschen nahmen ihr Essen nunmehr gemeinsam im Kollektiv in gigantischen Volksküchen zu sich. Morgens marschierten sie in Arbeitsbrigaden unter roten Fahnen und angestachelt von Lautsprecherparolen, die zur Übererfüllung des Planes aufriefen, in die »Produktionsschlacht« auf die Felder.
Das Experiment endete in der wohl größten Hungersnot der Menschheitsgeschichte – auf jeden Fall war es die größte von Menschen selbst verursachte. Der chinesische Demograf Cao Shuji schätzte auf Basis der offiziellen Bevölkerungsstatistiken für die Jahre 1958 bis 1962 die Zahl der Hungertoten in ganz China auf etwa 32,5 Millionen. Nach seinen Berechnungen war die Provinz Anhui am schlimmsten betroffen, wo über 18 Prozent der Bevölkerung verhungerten, das entspricht über sechs Millionen Menschen. Danach folgte Sichuan mit 13 Prozent Hungertoten, was 9,4 Millionen Menschen entspricht.30
Der Historiker Frank Dikötter kommt auf Basis einer Auswertung von Analysen des chinesischen Sicherheitsdienstes sowie der umfangreichen Geheimberichte, die in den letzten Monaten des »Großen Sprungs« von Parteikomitees verfasst wurden, zu deutlich höheren Zahlen für ganz China: Mindestens 45 Millionen starben in den Jahren 1958 bis 1962 einen unnötigen Tod, so seine Bilanz. Die meisten verhungerten, während etwa 2,5 Millionen starben, weil sie zu Tode gefoltert oder erschlagen wurden – oder weil man ihnen gezielt jegliche Nahrung verweigerte, damit sie verhungerten. »Menschen wurden zur Tötung ausgewählt, weil sie wohlhabend waren, weil sie trödelten, weil sie ihre Meinung sagten oder weil die Person, die in der Volksküche das Essen ausgab, aus irgendeinem Grund eine Abneigung gegen sie hatte.«31
Wer Kritik übte, wurde bestraft. Und davon war nicht nur eine kleine Minderheit betroffen, wie etwa ein Bericht über Fengyang zeigt. Dort wurden 28.026 Menschen (über 12 Prozent der Bevölkerung) mit körperlichen Züchtigungen oder der Kürzung der Essensrationen bestraft. 441 Menschen starben an den Folgen, 383 wurden schwer verletzt.32
Der chinesische Journalist Yang Jisheng berichtete: »Der Hunger war gegen Ende schrecklicher als der Tod selbst. Die Maiskolben waren gefressen, das wilde Gemüse war gefressen, die Baumrinde war gefressen, Vogelmist, Mäuse und Ratten, Baumwolle, alles hatte man sich in den Bauch gestopft. Wo man Guanyin-Erde, eine Art fetten Lehm, fand, schob man sich bereits beim Graben dicke Klumpen in den Mund.«33 Es kam immer wieder zu Kannibalismus. Zuerst wurden die Kadaver toter Tiere gegessen, doch später begannen die Dorfbewohner in ihrer Verzweiflung, Tote auszugraben, zu kochen und zu essen. Menschenfleisch wurde sogar, wie anderes Fleisch, auf dem Schwarzmarkt gehandelt.34 Eine nach Maos Tod entstandene (und prompt verbotene) Studie über den Bezirk Fengyang in der Provinz Anhui verzeichnete allein für den Frühling 1960 63 Fälle von Kannibalismus, darunter ein Ehepaar, das seinen achtjährigen Sohn erwürgte und aufaß.35
All das wollte die kommunistische Führung zunächst nicht wahrhaben. Sie wurde Opfer ihres eigenen Angstregimes. Die Kommunen meldeten sensationelle Ernteergebnisse, die das sozialistische Wunder belegen sollten. Wer realistische Zahlen meldete, bekam statt der roten eine weiße Fahne, wurde der Lüge beschuldigt und Opfer von Gewalt. In der Tat hatten sich die Bauern in den Jahren zuvor teilweise mit falschen Angaben gegen die Erhöhung der Getreideabgaben gewehrt. Aber bald schon galt jeder, der erklärte, er habe Hunger, als Feind der sozialistischen Revolution und Anhänger des Kapitalismus. Die Aussage »Ich habe Hunger« wurde immer mehr zu einem Tabu.36
Die Flucht an einen Ort, in dem es etwas zu essen gab, war verboten. Ein Bauer beschrieb die Situation als schlimmer als die Zustände während der japanischen Besatzungszeit: »Als die Japaner kamen, konnten wir immer noch weglaufen. Heute […] werden wir einfach in unsere Häuser gesperrt, um dort zu sterben. Meine Familie bestand aus sechs Personen und vier von ihnen sind gestorben.« Die Parteifunktionäre verhinderten auch, dass die Bauern ihre eigene Ernte »stahlen«. Manche Menschen wurden lebendig begraben, andere erdrosselt, wieder anderen schnitt man die Nase ab. In einem Dorf entgingen vier Kinder, die ein paar Nahrungsmittel an sich genommen hatten und zur Strafe schon bis zu den Hüften eingegraben waren, nur aufgrund der verzweifelten Bitten ihrer Eltern dem Tod. In einem anderen Dorf wurden einem Kind vier Finger abgehackt, weil es versucht hatte, aus einem Feld einen Bissen zu stehlen, der nicht einmal reif war. »An Brutalitäten dieser Art stößt man praktisch in jedem Bericht aus dieser Zeit, und das im ganzen Land.«37
Nach außen verkündete die Propaganda ständig neue Rekordzahlen auf allen Gebieten, die den Fortschritt und die Überlegenheit des Sozialismus beweisen sollten. Insbesondere an den Zahlen der Stahlproduktion sollte der Fortschritt des Sozialismus gemessen werden. Mao war geradezu besessen vom Stahl und hatte die Stahlproduktion fast aller Länder im Kopf. 1957 lag die Stahlproduktion bei 5,35 Millionen Tonnen, im Januar 1958 wurde das Ziel von 6,2 Millionen Tonnen ausgegeben und im September wurde es auf zwölf Millionen verdoppelt.38
Diese gigantischen Ziele sollten vor allem mit kleinen Hochöfen erreicht werden, die in den Hinterhöfen der Volkskommunen von den Dorfbewohnern betrieben wurden. Viele dieser Öfen funktionierten nicht richtig und es kam minderwertiges Material heraus. Überall türmten sich von ländlichen Kommunen erzeugte Eisenbarren, die so klein und spröde waren, dass sie für moderne Walzwerke unbrauchbar waren.39
Es spielten sich absurde Szenen überall in China ab: Parteiaktivisten zogen von Haus zu Haus, beschlagnahmten Haushaltsgeräte und für den Ackerbau benötigte Geräte, die eingeschmolzen wurden, um die ambitionierten Planziele der Stahlproduktion erreichen zu können. Kochgeräte, eiserne Türgriffe aus Metall und sogar die Haarspangen der Frauen wurden eingeschmolzen. Die Parole des Regimes lautete: »Wer eine Spitzhacke abgibt, löscht einen Imperialisten aus, und wer einen Nagel versteckt, der versteckt einen Konterrevolutionär.«40
Wer nicht genug Begeisterung zeigte, wurde beschimpft, gefesselt oder öffentlich zur Schau gestellt.41 Experten, die zur Vernunft rieten, wurden verfolgt. Mao schlug einen Ton an, durch den rationales Argumentieren diskreditiert wurde. Er sprach vom Wissen »bourgeoiser Professoren, das wie der Furz eines Hundes behandelt werden sollte, es ist nichts wert und verdient nur Geringschätzung, Hohn und Verachtung«.42
Ende Dezember 1958 musste Mao selbst in einem Gespräch mit einem Spitzenfunktionär einräumen, dass 40 Prozent des Stahls unbrauchbar waren. Der brauchbare Stahl war von herkömmlichen Stahlwerken produziert worden, die wertlosen 40 Prozent stammten aus den Kleinöfen. »Die gesamte Kraftanstrengung war eine gigantische Verschwendung von Ressourcen und Arbeitszeit und sie brachte weitere Verluste mit sich.«43
Immer mehr Bauern fehlten in der Landwirtschaft, weil sie in den gigantischen Bewässerungsprojekten arbeiteten oder mit der Stahlproduktion beschäftigt waren. Trotzdem wurden gerade in der Landwirtschaft immer neue Rekordzahlen gemeldet, die mit der Realität nichts zu tun hatten. Im September 1958 prahlte die chinesische »Volkszeitung«, die Parteizeitung der Kommunisten, in Guangxi sei die Getreideernte auf 65.000 Kilogramm pro mu (15 mu sind ein Hektar) gestiegen, während 500 Kilogramm eine realistische Zahl gewesen wäre.44
Die imposanten Ernteergebnisse wurden als »Sputniks« bezeichnet. Sogenannte »Sputnik-Felder« breiteten sich in ganz China mit atemberaubender Geschwindigkeit aus. Sie entstanden meist durch die Verpflanzung erntereifer Feldfrüchte, die auf verschiedenen Feldern wuchsen, auf eine einzige künstliche Parzelle. Angesichts solcher vermeintlichen Produktionsrekorde steigerten die Kommunisten den Getreideexport in den Jahren des »Großen Sprungs nach vorne« von 1,93 Millionen Tonnen im Jahr 1957 auf über vier Millionen Tonnen im Jahr 1959. Während Mao der Welt stolz verkündete, die Getreideproduktion habe 375 Millionen Tonnen erreicht, betrug sie tatsächlich mit 170 Millionen Tonnen nicht einmal die Hälfte.45
Da unter dem Druck der Partei, die auf der Umsetzung der Planvorgaben um jeden Preis bestand, übertrieben hohe Ernteerträge angegeben wurden, requirierte der Staat von den Bauern viel zu große Mengen Getreide, was zur Getreideknappheit und schließlich zur Hungersnot führen musste.46 Hinzu kam, dass große Teile der Getreideernte wegen des durch die Planwirtschaft angerichteten logistischen Chaos durch Kornfäule, Ratten und Insekten vernichtet wurden.47
Auch dieses Problem sollte durch eine große Kampagne beseitigt werden. Eines Tages kam Mao auf die Idee, alle Spatzen loszuwerden, weil sie Getreidekörner aufpickten. Er erklärte die Spatzen zu einer der »Vier Plagen«, die neben Ratten, Stechmücken und Fliegen zu beseitigen seien. Die gesamte Bevölkerung wurde mobilisiert, um mit Stöcken und Besen herumzufuchteln und einen gewaltigen Lärm zu veranstalten, damit die Spatzen es nicht mehr wagten, sich irgendwo niederzulassen, sondern schließlich erschöpft vom Himmel fallen würden und beseitigt werden könnten. Tatsächlich wurden so viele Spatzen (und andere Vögel) getötet, dass es nun zu wenig Spatzen gab, die Insekten fraßen. Wissenschaftler hatten schon davor gewarnt. Unter dem Vermerk »Streng geheim« bat die chinesische Regierung schließlich die befreundete Sowjetunion, man solle im Namen des sozialistischen Internationalismus 200.000 Spatzen aus den fernöstlichen Gebieten der Sowjetunion nach China schicken.48
Andererseits wollten sich die Chinesen keine Blöße geben und das verbündete Russland nicht darum bitten, die Exporte von Getreide aussetzen zu dürfen und die Schulden später zu begleichen, obwohl sich der Hunger immer mehr ausbreitete. Auch Hilfsangebote aus dem Westen lehnte die chinesische Regierung aus Stolz ab.49 Im Gegenteil: Um das Gesicht zu wahren, wurden in der Zeit der größten Hungersnot großzügig Weizenladungen an befreundete Länder wie etwa Albanien geliefert, teilweise wurde das Getreide an andere Länder verschenkt. Die Parole »Vorrang für den Export« hatte zur Folge, dass alle Provinzen auf dem Höhepunkt der Hungersnot mehr Nahrungsmittel als je zuvor liefern mussten.50 In der Propaganda nach innen und nach außen sollte der Schein gewahrt werden: Im Sozialismus dürfte es einfach keine Hungersnot geben. Berechnungen, die später angestellt wurden, belegen, dass durch eine andere Politik bis zu 26 Millionen Menschenleben hätten gerettet werden können.51
Die verzweifelten Menschen wandten sich in Briefen an Mao und den Staatschef Zhou Enlai, weil sie dachten, der große Führer des Sozialismus wüsste nichts von der Hungersnot. In einem Brief hieß es: »Lieber Vorsitzender Mao, Zhou Enlai und Führer der Zentralregierung, viele Grüße zum Frühlingsfest! 1958 hat unser Vaterland einen allseitigen Großen Sprung errungen […], aber im Osten von Henan, in den Kreisen Yucheng und Xiayi, ist das Leben der Menschen in dem letzten halben Jahr nicht gut […] Die Kinder hungern, die Erwachsenen sind betrübt. Sie sind auf Haut und Knochen abgemagert. Die auslösende Ursache sind die falschen Meldungen von Produktionsergebnissen. Hört unbedingt auf unseren Hilferuf!«52
Als die Parteizentrale Untersuchungen vor Ort anstellte, bot sich den Parteivertretern ein Bild des Grauens. Im Bezirk Guangshan wurden sie vom leisen Gewimmer der verzweifelten Überlebenden begrüßt, die in bitterer Kälte in den Trümmern ihrer zerstörten Häuser hockten. Denn überall in China waren Häuser abgerissen worden, um das Material entweder als Brennstoff für die Hochöfen oder als Dünger zu verwenden. In Guangshan war ein Viertel der 500.000 Einwohner tot, überall waren Massengräber ausgehoben worden.53 Auch Abermillionen Tiere verhungerten, was die Nahrungsmittelknappheit noch verstärkte.
Mao und die anderen Parteiführer wussten von den Problemen, aber versuchten lange, sie zu verharmlosen oder ganz zu leugnen. Es hieß, angesichts der grandiosen Aussichten, bald eine kommunistische Gesellschaft zu errichten, ließen sich Opfer – wie in einem Krieg – nicht vermeiden. Drei Jahre Opfer seien nicht zu hoch als Preis für die kommenden 1.000 Jahre im kommunistischen Paradies. Noch im Juli 1959 verkündete Mao: »Im Allgemeinen ist die Situation ausgezeichnet. Es gibt viele Probleme, aber wir haben eine glänzende Zukunft!«54
Den Tod von Millionen Menschen hatte Mao bewusst einkalkuliert. Schon bei seinem Moskau-Besuch im Jahr 1957 hatte er erklärt: »Wir sind bereit, 300 Millionen Chinesen für den Sieg der Weltrevolution zu opfern.«55 Und im November 1958 hatte er im engsten Führungskreis im Zusammenhang mit arbeitsintensiven Projekten wie den Bewässerungskanälen und der Produktion von Stahl gesagt: »Wenn wir so vorgehen mit all diesen Projekten, kann es gut sein, dass die Hälfte Chinas sterben muss. Wenn nicht die Hälfte, dann stirbt vielleicht ein Drittel oder ein Zehntel – 50 Millionen Menschen.«56
Lin Biao, der wegen seiner vermeintlich unverbrüchlichen Treue zu Mao von ihm zum Stellvertreter ernannt worden war, verkündete im Vorwort zu den »Worten des Vorsitzenden Mao«, der sogenannten Mao-Bibel: »Bei der Schifffahrt verlässt man sich auf den Steuermann, bei der Revolution auf den Vorsitzenden Mao Zedung.« Aber im internen Kreis erklärte derselbe Lin Biao, der »Große Sprung« sei »ein Fantasiegebilde und ein furchtbares Chaos«.57 Schließlich musste Mao den »Großen Sprung nach vorne« abbrechen, allerdings nur, um wenige Jahre später – 1966 – die nächste Katastrophe heraufzubeschwören, die sogenannte Chinesische Kulturrevolution. Sie war noch radikaler als der »Große Sprung nach vorne«: Millionen Menschen, die beschuldigt wurden, kapitalistische Ideen zu vertreten, oder die die Politik des »Großen Sprungs nach vorne« kritisierten, wurden zur Zwangsarbeit verdammt oder gefoltert, Hunderttausende wurden im Verlauf der sogenannten Kulturrevolution ermordet.
Wieder einmal war ein sozialistisches Experiment gescheitert und hatte mehrere Dutzend Millionen Menschenleben gefordert. Dabei hätten es die chinesischen Kommunisten wissen müssen, denn bereits in den 30er-Jahren hatte in der Sowjetunion die Kollektivierung der Landwirtschaft ähnlich katastrophale Folgen gehabt. Auch dort waren mehrere Millionen Menschen an Hunger gestorben. Aber die Geschichte lehrt, dass jedes Mal, nachdem ein sozialistisches Experiment gescheitert ist, die Kommunisten in einem anderen Land und zu einer anderen Zeit glaubten, sie könnten es besser und hätten den Königsweg zum sozialistischen Paradies gefunden.
Die ökonomische Bilanz der Mao-Zeit war verheerend: Zwei Drittel der Bauern hatten 1978 ein niedrigeres Einkommen als in den 50er-Jahren, bei einem Drittel war es sogar niedriger als 1935, vor der japanischen Invasion. Nachdem Mao im Jahr 1976 gestorben war, kamen in China glücklicherweise pragmatischer denkende Politiker an die Macht, die spürten, dass die Menschen genug von radikalen sozialistischen Experimenten hatten. Maos Nachfolger wurde Hua Guofeng und dieser bereitete einem Mann den Weg, ohne den das heutige moderne China schwer denkbar wäre, Deng Xiaoping. Die Nachfolger Maos, besonders Deng, waren so klug, dass sie die Worte des chinesischen Philosophen Konfuzius beherzigten: »Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken, das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen, das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste.«
Chinas Weg zum Kapitalismus
Den bitteren Weg waren die Chinesen gegangen. In ihrer Not erkundeten sie nun in anderen Ländern, wie es dort aussah und was sie von ihnen lernen könnten. 1978 begann eine rege Reisetätigkeit führender chinesischer Politiker und Wirtschaftler. Sie unternahmen 20 Reisen in mehr als 50 Länder, um herauszufinden, was sie wirtschaftlich von ihnen lernen könnten. Unter anderem besuchten sie Japan, Thailand, Malaysia, Singapur, die USA, Kanada, Frankreich, Deutschland und die Schweiz.58 Bevor eine Delegation von 20 hochrangigen Politikern und Wirtschaftlern unter Leitung von Gu Mu im Mai 1978 die erste Reise nach Westeuropa seit Gründung der Volksrepublik China antrat, forderte Deng die Mitglieder der Reisegruppe auf, so viele Fragen wie möglich zu stellen, genau zu beobachten und herauszufinden, wie diese Länder ihre Wirtschaft managten.59
Die Mitglieder der Reisedelegation waren ungeheuer beeindruckt von dem, was sie in Westeuropa sahen: moderne Flughäfen wie Charles de Gaulle in Paris, Autofabriken in Deutschland und Häfen, in denen Schiffe automatisiert mit Containern beladen wurden. Überrascht waren sie, wie hoch der Lebensstandard selbst eines normalen Arbeiters in den kapitalistischen Ländern war.60
Deng selbst besuchte Länder wie die USA und Japan. Fasziniert war er von den Nissan-Werken in Japan und nach der Besichtigung erklärte er: »Jetzt verstehe ich, was Modernisierung bedeutet.«61 Vor allem imponierten den Chinesen die wirtschaftlichen Erfolge in ihrer unmittelbaren Umgebung. »Insbesondere die ökonomische Dynamik der Nachbarländer galt, wenngleich kaum eingestanden, als Vorbild. Die Nähe der um 1945 noch durch den Krieg zerstörten japanischen Wirtschaft, die ab den 1950ern sämtliche Wachstumsrekorde brach und neben wettbewerbsfähigen Exportindustrien eine moderne Konsumgesellschaft hervorbrachte, ließ die Errungenschaften unter Mao als begrenzt erscheinen.«62