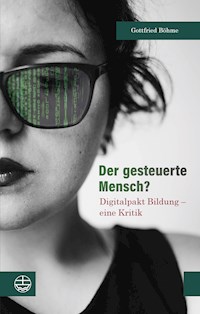
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Evangelische Verlagsanstalt
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Big Data greift nach der Schule, digitale Medien sollen den Schulalltag bestimmen. Doch die wenigsten erkennen: Es geht nicht um eine Ergänzung des Unterrichts, es geht um die Neudefinition dessen, was Schule heißt. Es geht um die Rolle, die in Zukunft Klassen, Lehrer und besonders Schüler in ihr spielen sollen. Schule soll durch eine "digitale Bildungsrevolution" umgekrempelt werden – und der Begriff "Revolution" ist ernst zu nehmen. Die Schule ist eine sehr empfindliche Stellschraube unserer Gesellschaft. Wer an ihr dreht, der bewegt sehr viel mehr als nur Schüler. Schulen sind keineswegs nur Lernorte. Bildung ist der Kitt, der eine Gesellschaft noch am ehesten zusammenhalten kann. Und das sollen in Zukunft Algorithmen gewährleisten? Die Sorge ist berechtigt, dass solcher Umbau kulturrevolutionäre Ausmaße annehmen könnte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gottfried Böhme
Der gesteuerte Mensch?
Digitalpakt Bildung – eine Kritik
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2020 by Evangelische Verlagsanstalt GmbH · Leipzig
Printed in Germany
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Das Buch wurde auf alterungsbeständigem Papier gedruckt.
Cover: makena plangrafik, Leipzig
Coverbild: © Aneta Pawlik / unsplash, Markus Spiske / unsplash
Satz und Gestaltung: Steffi Glauche, Leipzig
Druck und Binden: CPI books GmbH, Leck
ISBN 9783374063437
www.eva-leipzig.de
Vorwort
Keineswegs stand ich digitaler Technik ablehnend gegenüber, als sie in den 80er-Jahren allmählich für Privatpersonen erschwinglich wurde. In meinem Kollegium war ich der Vierte, der sich einen PC kaufte – und das als Geisteswissenschaftler. Ich genoss es, nicht mehr mit Tipp-Ex arbeiten zu müssen und Texte gestalten und speichern zu können, besaß also eine fantastische Schreibmaschine. Als sich etliche Jahre später das Internet durchsetzte und Recherchen ungemein erleichterte, war ich sehr angetan von der Arbeitsersparnis bei der Vorbereitung meines Unterrichts. Befördert hat dieses Interesse die Freundschaft mit einem Lehrer, dessen Lebenspartnerin mit Gleichgesinnten in Stuttgart eine Computerfirma gegründet hatte. Dieses Start-up entwickelte sogar ein Betriebssystem – dummerweise legten sich die Computerexperten darauf fest, dass beim Dateinamen das Programm vor dem Punkt steht, die persönliche Dateibezeichnung dahinter. Als sich MS-DOS endgültig durchgesetzt hatte, war zumindest der Traum vom ganz großen Geld ausgeträumt.
Erste Irritationen traten auf, als eine befreundete Musikerin von einer Tournee aus Japan zurückkehrte und belustigt erzählte, dass praktisch alle Passagiere des japanischen Hochgeschwindigkeitszugs Shinkansen, kaum hätten sie Platz genommen, in ihre Smartphones abtauchten. Damals schoben wir das noch auf eine nationale Eigentümlichkeit dieses technikaffinen Volkes. Wer zu dieser Zeit in Deutschland in der Öffentlichkeit mit einem Handy herumhantierte, wurde von Satirikern noch als »Handyman« verspottet.
Mit der Zeit mehrten sich Nachrichten, die darauf hindeuteten, dass sich gerade eine Umwälzung unserer gesamten Kultur und Gesellschaft vollzog, keineswegs nur der Textverarbeitung und des Telefonierens. Ich will hier nicht die ganze Kaskade beunruhigender Meldungen bis hin zum Facebook-Skandal auflisten – und belasse es bei den ganz wenigen, die zumindest mir signalisierten, dass es bei der neuen digitalen Technik um sehr viel mehr geht, als in Fabriken, Büros und Lehrerzimmern Arbeitserleichterungen anzubieten.
Ungläubig las ich irgendwann, dass sich der Google-Konzern, den ich bis dahin für den führenden Suchmaschinenspezialisten gehalten hatte, nun des Themas Mobilität durch selbstfahrende Autos angenommen hatte. Als ausgerechnet Mathias Döpfner, immerhin Vorstandsvorsitzender des Springer-Konzerns, 2014 in einem offenen Brief an seinen Kollegen Eric Schmidt, damals CEO von Google, resigniert einräumte, dass selbst ein Medienkonzern wie die Axel Springer AG von Google abhängig sei, läuteten bei mir die Alarmglocken. Der Google-Konzern plante vorübergehend, seine Unternehmenszentrale auf riesige Schiffe zu verlegen, die in internationalen Gewässern vor Anker gehen sollten, einzig deshalb, damit er nicht an nationale Gesetze gebunden ist. Was spielte sich da ab?
Das war die Zeit, in der sich auf deutschen Schulhöfen in den Pausen Trauben um die Jungen bildeten, die auf geeigneten elektronischen Endgeräten Computerspiele laufen ließen, statt selbst herumzulaufen. Und auf den Straßen begannen junge Frauen, immer öfter auf ihr Smartphone zu blicken statt in die Augen ihrer kleinen Kinder, die sie im Wagen vor sich her schoben.
Wir erleben gerade, wie sämtliche Bereiche unserer Wirklichkeit umgestaltet werden, und das in einem atemberaubenden Tempo. Es mehren sich die Stimmen der Zeitgenossen, die lapidar feststellen, dass dieser Prozess nicht aufzuhalten sei. Da jede dieser Techniken dem Nutzer in irgendeiner Weise Erleichterung verspricht, halten sie diese Entwicklung prinzipiell für gut. Aber das kann uns leider niemand garantieren.
Bisherige tiefgreifende Veränderungen der menschlichen Kultur haben sich noch nie so schnell und noch nie überall zugleich vollzogen. Als einige findige Vorfahren von uns auf die Idee kamen, Gras zu trocknen, also Heu zu machen, schufen sie die Grundlage für Viehhaltung auch in klimatisch raueren Breiten. Der Mensch wurde sesshaft, Städte entstanden, die Kultur erlebte einen ungeheuren Aufschwung. Aber es sollte noch Jahrtausende dauern, bis sich diese Existenzweise weltweit durchgesetzt hatte – und ganz vereinzelt trifft man sogar heute noch auf kleine Stämme, die allein von der Jagd leben. Unter den Migranten hingegen, die aus Zentralafrika übers Mittelmeer nach Europa gelangen wollen, findet man viele, die ihre Reise per Smartphone organisieren. Die Geräte sind bereits allgegenwärtig.
Und jetzt sollen sie bzw. digitale Technik auch in den Schulen zum Einsatz kommen. Das würde den Umbau unserer Kultur enorm forcieren. Sowohl die Risiken als auch die Chancen der Digitalisierung werden potenziert, wenn sich die Institution, die die Aufgabe hat, Menschen auf ihre Zukunft vorzubereiten, ganz in den Dienst des digitalen Wandels stellt. Wenn dieser etwas Positives ist, dann ist das gut. Wenn er aber ernsthafte Gefahren birgt, wenn man diese Gefahren nicht berücksichtigt, machen wir gerade einen riesigen Fehler. Dann wird die unseren Schulen verordnete Veränderung wie ein Brandbeschleuniger bei der Zerstörung unserer Kultur wirken.
Mancher Leser mag denken »so schlimm wird es schon nicht kommen«. Und er hat Recht – allerdings nur unter einer Voraussetzung: dass möglichst viele Menschen mit klaren Worten sagen, was ihnen an den Plänen nicht gefällt, die von Politik und Digitalwirtschaft zum Umbau unseres Schulsystems vorgelegt bzw. sogar bereits verabschiedet worden sind.
Es hat in der neueren Geschichte schon andere Beispiele dafür gegeben, dass der vermeintliche Fortschritt plötzlich eine hässliche Seite zeigt. So glaubte man vor 50 Jahren, mit der Kernkraft den Energiehunger der Welt stillen zu können. Noch im Jahr 1975 forderte eine Studie der Kernforschungsanlage Jülich die Errichtung von sage und schreibe 596 Reaktoren und 14 Wiederaufbereitungsanlagen allein in Westdeutschland. Heute zwingt uns der Ausstieg aus dieser Technologie, den die Bundesregierung nach der Katastrophe von Fukushima beschlossen hat, angesichts des Klimawandels zu einer wahrlich nicht billigen Energiewende.
Es kann nicht schaden, erst einmal in Ruhe nachzudenken, bevor mit dem Umbau der Schulen eine Entwicklung festgeklopft wird, von der niemand weiß, wohin sie führen wird. Während heute häufig darüber diskutiert wird, wie erfolgreich digitale Technik beim Lernen eingesetzt werden kann, wird über die tiefgreifenden Veränderungen, die diese Technik für das System Schule insgesamt hat, bisher weniger nachgedacht – es besteht also Nachholbedarf. Den versucht dieses Buch zu decken.
Zur Disposition stehen mit der Änderung der Rolle von Schüler, Lehrer und Klasse zentrale Elemente unserer Schulkultur: In vier philosophischen Abschnitten (Personalisierung – das Unwort des Jahrzehnts, Maria Montessoris »Selbst« – Geheimnis oder Illusion?, Identitätsbildung in Zeiten des Datenkapitalismus, Handeln – Freiheit – Kreativität) wird an grundlegende Begriffe unseres abendländischen Menschenbildes erinnert. In diesen Abschnitten verlässt der Gedankengang bisweilen den begrenzten Bereich der Schule und des Lernens. Erst eine solche Vergewisserung zentraler europäischer anthropologischer Bestimmungen macht deutlich, wie radikal die geplanten Eingriffe in die Schule und damit auch in die Gesellschaft uns selbst und unser Zusammenleben verändern würden. Zugespitzt wird dieses Thema im Abschnitt »Der heimliche Lehrplan: ein neues Menschenbild?«.
Dann geht es noch um die Schulcloud des Hasso-Plattner-Instituts (HPI), das gerade ein digitales Schulmodell mit dem Anspruch entwickelt, es zum führenden in unserem Land zu machen. Während sich Jörg Dräger von der Bertelsmann-Stiftung noch darum bemüht, uns zu erklären, warum digitale Schulmodelle den heute etablierten haushoch überlegen sein sollen, ist das HPI längst zur Praxis übergegangen und entwickelt die technischen Bausteine, derer man bedarf, um eine »digitale Bildungsrevolution« zu initiieren.
Wer die Schule verändert, der verändert auch die Gesellschaft. Das machen die digitalen Akteure allein dadurch, dass sie ihr den Berufsstand des Lehrers entziehen wollen – aber auch dadurch, dass sie den Erziehungsauftrag verkürzen. Wenn es hauptsächlich nur noch darum geht, als Individuum Medienkompetenz zu erlangen, droht die Erziehung zum mündigen Bürger verloren zu gehen. Die Schüler werden dann nicht mehr in den Diskurs darüber einbezogen, wie sich unsere Gesellschaft die Rolle der neuen Medien vorstellt – und das ist etwas, was im gemeinsamen Strategiepapier aller 16 Kultusminister vom Dezember 2016 (Bildung in der digitalen Welt) tatsächlich keine Rolle spielt.
In diesem Buch sollen aber auch die auf ihre Kosten kommen, die in Sorge um Gesundheit und Sicherheit ihrer Kinder sind, wenn digitale Technik demnächst einen noch größeren Raum im Leben ihrer Kinder einnehmen sollte – und das wäre der Fall, wenn in den Schulen Tablets oder Whiteboards häufig zum Einsatz kämen. Genauso sollen solche Leser wenigstens orientierende Hinweise bekommen, die wissen wollen, ob digitale Technik den Lernprozess ihrer Kinder effektiver gestalten kann oder nicht. Vor allem im Kapitel »Qualitätssicherung, Risiken, Nebenwirkungen« bemühe ich mich darum, einen knappen Einblick in derartige Forschungsergebnisse zu geben.
Ganz praktisch sind die Hinweise darauf, was bei der Berufswahl im digitalen Zeitalter von Nutzen sein könnte (Abschnitt »Was in den Rucksack gehört«), und die »Richtlinien für einen besseren Digitalpakt Bildung«. Mit ihnen in der Hand lässt sich in verschiedenen politischen oder schulischen Gremien eine Diskussion über die Art und Weise, wie Schulen bzw. der Unterricht digitalisiert werden sollte, leichter strukturieren. Insofern sind diese Richtlinien dann auch für Politiker, Lehrer und Schulleitungen von Interesse.
Leipzig, im Juni 2019
Gottfried Böhme
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Die Digitalisierungswelle erreicht die Pforten der Schulen
Eine Schule ohne Klassen, eine Schule ohne Lehrer
Der Schüler wird zum User
Hasso Plattners Schulcloud
Wer die Schule ändert, ändert die Gesellschaft
Der heimliche Lehrplan: ein neues Menschenbild?
Qualitätssicherung, Risiken, Nebenwirkungen
Quo vadis?
Literaturverzeichnis
Richtlinien für einen besseren Digitalpakt Bildung
Ein Lied zum Abschied
Anmerkungen
Zum Autor
Die Digitalisierungswelle erreicht die Pforten der Schulen
2007 – das ist gerade einmal zwölf Jahre her – brachte die Firma Apple das erste Smartphone auf den Markt. Heute besitzen Milliarden Menschen ein solches Gerät – die Schätzungen reichen von 3.24 Milliarden bis zu 66 Prozent der Weltbevölkerung.1Was das bedeutet, wird erst so richtig deutlich, wenn man es mit der Ausbreitung des Fernsehens vergleicht: Die BBC war der erste Sender, der ein Fernsehprogramm ausstrahlte. Das war 1931. Im Jahr 1961 gab es dann weltweit über 100 Millionen Fernsehempfänger2, das bedeutet, dass nach drei Jahrzehnten grob geschätzt gerade einmal drei bis vier Prozent von damals rund drei Milliarden Menschen auf der Welt ein solches Gerät besaßen.
Diese Zahlen verdeutlichen, dass wir es beim Smartphone mit der erfolgreichsten Vermarktung eines technischen Gerätes zu tun haben, die die Welt je gesehen hat. Das muss seinen Grund in der Bedürfnisstruktur des Menschen haben. Jeder zweite Erdenbürger scheint den Eindruck gewonnen zu haben: Es geht nicht ohne!
Eine ganze Generation ist inzwischen in einer von digitalen Techniken durchsetzten Alltagswelt herangewachsen – weshalb immer mehr der nach 1970 Geborenen sich als Digital Natives bezeichnen – also als so etwas wie die Ureinwohner unserer digitalen Welt. Sie organisieren ihr Leben mittels digitaler Geräte, fühlen sich schnell in ihren Sozialkontakten eingeschränkt, wenn diese Technik einmal nicht zur Verfügung steht, und zeichnen sich häufig durch geringe kritische Distanz zu ihr aus. Solange sie nur für sich agieren, stehen sie daher selten für Aktionen zur Verfügung, die etwa den Gebrauch digitaler Netzwerke einer wie auch immer gearteten Kontrolle unterwerfen wollen, sondern wehren sich häufig dagegen, manchmal sogar auf der Straße. Immerhin haben diese neuen technischen Möglichkeiten häufig eine wichtige Funktion gehabt, als sie sich in der Pubertät von ihren Eltern abgrenzten, und sind so ein Teil ihrer Identität geworden. In atemberaubendem Tempo hat sich damit auf allen Kontinenten unsere Kultur verändert. In diesem Kontext ist es Facebook, Google, Bertelsmann und anderen Unternehmen gelungen, eine Stimmung zu verbreiten, nach der die Zukunft digital ist.
Das ist jedoch alles andere als selbstverständlich. Zunächst einmal »ist« die Welt nicht digital, immer noch nicht und auch in Zukunft wird sie es nicht sein. Die Mütter und Väter unter den Lesern werden sich erinnern: Als ihr Kind geboren wurde, war dies kein digitaler Vorgang. Und sie kommunizierten mit ihm auch nicht digital. Als sie es heranwachsen sahen, haben sie seine Blicke absolut analog wahrgenommen. Analog spürten die älter gewordenen Kinder die aufregende Wirkung von Schmetterlingen im Bauch. Analog rührten sich Ängste in ihnen. Und wenn sie Handlungen planen oder ausführen, dann erinnert dieses Substantiv daran, dass diese von unserer Sprache der »Hand« zugeordnet werden. Das Tasten und Fühlen, die ursprünglichste Art, mit der Welt Kontakt aufzunehmen, ist der analoge Vorgang schlechthin. Unser Kontakt zur Welt ist ganz überwiegend analog. Analog ist alles, was echt ist. Analog ist das Leben.
Seit wenigen Jahrzehnten aber gibt es Verfahren, die Zug um Zug sämtliche ursprünglichen Informationen über unsere Wirklichkeit in eine digitale Sprache umschreiben. Diese Sprache lässt sich technisch und wirtschaftlich viel besser nutzen. Kein Wunder, dass in der Industrie immer häufiger digitale Technik zum Einsatz kommt. Der aufblühende Digitalkapitalismus hat sich innerhalb kürzester Zeit auf nahezu alle Bereiche des menschlichen Denkens, Fühlens und Handelns ausgebreitet. Immer wenn in der Konzernzentrale von Google/Alphabet die Einrichtung einer weiteren Unternehmenssparte bekannt gegeben wird, hat ein neuer Eroberungsfeldzug begonnen.
Der Zündfunke für den raketenhaften Aufstieg dieser neuen Ökonomie war die Idee, den »Datenabfall«, der entsteht, wenn jemand eine Suchanfrage startet, als Rohstoff für eine äußerst erfolgreiche Werbestrategie zu nutzen. 15 Jahre nach dieser Entdeckung setzte sich der Konzern vorübergehend an die Spitze der reichsten Unternehmen der Welt.
Diese Machtstellung basiert auf einer aggressiven Eroberung aller denkbaren Schürfgebiete, in denen Nutzer – gewollt oder ungewollt – Informationen über sich preisgeben. Die Harvard-Professorin Shoshana Zuboff schreibt:
»Die Erweiterung sucht jeden Winkel, jede Ritze, jede Äußerung, jede Geste in die mythische ›Cloud‹ hineinzusaugen und damit zu enteignen. Alles Belebte hat seine Fakten herauszugeben. Alles muss ausgeleuchtet werden, es kann keine Schatten geben, keine Dunkelheit. Unbekanntes ist nicht tragbar. Für sich zu bleiben ist verboten.«3
Aber nicht der enorme Reichtum eines Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg ist das eigentliche Problem – mal abgesehen davon, dass die gigantischen Gewinne etlicher Internetfirmen bei gleichzeitigen äußerst erfolgreichen Steuervermeidungsstrategien den Gerechtigkeitssinn manches Zeitgenossen empfindlich reizen –, sondern die Veränderungen, denen unsere Gesellschaften durch den Einsatz von Big Data ausgesetzt sind. Ständig werden neue Apps entwickelt, die dem Nutzer ermöglichen, mit geringstem Zeitaufwand bei einfachster Bedienung an Informationen heranzukommen, die ihm vielleicht nützen, die ihn vielleicht nur interessieren: Will ich in einer Sommernacht wissen, welches Flugzeug sich gerade über mir durch den Sternenteppich pflügt, so halte ich das Smartphone gen Himmel und die App sagt mir, welcher Flieger da gerade über mir blinkt und wann er wo landen wird. Interessiere ich mich für Mythologie, so zeigt mir eine andere eher unpoetische App, welche der Sterne da oben ich mit welchen anderen durch Linien verbinden muss, um beispielsweise den Orion zu erkennen.
Das ist sehr beeindruckend und die Ingenieure solcher phantasievollen Softwareprogramme sind zu beglückwünschen. Grund zur Freude über den Fortschritt – gäbe es da nicht eine Schattenseite: Immer dann, wenn es gelungen ist, ein Wissensgebiet zu digitalisieren, verlieren die an Bedeutung, die aufgrund ihres Spezialwissens bisher gefragte Fachleute waren. Beim Schachprogramm ist das harmlos, weil die Gruppe der Schachweltmeister relativ überschaubar ist. Aber wie verkraften es die Ärzte, dass der elektronische Dr. Watson sie aufgrund zigfacher digitalisierter Krankheitsverläufe bezüglich der Diagnosefähigkeit wahrscheinlich bereits heute locker aussticht? Was werden die Anwälte sagen, wenn eine zukünftige Juristen-App es jedem User ermöglicht, sich direkt aus dem Netz Beistand zu holen? Dieser Beistand dürfte bald kaum noch hinter dem zurückstehen, was standardmäßig in Kanzleien zusammengestellt wird.
Als der mechanische Webstuhl die Handweber brotlos machte, traf es einfache Handwerker. Heute trifft die Welle der Digitalisierung die Mittelschicht. Viele Berufe verlieren an Ansehen und mit ihnen ungezählte Menschen ihre Autorität. Ob das gerechtfertigt ist, welche Rolle der Faktor Mensch in der Medizin oder bei der Rechtsprechung in Zukunft spielen wird, diese sozial- und arbeitspsychologische Frage kann ich als medizinischer und juristischer Laie nicht beantworten.
Es gibt allerdings eine Branche, bei der der digitale Wandel mit Sicherheit nicht nur Konsequenzen für die Beschäftigten hat, sondern für sehr viel mehr Menschen: Das ist der Bildungssektor – und da kann ich mithalten, denn ich war über vier Jahrzehnte Lehrer. Die Schule durchlaufen alle, die später auf den verschiedensten Sektoren der Gesellschaft als was auch immer tätig sind, außerdem haben Schulen den Auftrag, den Menschen zu einem mündigen Bürger heranzubilden.
Bisher war die Schule ein in sehr überschaubarem Umfang von elektronischen Medien geprägter Raum. Es gab Computerkabinette und es wurde schon einmal im Internet recherchiert. In diversen Fächern wurden von engagierten Kollegen spezielle Apps genutzt – beispielsweise, wenn ein Biologielehrer seinen Schülern zeigte, wie man Vogellaute mit Hilfe einer App identifizieren kann. Die Schüler lernten professionelles Präsentieren (Power Point), auch für kreative Projekte wurden Medien genutzt, Filme geschnitten, Hörspiele produziert. Ansonsten galt: Zurückhaltung! Wahrscheinlich ist es gegenwärtig sogar in den meisten deutschen Schulen verboten, während des Unterrichts sein Smartphone oder Handy zu benutzen, immer häufiger gilt das auch für die Pausenzeiten.
Die Stunden und Jahre, die ein Jugendlicher in der Schule verbringt, sind deshalb gegenwärtig der größte Bereich unserer menschlichen Wirklichkeit, der von den Datenkapitalisten kaum eingesehen wird. Dieses Terrain zu erobern, muss diejenigen fürchterlich jucken, die sich dem Projekt verschrieben haben, über die Akkumulation sämtlichen verfügbaren Wissens, sämtlicher verfügbarer Informationen endgültig zur Macht zu gelangen, denn Wissen ist Macht. Es geht da um sehr viel mehr als das Kapellchen und die kleine Hütte der alten Eheleute Philemon und Baucis in Goethes Faust, die den nach Weltherrschaft gierenden Greis derart reizt, dass er sie mit Hilfe seiner finsteren Gesellen niederbrennen lässt. In den Blick geraten sind ganz im Gegenteil die Daten von Menschen, die den größten Teil ihres Lebens noch vor sich haben.
Jetzt also greift Big Data nach der Schule. Sie soll eine ganz andere, sie soll durch eine »digitale Bildungsrevolution« von Grund auf umgekrempelt werden – und dieser Begriff ist ernst zu nehmen. Alle Elemente der Schule sollen einer gründlichen Revision unterzogen werden. Es geht um die Rolle, die in Zukunft Klassen, Lehrer und besonders Schüler einnehmen sollen. Digitale Medien sollen den Schulalltag bestimmen, sollen zur dominierenden Unterrichtsform werden. Es geht nicht um eine Ergänzung des Unterrichts, es geht um die Neudefinition dessen, was Schule heißt. Die Digitalwirtschaft tritt mit dem Anspruch auf: Wir machen alles neu! Alles muss anders werden. Und sie muss auch keine Mordbuben beauftragen wie der greise Faust, im Gegenteil, es blinkt und ploppt, wenn die Schüler die Lernprogramme nutzen, während ihre Verhaltensdaten abgeschöpft werden.
Politik, Digitalwirtschaft und Wissenschaft zum Thema
Es sind drei Texte, die in meinem Buch eine besondere Rolle spielen. Der erste stammt von Politikern, der zweite repräsentiert die Vorschläge der Digitalwirtschaft, den dritten hat eine philosophisch reflektierende Wissenschaftlerin geschrieben. Die ersten beiden habe ich deshalb gewählt, weil ihre Verfasser jeweils zu den führenden Köpfen unter den für Bildung zuständigen Politikern und Wirtschaftseliten gehören.
Der erste Text ist das Strategiepapier Bildung in der digitalen Welt, das die Kultusministerkonferenz (KMK) am 08. 12. 2016 beschlossen hat.4 Zweifellos sind unsere Kultusminister unter allen Politikern diejenigen, die qua Amt am meisten für die Bildung in diesem Land zuständig sind. Ihr Papier ist die wichtigste aktuelle amtliche Verlautbarung bezüglich der Absichten, die in der Bildungspolitik verfolgt werden. Es bildet den Hintergrund für den DigitalpaktD oder Digitalpakt Schule, der die Beteiligung des Bundes an den Ausgaben der Länder bei der digitalen Ausstattung ihrer Schulen regelt.
Auch wenn die KMK keine unmittelbare legislative Funktion hat, kommt an dem, was die jeweils amtierenden 16 Kultusminister beschließen, keine nachgeordnete Bildungseinrichtung vorbei. Die Kabinette aller Bundesländer werden sich damit genauso beschäftigen wie ungezählte Ministerialbeamte aller deutschen Kultusministerien, Schulleiter, Lehrerkonferenzen usw.
Beim zweiten Text handelt es sich um ein Buch der beiden Autoren Jörg Dräger und Ralph Müller-Eiselt mit dem Titel Die digitale Bildungsrevolution – Der radikale Wandel des Lernens und wie wir ihn gestalten können.5 Dräger ist im Vorstand der Bertelsmann Stiftung, Müller-Eiselt befasst sich als Experte der Stiftung laut Selbstbeschreibung mit den Chancen und Risiken der Digitalisierung. Ihr Buch wird bzw. wurde von den Landeszentralen für politische Bildung umsonst abgegeben. Das ist angesichts der Tatsache, dass es sich bei Bertelsmann um den größten deutschen Medienkonzern handelt, der gerade dabei ist, weltweit Lernsoftware aufzukaufen, nicht ohne Brisanz. Der Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann AG, Thomas Rabe, weist darauf hin, dass »der Bildungsmarkt [...] weltweit ein Volumen von mehr als fünf Billionen US-Dollar [hat]. Knapp ein Fünftel davon entfällt auf private Anbieter, Tendenz steigend.«6 Wenn er dann fortfährt: »Global wächst die Nachfrage nach Bildung. Und durch Digitalisierung wird Bildung verfügbarer und bezahlbarer«7, signalisiert er seinen Aktionären, dass die Bertelsmann AG gewillt ist, sich ein Stück vom Kuchen zu sichern. Und das scheint am besten mit digitalisierter Bildung zu gehen.
Die Bertelsmann AG hat eine bemerkenswerte Aktionärsstruktur. Ihr Hauptaktionär ist nämlich niemand anderes als die Bertelsmann Stiftung. Immer wenn der Konzern hohe Gewinne erzielt, profitiert auch die Stiftung. Wen wundert es da noch, dass sie sich seit Jahren in die Diskussion um das, was zeitgemäße Bildung sein soll, einmischt. Wundern muss man sich eher darüber, dass die Stiftung trotz dieser Interessenverzahnung als gemeinnützig anerkannt wird. Ich wundere mich vor allem darüber, dass ein Hauptaktionär, der sich aus den Gewinnen eines Medienkonzerns finanziert, als unabhängiger Ratgeber zum Thema digitale Ausstattung der Schulen so viel Beachtung findet.
Ich möchte exemplarisch an diesen beiden mit Bedacht ausgewählten Texten zeigen, was uns die Vertreter einer digitalen »Bildungsrevolution« versprechen, wie sich die Schule ihrer Meinung nach verändern soll und was der Preis ist, den Schüler, Lehrer, Eltern und die Gesellschaft dafür zahlen müssten. Um das zu erkennen, muss man diese Texte nur absolut ernst nehmen und genau lesen: Es steht alles drin. Um dies hieb- und stichfest zu belegen, werde ich sie immer wieder zitieren. Den unvorbereiteten Leser mag die euphorische Rhetorik von Dräger und Müller-Eiselt verwirren, aber sobald man solche verbalen Ranken wegschneidet, sobald man sich zu einer nüchternen Bestandsaufnahme der vorgeschlagenen Rezepte durchringt, kommt der bohrende Verdacht auf, dass die anvisierten Eingriffe in die Schulkultur unsere Jugend gerade nicht angemessen auf das digitale Zeitalter vorbereiten, sondern sie ihm eher geschwächt und uninformiert ausliefern.
Neben diesen Texten, die Anlass zur Kritik geben, möchte ich voller Bewunderung auf das 700 Seiten starke Mammutwerk Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus von Shoshana Zuboff8 hinweisen. Was diese Harvard-Professorin alles zusammengetragen hat, kann mit Fug und Recht als eine aktualisierte Fassung des Kapitals von Karl Marx verstanden werden – allerdings ohne dessen Geschichtsoptimismus zu teilen. Ihr Buch wird uns helfen, zu verstehen, wie diese neue Variante des Kapitalismus funktioniert.
Wer die Digitalkapitalisten stoppen könnte
Karl Marx hat vor genau 151 Jahren in seinem Hauptwerk Das Kapital eine detaillierte Untersuchung des Kapitalismus seiner Zeit vorgelegt. Er sah nur noch Katastrophen auf die Menschheit zukommen, wenn diese Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ihre Macht behalten sollte. Parallel zur Analyse ihrer Strukturen und Mechanismen suchte Marx deshalb nach einem Subjekt, das in der Lage sein sollte, die Bourgeoisie zu stürzen. Er glaubte dieses Subjekt im Arbeiter gefunden zu haben, der »nichts mehr zu verlieren hat als seine Ketten« und deshalb am ehesten bereit sein dürfte, das lebensgefährliche Wagnis einzugehen, die herrschende Klasse zu stürzen.
Heute glauben viele, dass sich Marx trotz vieler profunder Einsichten in die Destruktivkraft des Kapitalismus in mancherlei Hinsicht geirrt hat. Vor allem unterschätzte er die Wandlungsfähigkeit des Kapitalismus. Er ahnte nicht, dass ein Henry Ford im Arbeiter den Konsumenten entdecken würde. Zwar waren auch die Ford-Arbeiter an die Ketten des ruckelnden Fließbandes gefesselt, aber sie hatten bald sehr viel mehr zu verlieren als diese Ketten: nämlich Autos und Eigentumswohnungen, Fernseher und am Ende gar elektrische Zahnbürsten.
Seit den Zeiten eines Henry Ford ist der Kapitalismus nicht stehen geblieben. Wieder hat er neue Formen der Kapitalakkumulation hervorgebracht und neue noch weitgehend unerschlossene Ressourcen entdeckt, die man ausbeuten kann: Daten über unser Verhalten. Es hat eine Weile gedauert, bis diese Mechanismen und Strategien durchschaut wurden. Mit dem Erscheinen solcher Bücher wie Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus ändert sich das gerade.
Im Gegensatz zu Karl Marx tut sich Shoshana Zuboff schwer, ein revolutionäres Subjekt auszumachen, das sich gegen diese neue Form der Ausbeutung und Entfremdung wehren könnte. Sie hofft darauf, dass »das Volk« irgendwann sagt: »Jetzt reicht’s.« Ihr Vorbild ist dabei die Friedliche Revolution: »Die Berliner Mauer fiel aus vielen Gründen, vor allem aber weil die Menschen in Ostberlin sich sagten: ›Jetzt reicht’s!‹«9 In der Einleitung ihres Werks schreibt sie: »Nur ein entschiedenes ›Wir, das Volk ...‹ vermag diese Entwicklung noch umzukehren.«10 Aber »Wir, das Volk« ist ein sehr heterogenes Subjekt. Teile dieses Volkes haben sich längst in eine viel zu große Abhängigkeit von den neuen Medien begeben, die das Instrument sind, mit dem der Datenkapitalismus seinen Einfluss auf unser aller Geschick immer weiter ausbaut, um noch in der Lage zu sein, gegen ihn aufzubegehren. Was dem amerikanischen Fließbandarbeiter des frühen 20. Jahrhunderts sein Ford T, das ist dem heutigen jugendlichen Internetnutzer sein Smartphone. Wer einmal süchtig ist, lässt sich vermutlich als Letzter dazu bewegen, seine Dealer an den Pranger stellen zu lassen.
Wer also könnte das Subjekt sein, das die dringend gebotene Bewegung gegen solche neuen Formen der Macht anführt? Hier mein Vorschlag: Das Subjekt eines friedlichen Aufbegehrens kann niemand anderes sein als Sie, liebe Eltern.
Um das zu begründen, hole ich ein wenig aus: Eines der schönsten Lieder von Gerhard Gundermann ist eine Liebeserklärung der besonderen Art. Hört man die ersten Zeilen, erwartet man noch ein ganz »gewöhnliches« Liebeslied. Wir hören, dass ein »Du« ins Herz des Sängers gefallen sei »wie in ein verlassnes Haus«, worauf es dort wieder licht und hell geworden sei. Aber schon wenige Zeilen weiter kommt der Verdacht auf, dass hier ein Vater seine neu geborene Tochter besingt: »Du bist so ne laute Braut«.
Der Vater, der da singt, ist in keiner guten Verfassung, als die Tochter zur Welt kommt. Der Verfasser des Liedes war es auch nicht. Immerhin hat er 1993 auf derselben Schallplatte, auf der »Linda« erschien, seine Verstrickung in den Überwachungsstaat der DDR angedeutet (»Sieglinde«). Das machte nicht nur seinen Freunden und Fans zu schaffen, sondern vor allem auch ihm selber. Im Lied klingen sogar Selbstmordabsichten an: »Meine Pistole war geladen mit dem allerletzten Schuss.«
Aber dann kommt Linda zur Welt. Und – seltsam – nicht der Vater beschützt das Kind, sondern das Kind rettet den Vater. In der letzten Strophe keimt bei ihm die Hoffnung auf, dass dieses laute Kind »sein Lotse« sein könnte. Nicht der Vater nimmt die Tochter bei der Hand, vielmehr bittet er die Tochter, ihn an der Hand zu halten. Weil er jetzt die Verantwortung für das Kind hat, vergräbt er den Revolver unter einem Baum im Garten. Diese Verantwortung übernimmt er, weil ihm dieses Kind so lieb und teuer ist.
Sicher ist es etwas anderes, eine Selbstverpflichtung als IM bei der Stasi zu unterzeichnen oder am Ende ellenlanger schnell durchgescrollter Geschäftsbedingungen ein Kreuz zu setzen beziehungsweise seinen Kindern ein Smartphone zu schenken. Den Stasi-Überwachungsstaat und den Überwachungskapitalismus sollte man nicht gleichsetzen. Während wir bei ersterem immer genauer wissen, wie grausam er war und was er für ein Elend im Leben vieler Menschen angerichtet hat, wissen wir beim letzteren noch nicht, wohin er uns führen wird. Mir reicht indes schon, was ich heute erlebe, wo diese historische Erscheinung gerade mal im Pubertätsalter ist. Wenn ich das extrapoliere, dann wird es gruselig. Trotzdem habe ich meinen beiden Kindern internetfähige Geräte geschenkt.
Und deshalb kann ich so gut mit Gundermann mitfühlen: mit seinem Entsetzen über sich selber und seiner Bereitschaft zum Verrat. Aber auch damit, dass die Existenz einer Tochter ihn alle Selbstmordabsichten beiseite schieben lässt und ihn dazu drängt, neue Verantwortung zu übernehmen.
Gundermanns Stimmungsumschwung gibt mir die Idee ein, dass es gerade die Eltern sein könnten, die trotz problematischer elektronischer Geschenke an ihre Kinder angesichts mancher Pläne der Digitalwirtschaft rufen: »Jetzt reicht’s!« Aus dem Verantwortungsgefühl für die Zukunft ihrer Kinder heraus könnten sie sich in so etwas wie ein »revolutionäres Subjekt« verwandeln, das weiteren Eroberungsphantasien großer Datenkonzerne einen Riegel vorschieben will – wenigstens bezüglich der Digitalisierung der Schulen.
Was Eltern sich wünschen, das ist die Besinnung darauf, wie man mit Augenmaß darangehen kann, die Lehrinhalte und Unterrichtsformen zu finden, die unsere Kinder stark für eine Welt machen, in der immer mehr Prozesse digital gesteuert werden – aber nicht, um sie diesem Trend zu opfern, sondern um ihnen die Souveränität über diese Prozesse zurückzugeben.
Der digitale Schulumbau: Eine Herausforderung für die protestantische Kirche
Von Anfang an ist die protestantische Kirche mit der Entwicklung des allgemeinen Schulwesens in Deutschland eng verbunden – und so müsste man eigentlich vermuten, dass sie zur Stelle ist, wenn Akteure auftreten, die das Schulwesen von Grund auf verändern wollen. Mindestens würde man erwarten, dass sich die Protestanten in den Parteien, in politischen Ämtern und den Vertretungsorganen der Elternschaft zu Wort melden, wenn das Erbe protestantischer Bildungsanstrengungen zur Disposition gestellt wird. Sie haben das getan, als es um die Ganztagsschule ging und um Inklusion, Protestanten waren selbstverständlich dabei, als es notwendig war, syrischen Flüchtlingen Deutsch beizubringen, und aus protestantischen Elternhäusern heraus startete manche Initiative zur Gründung freier Schulen, die es z. B. Kindern im ländlichen Raum weiter ermöglichen, in der Nähe der elterlichen Wohnung ihrer Schulpflicht nachzukommen. Da fällt die Zurückhaltung angesichts des Themas »digitale Umgestaltung der Schule« auf.
Das gilt umso mehr, als die Veränderungen Kernelemente protestantischer Bildung betreffen. Denn es geht neben der Neudefinition der Rolle von Lehrern, Schülern und Klassen eben auch darum, dass mit der Installierung des neuen Mediums Internet ganz im Sinne Marshall McLuhans eine Botschaft verkündet wird, die Christen gar nicht gefallen kann: Unter der Hand findet ein neues Menschenbild immer mehr Verbreitung, nach dem sich der Unterschied zwischen Mensch und Maschine allmählich auflöst.
Dies ist einzelnen Protestanten durchaus schon aufgefallen, aber dass in der evangelischen Kirche eine besonders lebhafte Debatte über künstliche Intelligenz und diese Neuinterpretation des Menschen geführt würde, kann ich nicht erkennen. Bisher sind die Stimmen selten, die sich da zu Wort melden. Ähnlich sieht das auch der Publizist Klaus-Rüdiger Mai, der einer der wenigen ist, die dieses Thema ansprechen:
»Gerade an dieser Stelle findet tatsächlich ein Generalangriff auf das christliche Menschenbild statt, gerade hier müsste die Kirche den Menschen als Geschöpf Gottes verteidigen und eine große Debatte in Gang setzen.«11
Die Kirche verkenne
»die große Gefahr, die von der konzerngetriebenen Digitalisierung für die Demokratie, die Freiheit und für die Menschlichkeit ausgeht. Dieses Thema hat die Kirche ausgehend von Luthers Entdeckung des Individuums, ausgehend von der Verantwortung der Christen für die Schöpfung offensiv anzugehen. Weder der Mensch noch Gott, der Schöpfer, sind ein Schürfgebiet für Daten.«12
Es ist vielleicht nützlich, angesichts dieser Zurückhaltung noch einmal daran zu erinnern, wie sehr sich gerade Martin Luther um das öffentliche Schulwesen in Deutschland verdient gemacht hat. Diese Erinnerung mag dazu anspornen, dass es in Zukunft wieder mehr Protestanten sind, die den Eltern bei ihren Bemühungen um eine sinnvolle Vorbereitung ihrer Kinder auf eine von digitaler Technik durchsetzte Welt zur Seite treten.
Luther als Pionier weltlicher Schulbildung
Bevor Martin Luther begann, durch spektakuläre Aktionen wie den Versand seiner 95 Thesen die Kirche zu reformieren, waren die Klöster die wichtigsten, in weiten Teilen Deutschlands sogar die einzigen Einrichtungen, die Bildung organisierten. Ein nicht beabsichtigter Nebeneffekt der Kritik Luthers am Mönchstum war der Niedergang dieser Bildungseinrichtungen. Einerseits war dies dem Reformator ganz recht, denn er verband mit diesen Klosterschulen keine guten Erinnerungen:
»Wahrlich, was hat man denn gelernt in hohen Schulen und Klöstern, als nur ein Esel, ein Klotz und ein Block zu werden? Zwanzig, vierzig Jahre lang hat einer gelernt und hat doch weder Lateinisch noch Deutsch beherrscht. Ich schweige über das schändliche, lästerliche Leben, durch das die kostbare Jugend so jammervoll verdorben worden ist.«13
Andererseits war nach mehreren Jahren des Niedergangs der Klosterschulen erkennbar, dass in gewissen Alterskohorten bereits spürbar gut ausgebildete Fachleute fehlten, das Land also dringend Alternativen brauchte, nicht nur um Pfarrer, sondern auch um Schulmeister, Juristen, Verwaltungsleute, Ratgeber der Fürsten, Ärzte usw. auszubilden. Luther führte insbesondere bezüglich der Besetzung der Pfarrstellen regelrechte Kalkulationen durch, bei denen er berücksichtigte, dass es einige Jahre dauern würde, um die Lücke zu schließen. Er war da weitsichtiger als heutige Kirchenleitungen oder Kultusministerien, die ähnliche Prognosen bezüglich der Pfarrer bzw. Schulmeister verschlafen haben. Sogar ein sich abzeichnender Küstermangel beschäftigte ihn.
»Ich möchte gern sehen, woher man in drei Jahren Pfarrer, Schulmeister, Küster nehmen will. Werden wir nun nichts dazu tun und besonders die Fürsten sich nicht darum kümmern, daß sowohl Knabenschulen als auch hohe Schulen in rechter Weise eingerichtet werden, so wird ein solcher Mangel an Personen entstehen, daß man drei oder vier Städte einem Pfarrer und zehn Dörfer einem Kaplan wird anvertrauen müssen, wenn man sie dann überhaupt noch bekommen kann.«14





























