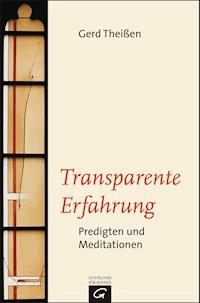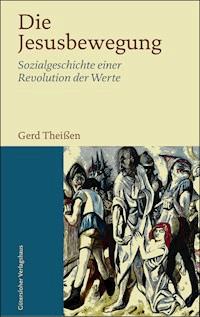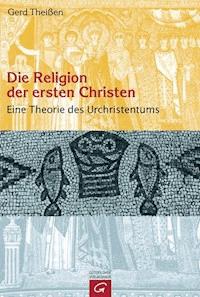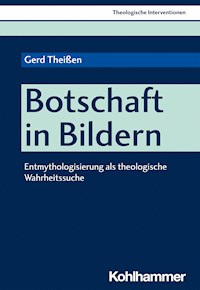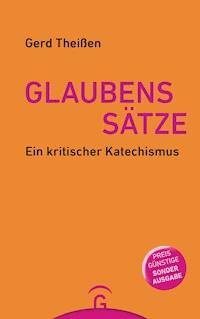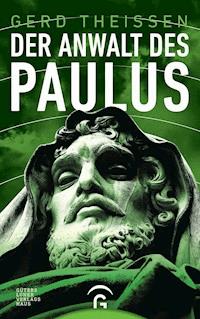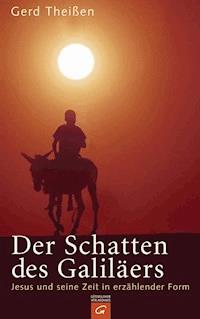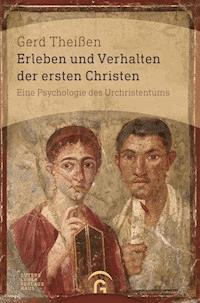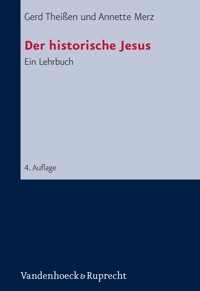
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Das Lehrbuch will auf möglichst sachliche und verständliche Weise über die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung zum historischen Jesus informieren. Jesus wird als eine auch heute noch erkennbare, tief im Judentum verwurzelte, profilierte Gestalt dargestellt. Es wird verständlich, dass seine Anhänger ihn als Messias und Gottessohn verehrten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1296
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christoph Burchardzum 65. Geburtstag
Gerd TheißenAnnette Merz
Der historische Jesus
Ein Lehrbuch
4. Auflage
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sindim Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-525-52198-4
ISBN 978-3-647-52198-5 (E-Book)
© 2011, 1996 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen/Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Oakville, CT, U.S.A. www.v-r.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu § 52a UrhG:Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung desVerlages öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch bei einer entsprechenden Nutzung für Lehr- und Unterrichtszwecke.
Printed in Germany.
Satz: Text & Form, Garbsen
Druck und Bindung: Hubert & Co, Göttingen
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.
VORWORT
Die Beschäftigung mit dem historischen Jesus war in der vergangenen Generation oft mit der Botschaft verbunden, es sei theologisch nicht wichtig, sich mit ihm intensiv auseinanderzusetzen. Entscheidend sei der verkündigte Christus, bei dem man sich nur vergewissern müsse, daß er nicht in Gegensatz zu dem stehe, was wir vom historischen Jesus wissen – und das sei sehr wenig. Diese Botschaft hat gewirkt. Viele sind heute hilflos, wenn es darum geht, argumentativ zu klären, was wir vom historischen Jesus wissen, was wir nur vermuten und was wir nicht wissen können. Enthüllungsbücher, die den wahren Jesus hinter kirchlichen Verfälschungen hervorholen wollen, stoßen ebenso in diese Marktlücke des Wissens wie erbauliche Werke, die aus den religiösen Sehnsüchten und ethischen Werten unserer Zeit einen neuen Jesus schaffen. Von beiden Seiten wird die geduldige Arbeit der Wissenschaft geringgeschätzt. Und doch gibt es zu ihr in einer aufgeklärten Gesellschaft und einer offenen Kirche, die sich über ihre eigenen Grundlagen Rechenschaft ablegen will, keine Alternative.
Dies Lehrbuch will wissenschaftliche Jesusforschung vermitteln – nicht nur ihre Ergebnisse, sondern auch den Prozeß des Wissenserwerbs. Es ist in der Überzeugung geschrieben, daß 200 Jahre historisch-kritischer Jesusforschung und die in dieser Zeit enorm vermehrten Quellen zu Jesus und seiner Umwelt wichtige Erkenntnisse gebracht haben. Zum Wissenschaftsprozeß gehört freilich viel, was Lesern und Leserinnen Geduld abverlangt, die primär an unmittelbar einleuchtenden Ergebnissen interessiert sind.
Wissenschaft sagt nicht: »So war es«, sondern: »So könnte es aufgrund der Quellen gewesen sein.« Deshalb besprechen wir alle relevanten Quellen – nicht nur die kanonischen, sondern auch die apokryphen Evangelien, nicht nur christliche, sondern auch nicht-christliche Texte, die Jesus erwähnen. Auch sonst wird immer die Textbasis vorgestellt, die den Schlußfolgerungen und Überlegungen zugrunde liegt.
Wissenschaft sagt nie: »So ist es«, sondern nur: »So stellt es sich uns auf dem Stand der Forschung dar.« Und das heißt im Klartext: »auf dem Stand unseres derzeitigen Wissens und Irrens.« Wir geben deshalb zu jedem wichtigen Thema einen kurzen Forschungsüberblick. Die klassischen Positionen, die in Variationen immer wiederkehren, werden knapp referiert. Das soll auch dazu helfen, die in diesem Buch vertretenen Entscheidungen einordnen, bewerten und relativieren zu können.
Wissenschaft sagt nicht: »Das ist unser Ergebnis«, sondern: »Das ist unser Ergebnis aufgrund bestimmter Methoden.« Der Weg, auf dem sie zu ihrem Ziel gelangt, ist ihr genauso wichtig wie das Ziel – oft sogar noch wichtiger. Denn der Weg kann richtig sein, auch wenn sich das Ziel als Zwischenstation erweist, die man wieder verlassen muß. Es finden sich daher in diesem Buch oft methodische und hermeneutische Überlegungen. Angesichts der Skepsis, ob man überhaupt etwas vom historischen Jesus weiß, ist das angebracht. Ein ganzer Paragraph (§ 4) beschäftigt sich mit dieser Frage.
Wissenschaft weiß schließlich, daß ihre Resultate vergänglicher sind als die Probleme, auf die sie eine Antwort zu geben versucht. Das gilt auch für die Jesusforschung. Trotz der ungeheuren Fülle von Meinungen und Positionen kehren einige Grundprobleme immer wieder. Sie bilden Konstanten. Daher ist unsere Darstellung problemorientiert. Schon aus Gründen der Durchsichtigkeit und Klarheit sagen wir aber jeweils, wo – auf dem Stand unseres Wissens und Irrens – die Lösungen liegen könnten.
Weil Wissenschaft nicht einfach von der Wirklichkeit »erzählen« kann, sondern über Quellen, Forschungslagen, Methoden und Probleme reflektiert, ist sie ein kompliziertes Geschäft. Wir sehen darin eine Herausforderung für die Wissenschaftsdidaktik. Unser Buch möchte differenziertes Problemwissen so klar wie möglich vermitteln und auch etwas von der Freude, die es macht, innerhalb des Wissenschaftsprozesses an der Suche nach Wahrheit und der Korrektur unserer Irrtümer teilzunehmen. Wir haben als Leserinnen und Leser auch interessierte Laien im Auge, die sich über Jesus informieren wollen. Deshalb ist allen griechischen und hebräischen Zitaten und Worten eine Übersetzung beigegeben. Deshalb bemühen wir uns, der akademischen Neigung, Tiefsinn und Unklarheit zu verwechseln, so wenig wie möglich nachzugeben. Deshalb ist unser Buch stark von didaktischen Überlegungen bestimmt. Es ist aus »Intensivkursen zum Neuen Testament« hervorgegangen, die der Autor als Lehrer durchführte und an denen die Autorin vor längerer Zeit als Studierende teilnahm. Wir haben bewußt ein Lehrbuch geschrieben, das auch zum Selbststudium in kleinen Gruppen oder in Einzelarbeit geeignet ist.
Jeder Paragraph beginnt mit einer kurzen Einführung und vorbereitenden Aufgaben, die oft dazu dienen, wichtige Texte kennenzulernen. Texte außerhalb des Alten und Neuen Testaments werden dabei meist zitiert. Diese Texte sollten auch Leser zur Kenntnis nehmen, die keine Zeit haben, die dazu gestellten Aufgaben zu bearbeiten. Denn sie sind für die Sachprobleme wichtig. Die gelegentlich an dieser Stelle gegebenen Lektürevorschläge sind dagegen keine Voraussetzung für das Verständnis des jeweiligen Paragraphen. Wer sich jedoch intensiver, etwa im Rahmen von Prüfungsvorbereitungen, mit einem Thema beschäftigen möchte, sollte diese grundlegenden Beiträge zur Kenntnis nehmen.
Der Hauptteil des jeweiligen Paragraphen enthält einen Überblick über Texte und Probleme zum jeweiligen Thema in möglichst klar gegliederter Form. Tabellen, Gegenüberstellungen und Skizzen sollen wichtige Probleme anschaulich machen. Aufgliederungen in Punkte und Unterpunkte – mit hervorgehobenen Stichworten – sollen helfen, komplizierte Sachverhalte für das Gedächtnis zu »verknappen«.
Am Ende jedes Hauptteils steht eine skizzenhafte Zusammenfassung, die sich von der (künstlichen) Einteilung in Punkte und Unterpunkte löst. Hier soll angedeutet werden, wie wissenschaftliche Ergebnisse in eine Bildungssprache für Schule, Kirche und Gesellschaft übersetzt werden könnten. Es folgen Anregungen zur hermeneutischen Reflexion. Einerseits sollen sie die sachliche Darstellung entlasten, denn zur historischen Arbeit gehört nicht unmittelbar die Frage, wie wir mit ihren Ergebnissen heute umgehen können. Andererseits sind sie Teil des didaktischen Konzepts: Wissen wird nur lebendiges Wissen, wenn wir uns mit ihm persönlich auseinandersetzen und es mit unserem Denken und Erleben vermitteln.
Am Ende jedes Paragraphen stehen Aufgaben zur Lernkontrolle, bei denen auch neue Probleme aufgeworfen werden – besonders dort, wo Transferleistungen von vorher Entfaltetem auf Unbekanntes verlangt werden. Auch diese Zusatzaufgaben gehören zur Behandlung des Themas. Zu allen Aufgaben werden am Ende des Buches Lösungen gegeben.
Bei der Gestaltung der einzelnen Paragraphen hatten wir das Ziel, jedes Thema in sich abzurunden. Wer sich z.B. mit dem letzten Mahl Jesu beschäftigt, soll eine in sich geschlossene Darstellung seiner Probleme erhalten, ohne daß er das ganze Buch gelesen haben muß. Daher kann man beim Lesen des Buches Paragraphen überschlagen. Wer der Meinung ist, alle Beschäftigung mit dem historischen Jesus müsse mit dem Osterglauben beginnen, kann auch hier einsetzen.
Auch ein Lehrbuch, das Jesusforschung vermitteln will und nicht die Lieblingsideen der beiden Verfasser, ist von einem bestimmten Jesusbild geprägt. Es ist ein kontextuelles Jesusbild. Jesus wird verstanden im Kontext des Judentums und der lokalen, sozialen und politischen Geschichte seiner Zeit. Auch hinter diesem Buch stehen »Vorverständnisse« und »Interessen«. So sind wir davon überzeugt, daß man über den historischen Jesus einen von Sympathie bestimmten Zugang zum Judentum finden kann, daß die Auseinandersetzung mit seiner Botschaft das soziale Gewissen schärft und die Begegnung mit ihm die Frage nach Gott verändert.
Das Buch ist eine Gemeinschaftsarbeit. Alle Abschnitte werden in ihrer Endgestalt von beiden Autoren verantwortet, aber wir haben uns die Arbeit aufgeteilt. Der größte Teil der Paragraphen 1.4–5.7–16 stammt von Gerd Theißen. Die Paragraphen 2–3.6 hat Annette Merz verfaßt. Von ihr stammen auch die Aufgaben und die auf S. 497–528 dazu aufgeführten Lösungen, ferner einzelne Abschnitte in den übrigen Kapiteln.1 Das Manuskript war September 1995 abgeschlossen. Danach erschienene Literatur konnte nicht mehr eingearbeitet werden.
Wir haben einzelne Teile anderen zur Probe vorgelegt. Für Hinweise und Lektüre einzelner Teile oder des Ganzen danken wir: Petra v. Gemünden (Genf), Michaela Höckel (Göttingen) und Christa Theißen (Heidelberg). Dörte Bester (Heidelberg) hat große Teile des Buches gründlich studiert und eine Fülle von Verbesserungsvorschlägen aus studentischer Perspektive eingebracht, die wir dankbar aufgegriffen haben. Unser Dank gilt ferner Matthias Walter und Heike Göbel für das Lesen der Korrekturen und Dörte Bester für die Mitarbeit am Stellenregister. Der Verleger Dr. Arndt Ruprecht hat die Entstehung des Buches, das eine lange Vorgeschichte hat und letztlich aus der Arbeit am Ergänzungsheft zu R. Bultmanns Geschichte der synoptischen Tradition hervorgegangen ist, begleitet und ermutigt. Dafür danken wir ihm.
Wir widmen das Buch Christoph Burchard zum 65. Geburtstag, ein Dank für den von uns allen geschätzten und von vielen geliebten Kollegen und Lehrer.
Heidelberg, Oktober 2010
Gerd TheißenAnnette Merz
_____________
1 Dabei handelt es sich um folgende Abschnitte: §1: 1.1.1.–2. (Teil d. Forschungsgeschichte); §7: 1.1.–3. (Nazareth); 3.5. (Die religiöse Eigenart Galiläas); § 8: 4.1.1.–3. (Johannes der Täufer: Quellen, Lehre und Selbstverständnis); 7.1.–2. (Jesus und die Frauen); § 9: 5.1. (Die Gerichtspredigt Jesu); § 10: 4.2. (Jesus als Magier?); § 11: 1.4.–6. (Teil d. Forschungsgeschichte); 3.6. (Mt 20,1–12 im Rahmen rabbinischer Lohngleichnisse); § 12:2.1.–2. (Jesus als Lehrer); 5.1.–6. (Liebesgebot); § 15:2.5.2. (Ersterscheinung Jesu); 3. (Hermeneutik). Annette Merz hat insgesamt etwa ein Drittel dieses Buches verfaßt.
INHALT
Vorwort
Häufiger zitierte Literatur und ihre Abkürzungen
§ 1: DIE GESCHICHTE DER LEBEN-JESU-FORSCHUNG
Einführung
1. Fünf Phasen der Leben-Jesu-Forschung
1.1. Erste Phase: Die kritischen »Anstöße« zur Frage nach dem historischen Jesus durch H.S. Reimarus und D.F. Strauß
1.2. Zweite Phase: Der Optimismus der liberalen Leben-Jesu-Forschung
1.3. Dritte Phase: Die Krise der Leben-Jesu-Forschung
1.4. Vierte Phase: Die »neue Frage« nach dem historischen Jesus – Exkurs: Die jüdische Jesusforschung
1.5. Fünfte Phase: The »third quest« for the historical Jesus
2. Zusammenfassende Übersicht: Die Geschichte der Leben-Jesu-Forschung
3. Hermeneutische Reflexion
4. Aufgaben
4.1. Fünf Phasen der Leben-Jesu-Forschung
ERSTER TEIL: DIE QUELLEN UND IHRE AUSWERTUNG
§ 2: CHRISTLICHE QUELLEN ÜBER JESUS
Einführung
1. Die Bedeutung außerkanonischer christlicher Literatur für die Jesusforschung: Tendenzen und Phasen der Forschung
2. Die synoptischen Quellen
2.1. Das Markusevangelium
2.2. Die Logienquelle
2.3. Das Matthäusevangelium
2.4. Das Lukasevangelium
3. Gnosisnahe Quellen
3.1. Das Johannesevangelium
3.2. Das Thomasevangelium (ThEv)
3.3. Gnostische Dialogevangelien
4. Evangelienfragmente mit synoptischen und johanneischen Elementen
4.1. Papyrus Egerton 2 (Egerton-Evangelium)
4.2. Das Geheime Markusevangelium
4.3. Das Petrusevangelium
4.4. Der sogenannte Oxyrhynchos Papyrus
5. Judenchristliche Evangelien
6. Weitere Quellen: Freie Jesusüberlieferung
6.1. Jesusworte im NT außerhalb der Evangelien
6.2. Spätere Zufügungen zu neutestamentlichen Handschriften
6.3. Papias und die Apostolischen Väter
6.4. Sonstige »Agrapha« und Erzählungen über Jesus
7. Zusammenfassende Übersicht
8. Zusammenfassung und hermeneutische Reflexion
9. Aufgaben
9.1. Außerkanonische Quellen und Jesusforschung
§ 3: DIE NICHT-CHRISTLICHEN QUELLEN ÜBER JESUS
Einführung
1. Josephus über »Jesus, der Christus genannt wird«
1.1. Die Erwähnung Jesu als Bruder des Jakobus (Ant 20,200)
1.2. Das »Testimonium Flavianum« (Ant 18,63f)
2. Die rabbinischen Quellen: Jesus als Verführer (bSanh 43a)
3. Mara bar Sarapion: ein syrischer Stoiker über den »weisen König der Juden«
4. Römische Schriftsteller und Staatsmänner über Christus, den Gründer der Christensekte
4.1. Plinius der Jüngere (61–ca. 120)
4.2. Tacitus (55/56–ca. 120)
4.3. Sueton (70–ca. 130) – Anhang: Thallus
5. Zusammenfassung
6. Aufgaben
6.1. Das Josephuszeugnis über Jesus nach dem Religionsgespräch am Hof der Sasaniden
6.2. Die altslavische Version des Jüdischen Krieges als Quelle für die Lehre und den Tod Jesu und die Urgestalt des TestFlav?
§ 4: DIE AUSWERTUNG DER QUELLEN: HISTORISCHE SKEPSIS UND JESUSFORSCHUNG
Einführung
1. Dreizehn Einwände historischer Skepsis gegen die historische Auswertbarkeit der Jesusüberlieferung und Argumente zu ihrer Widerlegung
2. Hermeneutische Reflexion
3. Aufgaben
3.1. Der »Stürmerspruch« als authentisches Jesuslogion?
3.2. Ist Jesus eine Erfindung der dritten Christengeneration?
ZWEITER TEIL: DER RAHMEN DER GESCHICHTE JESU
§ 5: DER ZEIT- UND RELIGIONSGESCHICHTLICHE RAHMEN DES LEBENS JESU
Einführung
1. Grundzüge des allgemeinen Judentums (»Common Judaism«) in hellenistischer und römischer Zeit
2. Die älteren innerjüdischen Erneuerungsbewegungen des 2. Jh. v.Chr
2.1. Die Spaltung der traditionellen Aristokratie in der Zeit der hellenistischen Reform
2.2. Der Aufstand gegen die hellenistischen Reformer und die seleukidischen Herrscher
2.3. Die Entstehung der drei traditionellen Religionsparteien in makkabäischer Zeit
2.4. Die Unterschiede zwischen Sadduzäern, Pharisäern und Essenern nach Josephus (im 1. Jh. n.Chr.)
2.5. Die Entwicklung im Laufe des 1. Jh. n.Chr. und das Verhältnis Jesu zu den alten »Religionsparteien«
3. Die Entstehung der jüngeren inneijüdischen Erneuerungsbewegungen des 1. Jh. n.Chr
3.1. Die messianischen Bewegungen im »Räuberkrieg« 4 v.Chr
3.2. Die radikal-theokratische Lehre des Judas Galilaios (6 n.Chr.)
3.3. Die prophetische Opposition: Die Bewegungen Johannes des Täufers und anderer Propheten
4. Zusammenfassung und hermeneutische Reflexion
5. Aufgaben
5.1. Jesus im Rahmen der Propheten des 1. Jh. n.Chr
5.2. Der »Lehrer der Gerechtigkeit« und der »gottlose Priester«
§ 6: DER CHRONOLOGISCHE RAHMEN DES LEBENS JESU
Einführung
1. Der Rahmen der Geschichte Jesu (Relative Chronologie)
2. Das Jahr der Geburt Jesu
3. Das öffentliche Wirken Jesu
4. Der Tod Jesu
5. Zusammenfassung und hermeneutische Reflexion
6. Aufgaben
6.1. Der Todestag Jesu
§ 7: DER GEOGRAPHISCHE UND SOZIALE RAHMEN DES LEBENS JESU
Einführung
1. Der Geburtsort Jesu: Nazareth
2. Das Zentrum des Wirkens Jesu: Kapernaum
3. Die Wanderungen Jesu: Galiläa und Umgebung
3.1. Die ethno-kulturellen Spannungen zwischen Juden und Heiden
3.2. Sozio-ökologische Spannungen zwischen Stadt und Land
3.3. Sozio-ökonomische Spannungen zwischen Reichen und Armen
3.4. Sozio-politische Spannungen zwischen Herrschern und Beherrschten
3.5. Die religiöse Eigenart Galiläas
4. Der Ort der Passion: Jerusalem
4.1. Der strukturelle Gegensatz von Stadt und Land in der Passionsgeschichte
4.2. Orte und Wege in der Passionsgeschichte
5. Hermeneutische Überlegungen
6. Aufgaben
6.1. Petronius und der Widerstand gegen das Kaiserstandbild
6.2. Jesus und Sepphoris
Aufgabe zu den §§ 5–7: Chronologische Übersicht
DRITTER TEIL: DAS WIRKEN UND DIE VERKÜNDIGUNG JESU
§ 8: JESUS ALS CHARISMATIKER: JESUS UND SEINE SOZIALEN BEZIEHUNGEN
Einführung
1. Phasen der Forschungsgeschichte
2. Die Quellen: Die Apophthegmen
3. Jesus und seine Familie
3.1. Jesus als Davidide
3.2. Die Davidssohnschaft Jesu als messianisches Postulat
4. Jesus und sein Lehrer: Johannes der Täufer
4.1. Die Quellen über Johannes den Täufer und ihre Auswertung
4.1.1. Die Einordnung des Täufers in die Zeitgeschichte
4.1.2. Die Lehre des Täufers
4.1.3. Die heilsgeschichtliche Einordnung des Täufers: das christliche Täuferbild und das Selbstverständnis des Johannes
4.2. Die urchristliche Überlieferung von Jesu Taufe
4.3. Jesus und der Täufer – ein Vergleich
4.4. Die Entwicklung vom Täufer zu Jesus
4.4.1. Jesu Berufungserfahrung?
4.4.2. Jesu Wundererfahrung
5. Jesus und seine Jünger
5.1. Die Berufungsgeschichten in den Evangelien
5.2. Analogien zu Nachfolge und Jüngerschaft in der Umwelt
5.3. Merkmale der Jüngerschaft
6. Jesus und seine Anhänger im Volk
6.1. Jesus und die Volksmenge
6.2. Jesus und die familia dei
7. Jesus und die Frauen in seinem Umfeld
7.1. Frauen im Umfeld Jesu
7.2. Die Lebenswelt von Frauen als bildspendender Bereich der Verkündigung Jesu
8. Jesus und seine Gegner
8.1. Die Schriftgelehrten
8.2. Die Pharisäer
8.3. Die Sadduzäer
8.4. Die Herodianer
9. Zusammenfassung und hermeneutische Reflexion
10. Aufgaben
10.1. Johannes der Täufer und Jesus: bleibende Übereinstimmungen
10.2. Johannes der Täufer und Jesus: unvereinbar?
10.3. Jesus und seine Gegner: Pharisäer
§ 9: JESUS ALS PROPHET: DIE ESCHATOLOGIE JESU
Einführung
1. Das Verständnis der Eschatologie Jesu von A. Ritschl bis zur Gegenwart: Sechs Phasen der Forschung
2. Die Metapher vom Königtum Gottes als (erste) geschichtliche Voraussetzung der eschatologischen Verkündigung Jesu
2.1. Zum Ursprung der Vorstellung vom Königtum Gottes
2.2. Die theokratische Vorstellung vom Königtum Gottes in nachexilischer Zeit
2.3. Die eschatologische Erwartung des Königtums Gottes in exilisch-nachexilischer Zeit
3. Die Apokalyptik als (zweite) geschichtliche Voraussetzung der eschatologischen Verkündigung Jesu
3.1. Prophetie und Apokalyptik: ein idealtypischer Vergleich
3.2. Apokalyptische Aussagen über das Reich Gottes in zwischentestamentarischer Zeit
3.3. Nichtapokalyptische Aussagen über das Reich Gottes in zwischentestamentarischer Zeit
3.4. Das Nebeneinander von futurischen und präsentisch-zeitlosen Aussagen über Gottes Königtum in Gebet und Liturgie
4. Das Verhältnis von Gegenwart und Zukunft in der Verkündigung Jesu
4.1. Die zukünftige Gottesherrschaft
4.2. Die gegenwärtige Gottesherrschaft
4.2.1. Erfüllungsworte
4.2.2. Kampfworte
4.2.3. Anbruchsworte
4.3. Die Verbindung von Gegenwart und Zukunft im Vaterunser
5. Das Verhältnis von Gericht und Heil in der Verkündigung Jesu
5.1. Die Gerichtspredigt Jesu
5.1.1. Die Verantwortung für Heil und Unheil im Gericht
5.1.2. Bilder und Metaphern für das Gericht
5.1.3. Die Zeit des Endgerichtes
5.1.4. Die Adressaten der Gerichtspredigt
5.2. Die Heilspredigt Jesu
5.2.1. Das Heil für die Heiden außerhalb Israels
5.2.2. Das Heil für deklassierte Gruppen im Innern Israels
5.2.3. Das Heil als neue Rechts- und Sozialordnung in der Gottesherrschaft
5.3. Die Einheit von Heils- und Gerichtspredigt, von Zukunfts- und Gegenwartseschatologie
6. Zusammenfassung und hermeneutische Reflexion
7. Aufgaben
7.1. Zur Forschungsgeschichte
7.2. Läßt Jesu Gerichts Vorstellung »den Vorgang des Richtens hinter sich«?
§ 10: JESUS ALS HEILER: DIE WUNDER JESU
Einführung
1. Sechs Phasen der Diskussion über die Wunder Jesu
2. Die urchristlichen Wundergeschichten
2.1. Exorzismen
2.2. Therapien
2.3. Normen wunder
2.4. Geschenkwunder
2.5. Rettungswunder
2.6. Epiphanien
2.7. Zusammenfassende Übersicht
3. Urchristliche Wunderüberlieferung als Auswirkung des historischen Jesus: Die Vielfalt der Zeugnisse
3.1. Zeugen für die Wunderüberlieferung mit verschiedenen Interessen
3.2. Wunderüberlieferung in verschiedenen Traditionsschichten
3.3. Wunderüberlieferung in verschiedenen Formen und Gattungen
3.4. Die urchristliche Wunderüberlieferung als Auswirkung des historischen Jesus und als urchristliche Dichtung
4. Jesus als Wundertäter im Vergleich zu zeitgenössischen Wundertätern
4.1. »Theios Aner«: der göttliche Mensch
4.2. War Jesus ein Magier? – Exkurs: Magische und charismatische Wunder
4.3. Rabbinische Wundercharismatiker
4.4. Jüdische Zeichenpropheten des 1. Jh. n.Chr
4.5. Das Proprium der Wunder Jesu
5. Zusammenfassung und hermeneutische Reflexion
6. Aufgaben
6.1. Glaube und Unglaube
6.2. Wundertäter und Götterliebling
§ 11: JESUS ALS DICHTER: DIE GLEICHNISSE JESU
Einführung
1. Phasen der Gleichnisauslegung seit A. Jülicher
2. Formen bildlicher Rede
2.1. Die Differenzierung von Gleichnis und Allegorie: Die Entdeckung des »one-point-approach« und seine Relativierung
2.2. Differenzierungen unter den Gleichnissen (i.w.S.): Bildworte, Gleichnisse (i.e.S.), Parabeln und Beispielerzählungen
3. Gleichnisse als Erzählungen
3.1. Das Verhältnis von Metapher und Erzählung im Gleichnis
3.2. Die Gleichnisanfänge
3.3. Die Erzählstruktur der Gleichnisse
3.4. Der Gleichnisschluß (Anwendung)
3.5. Die literaturgeschichtliche Einordnung der Gleichnisse – Exkurs: Die Authentizität der Gleichnisse Jesu
3.6. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg (Mt 20,1–16) im Rahmen rabbinischer Lohngleichnisse – ein Beispiel
4. Zusammenfassende Darstellung und hermeneutische Überlegungen
5. Aufgaben
5.1. Formen bildlicher Rede
5.2. Der gütige Arbeitgeber (Mt 20,1–16): dort Verdienst, hier Gnade?
§ 12: JESUS ALS LEHRER: DIE ETHIK JESU
Einführung
1. Phasen der Forschungsgeschichte
2. Jesus als Lehrer (Rabbi)
2.1. Die Bildung Jesu
2.2. Die Heiligen Schriften in Jesu Lehre
3. Jesu Ethik zwischen Thoraverschärfung und Thoraentschärfung
3.1. Die Thora im Judentum
3.2. Grundsätzliche Aussagen zur Thora in der Jesusüberlieferung: Die Ambivalenz gegenüber der Thora
3.3. Normverschärfung in der Jesusüberlieferung
3.3.1. Die Antithesen der Bergpredigt
3.4. Normentschärfung in der Jesusüberlieferung
3.4.1. Jesus und das Reinheitsgebot
3.4.2. Jesus und das Sabbatgebot
3.5. Das Verhältnis von Normverschärfung und –entschärfung in der Ethik Jesu
4. Jesu Ethik zwischen weisheitlicher und eschatologischer Motivation
4.1. Weisheit und Eschatologie im Judentum
4.2. Weisheitliche Motive in der Ethik Jesu
4.3. Eschatologische Motive in der Ethik Jesu
4.4. Das Verhältnis von weisheitlichen und eschatologischen Motiven in der Ethik Jesu und die Bedeutung der Thora
5. Das Liebesgebot als Zentrum der Ethik Jesu
5.1. Das Doppelgebot der Liebe: Übersicht zum Textbefund und den Tendenzen bei den Synoptikern
5.2. Jüdische Traditionen zum Doppelgebot der Liebe
5.3. Das urchristliche Doppelgebot im Rahmen jüdischer Traditionen
5.4. Die Ausweitung des Nächstenbegriffes auf den Fremden im Gleichnis vom barmherzigen Samariter
5.5. Die Ausweitung der Nächstenliebe im Gebot der Feindesliebe
5.6. Die Ausweitung der Nächstenliebe in der Begegnung Jesu mit den Deklassierten
6. Zusammenfassung und hermeneutische Reflexion
7. Aufgaben
7.1. Zur Bildung Jesu
7.2. Jesu Ethik als Protest gegen die jüdische Gesetzlichkeit?
7.3. Gottesdienst und Sorge um das tägliche Brot
7.4. Jesu Ethik und die Essener
VIERTER TEIL: PASSION UND OSTERN
§ 13: JESUS ALS KULTSTIFTER: DAS LETZTE MAHL JESU UND DAS URCHRISTLICHE ABENDMAHL
Einführung
1. Forschungsgeschichte zum Abendmahl
2. Abendmahlstexte und Abendmahlstypen im Urchristentum
2.1. Die synoptischen und paulinischen Einsetzungsworte
2.2. Urchristliche Abendmahlstypen neben dem paulinisch-synoptischen Typ
2.3. Überblick über Abendmahlstypen und –texte
2.4. Die Rekonstruktion der ältesten Abendmahlsworte
3. Das letzte Mahl Jesu im Kontext des Passafestes
3.1. Jesu letztes Mahl – ein Passamahl?
3.2. Kritik an der Deutung des letzten Mahls als Passamahl
4. Das letzte Mahl Jesu im Kontext seiner Todeserwartung
4.1. Die Jüngerflucht
4.2. Das gewaltsame Geschick der Propheten
4.3. Das Gleichnis: von den bösen Winzern (Mk 12,1–9 par.)
4.4. Mk 14,25 – Ausdruck eschatologischer Naherwartung oder Todesprophetie Jesu?
5. Das letzte Mahl Jesu im Kontext seines Konflikts mit dem Tempel
5.1. Die Tempelreinigung als kultkritische Symbolhandlung
5.2. Das letzte Mahl als kultstiftende Symbolhandlung
6. Zusammenfassung und hermeneutische Überlegungen
7. Aufgaben
7.1. Urchristliche Mahlformen: Bedingungen für die Teilnahme am Abendmahl
7.2. Jesus als Kultkritiker?
§ 14: JESUS ALS MÄRTYRER: DIE PASSION JESU
Einführung
1. Phasen und Ansätze in der Forschungsgeschichte
2. Die Tendenz der Quellen
2.1. Die Römer in den Quellen
2.2. Die Jerusalemer Lokalaristokratie in den Quellen
2.3. Das Volk (ὄχλος; λαός) in den Quellen
2.4. Das Jesusbild in den Quellen
2.5. Das Bild der Jünger in den Quellen
3. Die Rolle der Römer beim Vorgehen gegen Jesus
3.1. Formal-rechtliche Aspekte
3.2. Der sachliche Grund für das Vorgehen der Römer gegen Jesus
3.3. Der Anhalt im Wirken Jesu
4. Die Rolle der Jerusalemer Lokalaristokratie beim Vorgehen gegen Jesus
4.1. Formal-rechtliche Aspekte: Das Prozeßrecht der Mischna
4.2. Der sachliche Grund für das Vorgehen des Synhedriums gegen Jesus
4.3. Der Anhalt im Wirken Jesu
5. Die Rolle des Volkes beim Vorgehen gegen Jesus
5.1. Formal-rechtlicher Aspekt: die Passaamnestie
5.2. Sachliche Gründe für die Haltung des Volkes
5.3. Der Anhalt beim historischen Jesus
6. Zusammenfassung und hermeneutische Überlegungen
7. Aufgaben
7.1. Wichtige außerchristliche Quellen zur Rechtslage
7.2. Zur Frage nach der »Schuld am Tod Jesu«
7.3. Der Pilatusbrief: eine Quelle über die Passion aus dem 2. Jh.
§ 15: JESUS ALS AUFERSTANDENER: OSTERN UND SEINE DEUTUNGEN
Einführung
1. Sechs Phasen in der Diskussion um den Osterglauben
2. Die Quellen des Osterglaubens und ihre Ausweitung
2.1. Die Gattungen und Formen der Ostertexte
2.1.1. Die Formeltradition
2.1.2. Die Erzähltradition
2.1.3. Zusammenfassender Überblick über die Gattungen und Formen der Ostertexte
2.2. Formel- und Erzählüberlieferung – inhaltliche Parallelen und Differenzen
2.3. Die Formelüberlieferung der Erscheinungen: 1 Kor 15,3–8
2.4. Die Erzählüberlieferung
2.4.1. Synopse zu den Ostererscheinungen: Textvergleich der vier Evangelien
2.4.2. Die Ostererscheinungen in den Evangelien: Redaktionelle Tendenzen
2.5. Die Ostererzählungen der Evangelien: Ihre historische Auswertung
2.5.1. Die Gruppenerscheinung vor den Jüngern
2.5.2. Die umstrittene Ersterscheinung: Maria Magdalena oder Petrus?
2.5.3. Das umstrittene leere Grab
3. Zusammenfassung und hermeneutische Reflexion
4. Aufgaben
4.1. Forschungsgeschichtliche Einordnung
4.2. Der älteste Bericht über die Auferstehung Jesu (PEv 8,28–11,49)
§ 16: DER HISTORISCHE JESUS UND DIE ANFÄNGE DER CHRISTOLOGIE
Einführung
1. Drei Phasen der Erforschung neutestamentlicher Christologie
2. Jesus der Charismatiker: implizite Christologie beim historischen Jesus
2.1 Die Amen-Formel
2.2. Das betonte »Ich« Jesu in den Antithesen und den Sprüchen vom Gekommensein Jesu
2.3. Die Verwendung der Vatermetaphorik
2.4. Die Sündenvergebung
2.5. Die Kausalattribution der Wunder
2.6. Die Wertschätzung des Täufers
3. Jesus als Messias: evozierte Christologie beim historischen Jesus
3.1. Die beiden alttestamentlichen Wurzeln der Messiaserwartung
3.1.1. Die Gesalbten des AT
3.1.2. Messianische Gestalten des AT
3.2. Die Pluralität der Messiaserwartungen in neutestamentlicher Zeit
3.2.1. Eschatologische Erwartung messianischer Gestalten mit »Messias«-Begriff
3.2.2. Eschatologische Erwartungen messianischer Gestalten ohne Messiasbegriff
3.2.3. Die Usurpation messianischer Erwartungen durch politische Herrscher
3.2.4. Eschatologische Erwartungen ohne messianische Gestalt
3.3. Jesus und die Messiaserwartungen seiner Zeit
3.3.1. Der Textbefund zum Verhältnis des historischen Jesus zum Messiastitel
3.3.2. Jesu Konfrontation mit Messiaserwartungen während seines Lebens
3.3.3. Die Neudeutung der Messianität Jesu nach Kreuz und Ostern
4. Jesus als Menschensohn: eine explizite Christologie beim historischen Jesus?
4.1. Die beiden Sprachtraditionen hinter den Menschensohnworten: Alltags- oder Visionssprache?
4.2. Die Menschensohnworte in der Jesusüberlieferung: Der Befund
4.2.1. Die Worte vom gegenwärtig wirkenden Menschensohn
4.2.2. Die Worte vom zukünftigen Menschensohn
4.2.3. Die Worte vom leidenden Menschensohn
4.3. Der historische Jesus und der Ausdruck »Menschensohn«
5. Die Verwandlung des Jesusbildes durch Kreuz und Ostern
5.1. Vom Messias zum Sohn Gottes
5.2. Vom Menschensohn zum neuen Menschen
5.3. Von der Nachfolge Jesu zur Verehrung des Kyrios
6. Zusammenfassung und hermeneutische Reflexion
7. Aufgaben
7.1. Zum Messiastitel: PsSal 17
7.2. Zum Menschensohntitel: 4Esra 13
7.3. Zum Sohn-Gottes-Titel: 4Q
Rückblick: Ein Leben Jesu in Kurzfassung
Lösungen
Literaturnachtrag
Stellenregister
Personen- und Sachregister
HÄUFIGER ZITIERTE LITERATUR UND IHRE ABKÜRZUNGEN
Quellen und Quellensammlungen
Wenn nicht anders vermerkt, wird aus den folgenden Textausgaben, Quellensammlungen und Übersetzungen zitiert (Kurztitel in Klammern). Qumranschriften werden i.d.R. nach Maier zitiert (andernfalls ist Lohse vermerkt), teilweise wurden aber seit langem gebräuchliche Stellenangaben (neben Maiers Neuzuweisung) beibehalten, um das Wiederfinden von Stellen in älterer Literatur zu erleichtern (z.B. 4QFlor I,10–13/nach Maier: 4Q 174 III, 10–13). Bei der Wiedergabe älterer Übersetzungen (z.B. Clementz, Goldschmidt) wurde die Orthographie gelegentlich modernisiert.
Barrett, C.K./Thornton, C.-J. (Hg.), Texte zur Umwelt des Neuen Testaments (UTB 1591), Tübingen 21991. (Barrett/Thornton)
Bauernfeind, O./Michel, O. (Hg.), Flavius Josephus, De Bello Judaico – Der Jüdische Krieg, Griechisch – Deutsch, 4 Bde, München 1959–1969.
Becker, J., Die Testamente der zwölf Patriarchen (JSHRZ III/l), Gütersloh 1974.
Berger, K., Das Buch der Jubiläen (JSHRZ II/3), Gütersloh 1981.
(Strack, H./) Billerbeck, P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, Bd. I-IV, München 1922–28. (Bill.)
Goldschmidt, L., Der Babylonische Talmud, Berlin 1897–1935.
Dion Chrysostomos, Sämtliche Reden, eingeleitet, übersetzt und erläutert von W. Elliger (Bibliothek der Alten Welt), Zürich/Stuttgart 1967.
Epictetus, Epicteti Dissertationes, ed. H. Schenkl (BibliothecaTeubneriana), Tübingen 1894.
Epiktet, Teles und Musonius, Wege zu glückseligem Leben, übertragen und eingeleitet von W. Capelle, Zürich 1948.
Fischer, J.A. (Hg.), Die apostolischen Väter, Darmstadt 91986. (J.A. Fischer, Die apostolischen Väter)
Flavii Iosephi opera ed. B. Niese, Berlin 1887ff.
Flavius Josephus’ Lebensbeschreibung, übers, und eingeleitet von L. Haefeli (NTAXI/4), Münster 1925.
Des Flavius Josephus Jüdische Altertümer. Übersetzt… v. H. Clementz, 2 Bde, Berlin/Wien 1923.
Holm-Nielsen, S., Die Psalmen Salomos (JSHRZ IV/2), Gütersloh 1977.
Kraft, H. (Hg.), Eusebius von Caesarea: Kirchengeschichte, München 1967.
Lohse, E., Die Texte aus Qumran. Hebräisch und Deutsch, 2 Bde, Darmstadt 1971.
Maier, J., Die Qumran-Essener: Die Texte vom Toten Meer, Bd. I (UTB 1862); Bd. II (UTB 1863), München 1995.
Meisner, N., Aristeasbrief (JSHRZ II/1), Gütersloh 1973.
Die Mischna, Text, Übersetzung und ausführliche Erklärung hg. von G. Beer/O. Holtzmann/S. Krauß: ’Abôt (Väter), hg. v. K. Marti /G. Beer, Gießen 1927.
Pelletier, A., Lettre D’Aristée à Philocrate (Sources Chrétiennes), Paris 1962.
Philonis Alexandrini opera quae supersunt, ed. L. Cohn, editio minor, I-VI, Berlin 1886–1915.
Philo von Alexandrien. Die Werke in deutscher Übersetzung, hg. v. L. Cohn, I. Heinemann, M. Adler und W. Theiler, Bd. 1–6.7; Breslau 1909–1938.1964.
Philostratos, Das Leben des Apollonios von Tyana. Griech.-Dt., Hrsg., übers, u. erl. von Vroni Mumprecht (Sammlung Tusculum), München/Zürich 1983.
Plutarch, Große Griechen und Römer, eingeleitet und übersetzt von K. Ziegler (Bibliothek der Alten Welt), Bd. V, Zürich 1960.
Ritter, A. M. (Hg.), Alte Kirche. Kirchen und Theologiegeschichte in Quellen I, Neukirchen 51991. (A. M. Ritter (Hg.), Theologiegeschichte I)
Schneemelcher, W., Neutestamentliche Apokryphen, Bd. 1: Evangelien, Tübingen 51987; Bd. 2: Apostolisches, Apokalypsen und Verwandtes, Tübingen 51989. (NTApo 1/2)
Schreiner, J., Das 4. Buch Esra (JSHRZ V/4), Gütersloh 1981.
Schunk, K.-D., 1. Makkabäerbuch (JSHRZ 1/4), Gütersloh 1980.
Lucius Annaeus Seneca, Philosophische Schriften: Lateinisch und Deutsch, hg. v. M. Rosenberg, V.: De Clementia. De Beneficiis, Darmstadt 1989.
Stern, M., Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, Vol. 1–3, Jerusalem 1974–1984. (GLAJJ + Nr. der zitierten Quelle)
Gaius Suetonius Tranquillus, Das Leben der Caesaren, hrsg. von A. Lambert (dtv text-bibliothek), München 1972.
P. Cornelius Tacitus, Historien (lat-dt), hrsg. von J. Borst u.a. (Tusculum), München 41979.
Testamenta XII Patriarcharum ed. … M. de Jonge, Leiden 1964.
Uhlig, S., Das äthiopische Henochbuch (JSHRZ V/6), Gütersloh 1984.
Walter, N., Pseudepigraphische jüdisch-hellenistische Dichtung: Pseudo-Phokylides… (JSHRZ IV/3), Gütersloh 1983.
Wengst, K. (Hg.), Schriften des Urchristentums. Didache (Apostellehre), Barnabasbrief, Zweiter Klemensbrief, Schrift an Diognet, Darmstadt 1984. (K. Wengst, Didache)
Häufiger zitierte Literatur
Die im folgenden aufgeführten Titel werden im ganzen Buch mit Kurztitel* zitiert.
Berger, K., Formgeschichte des Neuen Testaments, Heidelberg 1984. (Formgeschichte*)
ders., Hellenistische Gattungen im Neuen Testament, ANRW II 25.2 (1984) 1031–1432.1831–1885. (Hellenistische Gattungen*)
ders., Einführung in die Formgeschichte (UTB 1444), Tübingen 1987. (Einführung*)
ders., Jesus als Pharisäer und frühe Christen als Pharisäer, NT 30 (1988) 231–262. (Jesus*)
Bornkamm, G., Jesus von Nazareth, Stuttgart 1956 141987. (Jesus*)
Bultmann, R., Die Geschichte der synoptischen Tradition (FRLANT 29), 1921 101995 (mit einem Nachwort von G. Theißen). (GST*)
ders., Jesus, Tübingen 1926 (GTB 17, Gütersloh 41970, mit einem Nachwort von W. Schmithals). (Jesus*)
ders., Theologie des Neuen Testaments, Tübingen 1953 (als UTB 630 mehrfach mit Nachträgen versehen, 91984). (Theologie*)
ders., Das Verhältnis der urchristlichen Christusbotschaft zum historischen Jesus, in: Exegetica, Tübingen 1967, 445–469. (Verhältnis*)
Burchard, C., Jesus von Nazareth, in: J. Becker u.a., Die Anfänge des Christentums, Stuttgart 1987,12–58. (Jesus*)
Crossan, J. D., The Historical Jesus. The Life of a Mediterranean Jewish Peasant, Edinburgh 1991; zitiert wird die dt. Übers.: Der Historische Jesus, München 1994. (Jesus*)
Dibelius, M., Die Formgeschichte des Evangeliums (BEvTh 54), Tübingen 1919 21933. (FG*)
Evans, C. A., Noncanonical Writings and New Testament Interpretation, Peabody 1992. (Noncanonical Writings*)
ders., Jesus and his Contemporaries (AGJU 25), Leiden/New York/Köln 1995. (Jesus*)
Flusser, D., Jesus, Hamburg 1968. (Jesus*)
Hengel, M., Die Zeloten. Untersuchungen zur jüdischen Freiheitsbewegung in der Zeit von Herodes I. bis 70 n.Chr. (AGJU 1), Leiden/Köln 21976. (Zeloten*)
Käsemann, E., Das Problem des historischen Jesus (1953), ZThK 51 (1954) 125–153 (= Exegetische Versuche und Besinnungen I, Göttingen 1960, 187–214). (Problem*)
Kümmel, W. G., Das Neue Testament. Geschichte der Erforschung seiner Probleme, Freiburg/München 1958, 2., erw. Aufl. 1970. (NT*)
Meier, J. P., A Marginal Jew. Rethinking the Historical Jesus, Vol. 1 The Roots of the Problem and the Person, New York, 1991; Vol. 2: Mentor, Message, and Miracles, New York 1994. (Marginal Jew 1/2*)
Sanders, E. P., Jesus and Judaism, Philadelphia 1985 31991. (Jesus*)
Schmidt, K. L., Der Rahmen der Geschichte Jesu, Berlin 1919. (Rahmen*)
Schürer, E., Die Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, Bd. I–III Leipzig 41901 – 41909. (Geschichte I/II/III* 41901 etc.)
Schürer, E., The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B. C.-A. D. 135), A New English Version Revised and Edited by G. Vermes & F. Millar, Vol. 1, Edinburgh 1973; Vol. 2,1979. (E. Schürer, History 1* (1973); 2* (1979))
Stegemann, H., Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und Jesus. Ein Sachbuch, Freiburg/Basel/Wien 1993. (Essener*)
Studying the Historical Jesus. Evaluations of the State of Current Research, ed. by B. Chilton and C. A. Evans, Leiden/New York/Köln 1994. (Studying*)
Theißen, G., Urchristliche Wundergeschichten (StNT 8), Gütersloh 1974. (Wundergeschichten*)
ders., Soziologie der Jesusbewegung, München 1977 61991. (Soziologie*)
ders., Studien zur Soziologie des Urchristentums (WUNT 19), Tübingen 1979, 3., erw. Aufl. 1989 (Studien*), darin:
– Wanderradikalismus. Literatursoziologische Aspekte der Überlieferung von Worten Jesu im Urchristentum, 79–105. (Wanderradikalismus*)
– Die Tempelweissagung Jesu. Prophetie im Spannungsfeld von Stadt und Land, 142–159. (Tempelweissagung*)
ders., Jesusbewegung als charismatische Wertrevolution, NTS 35 (1989) 243–360. (Jesusbewegung*)
ders., Lokalkolorit und Zeitgeschichte. Ein Beitrag zur Geschichte der synoptischen Tradition (NTOA 8), Freiburg Schweiz/Göttingen 1989 21992. (Lokalkolorit*)
ders., Theologie und Exegese in den neutestamentlichen Arbeiten von Günther Bornkamm, EvTh 51 (1991) 308–332. (Theologie*)
ders., Gruppenmessianisimus. Überlegungen zum Ursprung der Kirche im Jüngerkreis Jesu, JBTh 7 (1992) 101–123. (Gruppenmessianismus*)
Vermes, G., Jesus the Jew, 1973; zitiert wird die deutsche erweiterte Fassung: Jesus der Jude, Neukirchen 1993. (Jesus*)
Vielhauer, P, Geschichte der urchristlichen Literatur, Berlin/New York 1975. (Geschichte*)
Abkürzungen
Im allgemeinen werden für die biblischen Schriften und sonstige Quellen die Abkürzungen des Exegetischen Wörterbuches zum Neuen Testament verwendet, die übrigen Abkürzungen folgen meist der TRE. Abweichend bzw. darüber hinausgehend werden folgende Abkürzungen gebraucht:
BAR:
Biblical Archaeological Rewiev
GLAJJ:
M. Stern, Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, Vol. 1–3, Jerusalem 1974–1984
GMk:
Geheimes Markusevangelium
NEAEHL:
E. Stern (Hg.) The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land 1–4, Jerusalem 1993
NTApo 1/2:
W. Schneemelcher, Neutestamentliche Apokryphen, Bd. 1: Evangelien, Tübingen 51987; Bd. 2: Apostolisches, Apokalypsen und Verwandtes, Tübingen 51989
PEv:
Petrusevangelium
POx:
Oxyrhynchos-Papyrus
Syn; syn:
Synoptiker, synoptisch
ThEv:
Thomasevangelium (NHC II/2)
Sonstige Hinweise zur Literaturauswahl und Zitationsweise
Zu Beginn jedes Paragraphen und teilweise auch am Anfang einzelner Unterabschnitte finden sich Literaturblocks mit ausgewählten Titeln zum jeweiligen Thema, auf die im laufenden Paragraphen mit Kurztitel verwiesen wird. Vollständigkeit ist nicht angestrebt. Nicht enthalten sind in diesen Literaturübersichten vor ca. 1930 erschienene Titel und Literatur, die thematisch einem anderen Bereich zugehört. Diese werden in den Anmerkungen vollständig nachgewiesen.
§ 1: DIE GESCHICHTE DER LEBEN-JESU-FORSCHUNG
M. Baumotte (Hg.), Die Frage nach dem historischen Jesus. Texte aus drei Jahrhunderten (Reader Theologie), Gütersloh 1984; M.J. Borg, Jesus in Contemporary Scholarship, Valley Forge 1994; H. Braun, Der Sinn der neutestamentlichen Christologie, ZThK 54 (1957) 341–377; J.D. Crossan, The Cross that Spoke: The Origins of the Passion Narrative, San Francisco 1988; ders., Jesus*; G. Ebeling, Jesus und Glaube, ZThK 55 (1958) 64–110; E. Fuchs, Die Frage nach dem historischen Jesus, ZThK 53 (1956) 210–229; D. Georgi, Art. Leben-Jesu-Theologie/Leben-Jesu-Forschung, TRE 20 (1990) 566–575; E. Käsemann, Problem*; ders., Sackgassen im Streit um den historischen Jesus, Exegetische Versuche und Besinnungen II, Göttingen 1964,31–68; ders., Der Ruf der Freiheit, Tübingen 1968 1972; W.G. Kümmel, Vierzig Jahre Jesusforschung (1950–1990), BBB 91, Weinheim 1994 (Lit.!); S. Neill/T. Wright, The Interpretation of the New Testament 1861–1986, Oxford 1988; S. J. Patterson, The Gospel of Thomas and Jesus, Sonoma, CA 1993; E.P. Sanders, Jesus*; K.L. Schmidt, Rahmen*; H. Schürmann, Die vorösterlichen Anfänge der Logientradition, in: H. Ristow/K. Matthias (Hg.), Der historische Jesus und der kerygmatische Christus, Berlin 1960, 342–370; ders., Jesus. Gestalt und Geheimnis, Paderborn 1994; A. Schweitzer, Geschichte*; P. Stuhlmacher, Jesus als Versöhner. Überlegungen zum Problem der Darstellung Jesu im Rahmen einer biblischen Theologie des Neuen Testaments, in: Jesus Christus in Historie und Theologie (FS H. Conzelmann), hrsg. von G. Strecker, Tübingen 1975, 87–104 (= P. Stuhlmacher, Versöhnung, Gesetz und Gerechtigkeit. Aufsätze zur biblischen Theologie, Göttingen 1981, 9–26); G. Theißen, Theologie*; W. Wrede, Das Messiasgeheimnis in den Evangelien. Zugleich ein Beitrag zum Verständnis des Markusevangeliums, Göttingen 1901 1969.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!