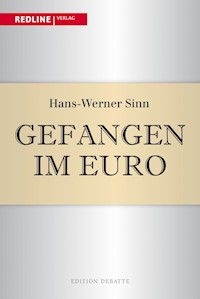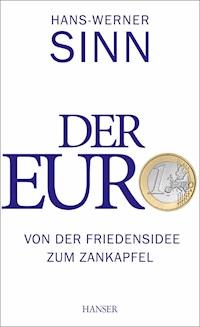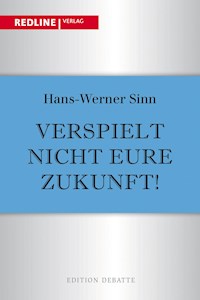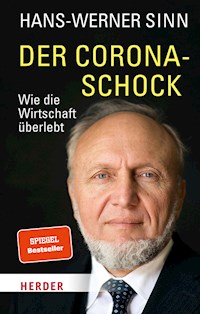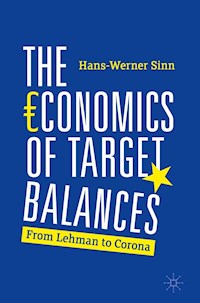Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Seit einigen Jahren bereits taumelt Europa von einer Krise in die nächste. Allen Beschwichtigungen zum Trotz verlieren Deutschland und die europäischen Staaten des Nordens durch den Euro unaufhörlich Milliardenvermögen zugunsten überschuldeter Volkswirtschaften in Südeuropa. 2015 erlebte der Kontinent dann einen kaum mehr beherrschbaren Flüchtlingsstrom. Und schließlich kam auch noch der Schwarze Juni 2016 – mit Brexit-Votum und wichtigem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Für Hans-Werner Sinn stellt dieser Monat mit seinen verheerenden Entscheidungen eine Zeitenwende dar, die sofortiges Handeln erfordert. In seinem kommenden, neuen Buch Der Schwarze Juni legt er daher nach einer profunden Analyse ein kompaktes 15-Punkte-Programm zur Neugründung Europas vor. Darin macht er auch vor einschneidenden Vorschlägen nicht halt, etwa der Drohung einer Änderungskündigung der EU-Verträge, um das europäische Zentralbankensystem zu reformieren und die Migrationsströme unter Kontrolle zu bringen. Nur so, davon ist Sinn überzeugt, kann eine weitere Verschärfung der europäischen Krise vermieden werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 576
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans-Werner Sinn
Der Schwarze Juni
Brexit, Flüchtlingswelle, Euro-Desaster – Wie die Neugründung Europas gelingt
3. korrigierte Auflage
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2016
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Gestaltungssaal
Umschlagmotiv: Shutterstock – Borislav Bajkic /Shutterstock – jack-sooksan
E-Book-Konvertierung: Daniel Förster, Belgern
ISBN (E-Book) 978-3-451-80876-0
ISBN (Buch) 978-3-451-37745-7
Die Geschichte hinter diesem Buch – Und Dank
Die Idee zu diesem Buch entstand bei einem Gespräch mit Jens Schadendorf, meinem langjährigen Lektor, nun Programmleiter im Herder-Verlag.
Wir hatten uns an einem sonnigen Nachmittag in meinem Büro getroffen und wollten eigentlich an etwas ganz anderem arbeiten. Schnell jedoch driftete unsere Diskussion zu jenen bahnbrechenden Ereignissen des Schwarzen Juni, die diesem Buch seinen Namen gaben. Je länger wir sprachen, desto klarer wurde, dass mit der Brexit-Entscheidung vom 23. Juni 2016 und der OMT-Entscheidung des deutschen Verfassungsgerichts vom 21. Juni innerhalb von nur zwei Tagen eine für Europa und Deutschland äußerst bedrohliche Gefährdungslage entstanden war.
Ich empfand die Ereignisse als eine Zeitenwende, die die Zukunft der EU, des Euro und Deutschlands maßgeblich verändern – falls den von ihnen ausgehenden Wirkungen nicht sofort gegengesteuert wird. Und mir war klar: Dieses Thema muss sofort bearbeitet und in die Öffentlichkeit getragen werden, damit es nicht wie sonst so oft im Nebel der Beschwichtigungsrhetorik der Politiker entschwindet.
Ich danke Jens Schadendorf und dem Herder-Verlag, dass sie sofort bereit waren, schon im Herbst diesen nun vorliegenden Debattenbeitrag herauszubringen. Die Idee war freilich das eine, die Umsetzung ein anderes. Meine Frau und ich warfen kurzerhand alle Urlaubspläne über den Haufen und ließen eine schon bezahlte Reise in die Mongolei verfallen, um Zeit für dieses Buch zu gewinnen. Ich danke ihr sehr für die Bestärkung und Toleranz, mit der sie seine Entstehung begleitet hat – so wie sie es in der Vergangenheit bei wichtigen Veröffentlichungen stets getan hat. Ihr Rat als Fachökonomin ist mir darüber hinaus auch diesmal wieder von allergrößtem Wert gewesen.
So ist nun in Tag- und Nachtarbeit innerhalb kürzester Zeit ein Buch entstanden, das zu meiner eigenen Überraschung sehr viel länger wurde, als es ursprünglich geplant war und nun auch schon wegen der hohen Nachfrage in der zweiten Auflage herauskommt. Dank eines Büros und personeller Unterstützung, die ich nach meiner Pensionierung im ifo Institut behalten durfte, gelang es, die notwendigen technischen Arbeiten, was die harten Daten betrifft, in dieser kurzen Zeit zu bewerkstelligen. Ich danke vor allem Florian Dorn, der das Manuskript von Anfang an mit betreut hat. Er hat nicht nur die in den Fußnoten genannten Quellen vervollständigt. Vielmehr hat er auch den gesamten Text gelesen und mich mit klugem Verstand stets kritisch unterstützt. Für die präzise Gestaltung der Abbildungen, die in einem vielfachen Iterationsprozess zwischen ihm und mir entstanden, danke ich Christoph Zeiner. Für die Bereitstellung der dafür und auch sonst nötigen präzisen Daten sowie für die sorgfältige Endlektüre geht mein Dank zudem an Wolfgang Meister.
Während des gesamten Entstehungsprozesses schließlich hat mir Jens Schadendorf als Sparringpartner zur Seite gestanden. Er hat das Manuskript mehrmals sorgfältig redigiert und mich immer wieder gedrängt, meine Gedanken einfacher und plastischer auszudrücken. Auch hat er dafür gesorgt, dass logische Brüche vermieden und dem Leser keine Gedankensprünge zugemutet wurden. Er hat mich zudem veranlasst, Farbe zu bekennen und mit einer konkreten Reformagenda für Europa zu enden.
Das war gut so, denn ich bin überzeugt, dass Europa mit dem am Ende des Buches abgedruckten Reformprogramm eine echte Chance hat, zu neuer Prosperität und einer nachhaltigen Entwicklung zurückzukehren, die hilft, seinen Frieden auch weiterhin zu sichern.
Auch deswegen widme ich dieses Buch den Bürgern Europas.
Hans-Werner Sinn
München, September 2016
Inhalt
Die Geschichte hinter diesem Buch – Und Dank
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Einleitung Scheitert Europa?
Kapitel 1 Der Brexit und die Spaltung Mitteleuropas
Eine klare Entscheidung
Bürokratie, Wirtschaft, Überfremdungsangst – Misstrauensvotum gegen die EU
Ein kaum zu ermessener Verlust für Europa
Was die Entscheidung für das Vereinigte Königreich bedeutet
Unzufriedene Franzosen, genervte Italiener – Wer geht als nächstes?
Verlust der Sperrminorität – Warum Deutschland besonders viel verlieren wird
Wo war die Politik?
Jetzt droht die Spaltung Mitteleuropas
Anmerkungen
Kapitel 2 Alle wollen nach Deutschland, doch so geht es nicht
Die Flüchtlingswelle
Schleusen öffnen sich – Wolfgang Schäuble und der unbedachte Skifahrer
Der mazedonische Zaun und andere Gegenmaßnahmen mit Kollateralschäden
Gesinnungsethik, Verantwortungsethik – Und vom Vorteil der spanischen Methode
Grundgesetz, Flüchtlingskonvention & Co – Die eigentlich eindeutige Rechtslage
Über Eigentumsrechte, Klubgüter und die Nützlichkeit von Zäunen
Die Arbeitsmarkteffekte: Eine etwas zynische Kalkulation der Ökonomen
Integrationsbremse Mindestlohn
Das Rentensystem: Der potenzielle Beitrag der Migranten
Wovon der Nettoeffekt der Migration auf das Staatsbudget abhängt
Nur Chefärzte aus Aleppo?
Starke Beanspruchung des Sozialstaates
Erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt?
Prognose der Nettokosten
Das unmögliche Migrationsdreieck: Warum die EU-Verträge falsch gestrickt sind
Anmerkungen
Kapitel 3 Der Weg in die Haftungsunion
Die OMT-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts: Genauso schwarz wie der Brexit
»Kostenlose« Kreditausfallversicherung von der EZB
Warum die Verluste auf die Steuerzahler durchschlagen werden
Niemand will es zugeben – Eurobonds durch die Hintertür
Haftung oder keine Haftung – Was wurde vereinbart?
Eine bescheidene Frage an das Hohe Gericht
Endlose Schuldenspirale trotz (angeblicher) Schuldenschranken
Eher DDR oder eher USA?
Europa wiederholt die Fehler aus den Anfangsjahren der USA
Sparer, Rentner, Stiftungen & Co – Warum Deutschland der große Verlierer der Niedrigzinspolitik ist
Geld horten, Bargeld abschaffen: Es geht nicht um Kleinkriminelle
Anmerkungen
Kapitel 4 Gigantomanie der Europäischen Zentralbank – Wie sich die Politik Rettungsschirme drucken lässt
Die große Geldschwemme
Wie Geld gemacht wird
Das Eurosystem
Erneut stark ansteigende Target-Salden
Drachmen, Lire und Peseten fluten Deutschland im Gewand des Euro
Risiken für die Überschussländer – Insbesondere für Deutschland
Die Europäische Zentralbank als Rettungsmaschine
Warum Yanis Varoufakis alle Zeit der Welt hatte – Und über Erpressbarkeit
Wo blieb das griechische Geld?
Mit dem QE-Programm der EZB brechen alle Dämme
Die EZB als Bad Bank der Eurozone – Verdeckte Hilfen für marode Banken
Eine Zeitbombe: Die große Umschuldungsaktion zu Lasten der Bundesbank – Und mögliche Konkurse von Notenbanken
Plan B: Vorbereitung für den Euro Med
Anmerkungen
Kapitel 5 Euro-Desaster, Flüchtlingswelle, Brexit – Und ein 15-Punkte-Plan zur Neugründung Europas
Eskalierende Krisen ohne Ende
Warum das europäische Modell in seiner heutigen Form nicht funktioniert
Sinnlose Hilfen – Und warum Deutschland jetzt die Änderung der EU-Verträge verlangen muss
Grundlegend für die Neukonstruktion Europas: das Pareto-Prinzip
I. Ein Reformprogramm für die Gesundung des Euro
Reformvorschlag 1: Die atmende Währungsunion
Reformvorschlag 2: Konkursordnung für Staaten
Reformvorschlag 3: Geldpolitik der Europäischen Zentralbank mit minimalem Risiko
Reformvorschlag 4: Tilgung der Target-Verbindlichkeiten
Reformvorschlag 5: EZB-Stimmrechte nach der Haftung und Größe der Mitgliedsländer
II. Ein Reformprogramm für die Steuerung der Migration von innen und von außen
Reformvorschlag 6: Heimatland- statt Gastlandprinzip für bedürftige EU-Bürger
Reformvorschlag 7: Inklusion der Asylanten, aber Asylanträge außerhalb der EU-Grenzen
Reformvorschlag 8: Grenzsicherung als EU-Aufgabe
Reformvorschlag 9: Hilfen für schwächer entwickelte EU-Nachbarstaaten
Reformvorschlag 10: Aussetzung des Mindestlohns, aber »Aktivierende Sozialpolitik«
Reformvorschlag 11: Punktesystem für hoch qualifizierte Migranten
Reformvorschlag 12: Freihandel und freier Kapitalverkehr ohne Arbeitnehmer-Freizügigkeit: Regeln für assoziierte EU-Mitglieder
III. Ein Schritt zurück, zwei Schritte nach vorn: Was Europa außerdem braucht
Reformvorschlag 13: Europaweite Netze
Reformvorschlag 14: Ein europäischer Subsidiaritätsgerichtshof
Reformvorschlag 15: Gemeinsame Armee, gemeinsame Sicherheitspolitik
Zum Abschluss: Der 15-Punkte-Plan zur Neugründung Europas auf einen Blick
I. Ein Reformprogramm für die Gesundung des Euro
II. Ein Reformprogramm für die Steuerung der Migration von innen und von außen
III. Ein Schritt zurück, zwei Schritte nach vorn: Was Europa außerdem braucht
Anmerkungen
Anhang zu Kapitel 2
Warum und in welchem Sinne das sozialstaatliche Inklusionsprinzip aus ökonomischer Sicht zu viel Migration anregt
Autoren- und Personenregister
Stichwort- und Institutionenregister
Der Autor
Abbildungsverzeichnis
1.1 Die regionale Aufteilung des Wahlergebnisses vom 23. Juni 2016
1.2 Nettozahlungen an die EU (2014)
1.3 Themen, die die Austrittsbefürworter als wichtig empfanden
1.4 Die wirtschaftliche Bedeutung des Vereinigten Königreichs in der EU, gemessen in BIP- und Bevölkerungsanteilen (2015)
1.5 Die Warenexporte und -importe des Vereinigten Königreichs (2015)
1.6 Nettoexporte des Vereinigten Königreichs in die EU nach Gütergruppen (2014)
1.7 Meinungsumfragen zur Zufriedenheit mit der EU
1.8 Stimmenanteil der europaskeptischen Parteien 51
1.9 Bevölkerungsanteile für potenzielle Sperrminorität im Ministerrat (35 %)
1.10 Deutschlands Außenhandel mit Waren (2014)
1.11 Der neue Euro-Staat?
2.1 Wanderungssaldo Deutschland (1975-2015)
2.2 Immigranten-Treck beim Weg durch Slowenien im Oktober 2015
2.3 Türken in Westeuropa (ohne eingebürgerte Personen)
2.4 Ertrunkene Flüchtlinge vor Europas Küsten – Gesinnungsethik versus Verantwortungsethik
2.5 Entscheidungen über 282.726 Asylanträge im Jahr 2015
2.6 Arbeitslose in Westdeutschland vor und nach der Agenda 2010 – Die Wirkung der impliziten Mindestlohnsenkung durch die Regierung Schröder
2.7 Alterspyramiden der einheimischen Bevölkerung und der neuen Migranten im Vergleich (2014)
2.8 Anteil der Ausländer an verschiedenen Gruppen von Empfängern staatlicher Sozialleistungen und an der Gesamtbevölkerung (2014/15)
2.9 Monatliches Nettoeinkommen der Migranten (Euro) inklusive der staatlichen Sozialtransfers im Vergleich zur Bevölkerung ohne Migrationshintergrund
2.10 Das Migrations-Trilemma
3.1 Die Spreizung der Zinsen auf zehnjährige Staatspapiere
3.2 Der Zuwachs der Schuldenquoten 2011-2015
3.3 Die Verletzungen des Defizitkriteriums nach dem Stabilitäts- und Wachstumspakt von 1996
3.4 Nettogläubiger und Nettoschuldner in der Eurozone (2015)
3.5 Die Zinsgewinne der GIPSIZ-Länder
3.6 Die deutschen Verluste aus den niedrigen Zinsen
3.7 Der Zinssatz auf Einlagen der Banken beim Notenbanksystem
4.1 Die Entwicklung der Target-Salden
4.2 Woher kommt das deutsche Geld?
4.3 Die Rettungskredite auf dem Höhepunkt der Krise (August 2012)
4.4 Die öffentlichen Kredithilfen der Staatengemeinschaft für Griechenland
4.5 Die Rentenniveaus der EU-Länder (2013)
4.6 Der Einfluss des QE-Programms auf die Zentralbankgeldmenge im Euroraum (bis August 2016)
4.7 Logo des EU-Med-Gipfels sowie Matteo Renzi und Alexis Tsipras auf diesem Gipfel im September 2016 in Athen
5.1 Die Änderung der Produzentenpreise relativ zum jeweiligen Rest der Euroländer und langfristige Zielmarken
Tabellenverzeichnis
1.1 Das Referendum vom 23. Juni 2016 im Vergleich zu Parlamentswahlen
1.2 Schildbürgerstreiche aus Brüssel
2.1 Die Bindungswirkung des Mindestlohns bei seiner Einführung am 1. Januar 2015
3.1 Die Begriffswelt der EZB
Einleitung Scheitert Europa?
Brexit, Flüchtlingswelle, Euro-Desaster – scheitert Europa? Kein Zweifel: Angesichts einer Vielzahl von eskalierenden Krisen könnte das nun passieren.
Es geschah zur Sonnenwende des Jahres 2016. Das sind eigentlich die hellsten Tage des Jahres, tatsächlich aber waren es die schwärzesten. Am 23. Juni gab Großbritannien sein Misstrauensvotum gegen die EU ab und entschied sich für den Austritt aus der EU. Statt des Grexit, den man noch im Jahr 2015 befürchtet hatte – und den man im Interesse der Griechen und Europas besser hätte geschehen lassen sollen –, wird nun tatsächlich der Brexit vorbereitet. Und das geschieht auch deshalb, weil die Briten angesichts der großen Flüchtlingswelle, die Europa kurz vorher überschwemmt hatte, zu der Auffassung gekommen waren, dass die EU die Lage nicht mehr im Griff hat.
Kaum zu glauben eigentlich: Um Griechenland hatte die Bundeskanzlerin gekämpft und dabei sogar ihren Finanzminister Wolfgang Schäuble, der den Grexit ermöglichen wollte, zurückgerufen. Den Austritt des Vereinigten Königreichs, der in wirtschaftlicher Hinsicht gleichbedeutend ist mit dem Austritt der zwanzig kleinsten der 28 EU-Länder, nimmt sie dagegen hin, als ginge er Deutschland nichts an. Nun sitzt sie da mit ihren Migranten und hofft vergebens darauf, dass wenigstens die anderen Länder, die noch bei Kasse sind, sich an deren Finanzierung beteiligen und noch ein paar von ihnen aufnehmen. Ihr Glück, dass der mazedonische Zaun die Welle zunächst einmal gestoppt hat.
Und nur zwei Tage vor dem Brexit-Entscheid, am 21. Juni, ist etwas passiert, das für die Zukunft Deutschlands ebenfalls sehr problematisch sein wird: Das deutsche Bundesverfassungsgericht unterwarf sich mit seinem sogenannten OMT-Urteil zur ausufernden Rettungspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) dem Europäischen Gerichtshof (EuGH), der diese Politik vollauf unterstützte. Auch dieses Votum und seine Wirkungen nahm die deutsche Politik kaum kommentiert hin. Es schien, als wolle sie es in Schweigen hüllen. Dabei gaben die Karlsruher mit ihrem Urteil der EZB nichts weniger als einen Freifahrtschein für eine Politik der Vergemeinschaftung der Haftung für Staatsschulden, denn das bedeutet das whatever it takes, das EZB-Chef Mario Draghi im Jahr 2012 unter dem technischen Kürzel Outright Monetary Transaction (OMT) verkündet hatte. Nutznießer dieser Politik sind vor allem die kriselnden Südländer Europas und Frankreich, Zahlmeister die noch einigermaßen gesunden Nordländer, allen voran Deutschland.
Zwar warf das Bundesverfassungsgericht zwei Jahre nach dem OMT-Beschluss den europäischen Währungshütern eine Mandatsüberschreitung vor und sprach in diesem Zusammenhang gar von »Machtusurpation«. In einem beispiellosen Schwenk jedoch schreibt das Gericht in seinem Urteil nun, man könne auch die Auslegung des EuGH, wonach die OMT-Politik der EZB mit europäischem Recht vereinbar sei, »noch hinnehmen«.
Beide Mittsommer-Entscheidungen sind von historischer, ja epochaler Bedeutung für die Zukunft Europas und Deutschlands. Sie stellen eine Zeitenwende dar. Vor allem aus deutscher Sicht machen sie den Juni zu einem pechrabenschwarzen Monat. Das ist das Thema dieses Buches.
Der anstehende Brexit bedeutet, dass Deutschland nun in der EU seinen wichtigsten Verbündeten für eine weltoffene und dem Freihandel verpflichtete EU-Politik verliert, ohne die die deutsche Exportwirtschaft nicht mehr funktionsfähig wäre. Ganz konkret verliert Deutschland, wie im ersten Kapitel dieses Buches ausführlich erläutert wird, zusammen mit anderen freihandelsorientierten Ländern die Sperrminorität bei Entscheidungen des EU-Ministerrates. Im Verbund mit Großbritannien und den Ländern des ehemaligen sogenannten D-Mark-Blocks Niederlande, Österreich und Finnland hatte Deutschland bislang sein Interesse an einer weltoffenen Handelspolitik in der EU verfolgen und auch durchsetzen können. Damit wird nun bald Schluss sein. Die mediterranen Länder, allen voran Frankreich, die eine eher protektionistische Handelspolitik verfolgen und die mehr auf Staatseingriffe vertrauen möchten als auf das freie Spiel der Marktkräfte, werden alles daransetzen, dass Europa wirtschafts- und handelspolitisch umsteuert. Wenn sich die Protektionisten durchsetzen, wird das exportorientierte Wohlstandsmodell Deutschlands massiv geschädigt.
Zudem wird sich die Eurozone ohne die britische Gegenkraft immer rascher zu einer Fiskalunion entwickeln, so wie sich das die Länder Südeuropas und Frankreich wünschen, um ihre schwindende Wettbewerbsfähigkeit mit Transfers aus dem Norden zu kompensieren. Eine Fiskalunion bedeutet nicht nur, dass es ein gemeinsames Euro-Budget und womöglich einen gemeinsamen Euro-Finanzminister gibt. Sie bedeutet auch, dass allerlei Umverteilungsmechanismen festgelegt werden – von einer Versicherung der Bankkonten bei den angeschlagenen Finanzinstituten bis hin zu einer europaweiten Arbeitslosenversicherung –, die permanente Einkommenshilfen für die nicht mehr wettbewerbsfähigen Länder Südeuropas als festen Rechtsanspruch installieren.
Die Eurozone in eine Fiskalunion zu verwandeln wird nicht nur teuer für Deutschland. Dieser Schritt ist auch insofern problematisch, als er impliziert, dass es immer unwahrscheinlicher wird, dass die osteuropäischen Länder oder Schweden den Euro als Währung übernehmen.
Wenn aber künftig keine nicht-mediterranen Länder mehr der Eurozone beitreten, dann wird das Eurosystem eine neue »lateinische Münzunion« mit Deutschland als Goldesel, die an der Ostseite Deutschlands einen tiefen Graben quer durch Mitteleuropa zieht und damit den historisch gewachsenen Kulturkreis durchschneidet. Die Parallelen zur echten lateinischen Münzunion sind verblüffend. Diese Währungsunion war unter Führung Frankreichs und unter Beteiligung vieler mediterraner Länder in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründet worden und zerbrach, weil sich Italien und Griechenland zu viel des Gemeinschaftsgeldes gedruckt hatten.
Heute stellt sich die Situation nicht viel anders dar. Heute sind die Krisenländer der Eurozone, vor allem jene in Südeuropa, ebenfalls wieder dabei, sich in großem Stil das benötigte Geld zu drucken, anstatt es sich am Kapitalmarkt zu leihen oder selbst zu verdienen. Die sogenannten Target-Salden in den Bilanzen von EZB und nationalen Notenbanken, die diesen Extra-Druck messen, wachsen seit zwei Jahren wiederum nahezu beständig an und haben mittlerweile einen Wert von fast 750 Milliarden Euro erreicht. Eine Trendwende ist nicht in Sicht.
Das Gefährliche daran ist: Das von den Euro-Krisenländern selbst gedruckte Geld wird derzeit vor allem dafür verwendet, im Ausland die eigenen Staatspapiere zurückzukaufen. Auf diese Weise tauschen diese Länder eine verbriefte, verzinsliche Schuld gegenüber privaten ausländischen Gläubigern gegen eine bloße Buchschuld bei den Notenbanken des Nordens, allen voran der Bundesbank, deren Zins der EZB-Rat mit den Stimmen derselben Länder auf null gesetzt hat und die nie fällig gestellt werden kann. Diese Schuld und die entsprechende Forderung bei der Bundesbank würden sich großenteils in Luft auflösen, wenn die Banken Südeuropas in Konkurs gingen und die südlichen Länder aus der Eurozone austräten.
Dass dieses Szenario alles andere als unmöglich ist, konnte man Anfang September 2016 erahnen, als sich die mediterranen Krisenländer und Frankreich in Griechenland überaus medienwirksam zum EU-Med-Gipfel trafen. Wenn nicht als konkrete Vorbereitung eines Austritts aus der Eurozone, so kann man diesen Gipfel doch zumindest als eine Vorbereitung für den Plan B deuten. Gemeint ist damit der Aufbau einer Drohkulisse für die demnächst wieder anstehenden Verhandlungen über immer mehr Schuldenerleichterungen, immer mehr Gemeinschaftskredite und immer mehr Transfers in die Krisenländer. Frankreich selbst will sicherlich nicht austreten. Doch hält es seine schützende Hand über die mediterranen Länder, weil es mit ihnen kulturell eng verbunden ist und enge Wirtschaftsbeziehungen unterhält, sowohl was den Absatz der französischen Waren als auch die Finanzierung der südlichen Volkswirtschaften durch die französischen Banken betrifft.
Vor diesem Hintergrund ist die OMT-Entscheidung von EuGH und Bundesverfassungsgericht verheerend, weil sie ein für allemal klarmacht, dass der EZB mit rechtlichen Mitteln nicht beizukommen ist. Die EZB kann fortan die Staatspapiere der Krisenländer unbegrenzt kaufen, wenn es darauf ankommt. Auf diese Weise kann sie diese Länder und deren Gläubiger so schützen, als hätte man sich bereits in gemeinschaftlicher Haftung mittels Eurobonds verschuldet. Das drückt die Zinsen und nimmt den Sparern ihre Erträge, obwohl diese Sparer in ihrer Eigenschaft als Steuerzahler und implizite Eigentümer der EZB zugleich weiterhin für die Ausfälle haften müssen. So gehen viele Euroländer immer weiter auf ihrem Weg in den Schuldensumpf, ohne dass ihnen juristische Schuldenschranken Einhalt gebieten könnten.
Wenn Deutschland angesichts all dieser falschen Weichenstellungen nicht schnellstens die Notbremse zieht, könnte es mit den Ländern der Eurozone ähnlich enden wie mit den USA, die in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens unter dem Einfluss einer Schuldensozialisierung in eine verhängnisvolle Schuldenspirale gerieten. In der Zeit von 1835 bis 1842 trieb diese Spirale ein Drittel der Staaten und staatsähnlichen Territorien in den Konkurs und schuf nichts als Unfrieden. Der britische Historiker Harold James von der Universität Princeton führte sogar einen Teil der Spannungen, die zwanzig Jahre später in den USA zum Bürgerkrieg führten, auf das Schuldendebakel zurück, das durch die Vergemeinschaftung der Schulden entstanden war.
So weit muss es mit Europa nicht kommen. Die Gefahren aber sind schon deutlich erkennbar. Mindestens werden die Deutschen in fünfzehn Jahren, wenn die Babyboomer ins Rentenalter kommen, erhebliche Probleme mit ihrer Altersvorsorge bekommen. Die Haftungsversprechen aus der Rettung Südeuropas könnten dann mit den nur noch schwer erfüllbaren Forderungen der Rentner gegen den deutschen Staat zusammenfallen und eine kaum noch beherrschbare wirtschaftliche Gemengelage erzeugen.
Natürlich ist es für den Frieden und die Einigung Europas gerechtfertigt, einen hohen Preis zu zahlen. Und auch der Freihandel, den die EU den Ländern Europas gebracht hat, ist seinen Preis wert, weil er allen Beteiligten wirtschaftlich nützt. Deutschland, das ebenfalls von diesem Freihandel profitiert, kann deshalb Maßnahmen der EU, die ihm zunächst finanziell zum Nachteil gereichen, ein ganzes Stück weit mittragen – nicht nur aus ökonomischen Gründen, sondern auch, wenn sie die europäische Einigung voranbringen. Dass Deutschland der größte Nettozahler der EU ist, kann man zum Beispiel als einen solch vertretbaren Preis interpretieren.
Doch erstens haben die Beiträge zum EU-Budget längst nicht die Dimension dessen, worum es bei einer Vergemeinschaftung der Haftung für Staatsschulden geht, und zweitens führt eine solche Vergemeinschaftung nicht nach Europa, sondern an einen anderen, gefährlichen Ort. Schon der Euro und die mit ihm bis heute verbundenen politischen Maßnahmen haben sich nicht als Friedens- und Integrationswerk, sondern als Krisentreiber und Herd des Unfriedens gezeigt.
Vor allem führte der Euro Südeuropa in eine kaum noch zu lösende Wirtschaftskrise mit einer gefährlichen Massenarbeitslosigkeit, die die Nerven der Bevölkerung nun schon seit mehr als acht Jahren strapaziert. Und er zwang die Staaten Nordeuropas, mit fiskalischen Rettungskrediten einzuspringen, die den privaten Gläubigern die Möglichkeit gaben, sich aus dem Staube zu machen, und sie selbst an deren Stelle setzte. Der deutsche Staat ist jetzt der hässliche Gläubiger, auf den sich der Zorn der Schuldner entlädt, und nicht mehr die französischen und deutschen Banken, nicht mehr die Wall Street und nicht mehr die City of London. »Bürge nicht für deinen Freund und leihe ihm kein Geld, denn wenn du das tust, ist er dein Freund gewesen«: Diese alte Volksweisheit hat die deutsche Politik in den vielen Krisen rund um den Euro sträflich missachtet. Den Preis dafür zahlen wir heute – und noch stärker in der Zukunft.
Das ist ja das Problem. Nicht alles, was gut gemeint war, wirkt auch am Ende gut. Die Politiker in Europa – ob in Brüssel oder den Hauptstädten – treffen Entscheidungen, von denen sie glauben oder glauben machen möchten, sie würden den Einigungsprozess voranbringen. Das Gegenteil aber tritt ein. Und doch korrigiert kaum jemand den beschrittenen Weg. Fast will es scheinen, als könne niemand mehr dazulernen.
Bei nüchterner Betrachtung ist das fast verständlich. Das politische Führungspersonal investiert gewissermaßen sein politisches Schicksal in seine Entscheidungen. Es baut dabei Partei- und Bürokratieapparate auf, die Abertausenden von Menschen lukrative Berufskarrieren eröffnen. Auf diese Weise entstehen strukturelle Abhängigkeiten, die bewirken, dass sich kaum noch etwas Einschneidendes ändern lässt, weil zu viele in den Apparaten etwas zu verlieren haben. Die Folge ist, dass alles bleibt, wie es war, dass die immer gleichen rhetorischen Formeln zu hören sind und dass stur die immer gleichen Meinungen vertreten werden.
Kein Zweifel: Wenn die EU-Verträge die ever closer union, also die immer enger zusammenwachsende Union, proklamieren, wenn die Kanzlerin einen einmal eingeschlagenen Weg als »alternativlos« bezeichnet, wenn EU-Politiker das Beispiel des Fahrrads bemühen, das umkippt, wenn es nicht weiterfährt, dann schwingt darin schon viel von jenem gefährlichen Starrsinn mit, der in der Menschheitsgeschichte Systeme immer wieder untergehen ließ. »Vorwärts immer, rückwärts nimmer«, erklärte der Staatsratsvorsitzende Erich Honecker bei seiner Festrede aus Anlass des 40. Jahrestages der DDR noch am 7. Oktober 1989. Das war nur zwei Tage vor der entscheidenden Montagsdemonstration am 9. Oktober, die den Untergang der DDR besiegelte, und einen Monat vor dem Fall der Mauer.
Wut und Frust über »die Politiker« und »die Eurokraten« nehmen in den europäischen Ländern zu – auch in Deutschland. Vielen Bürgern reicht es mittlerweile. Auch vielen, die gewohnt sind, in komplexen Zusammenhängen unterwegs zu sein. Sie wollen sich nicht mehr mit rhetorischen Floskeln oder Durchhalteparolen abspeisen lassen. Das gilt für den Euro und Europa insgesamt. Es gilt besonders für den Umgang mit den Flüchtlingen und Wirtschaftsmigranten. Zu Recht verlangen die Bürger, dass man sie ernst nimmt mit ihren Sorgen um die Zukunft Deutschlands und Europas. Zu Recht verlangen sie, dass jetzt umgesteuert wird.
In der Tat, statt auf dem falschen Weg noch schneller voranzuschreiten und die britische Brexit-Entscheidung einfach abzuhaken, sollten die Europäer nun innehalten und die Marschrichtung verändern. Sie sollten auf die in diesem Votum zum Ausdruck kommende britische Kritik an der EU mit ernsthaften Reformen antworten.
Die Reaktion der EU-Kommission und der Spitze des Europaparlaments, die Großbritannien nun zum schnellen Austritt drängt, um wieder zur Tagesordnung übergehen zu können, ist in diesem Zusammenhang anmaßend und vollständig unakzeptabel. Großbritannien ist und bleibt eine der großen Nationen Europas, mit denen wir auch weiterhin gutnachbarschaftlich und in regem wirtschaftlichen Austausch zusammenarbeiten müssen. Auch die Bundesregierung kritisiert die Brüsseler Bürokraten, die die Zeichen der Zeit offenkundig nicht erkennen. Aber sie ist auch sehr zaghaft, weil sie offenbar die bestehenden EU-Verträge nicht in Frage stellen möchte.
Dabei waren es doch gerade auch die Implikationen dieser Verträge, die den Unwillen der Briten hervorriefen. Man störte sich zum einen an der ausufernden Bürokratie, die dazu führte, dass sich eine Flut von großenteils überflüssigen Richtlinien und Verordnungen über die Länder der EU ergoss, die dem im Maastrichter Vertrag formulierten Subsidiaritätsprinzip Hohn spricht. Nach diesem, damals von Deutschland durchgesetzten Prinzip darf die EU nur dort tätig werden, wo es echte grenzüberschreitende Aufgaben gibt, wie zum Beispiel bei der Verteidigung, grenzüberschreitenden Verkehrs- und Datennetzen oder im Bereich der Standardisierung von technischen Normen für handelbare Güter. Doch ansonsten darf sie – eigentlich – keine Gesetze, Verordnungen oder Normen erlassen.
Zum anderen war die britische Entscheidung durch die Angst vor einer nicht mehr kontrollierbaren Migration in die gut entwickelten Sozialstaaten Europas getrieben, zu denen auch Großbritannien gehört. Ja, die Migration wurde durch die Entscheidungen der Bundesregierung im Jahr 2015, Flüchtlingen aus Kriegsgebieten pauschal die Einreise zu erlauben, was Hunderttausende von Menschen in Bewegung setzte, zum alles beherrschenden Thema im britischen Wahlkampf. Großbritannien hatte schon in den 1950er- und 1960er-Jahren eine Massenimmigration aus den ehemaligen Commonwealth-Staaten erlebt und kämpft bis heute mit deren augenfälligen Folgen in den Ghettos der Großstädte. Dann hatte es nach der Osterweiterung der EU viele Menschen aus den ost- und südosteuropäischen Ländern angezogen, nicht zuletzt auch deshalb, weil die Magnetwirkung des britischen Wohlfahrtsstaats dazu beitrug. Und nun kamen auch noch die Kriegsflüchtlinge und Wirtschaftsmigranten unkontrolliert in die EU. Das brachte das Fass zum Überlaufen.
Eine Reform der EU mit Blick auf die entschiedene Steuerung der Migration von innen und von außen müsste zum einen bei der Magnetwirkung der raschen Inklusion in den Sozialstaat ansetzen, zum anderen aber auch weiter greifen, etwa bis zur Grenzsicherung. Wie diese Steuerung konkret geschehen kann, wird im letzten Kapitel dieses Buches diskutiert.
Doch müsste die Reform der EU noch sehr viel mehr leisten, wie gleichfalls im Detail im letzten Kapitel gezeigt wird. Vor allem müssten die Regeln, die Deutschland seinerzeit in den Maastrichter Vertrag als Bedingungen dafür schrieb, dass es die D-Mark aufgab, nun endlich so formuliert werden, dass sie nicht mehr umgangen werden können. Das betrifft das Verbot der Monetisierung der Staatsschulden, das Verbot der Rettung von Gläubigern eines konkursreifen Staates mit Steuermitteln, das Subsidiaritätsprinzip und vieles mehr. Vor allem muss man der EZB klarere und härtere Schranken auferlegen, um deren dauernde Mandatsüberschreitungen zu beenden und sie auf den Pfad der traditionellen Geldpolitik zurückbringen, wie sie von der Bundesbank betrieben wurde. Es ist nicht Aufgabe einer Zentralbank, fast wie früher das Politbüro in den Zentralverwaltungswirtschaften, die Kapitalströme in ihrem Hoheitsgebiet gezielt irgendwo hinzulenken, schon gar nicht in Länder, in die das private Kapital mangels echter Renditen gar nicht will. Die Steuerung des Kapitals ist in der Marktwirtschaft Sache der Sparer und ihrer Institutionen. Auch deswegen müssen die EZB und die Bundesbank aufhören, Südeuropa andauernd mit Krediten zu stützen, die unterhalb der Marktkonditionen zur Verfügung gestellt werden und für die am Ende der deutsche Steuerzahler einzustehen hat. Wenn überhaupt, so sind solche Kredite von den Parlamenten zu genehmigen, und von niemandem sonst.
Nach Lage der Dinge hat es wenig Sinn, wenn Deutschland versuchen sollte, im Rahmen der bestehenden EU-Verträge eine Kursänderung zu versuchen. Das würde ohnehin nie gelingen und bei jeder Einzelfrage neuen Streit hervorrufen. Der Streit würde Europa weiter zerrütten, ähnlich, wie es der Euro schon getan hat.
Besser ist es, wenn Deutschland jetzt – im Rahmen der ohnehin anstehenden Austrittsverhandlungen mit dem Vereinigten Königreich – eine Änderung der EU-Verträge verlangt und notfalls auch nicht vor einer Änderungskündigung zurückschreckt. Der richtige Zeitpunkt für das Änderungsverlangen ist so gesehen jetzt gekommen. Solange Großbritannien über die Konditionen des Austritts verhandelt, am besten noch vor dem formellen Austrittsantrag, bietet sich für Deutschland und gleichgesinnte Länder wie die Niederlande, Österreich, Finnland, die baltischen Staaten, Tschechien, Polen, die Slowakei, Dänemark und Schweden die einmalige Chance, die notwendigen Reformen herbeizuführen. In jedem Fall darf man mit Neuverhandlungen und Reformen nicht noch zehn Jahre warten, denn dann ist Großbritannien draußen und das Geld weg. Und Europa ist dann zu einem noch größeren Krisenfall geworden.
Versucht man Politikern diese Logik klarzumachen, pflegen sie nicht selten zu antworten, sie glaubten nicht, dass es zu neuen Vertragsverhandlungen kommen werde. Der Zug fahre in eine andere Richtung. Das mag sein. Viele Politiker sind, so scheint es, grundsätzlich nicht in der Lage, zwischen dem, was sein soll, und dem, was sein wird, zu unterscheiden, und auch echte Verantwortung zu übernehmen. Die Folge ist eine Schere im Kopf, die bewirkt, dass niemand wagt, von vornherein Forderungen zu erheben, von denen er befürchtet, dass er mit ihnen nicht durchkommt.
Wirkliche, verantwortungsbewusste Politik hingegen wird von Staatsmännern und -frauen gemacht, die sich nicht selbst beschränken, sondern langfristige Visionen strategisch und beharrlich über viele Jahre hinweg verfolgen und im historisch richtigen Moment ihre Chance zu nutzen wagen. Man denke an Margret Thatcher, die die englische Wirtschaftsgesellschaft mit eiserner Hand revolutioniert hat. Oder an Willy Brandts Ostpolitik mit ihrem Credo »Wandel durch Annäherung«. Oder an Helmut Kohls 10-Punkte-Plan vom Herbst 1989, der zur deutschen Vereinigung führte. Oder auch an Gerhard Schröders Agenda 2010, mit der die Massenarbeitslosigkeit überwunden wurde. Begleitende, anpassende, bestenfalls marginal modifizierende Politik wird von Standardpolitikern gemacht, die austauschbar, beliebig und orientierungslos sind. Sie begleiten alles und jedes, wenn es denn nur mit Macht und scheinbar alternativlos daherkommt.
Ein Volkswirt jedenfalls, wie der Autor dieser Zeilen, darf seine Empfehlungen nicht schon im Hinblick auf das Machbare formulieren, sondern muss vom Grundsätzlichen her argumentieren. Er muss aufklärerisch und kompromisslos sein, er darf sich nicht verbiegen und darf nicht kapitulieren vor dem scheinbar Unumstößlichen, Wahrscheinlichen, das vermeintlich ohnehin passieren wird. Es gibt seltene Augenblicke in der Geschichte mit eruptiven Umbrüchen, in denen das Grundsätzliche in der Lage ist, die Welt zu verändern. Darauf muss er die Öffentlichkeit vorbereiten, den Diskurs öffnen und vorantreiben. Womöglich ist jetzt so ein Augenblick gekommen. Mancur Olson, einer der großen Ökonomen des letzten Jahrhunderts, hat einmal geschrieben, jedes politische System brauche nach einem halben Jahrhundert eine grundlegende kulturelle Umbruchphase, um sich von den verfilzten Interessen zu lösen, die es erlahmen lassen. Es ist an der Zeit, dass auch die EU einen solchen Umbruch erlebt. Lange genug existiert sie ja, und genug Filz gibt es allemal.
Kein Zweifel, Europa befindet sich in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Herausforderungen, vor denen es steht, sind gewaltig, allen voran Euro-Desaster, Flüchtlingswelle und Brexit. Die Gefühle von Unbehagen, Unmut, Aggression und Angst wachsen angesichts dieser Herausforderungen in ganz Europa. Natürlich sind sie keine guten Ratgeber. Und doch lässt der steigende Zuspruch zu extrem orientierten Parteien mit ihren maßlosen Programmen und Parolen überall auf dem Kontinent erahnen, wie schnell vertraute Dinge wie Frieden und Wohlstand verschwinden könnten.
Kritische Phasen wie diese hat es immer wieder in der deutschen Geschichte gegeben. Man denke nur an den Vormärz in der Zeit vor 1848 oder das Erstarken der sozialistischen Bewegungen im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts. Damals hatte Bismarck auf Anraten der Volkswirtschaftsprofessoren, die den Verein für Socialpolitik – den heute noch bestehenden Fachverband der deutschen Ökonomen – gründeten und die ihre Gegner verächtlich »Katheder-Sozialisten« nannten, seine Sozialreformen auf den Weg gebracht und der Revolution auf diese Weise den Wind aus den Segeln genommen. Natürlich wäre es im höchsten Grade anmaßend, jene 15 Reformvorschläge, die am Ende dieses Buches ausführlich zusammengestellt sind, auf die gleiche Stufe mit den Bismarckschen Reformen zu stellen. Doch sie sind als Versuch eines heute lebenden Volkswirts zu verstehen, Reformen zu definieren, die, wenn sie beherzt durchgeführt werden, dazu beitragen können, das derzeit stark gefährdete europäische Einigungswerk auf neue, stabilere Füße zu stellen. Die Neugründung Europas muss gelingen. Wir haben keine Wahl.
Kapitel 1 Der Brexit und die Spaltung Mitteleuropas
Eine klare Entscheidung • Bürokratie, Wirtschaft, Überfremdungsangst – Misstrauensvotum gegen die EU • Ein kaum zu ermessener Verlust für Europa • Was die Entscheidung für das Vereinigte Königreich bedeutet • Unzufriedene Franzosen, genervte Italiener – Wer geht als nächstes? • Verlust der Sperrminorität – Warum Deutschland besonders viel verlieren wird • Wo war die Politik? • Jetzt droht die Spaltung Mitteleuropas
Eine klare Entscheidung
Das Ergebnis des britischen Referendums versetzte Europa und der Welt einen Schock, denn die Möglichkeit eines Votums für den Brexit hatte kaum jemand in den politischen und wirtschaftlichen Führungsetagen wirklich auf dem Schirm. Die Buchmacher boten Quoten von 5:2 für jene, die es wagten, auf eine Mehrheit der Befürworter eines EU-Austritts zu wetten. Auch meinten nicht wenige, dass sich die vielen Unentschlossenen, die man bei den Umfragen vor dem Referendum feststellte, mehrheitlich für den Status quo aussprechen würden. So war es schließlich bei der Abstimmung über die Unabhängigkeit Schottlands im Jahr 2014 gewesen oder auch früher bei anderen Referenden, so jenen zur Abspaltung Quebecs von Kanada.
In gewisser Weise stellte sich die Situation diesmal nicht wirklich anders dar. Auch am 23. Juni wählten die Unentschlossenen den Status quo. Nur bestand der Status quo in den Augen der Mehrheit nicht in der EU-Mitgliedschaft, sondern in der Splendid Isolation, also in der Unabhängigkeit von den Kontinentalmächten, wie sie seit Königin Victoria und ihrem Premierminister Benjamin Disraeli die britische Politik bestimmt hatte. Nicht der Brexit, sondern die EU war in den Augen vieler Briten das unkalkulierbare Experiment, dessen Ausgang man skeptisch beurteilte.
So kam es, dass sich beim Referendum eine Mehrheit von 51,9 % zu 48,1 % für jene ergab, die aus der EU austreten wollen. Bei einer Umfrage des Instituts ICM vom 29. Mai hatte der Vorsprung der Austrittsbefürworter bei 3 Prozentpunkten gelegen, während zugleich 13 % der Befragten unentschlossen waren.1 Andere Umfrageinstitute prognostizierten einen annähernden Gleichstand beider Gruppen.2 Beim Referendum betrug der Vorsprung dann schließlich deutliche 3,8 Prozentpunkte.
Nicht überall im Vereinigten Königreich ergab sich freilich ein ähnliches Meinungsbild. Wie Abbildung 1.1 zeigt, fanden sich die Austrittsbefürworter vor allem in den britischen Kernländern England und Wales, während die Schotten und Nordiren mehrheitlich für den Verbleib in der EU votierten. Eine Ausnahme unter den Engländern stellten die Akteure des Finanzplatzes London dar, der City of London also, die bei einem Brexit für ihr Finanzgewerbe zu Recht erhebliche wirtschaftliche Nachteile befürchten. Doch auf dem Lande und in den alten Industriegebieten überwogen die Austrittsbefürworter.
Auch zwischen Jung und Alt gingen die Meinungen auseinander. Während 71 % der jungen Briten zwischen 18 und 24 Jahren für den Verbleib in der EU stimmten, präferierten 64 % der älteren Bürger ab 65 Jahren den Austritt.
Abbildung 1.1: Die regionale Aufteilung des Wahlergebnisses vom 23. Juni 2016
Quelle: Eigene Darstellung; The Electoral Commission, Elections & Referendums, Upcoming Elections & Referendums, EU Referendum, EU Referendum Results, <http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/upcoming-elections-and-referendums/eu-referendum/electorate-and-count-information>.
Es war schon erstaunlich, aber unmittelbar nach dem Referendum haben nicht wenige Wahlverlierer den Eindruck zu erwecken versucht, die Wahl sei außerordentlich knapp ausgefallen und das Ergebnis einer augenblicklichen Stimmung der Bevölkerung, die sich nur aufgrund der verantwortungslosen Hetze von Populisten ergeben habe. Das schöne Wetter habe zudem einen Teil der Wähler von den Urnen ferngehalten. Inzwischen bereue die Bevölkerung ihre Entscheidung bereits. Da das britische Parlament formal nicht daran gebunden sei, solle Großbritannien trotz des Votums in der EU bleiben. An dem Umstand, dass sich die beiden hauptsächlichen Protagonisten im Kampf für den Brexit, der ehemalige Londoner Bürgermeister Boris Johnson von den Konservativen sowie Nigel Farage vonder United Kingdom Independence Party (UKIP), um es salopp auszudrücken, »vom Acker gemacht« hätten, sehe man, dass die Entscheidung gar nicht ernsthaft zustande gekommen sei.
Diese Argumente hören sich zunächst plausibel an. In Wirklichkeit aber greifen sie zu kurz. Zum einen hatte Nigel Farage, der direkt nach der Umfrage seinen Rückzug bekannt gab, wohl gesundheitliche Probleme, und Boris Johnson hatte nur erklärt, dass er für das Amt des Premierministers nicht zur Verfügung stehe, weil er sah, dass er die nötige Mehrheit der Konservativen nicht würde hinter sich bringen können. In der Tat suchte die Partei nach der klaren Entscheidung, die auch ein Votum gegen den amtierenden Partei- und Regierungschef David Cameron darstellte, zügig nach einem die Spaltung vermeidenden Kompromisskandidaten für Parteivorsitz und Amt des Premierministers. Der Polarisierer Boris Johnson kam dafür nicht in Frage, wohl aber Theresa May, die bisherige Innenministerin, die bereits am 13. Juli zur Nachfolgerin Camerons ernannt wurde.
Theresa May galt stets als EU-Skeptikerin, hatte sich aber vor dem Referendum dem Lager der EU-Befürworter angeschlossen. Kaum im Amt, teilte sie unmissverständlich mit, dass sie das Ergebnis des Referendums respektieren und den Austrittswunsch umsetzen werde. Und in der Folge schuf sie ebenfalls umgehend in ihrem Kabinett ein Ministerium zur Organisation des Austritts unter Leitung des Hardliners David Davis und machte Boris Johnson zu ihrem Außenminister.
Zum anderen war die Wahlentscheidung alles andere als knapp ausgefallen. Die Daten der Tabelle 1.1 zeigen das. Man erkennt, dass die Wahlbeteiligung sehr viel höher lag als bei den vergangenen drei Unterhauswahlen. Und man erkennt ebenfalls, dass eine sehr viel höhere Zahl von Bürgern für den Brexit votierte, als im Rahmen von Wahlen zuvor für die jeweils siegreiche Partei gestimmt hatte. So sprachen sich über 17 Millionen Briten für den Austritt aus, während die siegreichen Parteien bei den Unterhauswahlen normalerweise nur auf etwa 10 –12 Millionen Stimmen kamen.
Tabelle 1.1: Das Referendum vom 23. Juni 2016 im Vergleich zu Parlamentswahlen
Quelle: Electoral Commission, EU referendum results, <http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/eu-referendum/electorate-and-count-information>; House of Commons Library, General Elections Online, Election Results, <http://geo.digiminster.com/election/2015-05-07/Results>, bzw. <http://geo.digiminster.com/election/2010-05-06/Results; A. Mellows-Facer, »General Election 2005«, House of Commons Library Research Paper 05/33, 2006, http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/RP05-33.
Bürokratie, Wirtschaft, Überfremdungsangst – Misstrauensvotum gegen die EU
Wie aber kam es zu der Entscheidung der Briten? Sie ist keineswegs aus einer Laune des Augenblicks erwachsen. Vielmehr drückt sie eine in den vergangenen Jahren beständig gewachsene Skepsis gegenüber der EU aus. Mehr noch: Im Wesentlichen stellt sie ein deutliches Misstrauensvotum gegen die Europäische Union und ihre Führung dar.
Lange schon hatten sich die Briten darüber geärgert, dass sie sich den Mehrheitsentscheidungen in Brüssel unterwerfen mussten. Wie viele andere EU-Bürger auch fühlten sie sich vielen kleinkrämerischen Detailentscheidungen aus Brüssel ausgeliefert. Man denke nur an das Verbot der Glühbirne im Jahr 2009 oder die Begrenzung der Saugkraft der Staubsauger, die seit 2014 greift und 2017 weiter verschärft wird. Oder man denke an die heute nicht mehr so gut wie früher funktionierenden Geschirrspüler, die – wenn man sie vollmacht – das Geschirr nass und klebrig zurücklassen, damit sie die Energie- und Wassereinsparvorschriften einhalten können. Als Ergebnis der Energieeinsparvorschriften spült man heute halt häufiger. Die Richtlinie zur Definition des Krümmungsgrades der Gurke, über die sich die Kabaretts jahrelang lustig gemacht hatten, wurde von der EU-Kommission inzwischen zwar wieder zurückgezogen. Doch die Dicke und Länge der Banane ist nach wie vor vorgeschrieben.
Der Unsinn aus Brüssel mag nicht selten ideologische Ursachen haben, vor allem aber ist er auf handfeste wirtschaftliche Interessen zurückzuführen. Oft wollen sich die Hersteller der EU gegen Importprodukte schützen – und setzen ihre Lobbyisten auf die Brüsseler Gesetzgeber an, die später dann oft abstrus erscheinende Regelungen verabschieden. Nicht selten auch streben große Firmen, die in Brüssel viel Geld für die Lobbyarbeit ausgeben, danach, kleinere Hersteller an die Wand zu drücken. Wenn Unternehmen die Herstellung eines Gutes exzellent beherrschen – etwa den Anbau von großen, dann aber wässrigen Äpfeln, die Herstellung besonderer Leuchtmittel, die Produktion besonderer Isolierstoffe oder die Herstellung von Elektroautos, die mit Atomstrom fahren –, dann zeigt sich stets irgendwann ein ähnliches Muster: Die Unternehmen entfalten Aktivitäten, damit das, was sie gut beherrschen, zur Norm gemacht wird, um sich auf diese Weise zusätzliche Nachfrage für ihre Produkte zu sichern. Das gilt im Übrigen nicht nur für Normen, die aus Brüssel kommen, sondern etwa auch für solche, die, wie die deutschen DIN-Normen, in Berlin gemacht werden. Natürlich haben solche Normen zur Vereinheitlichung grundsätzlich ihre Berechtigung, wenn es darum geht, Mindestqualitäten zu sichern, die die Verbraucher beim Kauf nicht beachten können.3 Doch nutzen die privaten Hersteller ihre Gestaltungsmacht in den Normausschüssen regelmäßig auch für die nachdrückliche Verfolgung ihrer eigenen Interessen. Tabelle 1.2 zeigt einige Beispiele des versuchten oder realisierten Missbrauchs der Regulierungskompetenzen des Brüsseler Apparats, die – man kann es kaum verhehlen – bei näherer Betrachtung wie Schildbürgerstreiche anmuten.
Aber es ging beim Brexit-Votum nicht nur um das starke Unbehagen an der Gängelung der Verbraucher durch die Brüsseler Politik. Es ging vielmehr auch um handfeste Gefahren aufgrund der destabilisierenden Wirkungen, die das fehlkonstruierte Eurosystem in Europa ausgelöst hat, sowie um offenkundige finanzielle Nachteile Großbritanniens infolge der gemeinsamen Agrarmarktordnung. Angesehene Ökonomen im Umfeld von Patrick Minford von der Universität Cardiff haben das immer wieder hervorgehoben.4
Tabelle 1.2: Schildbürgerstreiche aus Brüssel
Großbritannien wollte dem Euro nie beitreten und hatte bei der Beschlussfassung für den Maastrichter Vertrag (ebenso wie Dänemark) das Sonderrecht ausgehandelt, es im Gegensatz zu den anderen EU-Ländern auch niemals zu müssen. Die Skepsis gegenüber der gemeinsamen Währung sah man durch die Verwerfungen, die der Euro zwischen den nördlichen und südlichen Ländern der Eurozone vor allem in den letzten Jahren herbeiführte, bestätigt. Und in der Nähe der riesigen Haftungsspirale, die sich nun zu Gunsten der Südländer und zu Lasten der Nordländer immer schneller dreht, wollte man sich dabei nicht aufhalten. »Wenn ihr Deutschen euch zum Zahlmeister der Eurozone machen wollt, dann tut es halt, aber lasst uns damit zufrieden«, war die Devise, die man von britischen Kollegen immer wieder zu hören bekam. Zu den Skeptikern gehörte auch der langjährige Präsident der britischen Zentralbank Mervyn King, der seine Kritik am Euro kürzlich in einem umfassenden Buch zusammengeführt hat.5
Wichtig für die Kritik der britischen Ökonomen an der EU war zudem die Landwirtschaftspolitik. So beklagt Großbritannien seit jeher seinen hohen Nettobeitrag zum EU-Budget. Trotz der Nachverhandlungen von Margret Thatcher im Jahr 1984, in der sie einen bis heute geltenden Rabatt für die britischen Beiträge zum EU-Haushalt erwirkte, trägt das Land stets mehr zur Finanzierung der Gemeinschaftsaufgaben bei, als es zurückerhält. Abbildung 1.2 zeigt, dass es nach Deutschland und Frankreich absolut gesehen den dritthöchsten Nettobeitrag leistet. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auf Deutschland nach dem Austritt der Briten die Forderung zukommen wird, den bisherigen Beitrag der Briten großenteils zu übernehmen. Auf die Idee, stattdessen das EU-Budget inklusive ihrer Gehälter zu verringern, werden die Damen und Herren in Brüssel bestimmt nicht kommen.
Die Zahlungen Großbritanniens an die EU lassen sich natürlich nicht über Nacht auf null zurückführen, denn vielfach ist die EU unter britischer Mitverantwortung bereits zukünftige Zahlungsverpflichtungen eingegangen, aus denen sie fürs Erste nicht mehr herauskommt. Und sie hat lange laufende Ausgabenprogramme begonnen, die sie nicht einfach mal so abbrechen kann. Die EU-Kommission hat Großbritannien daher bereits eine Rechnung von 25 Milliarden Euro gestellt, um solcherlei Verpflichtungen abzudecken. Man braucht nicht viel Fantasie, sich den anstehenden Rosenkrieg auszumalen.6
Das Geld, das vor allem Länder wie Großbritannien und Deutschland an die EU überweisen, wird zu einem großen Teil verwendet, um Subventionen an die Landwirte auszuzahlen, denn die Ausgaben für die Landwirtschaft machen ca. 42 % des gesamten EU-Budgets aus. Während früher Frankreich der größte Nutznießer der EU-Agrarzuschüsse war (und auch heute noch stark von ihnen profitiert), sind es nach der Osterweiterung vor allem Ungarn, Rumänien und Polen, jene Länder also, die über relativ große Landwirtschaftssektoren verfügen.7
Abbildung 1.2: Nettozahlungen an die EU (2014)
Quelle: European Commission, EU Budget 2014, Financial Report, Publications Office of the European Union, Luxemburg 2015, S. 145.
Großbritannien leidet unter der EU-Landwirtschaftspolitik nicht nur wegen der hohen Subventionen für andere Länder, sondern auch, weil Brüssel dem Land viele traditionelle Handelsverbindungen in die Commonwealth-Gebiete erschwert, wenn nicht abgeschnitten hat. Der Handel wird insbesondere durch variable Zölle behindert, sogenannte Einfuhrausgleichsabgaben, die die Importe aus Nicht-EU-Ländern so verteuern, dass sie nicht mehr billiger als EU-Ware sind. Derzeit werden Zölle auf gut zwei Drittel der Agrargüter (über 2.000 Arten) erhoben.8 Während die Zolltarife für Agrarprodukte wie Kaffee oder Tee, die nicht in der EU produziert werden, vergleichsweise niedrig sind, werden zum Schutz heimischer Produzenten beispielsweise auf Milcherzeugnisse sehr hohe Zölle verlangt. Im Jahr 2013 lag der Netto-Importwert aller Agrargüter in der Europäischen Union bei 129 Mrd. Euro, wobei 54 % dieses Importwerts Agrarzöllen unterlagen.9
Den Nachteil dieser Politik erleiden die Verbraucher der EU in ihrer Gesamtheit in Form überhöhter Preise für Nahrungsmittel. Nach Schätzungen der OECD kosteten die EU-Agrarzölle die europäischen Verbraucher zwischen 2013 und 2015 jährlich knapp 18,6 Mrd. Euro.10 Eine andere Schätzung von Patrick Minford kommt zu dem Schluss, dass die Handelsschranken der EU in ihrer Gesamtheit die europäischen Agrarpreise um bis zu 20 % gegenüber den Weltmarktpreisen angehoben haben.11 Der Vorteil der höheren Preise liegt bei den Bauern bzw. konkreter bei den Landbesitzern, die höhere Pachtraten durchsetzen können, als es bei freiem Wettbewerb der Fall wäre. Davon profitieren die genannten Länder mit viel Landwirtschaft, doch keinesfalls Großbritannien als Nettoimporteur landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Es wird geschätzt, dass Großbritannien allein aufgrund der Handelsbarrieren und Transfers im Agrarsektor jährlich Nettoverluste von etwa 0,5 % bis 1,1 % seines BIP verzeichnet.12
Haben also vor allem der Frust über die Brüsseler Bürokratie und die skizzierten ökonomischen Argumente den Ausschlag für das Brexit-Votum gegeben? Umfragen in der Bevölkerung zu den Beweggründen für einen Austritt aus der EU zeigen etwas andere Schwerpunkte bei den Motiven für die Wahlentscheidung. Danach kam nach der Bevormundung durch den Brüsseler Apparat – zu verstehen als ein Wunsch nach Unabhängigkeit an sich – der Migrationspolitik der EU eine entscheidende Bedeutung zu. Wie Abbildung 1.3 zeigt, maßen diesem Thema mehr als fünfmal so viele Austrittsbefürworter eine wichtige Bedeutung zu wie z.B. Themen wie Arbeitsplatz und Investitionen oder Familie. Es verwundert daher nicht, dass UKIP und die EU-skeptischen Wortführer das Migrationsthema in der Brexit-Debatte immer wieder betonten.
Abbildung 1.3: Themen, die die Austrittsbefürworter als wichtig empfanden
Quelle: YouGov, YouGov Survey Results, 23. Juni 2016, https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/640yx5m0rx/On_the_Day_FINAL_poll_forwebsite.pdf.
Hinweis: Die Umfrage wurde am 23. Juni 2016, also am Tag des Referendums, durchgeführt. Die Abbildung zeigt, welche Themen die Austrittsbefürworter als wichtig empfanden. Die fehlenden 12 % verteilen sich hauptsächlich auf die Antwort, dass etwas anderes relevant war.
Großbritannien kennt sich aus mit Migrationsströmen. Das Vereinigte Königreich hatte schon in den 1950er- und 1960er-Jahren eine erhebliche Immigrationswelle aus den Ländern des Commonwealth erfahren. Die dort lebenden Menschen galten ursprünglich als Bürger des Vereinigten Königreichs und seiner Kolonien (Citizens of the United Kingdom and Colonies, CUKC) und hatten insofern das uneingeschränkte Aufenthalts- und Arbeitsrecht im Vereinigten Königreich selbst. Die Freizügigkeit wurde zwar in den 1960er-Jahren etwas eingeschränkt, doch erst mit dem EU-Beitritt im Jahr 1973 behandelte man die EU-Ausländer so restriktiv wie es die anderen EU-Länder auch taten. Diese ältere Immigration hat bis zum heutigen Tage sichtbare Spuren in Großbritannien hinterlassen, vor allem mit Blick auf die Beanspruchung der Leistungen des Sozialstaates und die Herausbildung von ghettoähnlichen Stadtbezirken mit ethnischem und sozialem Sprengstoff. Deswegen haben sich gerade die älteren Briten, die die Geschichte überschauen, als so EU-skeptisch erwiesen.
Nach dem Beitritt der osteuropäischen Staaten Mitte der 2000er-Jahre kam es zu einer weiteren großen Migrationswelle. Sie kam diesmal aus Osteuropa und war unter anderem deswegen so heftig, weil Großbritannien nicht – wie Deutschland es tat – von der Möglichkeit Gebrauch machte, die Freizügigkeit für EU-Arbeitnehmer aus Osteuropa während einer Übergangszeit zunächst zu beschränken.
Und dann kam das Jahr 2015 mit einer unkontrollierten Massenimmigration von weit über einer Million Menschen, die von außen in die EU hineindrängten. Das war aus der Sicht der Briten nun schon die dritte Migrationswelle seit dem Zweiten Weltkrieg. Zwar wanderte nur ein kleiner Teil der Menschen wirklich nach Großbritannien. Doch waren es die Medienberichte über die chaotischen Verhältnisse beim Ansturm der Massen, auch über die Camps vor dem Eisenbahntunnel von Calais, die für die Briten jener Tropfen waren, der das Fass zum Überlaufen brachte. »Wehret den Anfängen!«, so ihre Devise. Und so votierten sie, als sie für den Brexit stimmten, vorrangig auch für die Schließung der britischen Grenzen. Nicht von ungefähr hat die neue britische Premierministerin deshalb auch sofort nach ihrem Amtsantritt klar gemacht, dass Großbritannien bei den Verhandlungen über die zukünftige Zusammenarbeit zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich die Freizügigkeit für EU-Bürger und für Einwohner von Drittstaaten unter keinen Umständen akzeptieren werde.13
Vor Calais, noch auf französischem Territorium, baut Großbritannien nun übrigens eine hohe Mauer um die Einfahrt zum Tunnel, um die vielen Menschen, die dort in einer provisorischen Zeltstadt hausen, davon abzuhalten, auf die Züge oder Lastwagen zu springen und nach Großbritannien zu reisen. Im Sommer 2016 kampierten noch ca. 9.000 Personen vor dem Eingang des Tunnels im sogenannten Dschungel von Calais.14
Kapitel 2 dieses Buches wird sich dem Thema der Migration ausführlich widmen, denn auch der Rest Europas muss seine Migrationspolitik grundlegend verändern, will es seine besser ausgebauten Sozialstaaten unter dem Druck der Armutsflüchtlinge aus anderen EU-Ländern und aus Drittländern nicht zusammenbrechen lassen.
Ein kaum zu ermessener Verlust für Europa
Im Weltmaßstab betrachtet wird der Austritt Großbritanniens eine erhebliche ökonomische und politische Schwächung der EU zur Folge haben, weil das Vereinigte Königreich ein in jeder Hinsicht großes Land ist. In Großbritannien leben mit 13 % der EU-Bevölkerung etwa genauso viele Menschen wie in Frankreich, wenn auch nicht ganz so viele wie in Deutschland (16 %). Wie Abbildung 1.4 zeigt, ist die britische Volkswirtschaft nach Deutschland die größte in der Europäischen Union, mit deutlichem Abstand vor Frankreich. Sie erbrachte im Jahr 2015 eine Wirtschaftsleistung, die 18 % größer als die Frankreichs war, und sie steuerte 17,6 % zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) aller EU-Länder bei.
Um die Bedeutung des Verlustes von Großbritannien für die EU zu verstehen, ist es nützlich sich klarzumachen, dass das Land nahezu so viel Wirtschaftsleistung auf sich vereint, wie die 20 der Wirtschaftskraft nach kleinsten Länder der EU zusammengenommen. Das zeigt das obere der beiden Schaubilder in Abbildung 1.4. So gesehen ist der Austritt Großbritanniens wirtschaftlich in etwa dasselbe, als würden nun diese 20 von 28 Ländern gleichzeitig die EU verlassen. Zieht man das Bevölkerungskriterium zum Vergleich heran, kommt eine etwas weniger krasse Relation zustande. Doch auch dann ist der Austritt immer noch mit dem Austritt der gemessen an ihrer Einwohnerzahl 15 kleinsten Länder der EU zu vergleichen.
Natürlich hinkt dieser Vergleich insofern, als in der EU nicht alle Bürger gleich sind. One man, one vote ist zwar das Grundprinzip der Demokratie, das in Großbritannien, den USA und überall auf der Welt hochgehalten wird – aber eben nicht in der EU. Pro Einwohner betrachtet haben in fast allen Entscheidungsgremien, sei es nun der Ministerrat, das Parlament oder auch der EZB-Rat, die kleinen Länder wesentlich mehr Stimmengewicht als die großen. Auch in der EU-Verwaltung oder in der EZB bekleiden die kleinen Länder überproportional viele Posten. Dieses Demokratiedefizit könnte einer der Gründe dafür sein, warum sich die Briten in der EU nicht gut aufgehoben fühlten. Obwohl sie genauso viele Menschen wie die 15 der Bevölkerungszahl nach kleinsten Länder der EU auf sich vereinen, konnten sie nicht im Entferntesten einen ähnlichen Einfluss auf die EU-Politik ausüben wie diese Länder. Das gilt in ähnlicher Form übrigens für die Bundesrepublik Deutschland, die bevölkerungsmäßig den 17 kleinsten Ländern der EU und im Hinblick auf ihre Wirtschaftsleistung den 21 kleinsten der 28 EU-Länder entspricht.
Abbildung 1.4: Die wirtschaftliche Bedeutung des Vereinigten Königreichs in der EU, gemessen in BIP- und Bevölkerungsanteilen (2015)
Quelle: Eurostat, Datenbank Wirtschaft und Finanzen, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (ESVG 2010), Jährliche Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Hauptaggregate des BIP; dieselbe, Datenbank Bevölkerung und soziale Bedingungen, Demographie und Migration, Demographische Veränderung – absoluter und relativer Bevölkerungsstand auf nationaler Ebene.
Hinweis: Die BIP-Anteile der nicht zum Euro gehörenden Länder wurden nach den jeweils jahresdurchschnittlichen Wechselkursen zum Euro umgerechnet.
Außen- und sicherheitspolitisch wird Großbritannien nun bald seinen eigenen Weg gehen. Zwar bleibt es Mitglied der NATO. Doch die Hoffnung vieler Europäer, eines Tages eine gemeinsame Streitmacht zu erhalten und eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik durchführen zu können, um auf diese Weise auch eine neue, sinnvolle Integrationsstufe zu erreichen, hat mit der Entscheidung im EU-Referendum einen großen Dämpfer bekommen. Großbritannien ist eine Atomstreitmacht, und es ist eines von fünf ständigen Mitgliedern im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Beides geht der EU mit dem Schwarzen Juni des Jahres 2016 verloren.
Was die Entscheidung für das Vereinigte Königreich bedeutet
Davon unberührt wird sich Großbritannien nun vom Kontinent erneut in die Splendid Isolation zurückziehen, im Ausgleich seinen Welthandel mit dem alten Commonwealth wieder ausbauen und zudem ein besonders enges Verhältnis zu den USA suchen. Schon jetzt ist das Land im Begriff, spezielle Handelsabkommen mit Australien und Kanada zu vereinbaren, wobei das von der EU mit Kanada bereits ausgehandelte CETA-Abkommen – bei aller Unsicherheit, ob es überhaupt in allen EU-Mitgliedsländern ratifiziert wird – dafür die Basis sein kann. Das Vereinigte Königreich wird ebenfalls versuchen, ein TTIP-ähnliches Abkommen mit den USA zu schließen. Da es angesichts der überall in Europa wachsenden Vorbehalte gegen die Liberalisierung des Agrarhandels mit den USA derzeit nicht sehr wahrscheinlich erscheint, dass TTIP mit der EU überhaupt abgeschlossen wird, ist zu vermuten, dass die britischen Inseln sehr viel mehr Handelsliberalisierung mit den USA erreichen können als die EU.
Gleichwohl wird all dies aber nicht verhindern können, dass Großbritannien durch den Austritt aus der EU einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden erleidet, weil wohl neue Handelsbarrieren zwischen der EU und Großbritannien errichtet werden. Die dabei zu erwartenden Effekte sind indes so komplex und vielschichtig, dass allzu schnelle Schlüsse, wie sie nun vielerorts formuliert werden, fehl am Platz sind.
Als unmittelbare Reaktion auf die Wahlentscheidung kam es in jedem Fall bereits zu einer massiven Flucht von Finanzkapital. Das britische Pfund verlor dadurch innerhalb weniger Tage um 10 % und mehr gegenüber dem Euro und wertete vor allem gegenüber dem Dollar ab – wobei die Bank of England wohl durch den Verkauf von Devisen aus ihren Beständen interveniert hat, um noch stärkere Ausschläge abzufedern. Auch die Börse reagierte nervös. Der Börsenindex der Financial Times für die 100 größten Unternehmen stabilisierte sich dann aber sogar auf einem etwas höheren Niveau, weil sich die Neubewertung der Aktienkurse in den internationalen Portfolios der Anleger bereits durch den Pfundkurs erledigt hatte.
Davon unberührt steht in den ersten Jahren nach dem Referendum in jedem Fall zu erwarten, dass es zu einer konjunkturellen Flaute kommt, weil die durch das Brexit-Votum entstandene Unsicherheit die Investoren zurückhaltender werden lässt. Insbesondere in London dürften viele Bauprojekte auf Eis gelegt werden, weil die Investoren erst einmal abwarten wollen, wie sich die Lage entwickelt. In der Folge wird es dann zu einem Verlust an gesamtwirtschaftlicher Nachfrage kommen, der selbst wiederum einen negativen Konjunkturimpuls mit einer wachsenden Arbeitslosigkeit auslöst. Die Regierung könnte daraufhin gezwungen werden, eine kreditfinanzierte Nachfragepolitik zu betreiben, um so den Einbruch der Wirtschaft aufzuhalten. Auch wird die britische Notenbank vermutlich zu weiteren Zinssenkungen und anderen stimulierenden Maßnahmen gezwungen werden.
Mittelfristig wird der Flucht des Finanzkapitals zudem eine Umlenkung von Direktinvestitionsströmen folgen, denn viele Firmen werden ihre Zentralen nun in die Nähe ihrer Absatzmärke in die EU-Länder verlegen, um sich nicht eines Tages vor verschlossenen Türen wiederzufinden. So wurde bereits bekannt, dass renommierte Firmen wie Vodafone, easyJet, Samsung, die Bank of America, Ford und sogar die HSBC (Hongkong & Shanghai Banking Corporation), die 2015 gemessen an ihrer Bilanzsumme die größte Bank Europas war, eine Verlegung ihrer Europa-Zentralen in die EU erwägen.15 Die Frankfurter Börse, die mit der britischen Börse fusionieren will, überlegt nun, statt wie eigentlich geplant nach London umzuziehen, ihre Zentrale in Frankfurt zu belassen. Und auch von der Deutschen Bank hört man, sie prüfe, ganze Geschäftsfelder wie etwa den Handel mit Euro-Staatsanleihen aus London abzuziehen.16
Langfristig wird man Handelsbarrieren seitens der EU erwarten müssen, die Großbritannien erheblich treffen könnten. Wie Abbildung 1.5 zeigt, liefert das Land einen erheblichen Teil (44 %) seiner Exportwaren in die EU und bezieht auch umgekehrt die meisten der importierten Waren von dort (53 %), wobei Deutschland bei den Importen und die USA bei den Exporten sein wichtigster Handelspartner ist.
Abbildung 1.5: Die Warenexporte und -importe des Vereinigten Königreichs (2015)
Quelle: Eurostat, Datenbank Wirtschaft und Finanzen, Zahlungsbilanz – Internationale Transaktionen (BPM6), Zahlungsbilanzstatistiken nach Land – vierteljährliche Daten (BPM6).
Handelsbeschränkungen liegen zwar nicht im Interesse der Rest-EU, denn Handel ist grundsätzlich für Länder vorteilhaft, weil sie sich alle auf das spezialisieren, was sie am besten können, und die Verbraucher die Möglichkeit haben, jeweils dort zu kaufen, wo es am billigsten ist. Insofern mag man sich fragen, warum die EU Handelsbarrieren errichten sollte. Die Antwort auf diese Frage liegt darin, dass die Regierungen der Länder sich häufig von den Partikularinteressen alter und politisch mächtiger Industrien beeinflussen lassen und das gesamtwirtschaftliche Interesse aus dem Auge verlieren. So scharren die Lobbyisten jener Wirtschaftszweige, die sich gerne vor unliebsamer Importkonkurrenz schützen lassen möchten, in Brüssel schon mit den Hufen und sehen nun eine Chance, Schutzzölle und regulatorische Handelsbarrieren von der Art, wie sie in Tabelle 1 dargestellt wurden, durchzusetzen. Gesamtwirtschaftlich betrachtet können Länder wie Deutschland, Österreich, die Niederlande und Finnland, die für ihren Wohlstand auf eine liberale und weltoffene Handelspolitik angewiesen sind, daran kein Interesse haben. Es ist aber leider wahrscheinlich, dass sich die protektionistisch ausgerichteten Lobbyisten zumindest teilweise durchsetzen werden – zumal sie Frankreich und manche andere Länder fest im Griff zu haben scheinen.
Wie Abbildung 1.6 zeigt, ist Großbritannien in einer Reihe von Gütergruppen Nettolieferant von Waren und Dienstleistungen an die EU. Dabei stehen Finanzdienstleistungen, Erdöl oder Unternehmensdienstleistungen vorn auf der Liste.
Für einige dieser Gütergruppen, insbesondere jene, bei denen es konkurrierende Firmen in der EU gibt, wird die Europäische Union unter dem Druck der Lobbys vermutlich Handelsbarrieren einführen. So ist zu erwarten, dass die EU-Finanzzentren in Paris, Luxemburg, Mailand und Frankfurt darauf drängen werden, größere Teile der Finanzgeschäfte in Zukunft selbst zu machen. Umgekehrt werden die entsprechenden Lobbys im Vereinigten Königreich versuchen, sich ebenfalls durch protektionistische Maßnahmen zu schützen. Das wird unter anderen die deutsche Automobilindustrie treffen, für die Großbritannien nach den USA der wichtigste Absatzmarkt ist und die 2015 doppelt so viel in Großbritannien wie in Frankreich absetzte.17
Es ist zu befürchten, dass die EU und Großbritannien für Gütergruppen, bei denen sie jeweils Netto-Importeur sind, obwohl sie selbst über Lieferkapazitäten verfügen, Zölle und nicht-tarifäre Handelshemmnisse aufbauen werden, um ihre heimischen Unternehmen zu bevorzugen. Dadurch werden Lieferbeziehungen eingeschränkt, und die Menschen aller beteiligten Länder haben das Nachsehen, weil sie statt der billigeren Exportware nun jeweils die teureren heimischen Produkte kaufen müssen. Das wird die Politik aber nicht davon abhalten, die Handelsbeschränkungen mit fadenscheinigen Argumenten zu verteidigen, wie man aus jahrelangen und vergeblichen Verhandlungen um eine weltweite Liberalisierung des Handels weiß. Die aus Brüssel und leider auch Berlin immer wieder zu hörende Aussage, man werde Großbritannien kein »Rosinenpicken« erlauben und die von Großbritannien gewünschte Beschränkung der Freizügigkeit für die Wohnsitzwahl durch Beschränkung in anderen Sektoren kompensieren, zeugt zwar von einer großen wirtschaftlichen Unvernunft, ist aber eine ernst zu nehmende Prognose bezüglich der Fehlentwicklungen, mit denen die Bürger Europas nun rechnen müssen.
Abbildung 1.6: Nettoexporte des Vereinigten Königreichs in die EU nach Gütergruppen (2014)
Hinweis: Eigene Rechnung unter Verwendung der folgenden Quellen: Office for National Statistics, UK Trade in goods by classification of product by activity, time series dataset; Office for National Statistics, United Kingdom Balance of Payments – The Pink Book.
Es gibt verschiedene Studien zu den negativen Wohlfahrtswirkungen der möglichen Handelsbeschränkungen. Eine besonders aktuelle und gründliche stammt von Rahel Aichele und Gabriel Felbermayr vom ifo Institut sowie Ulrich Schoof und Thieß Petersen vom Programm »Nachhaltig Wirtschaften«.18 Die Autoren untersuchen alternative Szenarien bezüglich der Schwere der Handelsbeschränkungen und kommen dabei zu dauerhaften Realeinkommensverlusten für die Briten in Höhe von 2 % bis 14 % im Vergleich zum EU-Verbleib. Dabei sind mögliche Gewinne und Verluste aus der Neuverteilung der Lasten aus der Finanzierung des EU-Budgets noch nicht enthalten.
Obwohl zu vermuten ist, dass alle Länder aufgrund des Brexit langfristige Realeinkommensverluste erleiden werden, gilt das aus den genannten Gründen nicht für alle Sektoren und Bürger dieser Länder zugleich. So könnten sich erhebliche Effekte über eine veränderte Rolle der Finanzdienstleister in der City of London ergeben. Während Deutschland im Bereich des verarbeitenden Gewerbes und Frankreich im Staatssektor überdurchschnittlich hohe Einkommen ausweist, gilt das für Großbritannien im Finanzsektor.
Wie Abbildung 1.6 zeigt, ist der Finanzsektor auch der größte Netto-Exportsektor der Briten. Im Jahr 2014 lag der Anteil der dort erzeugten Wertschöpfung bei 7,3 % des BIP, während Frankreich und Deutschland nur auf 4,0 % bzw. 3,7 % kamen. In der Vergangenheit hat die hohe Wertschöpfung dieses Sektors zu einer erheblichen Steigerung der Lohneinkommen und der zum Wechselkurs umgerechneten Preise der britischen Güter beigetragen. Ökonomen sprechen von einer realen Aufwertung, um diesen Effekt zu beschreiben. Die reale Aufwertung hat die britischen Einkommen im internationalen Vergleich und auch die tatsächliche Kaufkraft der Briten sowie die binnenwirtschaftliche Nachfrage nach Serviceleistungen gesteigert, doch hat sie dem verarbeitenden Gewerbe das Leben schwer gemacht. Dessen Anteil am BIP sank von 20,9 % im Jahr 1979 auf zuletzt (2014) nur noch 9,5 %. Entsprechend fiel der Anteil der dort Beschäftigten von 23,9 % auf 8,1 %. Im Vergleich dazu hat Deutschland noch 17,5 % der Beschäftigten in diesem Gewerbe und erzeugt dort 20,4 % seines Bruttoinlandsprodukts.19
Die britische Abkehr vom verarbeitenden Gewerbe könnte nun rückgängig gemacht werden, wenn die EU den Briten durch restriktive Regularien die Möglichkeit nimmt, die Finanzdienstleistungen weiter in die EU zu verkaufen. Dann käme es nämlich zu einer nachhaltigen realen Abwertung durch Lohn- und Preiszurückhaltung, verbunden mit einem dauerhaft niedrigeren Pfundkurs. Wie erläutert hatte eine solche Abwertung aufgrund einer unmittelbar nach dem Referendum einsetzenden Kapitalflucht aus Großbritannien ohnehin bereits stattgefunden. Aber das waren kurzfristige Effekte anderer Art. Wichtiger ist langfristig, dass die geringeren Chancen der City of London