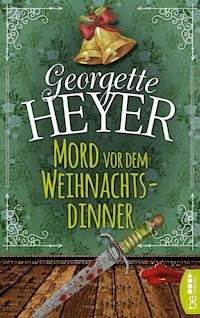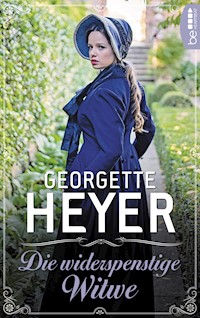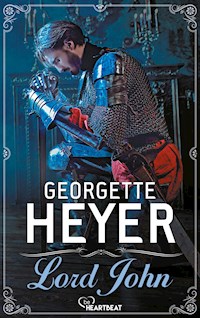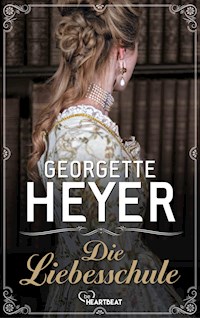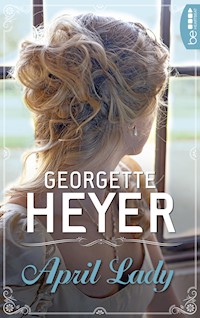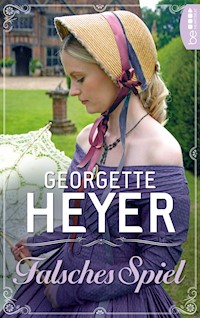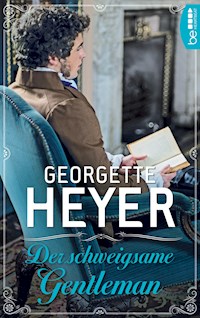
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Liebe, Gerüchte und Skandale - Die unvergesslichen Regency Liebesromane von Georgette
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
England, 1815. Als Gervase Frant, Earl of St. Erth, unverhofft aus der Schlacht von Waterloo nach Hause zurückkehrt, sind seine Verwandten enttäuscht. Schließlich hatten sie das gesamte Erbe bereits unter sich aufgeteilt. Warum war der Earl auch so taktlos, sich nicht totschießen zu lassen? Der einzige Lichtblick inmitten der feindseligen Familie ist die unscheinbare, aber äußerst charmante Miss Drusilla Morville, die gerade zu Besuch auf dem Herrensitz ist und den Earl mit ihren gewagten politischen Ansichten amüsiert. Aber als ein Mordanschlag auf den Earl verübt wird, überschlagen sich die Ereignisse ...
"Der schweigsame Gentleman" (im Original: "The Quiet Gentleman") besticht mit herzerfrischend skizzierten Figuren und einem spritzig pointierten Erzählstil. Ein romantischer Regency-Klassiker von Georgette Heyer - jetzt als eBook bei beHEARTBEAT. Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 528
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Leseprobe [Mydworth]
Über dieses Buch
England, 1815. Als Gervase Frant, Earl of St. Erth, unverhofft aus der Schlacht von Waterloo nach Hause zurückkehrt, sind seine Verwandten enttäuscht. Schließlich hatten sie das gesamte Erbe bereits unter sich aufgeteilt. Warum war der Earl auch so taktlos, sich nicht totschießen zu lassen? Der einzige Lichtblick inmitten der feindseligen Familie ist die unscheinbare, aber äußerst charmante Miss Drusilla Morville, die gerade zu Besuch auf dem Herrensitz ist und den Earl mit ihren gewagten politischen Ansichten amüsiert. Aber als ein Mordanschlag auf den Earl verübt wird, überschlagen sich die Ereignisse …
»Der schweigsame Gentleman« (im Original: »The Quiet Gentleman«) besticht mit herzerfrischend skizzierten Figuren und einem spritzig pointierten Erzählstil. Ein romantischer Regency-Klassiker von Georgette Heyer – jetzt als eBook bei beHEARTBEAT. Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Georgette Heyer, geboren am 16. August 1902, schrieb mit siebzehn Jahren ihren ersten Roman, der zwei Jahre später veröffentlicht wurde. Seit dieser Zeit hat sie eine lange Reihe charmant unterhaltender Bücher verfasst, die weit über die Grenzen Englands hinaus Widerhall fanden. Sie starb am 5. Juli 1974 in London.
Georgette Heyer
Der schweigsame Gentleman
Aus dem Englischen von Emi Ehm
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Copyright © Georgette Heyer, 1951
Die Originalausgabe THE QUIET GENTLEMAN erschien 1951 bei William Heinemann.
Copyright der deutschen Erstausgabe:
© Paul Zsolnay Verlag GmbH, Hamburg/Wien, 1955.
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de unter Verwendung von Motiven © Richard Jenkins
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar
ISBN 978-3-7325-7328-8
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Kapitel 1
In Reisehandbüchern hieß es Schloss Stanyon; für die Dorfbewohner war es »das Schloss«; die gute Gesellschaft sprach von Stanyon ebenso wie von Woburn und Cheveley. Es lag in Lincolnshire, unweit von Grantham und eher näher zu Stamford, einem Ort, den Leute, die sich mehr für Jagd im Allgemeinen als für Naturschönheiten im Besonderen interessierten, bezaubernd fanden. Es durfte sich mit größerer Berechtigung »Schloss« nennen als der Wohnsitz so manchen Edelmannes. Laut verschiedenen, im Übrigen recht uninteressanten Urkunden im Schlossarchiv, das Mr. Theodore Frant jetzt als Arbeitsraum diente, hatte an jener Stelle ursprünglich eine mittelalterliche Festung gestanden. Was davon dem Lauf der Zeit getrotzt hatte, war dem Tudorschloss einverleibt worden, das der Festung gefolgt war. Spätere Generationen vergrößerten und verschönerten das Gebäude je nach Laune, wobei Schwierigkeiten, die sich bei der Vergrößerung ergaben, einfach durch die Anlage eines weiteren Hofes aus der Welt geschafft wurden. Jener Frant zum Beispiel, dem es gelang, eine Freundschaft mit dem gemütlichen König Heinrich VIII. zu überdauern, erregte das Ärgernis seiner Zeitgenossen durch eine maßlose Vorliebe für Eichentäfelungen; sein Enkel, durch ausgedehnte Reisen verfeinert, ließ einen neuen Flügel anbauen und zierte den alten mit Vergoldungen und Deckenfresken. Ein späterer Frant verfiel der herrschenden Mode, berauschte sich am Rokoko, ließ den Brunnenhof anlegen und wurde lediglich von seinem Tod daran gehindert, noch großartigere Pläne in Angriff zu nehmen. Sein Erbe, ein glühender Anhänger Mr. Walpoles, bekehrte sich zur Gotik, und als ein Sturz bei einem seiner regelmäßigen Ausritte mit dem »Old Club« seiner Laufbahn ein jähes Ende bereitete, gab es nirgends in England so schwere Eichentüren, so gewichtige Eisenklinken und so viele schmale Spitzbogenfenster wie in Stanyon.
Der Sechste Earl of St. Erth, möglicherweise der Ansicht, dass sich sein Stammsitz schon zu sehr in der Gegend ausbreitete, mit größerer Wahrscheinlichkeit aber von den harten Zeiten, in denen zu leben er das Missgeschick hatte, daran gehindert, einen Flügel im Stile Palladios anbauen zu lassen, begnügte sich damit, die Ställe neu aufbauen, eine große Zahl von Zimmern tapezieren und in der riesigen Küche einen Herd aufstellen zu lassen, der, nebenbei bemerkt, von einem erzürnten Diener als das einzige Anzeichen moderner Zivilisation in dem ganzen Gebäude bezeichnet wurde; aber der Oberkoch, der für moderne Errungenschaften nichts übrighatte, benutzte den neuen Herd ausschließlich dazu, um von einem seiner Untergebenen darauf Gemüse kochen zu lassen, während er selbst nach wie vor über seiner Feuerstelle mit ihren riesigen Spießen, eisernen Kesseln und veralteten Back- und Bratöfen das Zepter schwang. Mit den Örtlichkeiten unvertraute Gäste, die verstört in den schlecht erleuchteten Gängen umherirrten, Stiegen entdeckten, die in unerforschte Dienerschaftsregionen führten, und endlich, erhitzt und erschöpft, dort anlangten, wo man inzwischen stundenlang auf sie gewartet hatte, verliehen mitunter ihrem Erstaunen darüber Ausdruck, dass jemand, der zwei andere bequemere Landsitze besaß, aus freien Stücken in einem solchen Labyrinth wohnte. Keiner dieser zwei, das war wohl richtig, hatte Bankettsäle aufzuweisen, Galerien für Spielleute, Waffenkammern, Türme und Gräben; aber dafür pfiff die Zugluft nicht durch die Gänge, keine schleichende Kälte drang aus feuchten Mauern, und die Kamine rauchten nur selten.
Der Sechste Earl und seine zweite Frau fanden Stanyon vollkommen in Ordnung: der Earl, weil er hier seine Kindheit verbracht hatte, seine Frau, weil sie in einem noch weniger komfortablen Haus im rauen Norden aufgewachsen war. Abgesehen davon würde sie, wenn man ihr die Wahl gelassen hätte, Bequemlichkeit ohne mit der Wimper zu zucken gegen Prunk eingetauscht haben. Die erste Frau des Earl hatte Stanyon gehasst. Aber die erste Frau des Earl, wenn auch zugegebenermaßen eine Dame von Stand und bemerkenswerter Schönheit, hatte sich der hohen Stellung, zu der sie berufen war, im höchsten Maße unwürdig erwiesen. Ehe noch ihr Sohn dem Gängelband entwachsen war, lief sie mit einem berüchtigten Wüstling auf und davon. Ihr Gatte, gehörnt, verraten und dem allgemeinen Gelächter preisgegeben, tilgte ihren Namen aus den Familienannalen, gestattete niemandem, ihn innerhalb seiner vier Wände auszusprechen, und betrachtete sich durchaus nicht als gerächt, als er erfuhr, dass sie drei Jahre nach ihrer Flucht in Not und Elend gestorben war. Sein Butler sowie seine Haushälterin, zwei gefühlvolle Leute, hofften, er würde sich wenigstens auf dem Totenbett seiner ersten Frau erinnern und Worte der Vergebung für sie finden, da es ihnen unmöglich schien, dass eine so schöne und liebenswürdige Dame aus seinem Herzen und seiner Erinnerung vollends verbannt sein sollte. Ja, sie gingen in ihren Illusionen sogar so weit, sich vorzustellen, dass die offensichtliche Abneigung des Earl gegen seinen ältesten Sohn von dem heimlichen Schmerz herrühre, den der Anblick des schönen Knaben, der tatsächlich das Abbild seiner Mutter war, wohl in ihm hervorrief. Aber wenn man dem hochwürdigen Herrn Felix Clowne, dem Kaplan seiner Lordschaft, Glauben schenken durfte, so bezog sich dessen letzter zusammenhängender Satz – ebenso kräftig in Worten wie schwach im Ton – darauf, dass der Wein, den ihm der Kammerdiener auf seinen Befehl gebracht hatte, nach Kork schmecke. Vorher hatte er seinem jüngeren Sohn Martin den Segen erteilt; er hatte ein freundliches Wort an seinen Neffen Theodore gerichtet; er hatte sich mit allem Zeremoniell von seiner Gattin verabschiedet; er hatte eine geziemende Botschaft an seine verheiratete Tochter geschickt; aber weder der Name seiner ersten Frau noch der seines Erben war über seine Lippen gekommen. Ebenso wenig war dieser in Stanyon eingetroffen, um an seinem Sterbebett zu weilen, obwohl kein Zweifel bestehen konnte, dass Mr. Theodore Frant ihm ein Eilschreiben nach Flandern gesendet hatte, in dem er ihm das bevorstehende Ableben seines Vaters ankündigte. Captain Viscount Desborough, wie er damals hieß, war mit seinem Regiment in Mons stationiert, und man konnte sich zur Not vorstellen, dass ein stark ausgeprägtes Gefühl für seine militärischen Pflichten ihn daran gehindert hatte, in einem Augenblick um Urlaub einzukommen, da fast stündlich erwartet wurde, Napoleon würde die Grenze überschreiten. Aber nachdem der Siebente Earl bereits ein kleines, aber ziemlich heftiges Gefecht beim Dorf Genappe und ein beträchtlich größeres bei Waterloo überlebt hatte, zeigte er noch immer keinerlei Neigung, in das Haus seiner Väter zurückzukehren. Er quittierte den Dienst, blieb jedoch auf dem Kontinent und setzte das vollste Vertrauen in die Fähigkeit seines Vetters, seine Güter zu verwalten. Und erst ein volles Jahr nach dem Tod seines Vaters erhielten die Gräfinwitwe und sein Vetter von ihm die Nachricht, dass er in England wäre und die Absicht hätte, sein Erbe anzutreten. Er setzte seine Stiefmutter mit einem sehr artigen Brief vom Tag seiner Ankunft in Stanyon in Kenntnis und erkundigte sich in höflichster Weise nach ihrem Befinden sowie dem seines Stiefbruders und seiner Stiefschwester. Ein sehr liebenswürdiger Brief, gab die Gräfinwitwe zu, aber, fügte sie in nicht allzu hoffnungsvollem Ton hinzu, ebendieselbe gewinnende Art war seiner Mutter eigen gewesen, und sie hatte sich dennoch als Schlange am Busen erwiesen.
»Ich sollte Sie vielleicht darauf aufmerksam machen, Ma’am, dass mein Vetter tadelnde Worte über den Charakter seiner Mutter nicht gerade schätzt«, sagte Mr. Theodore Frant ein wenig gezwungen. »Derartige Bemerkungen sollten in seiner Gegenwart lieber unterbleiben.«
»Mein lieber Theo«, antwortete die Gräfin, »es wäre in der Tat seltsam, wenn ich in Fragen der Höflichkeit dich um Rat fragen müsste!« Er verbeugte sich, und da sie ihm durchaus gewogen war, setzte sie freundlich hinzu: »Oder irgendjemand anderen, meine ich! In diesem Hause mag Desborough – oder, wie ich nun werde lernen müssen, ihn zu nennen, St. Erth – sicher sein, dass ihm jede Aufmerksamkeit gezollt werden wird, die seinem Rang zukommt!«
»Selbstverständlich, Ma’am«, sagte Mr. Frant und verbeugte sich aufs Neue.
»Der Ratschluss der Vorsehung hat ihn nun einmal für den Rang seines teuren Vaters bestimmt«, sprach die Gräfin, und ihre Meinung von der Vorsehung war keine sehr hohe. »Man hätte annehmen können, der Militärdienst in Spanien – sehr ungesundes Klima, soviel ich weiß, ganz abgesehen von der Möglichkeit eines gewaltsamen Todes im Kampf, die immerhin nicht von der Hand zu weisen war – würde den jetzigen Anlass unnötig machen. Aber es sollte nicht sein! Hätte man mich um Rat gefragt, so würde ich mich zu der Erklärung verpflichtet gefühlt haben, dass eine militärische Laufbahn für jemanden, den ich ohne zu zögern alles eher als robust nennen würde, leicht tödlich ausgehen könnte! Das, mein lieber Theo, muss ich schon sagen, denn, welche auch immer meine mütterlichen Gefühle sein mögen – wenn ich mich einer Sache rühme, so der Erfüllung meiner Christenpflicht! Glücklicherweise, so schien es damals (obwohl das Walten eines unerforschlichen Geschicks diesen Umstand nunmehr nebensächlich erscheinen lässt), suchte man meinen Rat nicht. Da es Lady Penistone für gut fand, sich so eingehend für ihren Enkel zu interessieren, und mein teurer Gatte daran nichts auszusetzen hatte, war es nicht an mir, meine Stimme zu erheben. Auf ihr Haupt die Folgen, so sagte ich damals! Zweifelsohne ist Lady Penistone auf ihre Art eine ganz rechtschaffene Frau – ich bin gerecht genug, zuzugeben, dass sie den Fehltritt ihrer unglücklichen Tochter nicht, wie man hätte befürchten können, in ihrem unheilbaren Leichtsinn entschuldigt hat –, aber wenn sie Desborough aus irgendeinem anderen als dem boshaften Wunsch heraus, meinem armen Gatten damit einen Tort anzutun, so verhätschelt und verwöhnt hat, müsste ich mich sehr irren! Ich habe ihn immer für einen zaghaften Jungen gehalten. Viel zu verschlossen, um anziehend zu wirken. In Eton hat er nie von sich reden gemacht. Er muss ein eigenartiger Soldat gewesen sein!«
»Es ist einige Jahre her, seitdem Sie meinen Vetter zuletzt gesehen haben, Ma’am«, unterbrach Mr. Frant gemessen.
»Ich hoffe«, sagte die Gräfinwitwe, »dass daran niemand mir die Schuld geben wird! Wenn Lady Penistone den Jungen während der Schulferien einlud und mein Gatte seine Zustimmung gab, so rufe ich den Himmel zum Zeugen an, dass es nicht mein ausgesprochener Wunsch war, wenn Desborough aufhörte, Stanyon als sein Heim zu betrachten! Mein Gewissen ist in jeder Beziehung ruhig: Solange er klein war, habe ich meine Pflicht ihm gegenüber erfüllt; und jetzt bin ich entschlossen, dass, ebenso wenig wie ein Wort des Tadels über sein Fernbleiben vom Begräbnis seines teuren Vaters über meine Lippen kommen wird, ebenso keine dem Oberhaupt der Familie schuldige Ehrenbezeigung unterlassen werden soll. Ich werde ihn in der Halle erwarten.«
Diesem spontanen Entschluss getreu versammelten sich an einem kühlen Frühlingsnachmittag fünf Personen im ehemaligen Rittersaal des Schlosses. Die meisten seiner ursprünglichen Züge waren den künstlerischen Bestrebungen mehrerer Generationen zum Opfer gefallen, aber die Stichbalken an der hohen Decke und der große offene Kamin, in dem einige Baumstämme bequem Platz hatten, waren erhalten geblieben. Die wurmstichigen geschnitzten Zwischenwände hatte man schon vor geraumer Zeit entfernt. Dadurch öffnete sich der Saal auf die im rechten Winkel angrenzende kleinere Vorhalle, in der die große Treppe ihren Anfang nahm. Sie führte in kühnem Schwung über einen breiten Treppenabsatz, wo sie sich gabelte, zur Hauptgalerie empor, stammte aus der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts und war dafür berechnet, etwa zwölf Personen bequem nebeneinander hinaufschreiten zu lassen. Außer der großen Eingangstür gegenüber der Treppe führten noch mehrere andere massive, mit Eisenbändern beschlagene Türen in die Vorhalle, was den Saal durchaus nicht wohnlicher machte, bildete er doch nur eine Art Durchgang zu einer Reihe von weiteren Zimmern. Die Hitze, die von den im Kamin brennenden Scheiten ausging, war beträchtlich, genügte aber nicht, um die Zugluft vergessen zu lassen, die durch den Raum strich. Sie schien von überall herzukommen und bewegte sogar fortwährend die schweren Vorhänge, die vor die Fenster gezogen waren, aus denen die ganze der Feuerstelle gegenüberliegende lange Wand vorwiegend zu bestehen schien. Es dämmerte. In den Wandleuchtern und den Kandelabern, die auf den verschiedenen Tischen standen, hatte man Kerzen entzündet. Ihre Flämmchen flackerten ohne Unterlass, brachten das Wachs ungleichmäßig zum Schmelzen und eine der in der Halle versammelten Personen um jede Möglichkeit, die Stiche auf ihrer Stickerei auch nur annähernd genau dort anzubringen, wo sie hingehörten. Nachdem sie zweimal erfolglos ihren Platz gewechselt hatte, legte sie die Arbeit zusammen, verstaute sie in ihrem Arbeitskörbchen und entnahm ihm stattdessen eine nüchterne Strickerei, mit der sie sich zu beschäftigen begann wie jemand, der entschlossen ist, aus misslichen Umständen stillschweigend das Beste zu machen.
Die Einrichtung des Saales hätte für das Stilkonglomerat des Schlosses als Beispiel dienen können, da nur wenige der Stücke, aus denen sie bestand, mit Geschmack ausgewählt waren. Die einzigen zu ihrer Umgebung passenden Gegenstände waren ein sehr schöner Esstisch, der nahe zu den Fenstern gerückt war, und mehrere geschnitzte Eichenstühle mit hölzernen Sitzen. Die übrigen Möbel, zu denen auch ein sehr hässliches modernes Abstelltischchen gehörte, dessen Marmorplatte auf zwei ehernen Greifen ruhte, vertraten sämtliche Epochen und Stilarten. Zwei Rüstungen aus der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts bewachten den Eingang, und an der Wand oberhalb des hohen gipsernen Kaminsimses waren Schilde, Hellebarden, Piken und Glefen in reicher Auswahl angebracht. Daneben hing ein lebensgroßes Bild des verstorbenen Earl, das ihn mit gekreuzten Beinen nachlässig an sein Pferd gelehnt zeigte; sowie ein vorzügliches Schlachtengemälde, auf dem der Rauch, der in Form von Wattekugeln aus den Mäulern unzähliger Kanonen kam, und die faszinierende Gestalt des kommandierenden Offiziers im Vordergrund die bemerkenswertesten Details darstellten.
Nur eine der fünf in Erwartung des Earl um den Kamin versammelten Personen schien sich der Unbehaglichkeit der Situation bewusst zu sein. Sie beklagte sich jedoch nicht, sondern schob ihren Sessel bloß etwas weiter zurück und legte ihren Schal fester um die Schultern, um ihr Gesicht vor den züngelnden Flammen und ihren Rücken vor der aus der Vorhalle eindringenden Kälte zu schützen. Die Gräfinwitwe, königlich auf einem Lehnsessel thronend, die Füße auf einen Schemel gestützt, war gegen Zugluft unempfindlich. Und weder Martin, ihr Sohn, der am Feuer vor sich hin brütete und hin und wieder mit der Stiefelspitze nach einem schwelenden Scheit stieß, noch Mr. Theodore Frant, der damit beschäftigt war, eine der Kerzen zu schnäuzen, die mitten auf dem langen Tisch standen, schienen unter der Kälte zu leiden; was den Kaplan betrifft, der zur Linken der Gräfin saß, so war er gegen die in Stanyon herrschenden spartanischen Verhältnisse schon seit Langem abgehärtet und hatte den Ort für eine behagliche Zusammenkunft wie geschaffen bezeichnet. Diese pflichtschuldige Bemerkung brachte ihm ein huldvolles Lächeln der Gräfin ein, die ihn sodann von der häufig angestellten Beobachtung in Kenntnis setzte, dass nur wenige Feuer imstande wären, eine so glühende Hitze auszustrahlen, wie eben dieses. Dann ersuchte sie Miss Morville halb höflich, halb herablassend, doch die Güte zu haben, ihr aus dem Roten Salon ihren kleinen Ofenschirm herunterzubringen. Miss Morville legte ihre Strickerei unverzüglich beiseite und entfernte sich, um den Auftrag auszuführen; und als ob ihre Abwesenheit ihn von einem Zwang befreit hätte, hob Martin, der bis dahin verdrossen ins Feuer gestarrt hatte, den Kopf und rief: »Verwünscht! Ich wollte, es wäre schon vorüber! Weshalb sollen wir hier parat stehen und warten, bis es ihm genehm ist? Gott weiß, wir brauchen ihn nicht! Ich habe große Lust, zu Barny hinüberzureiten und meinen Braten dort zu essen!«
Sein Vetter blickte ihn stirnrunzelnd an, sagte aber nichts. Eine andere Kerze bedurfte seiner Aufmerksamkeit, und er nahm sich ihrer fachgemäß an. Er war ein kräftig gebauter Mann nahe den Dreißig, mit einem entschlossenen, eher eckigen Gesicht und sehr zurückhaltendem Wesen. Der Schnitt seiner Züge zeigte eine gewisse Ähnlichkeit mit denen seines jungen Vetters, die aber hauptsächlich in der gebogenen Nase, der etwas plumpen Kinnlinie und den Augen bestand, deren überhängende Brauen dem Gesicht einen abweisenden Ausdruck gaben. Die seinen waren von klarem, hellem Grau und kühl wie ein Bergsee; der Mund mit seinen fest zusammengepressten Lippen verriet keinerlei Geheimnisse und schien zu zeigen, dass sein Besitzer nicht nur Entschlossenheit, sondern auch die Fähigkeit besaß, seine Angelegenheiten bei sich zu behalten. Seine Redeweise war gepflegt, und aus seinem Benehmen sprach die ruhige Sicherheit der Menschen seines Standes.
Anders verhielt es sich mit Martin. In seinen dunkelbraunen Augen – sie schienen beinahe schwarz zu sein – und dem sanften Schwung seiner vollen Lippen spiegelte sich jede seiner Stimmungen wider. Er war um sechs Jahre jünger als sein Vetter und stand mit einem Fuß noch immer in den Kinderschuhen. Als Abgott der Mutter und Liebling des Vaters war er sehr verzogen worden und konnte über Winzigkeiten in Unwillen und über ernsthafte Hindernisse, die sich seinen Plänen in den Weg stellten, in blinde Wut geraten. Zwang war ihm unerträglich. Da man ihn von seiner frühesten Jugend an so behandelt hatte, als wäre er und nicht sein Stiefbruder der Erbe von Stanyon, konnte man nicht erwarten, dass er die Nachfolge des Siebenten Earl mit Gleichmut betrachten würde. Die unbestimmte Annahme, sein Bruder würde den Anstrengungen des spanischen Feldzugs nicht gewachsen sein, hatte in ihm den uneingestandenen Gedanken genährt, dass er eines Tages selbst in seines Vaters Fußstapfen treten würde; die Tatsache, dass der Siebente Earl heil und ganz aus dem Krieg auftauchte, fand ihn daher völlig unvorbereitet und erfüllte ihn, nachdem der erste Schreck und die ersten Zweifel verflogen waren, mit wütendem Groll. Er erinnerte sich seines um sieben Jahre älteren Bruders nur dunkel; kaum, dass in seinem Gedächtnis mehr haftete als das Bild eines stillen blonden Knaben mit freundlichem Wesen und sanfter Stimme. Aber er wusste schon jetzt, dass er ihn nicht mögen würde. Er warf einen herausfordernden Blick auf seinen undurchdringlichen Vetter und sagte: »Jetzt ist es meiner Treu schon sechs Uhr vorüber! Wann sollen wir denn essen? Wenn er sich einbildet, in Stanyon Stadtsitten einführen zu können, wird er sich täuschen. Wenigstens bei mir!«
»Rege dich nicht auf, mein Lieber!«, empfahl ihm seine Mutter. »Diesmal müssen wir mit dem Essen wohl auf ihn warten. Aber bei all seinen Fehlern war er immer von nachgiebiger Wesensart. Du kannst versichert sein, dass etwaige Modetorheiten, die er in Lady Penistones Haus gelernt haben mag, unsere Lebensgewohnheiten nicht beeinflussen werden. Das würde mir durchaus nicht passen, und schließlich bin ich hier kein Niemand, soviel ich glaube!«
Mr. Clowne lachte ein wenig über diese Äußerung, die offensichtlich scherzhaft gemeint war, und sagte: »Das will ich meinen, dass Mylady kein Niemand ist! Solche Launen müssen jeden, der mit diesen uns so wohlbekannten Einfällen unvertraut ist, wirklich stutzig machen!« Er fing einen ironischen Blick Theodores auf und fügte hastig hinzu: »Es ist so lange her, seit ich das Vergnügen hatte, Seiner Lordschaft zu begegnen! Wie viel wird er uns doch von seinen Abenteuern zu erzählen haben! Ich bin sicher, wir werden alle an seinen Lippen hängen!«
»An seinen Lippen hängen!«, rief Martin mit einem seiner wilden Blicke, »Ja! Kriechen Sie nur vor ihm! Aber ohne mich! Ich wollte, er läge unter der Erde!«
»Bedenke, was du sprichst!«, mahnte sein Vetter streng.
Martin schoss das Blut in die Wangen. Er war sichtlich betreten und sagte trotzig: »Ich wünsche es wirklich. Aber natürlich meine ich es nicht so. Du brauchst mich wirklich nicht so rasch beim Wort zu nehmen!«
»Für Kriegserinnerungen habe ich nichts übrig«, sagte die Gräfin, als ob der kurze Wortwechsel zwischen den Cousins nicht stattgefunden hätte. »Ich habe durchaus nicht die Absicht, Desborough aufzufordern, seine spanischen Abenteuer zum Besten zu geben. Die Ansichten eines Generals sind bestimmt immer interessant – wiewohl ich der Meinung bin, dass wir vom letzten Krieg schon mehr als genug gehört haben –, aber die eines jüngeren Offiziers können den Zuhörer höchstens ermüden!«
»Sie brauchen sich diesbezüglich keine Sorgen zu machen, Ma’am«, sagte Theodore. »Mein Vetter hat sich nicht so sehr verändert!«
Der Ton, in dem er diese Worte vorbrachte, war so trocken, dass sich der Kaplan genötigt sah, in eine etwa vorhandene Bresche zu springen.
»Ah, Mr. Theodore, Sie erinnern uns daran, dass Sie der Einzige sind, der behaupten darf, mit Seiner Lordschaft näher bekannt zu sein. Sie sind häufig mit ihm zusammengekommen, während wir –«
»Ich habe ihn gelegentlich gesehen«, unterbrach Theodore. »Sein Dienst im Ausland hat häufige Zusammenkünfte unmöglich gemacht.«
»Selbstverständlich – genau das wollte ich eben bemerken! Aber Sie kennen ihn immerhin gut genug, um ihn gernzuhaben!«
»Ich habe ihn immer sehr gerngehabt, Sir!«
Die Rückkehr Miss Morvilles mit einem kleinen auf einen Elfenbeinstab montierten Ofenschirm, den sie der Gräfin überreichte, bot willkommene Abwechslung. Die Gräfin lächelte ihr huldvoll zu und sagte, dass sie ihr sehr verbunden wäre. »Ich weiß nicht, wie ich es übers Herz bringen werde, Sie wieder Ihren lieben Eltern zurückzugeben, wenn sie aus dem Seengebiet heimkehren werden, denn ich weiß bestimmt, dass ich Sie überaus vermissen werde! Meine Tochter – Lady Grampound, Sie wissen ja – rät mir schon die längste Zeit, eine Person von Stand anzustellen, die mir Gesellschaft leisten und meine kleinen Besorgungen für mich erledigen könnte. Sollte ich mich jemals dazu entschließen, so werde ich die Stelle Ihnen anbieten, das verspreche ich Ihnen!«
Miss Morville, nicht so schnell bei der Hand wie Mr. Clowne, Mylady Witz zuzuerkennen, beantwortete diesen Scherz auf praktische Weise. »Es ist sehr liebenswürdig von Ihnen, Ma’am, dass Sie mich gerne ständig in Ihrer Nähe hätten«, sagte sie, »aber ich glaube nicht, dass es das Richtige für mich wäre. Ich würde nämlich nicht annähernd genug zu tun haben.«
»Sie haben gern viel zu tun, nicht wahr?«, sagte Theodore und lächelte ihr belustigt zu.
»Ja«, antwortete sie, setzte sich auf ihren früheren Platz und nahm ihre Strickerei wieder auf. Dann fügte sie nachdenklich hinzu: »Hoffentlich werde ich niemals in die Lage kommen, mir einen solchen Posten suchen zu müssen, denn ich bin alles andere als sanftmütig und daher für keine andere Stelle geeignet als – vielleicht – die einer Haushälterin.«
Diese prosaische Bemerkung schien die Anwesenden ein wenig zu befremden; es folgte ein kurzes Schweigen, das erst vom allgegenwärtigen Mr. Clowne gebrochen wurde. Er sagte schalkhaft: »Woran denken Sie, Miss Morville, während Ihre Hände so geschäftig sind? Oder dürfen wir nicht fragen?«
Sie schien etwas überrascht zu sein, erwiderte jedoch mit der größten Bereitwilligkeit: »Ich überlegte mir gerade, ob ich den Fuß nicht doch ein wenig länger machen soll. Wenn die Strümpfe zu Hause gewaschen werden, gehen sie nämlich nicht ein. Aber dafür doppelt in Cambridge! Die Wäscherinnen dort sollten sich schämen, finde ich!«
Da diese Feststellung bei den Anwesenden keinen Widerhall fand, konzentrierte sie sich von Neuem auf ihre Arbeit und blieb darein so lange vertieft, bis der hellhörige Martin in die Höhe fuhr und ausrief: »Ein Wagen! Endlich!«
Gleichzeitig setzte ein zusätzlicher kalter Luftzug die Eingeweihten davon in Kenntnis, dass jemand die Tür hinter der großen Treppe geöffnet hatte; aus der Vorhalle kamen gedämpfte Anzeichen von Geschäftigkeit und von der Auffahrt das Klappern von Hufen. Miss Morville strickte ihre Nadel zu Ende, faltete den Socken zusammen und verstaute ihn ordentlich in ihrem Arbeitskörbchen. Und obgleich Martin aufgeregt an seinem Halstuch herumfingerte, verriet die Gräfinwitwe mit keinem Anzeichen, dass sie irgendwelche Geräusche gehört hatte, die auf eine Ankunft schließen ließen. Mr. Clowne, ihr getreuer Schatten, folgte ihr mit ebenso angespannter wie wenig überzeugender Aufmerksamkeit auf die Gemeinplätze, die sie zum Besten gab; und Theodore schaute von einem zum anderen und wollte sich offensichtlich nicht vordrängen.
Stimmengewirr aus der Vorhalle zeigte an, dass Abney, der Butler, die Türen aufgerissen hatte, um seinen neuen Herrn zu empfangen. Mehrere Personen einschließlich des Verwalters und einiger Lakaien verbeugten sich und wichen unterwürfig zurück; und gleich darauf kam eine schlanke Gestalt in Sicht. Lediglich Miss Morville, die in einem mit dem Rücken zur Vorhalle stehenden Stuhle saß, blieb dieser erste Anblick des Siebenten Earl versagt. Und gute Erziehung – oder war es Mangel an Interesse? – hielt sie auch davon ab, hinter der Sessellehne hervorzuspähen; worauf sie die Gräfinwitwe, um ihre Billigung darzutun, mit einer weiteren ihrer majestätischen Platituden beehrte.
Alles, was man vom Siebenten Earl auf den ersten Blick sehen konnte, waren ein klassisches Profil unter einem hohen Filzhut, ein Paar glänzender hessischer Stulpenstiefel und eine braune Pelerine mit vielen Kragen und elegantem Faltenwurf, die ihn von Kopf bis Fuß einhüllte. Als Nächstes hörte man seine weiche Stimme. Er sagte zum Butler: »Danke! Ja, ich erinnere mich Ihrer sehr gut! Sie sind Abney. Und Sie sind mein Verwalter, glaube ich. Perran, nicht wahr? Ich freue mich sehr, Sie wiederzusehen.«
Er drehte sich um, als wüsste er, dass alle Blicke an ihm hingen, wandte sich entschlossen dem Saal zu und erblickte die imposante, in purpurrote Seide gehüllte Erscheinung seiner Stiefmutter, einen Turban auf den grauen Locken, mit erhobener Römernase; seinen Stiefbruder, der finster am Kamin stand, sich mit der einen Hand am hohen Sims festklammerte und die andere in der Tasche seiner Atlashose vergraben hielt; seinen Vetter, ein wenig im Hintergrund, mit dem Ansatz eines Lächelns; seinen Kaplan, hin- und hergerissen zwischen Neugierde und Ergebenheit für die Gräfinwitwe. Sie alle betrachtete er gedankenvoll, während er mit der einen Hand seinen Hut abnahm und dem Butler reichte und mit der Anderen Stock und Handschuhe der Obhut eines Lakaien übergab. Abney nahm seinen Hut voll Ehrfurcht entgegen und murmelte: »Ihren Mantel, Mylord!«
»Meinen Mantel, ja: sofort!«, sagte der Earl und schritt gelassen dem Saal zu.
Theodore zögerte einen Augenblick. Er wartete auf eine Geste Martins oder der Gräfin, Dann erst ging er mit ausgestreckten Händen auf den Earl zu und rief: »Gervase, mein Lieber! Willkommen!«
Martin, dessen trotziger Blick auf den zahlreichen Kragen der braunen Pelerine, den spiegelnden Stulpenstiefeln, dem extravagant zugespitzten Hemdkragen und dem goldbraunen Haar verweilte, das sich über einer weißen Stirn in wohlgeordnete Wellen legte, murmelte hörbar: »Mein Gott! Der Kerl ist nichts als ein elender Dandy!«
Kapitel 2
Ein schneller, belustigter Blick in Martins Richtung verriet, dass sein Stiefbruder dessen unwillkürlichen Ausruf gehört hatte. Doch ehe noch Martin, der sehr leicht die Farbe wechselte, bis unter die Haarwurzeln rot geworden war, hatte Gervase die Augen schon abgewendet, schüttelte seinem Vetter die Hand, lächelte ihm zu und sagte: »Wie geht es dir, Theo? Du siehst, ich halte meine Versprechen: Da bin ich!« Theo behielt seine schlanke Hand einen Augenblick in der seinen und drückte sie leicht. »Ein ganzes Jahr! Du Halunke!«
»Nun ja, aber siehst du, wenn ich früher gekommen wäre, hätte ich schwarze Handschuhe anziehen müssen. Und das konnte ich wirklich nicht über mich bringen!« Er zog seine Hand zurück und ging auf den Lehnstuhl seiner Stiefmutter zu.
Sie erhob sich nicht, streckte ihm jedoch die Hand entgegen. »Nun sind Sie also wirklich gekommen, St. Erth! Ich bin glücklich, Sie hier zu sehen, obwohl ich es, ehrlich gestanden, kaum erwartet hätte! Ich weiß nicht, warum es Ihnen nicht möglich war, früher zu kommen, aber schließlich waren Sie immer eigenwillig und launisch, und ich glaube wohl annehmen zu müssen, dass ich an Ihnen keinerlei Änderungen bemerken werde.«
»Liebe Ma’am«, antwortete Gervase und beugte sich über ihre Hand, »glauben Sie mir, es verschafft mir die allergrößte Befriedigung, auf den ersten Blick feststellen zu können, dass Sie sich nicht geändert haben – nicht um ein Jota!«
Diese Worte hatten so liebenswürdig geklungen, dass sie jeden der Anwesenden über ihre eigentliche Bedeutung im Unklaren ließen, mit Ausnahme der Gräfin selbst, der es sehr schwergefallen wäre, sich vorzustellen, dass sie jemandem zum Spott dienen könnte. Sie blieb daher ungerührt und sagte selbstgefällig: »Nein, ich ändere mich wohl nicht. Aber sicher werden Sie Ihren Bruder sehr verändert finden.«
»Sehr verändert, in der Tat«, stimmte Gervase zu, streckte Martin die Hand entgegen und betrachtete ihn eingehend aus seinen lächelnden blauen Augen. »Bist du mein kleiner Bruder? Es kommt mir so unwahrscheinlich vor! Ich hätte dich nicht erkannt!« Er drehte sich um und bot dem Kaplan seine Hand und sein Lächeln. »Mr. Clowne dagegen überall! Wie geht es Ihnen?«
Der Kaplan, der den Earl von dem Augenblick, da er Abney seinen Hut übergeben hatte, angestarrt hatte, als könnte er die Augen nicht von seinem Gesicht abwenden, schien ein wenig verwirrt und antwortete mit weitaus geringerer Geläufigkeit als sonst: »Und ich Sie, Mylord! Einen Augenblick war mir’s, als ob – Sie müssen mir vergeben! Das Gedächtnis spielt einem manchmal seltsame Streiche!«
»Sie meinen wahrscheinlich, dass ich meiner Mutter sehr ähnlich sehe«, sagte Gervase. »Das freut mich – obwohl diese Ähnlichkeit früher manches über mich gebracht hat, das ich lieber vergessen möchte.«
»Es ist des Öfteren bemerkt worden«, verkündete die Gräfin, »dass Martin das wahre Abbild aller Frants ist.«
»Sie sind zu streng, Ma’am«, sagte Gervase galant.
»Ich kann Ihnen sagen, St. Erth, dass es mich verflucht freut, wenn ich den Frants nachgerate!«, sagte Martin.
»Du kannst mir sagen, was immer du willst, mein lieber Martin!«, sagte Gervase ermutigend.
Sein junger Bruder blieb nicht ganz unverständlicherweise eine Weile sprachlos und beschränkte sich darauf, Gervase mit Blicken zu durchbohren. Die Gräfin sagte missbilligend: »Gegen derart oberflächliche Gespräche hege ich den größten Widerwillen. Kommen Sie, St. Erth. Ich werde Sie Miss Morville vorstellen.«
Man verbeugte sich; der Earl murmelte, dass er glücklich wäre, Miss Morvilles Bekanntschaft zu machen; und Miss Morville, die seine Höflichkeitsbezeigungen voll Gleichmut zur Kenntnis nahm, machte ihn hilfsbereiterweise darauf aufmerksam, dass Abney noch immer darauf wartete, ihm seine Pelerine abzunehmen.
»Ja – natürlich!«, sagte Gervase, ließ sich vom Butler aus dem Mantel helfen und zeigte sich in der ganzen Pracht taubengrauer Hosen und eines dunkelblauen Rocks aus feinstem Tuch mit Silberknöpfen nach der neuesten Mode. Um den Hals trug er ein Lorgnon an einem schwarzen Band. Er hob es an ein Auge und schien erst jetzt zu bemerken, dass Bruder und Vetter Kniehosen trugen und dass seine Stiefmutter sogar eine tief dekolletierte Pracht aus purpurroter Seide angezogen hatte. »Oh, ich fürchte fast, ich habe euch warten lassen!«, sagte er niedergeschlagen. »Was sollen wir nun machen? Werden Sie mir erlauben, Ma’am, mich zu Tisch zu setzen, schmutzig wie ich bin? Oder soll ich mich umziehen, während das Essen kalt wird?«
»Sie würden dazu wahrscheinlich eine Stunde brauchen!«, bemerkte Martin verächtlich.
»Mindestens!«, antwortete Gervase ernsthaft.
»Ich bin im Allgemeinen nicht dafür, dass sich ein Mann in seiner Straßenkleidung zu Tisch setzen soll«, erklärte die Gräfin. »Ich finde es liederlich, und Liederlichkeit ist mir ein Gräuel. In gewissen Fällen mag es jedoch angehen. Wir speisen unverzüglich, Abney.«
Der Earl stellte sich neben seinen Bruder ans Feuer, zog eine Schnupftabaksdose aus Sèvresporzellan aus der Tasche, öffnete sie mit einer gewandten Daumenbewegung, nahm eine Prise der darin enthaltenen Mischung und führte sie zur Nase. Ein auffallender Siegelring, manchmal dunkel und glanzlos, dann wieder, wenn der Earl die Hand so bewegte, dass das Licht darauf fiel, grünes Feuer sprühend, erregte die Aufmerksamkeit seiner Stiefmutter. »Was ist das für ein Ring, den Sie da tragen, St. Erth?«, fragte sie mit Nachdruck. »Es scheint mir ein Siegelring zu sein!«
»Es ist tatsächlich einer, Ma’am!«, antwortete er und zog leicht überrascht die Augenbrauen hoch.
»Wie das? Ihr Vetter hat Ihnen den Ring Ihres Vaters vor ich weiß nicht wie viel Monaten übersandt! Alle Grafen von St. Erth haben ihn getragen, fünf Generationen hindurch – wenn nicht länger!«
»Ich trage lieber meinen eigenen«, sagte der Earl ruhig.
»Auf mein Wort!«, rief die Gräfin mit schwellendem Busen. »Ich habe Sie wohl nicht missverstanden, nehme ich an! Sie ziehen ein wertloses Stück Ihrem Erbring vor?«
»Ich möchte wissen«, grübelte der Earl und betrachtete seinen Ring gedankenvoll, »ob man irgendeinem noch ungeborenen Grafen von St. Erth – meinem Ururenkel vielleicht – eines Tages dasselbe sagen wird, wenn er sich weigert, diesen Ring zu tragen?«
Die Gräfin wurde feuerrot; bevor sie jedoch antworten konnte, sagte Miss Morville mit leidenschaftsloser Stimme: »Höchstwahrscheinlich. Die Zeiten ändern sich, wie Sie wissen, und wie oft verachtet eine Generation das, was die vorherige bewundert hat! Meine Mama zum Beispiel besitzt einen Granatschmuck, den ich ganz gräulich finde. Ich werde damit sicher nichts anzufangen wissen, wenn er einmal mir gehören wird.«
»Die Kindesliebe wird Sie nicht dazu bewegen, den Schmuck zu tragen, Miss Morville?«
»Ich glaube nicht«, erwiderte sie nach einigem Nachdenken.
»Meine liebe Drusilla, die Granate Ihrer Mutter – sicherlich sehr hübsch in ihrer Art! – können schwerlich mit dem Frant’schen Ring verglichen werden!«, sagte die Gräfin. »Ich muss sagen, wenn ich höre, dass St. Erth lieber einen billigen, geschmacklosen Ring –«
»Halt, halt, das habe ich niemals gesagt«, unterbrach der Earl. »Sie dürfen den Ring wirklich weder billig noch geschmacklos nennen, meine liebe Ma’am. Es ist ein sehr schöner Smaragd, eigens für mich geschliffen. Ich glaube sogar, dass Sie nirgends einen ähnlichen mehr finden werden. Smaragde sind nämlich sehr selten, und das Schneiden von Siegeln ist, soviel ich weiß, mit beträchtlichen Schwierigkeiten verbunden.«
»Ich verstehe nichts von diesen Dingen – aber ich bin empört. Zutiefst empört! Ihr Vater würde seinen Ring herzlich gerne Martin vermacht haben, das können Sie mir glauben, hätte er es nicht für unrecht gehalten, ihn jemand anderem zu geben als dem Erben!«
»Hat er ihn tatsächlich ausdrücklich mir hinterlassen?«, fragte Gervase interessiert. »Das muss ich wirklich als Steigerung seines Wertes betrachten. Ja, der Ring wird dadurch zu einer Rarität, da er sicherlich das einzige Erbstück darstellt, das mir mein Vater freiwillig hinterlassen hat. Ich werde ihn in einen Glasschrank legen.«
Martin errötete und sagte: »Ich merke genau, worauf Sie aus sind! Meine Schuld ist es nicht, wenn mein Vater mich lieber hatte als Sie!«
»Nein, dein Glück!«, sagte Gervase.
»Mylord! Mr. Martin!«, sagte der Kaplan beschwörend.
Die beiden Brüder maßen sich mit feindlichen Blicken aus hitzigen braunen und kühlen blauen Augen. Der unerquickliche Zwischenfall wurde durch den Eintritt des Butlers beendet, der meldete, dass die Tafel gedeckt sei.
Es gab zwei Speisesäle in Stanyon. Der eine wurde nur dann benützt, wenn die Familie allein speiste. Beide lagen im ersten Stock am Ende des Ostflügels und waren über die große Treppe, den Italienischen Salon und eine breite Galerie, die den Namen »Langer Salon« führte, erreichbar. Außerdem war der Zugang noch durch zwei durch Wandschirme verdeckte Türen möglich, die aber nur zu einer steil zur Küche abfallenden Stiege führten. Das Familienspeisezimmer war beträchtlich kleiner als das für offizielle Anlässe. Da aber der darin befindliche Mahagonitisch dafür berechnet war, zwanzig Personen bequem Platz zu bieten, schien er für die kleine Gesellschaft viel zu groß. Die Gräfin nahm am unteren Ende des Tisches Platz und verwies ihren Sohn und den Kaplan auf die Plätze zu ihrer Rechten und Linken. Martin, der ohne zu überlegen zum oberen Ende des Tisches gegangen war, besann sich auf die veränderten Umstände, murmelte etwas Unverständliches und entfernte sich wieder. Die Gräfin bedeutete Miss Morville mit einer Handbewegung, rechts vom Earl Platz zu nehmen, und Theodore setzte sich ihr gegenüber. Da die Mitte des Tisches von einem riesenhaften silbernen Tafelaufsatz eingenommen wurde (einem Geschenk der Ostindischen Handelsgesellschaft an den Großvater des Earl), der einen von ebenso geschmackvoll wie unglaubwürdig angeordneten Palmen, Elefanten, Tigern und Eingeborenen mit Sänften umgebenen Tempel darstellte, konnten der Earl und seine Stiefmutter einander nicht sehen, und eine Unterhaltung von einem Tischende zum anderen war ganz unmöglich. Ebenso wenig kam ein Gespräch zwischen den einzelnen Tischnachbarn zustande, da sie ein verschwenderischer Aufwand an Tischzeug voneinander trennte und ihnen ein nur schwer zu überwindendes Gefühl der Einsamkeit vermittelte. Dafür sorgte die Gräfin mit durchdringender Stimme für einen gleichmäßigen Fluss von leerem Geschwätz, das hauptsächlich aus genauen Erklärungen der verschiedenen Verwandtschaftsbeziehungen bestand, die sie mit jeder einzelnen der von ihr erwähnten Personen verband; aber die Konversation zwischen St. Erth, seinem Vetter und Miss Morville war eine äußerst stockende. Und als sich Martin bereits zum dritten Mal den Hals ausrenkte, um dem durch den Tafelaufsatz seinen Blicken entzogenen Theo etwas mitzuteilen, reifte im Earl ein Entschluss, den er sogleich in die Tat umsetzte. Kaum hatte sich die Gräfin mit Miss Morville in den Italienischen Salon zurückgezogen, als er sagte: »Abney!«
»Mylord?«
»Hat dieser Tisch Ausziehbretter?«
»Viele, Mylord.«
»Dann nehmen Sie sie weg, bitte.«
»Wegnehmen, Mylord?«
»Nicht sofort, natürlich, aber ehe ich mich wieder an diesen Tisch setze. Und dieses Ding ebenso!«
»Den Tafelaufsatz«, stammelte Abney. »Wo – wo wünscht Eure Lordschaft, dass ich ihn hinstellen soll?«
Der Earl betrachtete den Aufsatz nachdenklich. »Eine treffende Frage, Abney. Es sei denn, Sie wüssten einen dunklen Schrank, wo er sicher verstaut werden könnte?«
»Meine Mutter«, erklärte Martin, klar zum Gefecht, »hat für dieses Stück eine besondere Vorliebe.«
»Was für ein glücklicher Umstand!«, erwiderte St. Erth. »Setz dich doch zu mir, Martin! Und auch Sie, Mr. Clowne! Abney, sorgen Sie dafür, dass der Tafelaufsatz in Myladys Wohnzimmer gebracht wird.«
Theo war sichtlich erheitert, sagte aber leise: »Gervase, um Gottes willen –!«
»Sie werden dieses Zeug nicht in das Zimmer meiner Mutter stellen lassen!«, rief Martin aufgeregt.
»Glaubst du, sie würde sich darüber nicht freuen? Wenn sie eine besondere Vorliebe für den Tafelaufsatz hat, möchte ich sie seiner nicht berauben.«
»Sie wird wollen, dass er dort bleibt, wo er immer gestanden hat, darauf können Sie sich verlassen. Und wie ich Mama kenne«, setzte er genießerisch hinzu, »möchte ich wetten, dass er auch dort bleiben wird.«
»Oh, das würde ich an deiner Stelle lieber nicht tun«, sagte Gervase. »Du kennst mich nämlich nicht, und es ist niemals klug, auf ein unbekanntes Pferd zu setzen.«
»Mir scheint, Sie glauben, bloß weil Sie jetzt St. Erth sind, können Sie in Stanyon das Oberste zuunterst kehren, wenn es Ihnen so passt«, knurrte Martin, ein wenig in die Enge getrieben.
»Eigentlich schon«, antwortete Gervase, »aber du kannst unbesorgt sein, ich werde es nicht ganz so arg treiben.«
»Wir werden sehen, was Mama dazu zu sagen hat!«, war alles, was Martin darauf einfiel.
Die Kommentare der Gräfin, der die grause Botschaft unverzüglich überbracht wurde, waren ebenso erschöpfend wie wortreich und gipfelten in der unklugen Ankündigung, dass Abney seine Befehle von seiner Herrin entgegennehmen würde.
»Oh, ich hoffe, das wird er nicht tun!«, sagte Gervase. »Ich würde nämlich einen Diener, der schon so viele Jahre im Haus ist, höchst ungern entlassen!« Er schaute lächelnd in das entgeisterte Gesicht der Gräfin hinab und sagte in seiner liebenswürdigen Art: »Aber ich zähle viel zu sehr auf Ihr Anstandsgefühl, Ma’am, um anzunehmen, Sie würden in Stanyon irgendwelche Befehle erteilen, die den meinen zuwiderlaufen.«
Alle außer Miss Morville, die in die neuesten Modejournale vertieft war, erwarteten den Höhepunkt dieses Zusammenstoßes mit angehaltenem Atem und waren je nach Veranlagung enttäuscht oder erleichtert, als die Gräfinwitwe nach kurzem Schweigen mit verhaltenem Zorn sagte: »Sie können in Ihrem Hause machen, was Sie wollen, St. Erth! Bitte zögern Sie nicht, mich davon in Kenntnis zu setzen, falls ich unverzüglich in den Witwensitz übersiedeln soll!«
»Aber ganz im Gegenteil! Es würde mir sehr leidtun, wenn Sie das täten, Ma’am!«, erwiderte Gervase. »Ein Haus wie Stanyon wäre ein trauriger Aufenthaltsort ohne Herrin!« Da ihr Gesicht keine Spur von Versöhnlichkeit zeigte, setzte er in seinem liebenswürdigsten Ton hinzu: »Seien Sie mir nicht böse! Müssen wir denn zanken? Ich möchte mich wirklich gut mit Ihnen vertragen!«
»Sie können versichert sein, dass nicht ich es bin, die Streit mit Ihnen suchen wird!«, sagte die Gräfinwitwe unbeugsam. »Es wäre in der Tat sehr seltsam, wenn ich mit meinem Stiefsohn Streit vom Zaune brechen wollte! Bitte, haben Sie die Güte, mich in Zukunft von den Änderungen in Kenntnis setzen zu wollen, die Sie an den in Stanyon bestehenden Einrichtungen vorzunehmen wünschen!«
»Danke!«, sagte Gervase mit einer Verbeugung.
Der sanfte Ton seiner Stimme ließ seinen Vetter die Brauen runzeln; aber Martin war offensichtlich der Ansicht, dass seine Mutter die erste Runde verloren hatte, denn er rief etwas Zorniges und stürzte aus dem Zimmer, als ob er plötzlich den Koller bekommen hätte.
Die Gräfinwitwe ignorierte den Zwischenfall in hochherziger Weise und ersuchte Theo, nach dem Spieltisch zu läuten, da, wie sie sagte, St. Erth sicherlich gerne eine Partie Whist spielen würde. Wenn Gervase auch nicht danach aussah, als ob diese Pläne zu seiner Unterhaltung nach seinem Geschmack wären, so bewog ihn doch seine gefällige Wesensart, ihnen fügsam zuzustimmen und, als die vier Spieler beisammen waren, die von seiner Stiefmutter an seinem Spiel mitleidslos geübte Kritik voll Gleichmut zu ertragen. Sein Vetter und der Kaplan waren die anderen beiden Spieler, da sich Miss Morville energisch geweigert hatte, mit von der Partie zu sein; und erst das Erscheinen des Teetabletts gegen zehn Uhr beendete die Unterhaltung. Die Gräfinwitwe, die während der ganzen Zeit unermüdlich ihre Meinung über ihre eigene Geschicklichkeit bzw. die Ungeschicklichkeit der anderen drei Spieler abgegeben hatte, über das Blatt, über die Regeln, an die sie sich hielt und die sie mithilfe von Maximen veranschaulichte, deren Urheber ihr Vater gewesen war, wodurch Gervase von den geistigen Fähigkeiten dieses verstorbenen Edelmannes eine sehr geringe Meinung bekam, verkündete nun, dass wohl niemand mehr Lust hätte, ein neues Spiel zu beginnen, erhob sich und ließ sich in ihrem Lieblingssessel neben dem Feuer nieder. Miss Morville servierte Tee und Kaffee, was den Earl auf den Gedanken brachte, sie stünde vielleicht doch in den Diensten seiner Stiefmutter; auf den ersten Blick hatte er sie für eine arme Verwandte oder eine bezahlte Gesellschafterin gehalten; da aber die Gräfin sie – wenn auch nicht mit besonderer Auszeichnung – so doch zumindest mit vollkommener Höflichkeit behandelte, war er zu dem Schluss gekommen, sie müsse in Stanyon zu Gast sein. Er war mit den Feinheiten der Damenmode nicht besonders vertraut, aber es schien ihm, als sei sie mit Anstand, ja sogar mit einer gewissen ruhigen Vornehmheit gekleidet. Ihr Kleid aus weißer Seide mit einem blassrosa Mieder und langen an den Handgelenken zusammengefassten Ärmeln zeigte nichts von dem Spitzenputz und der Posamentierarbeit, mit denen elegante junge Damen ihre Kleider zu schmücken pflegten. Andererseits war es über ihrer rundlichen Brust tiefer ausgeschnitten, als man dies bei einer bezahlten Gesellschafterin wohl geduldet hätte; und sie trug ein sehr hübsches Schmuckstück an einer goldenen Kette um den Hals. An ihrem Benehmen war keine Spur von Unterwürfigkeit zu entdecken. Sie begann keinerlei Unterhaltung, antwortete aber bereitwillig und gelassen, wenn man das Wort an sie richtete. Ein rosa Band hielt ihre mattbraunen, sehr einfach frisierten Locken zusammen, und ihr Gesicht war einnehmend, jedoch nicht schön. Das Beste daran waren ihre dunklen großen Augen, die offen und frei in die Welt blickten. Sie hatte eine hübsche, aber viel zu kleine Figur und einen eher kurzen Hals. Sie war nicht kokett; der Earl fand sie uninteressant.
Nach dem Tee kam die Familienandacht, worauf sich die Gräfin mit Miss Morville zurückzog und Theo beauftragte, St. Erth in sein Schlafzimmer zu geleiten. »Nicht«, sagte sie edelmütig, »dass ich Ihnen vorschreiben wollte, wann Sie zu Bett gehen sollen, denn Sie können natürlich tun und lassen, was Sie wollen, aber ich zweifle nicht daran, dass Sie von der Reise sehr müde sind.«
Es schien zwar nicht wahrscheinlich, dass eine Fahrt von fünfzig Meilen in einer luxuriösen Kutsche (der Earl war bloß aus Penistone Hall gekommen) einen Mann ermüden konnte, der die Strapazen eines anstrengenden Feldzugs gewohnt war, aber Gervase stimmte mit seiner gewohnten Liebenswürdigkeit zu, wünschte seiner Stiefmutter eine gute Nacht und schob seinen Arm unter den Theos mit den Worten: »Nun, bringe mich zu Bett! Wo hat man mich untergebracht?«
»In deines Vaters Zimmer, natürlich.«
»Oh Gott! Muss das sein?«
Theo lächelte. »Lasse meiner Tante wenigstens die Gerechtigkeit widerfahren, zuzugeben, dass es unpassend gewesen wäre, dir einen anderen Raum anzuweisen!«
Das Schlafzimmer des Earl lag im Haupt- oder Tudorflügel des Schlosses und war ein geräumiges Zimmer, dem dunkle Täfelungen und rote Vorhänge ein düsteres Aussehen gaben. Man hatte jedoch mehrere Kerzenleuchter hineingestellt und im steinernen Kamin ein helles Feuer entzündet. Ein distinguierter Mann, auf den ersten Blick als des Gentlemans Gentleman kenntlich, harrte dort seines Herrn und hatte bereits dessen Nachtzeug hergerichtet.
»Nimm Platz, Theo!«, sagte St. Erth. »Turvey, lassen Sie Brandy und Gläser kommen!«
Der Kammerdiener verneigte sich, sagte jedoch: »In der Annahme, Eure Lordschaft würde diesen Wunsch aussprechen, habe ich beim Butler bereits das Nötige beschafft. Gestatten Sie, Mylord, dass ich Ihnen die Stiefel ausziehe!«
Der Earl setzte sich nieder und streckte ein Bein aus. Der Diener kniete vor ihm hin, zog ihm den einen der beiden Stulpenstiefel herunter – er handhabte ihn mit liebevoller Sorgfalt – und betrachtete ihn besorgt, auf der Suche nach etwaigen Kratzern. Er fand keine, seufzte erleichtert auf, zog dem Earl auch den zweiten Stiefel herunter und stellte beide sorgsam nebeneinander hin. Dann half er dem Earl aus seinem eng anliegenden Rock und hielt ihm einen wattierten, mit Schnüren besetzten Schlafrock aus Seidenbrokat hin. Der Earl riss das kunstvoll geknüpfte Halstuch herunter, warf es beiseite und entließ den Diener mit einem Kopfnicken.
»Danke! Ich werde läuten, wenn ich so weit bin.«
Der Diener zog sich mit einer Verbeugung zurück, unter Mitnahme der geliebten Stiefel. St. Erth füllte zwei Gläser mit Brandy, reichte eines seinem Vetter und sank in einen bequemen Stuhl neben dem Feuer. Theo, der beim Anblick des prächtigen Schlafrocks gestutzt hatte, lachte laut und sagte: »Ich glaube, du bist wirklich ein Dandy geworden, Gervase!«
»Ja, das war anscheinend auch Martins Meinung!«, stimmte Gervase zu und schwenkte sein Brandyglas.
»Oh! Das hast du also gehört?«
»War das nicht der Zweck der Übung?«
»Ich weiß nicht.« Theo schwieg einen Augenblick und schaute ins Feuer. Nach einer kleinen Weile blickte er seinen Vetter an und sagte unvermittelt: »Er kann dich nicht leiden, Gervase.«
»Das ist mir schon klar geworden – nur nicht, warum.«
»Ist der Grund wirklich so schwer zu finden? Du stehst zwischen ihm und dem Titel.«
»Aber mein lieber Theo, das habe ich immer getan! Ich bin doch kein verlorener Sohn, der plötzlich zurückkommt, um ihn aus einer Stellung zu vertreiben, die er die seine glaubte!«
»Nicht verloren, aber ich glaube, er dachte, die Stellung könnte eines Tages wohl die seine werden!«, antwortete Theo.
»Ich halte ihn zwar für einen sehr beschränkten jungen Mann, aber doch nicht für einen solchen Dummkopf!«, sagte Gervase ungläubig. »Nur ich konnte den Rang meines Vaters erben!«
»Sehr richtig, aber Tote erben nicht«, sagte Theo trocken.
»Tote!«, rief Gervase halb belustigt, halb betroffen.
»Mein lieber Gervase, du hast an mehr als einem Kampf teilgenommen und wirst zugeben müssen, dass es niemanden überrascht hätte, wenn du in der Schlacht gefallen wärest. Im Gegenteil, man hat diese Möglichkeit als durchaus wahrscheinlich betrachtet.«
»Und erhofft?«
»Und erhofft.«
Das Gesicht des Earl blieb undurchdringlich; nach einer Weile sagte Theo: »Ich habe dich erschüttert, aber ich glaube, es ist besser, offen zu sprechen. Du kannst doch nicht angenommen haben, dass sie dich lieben!«
»Nicht Lady St. Erth, nein! Aber Martin …!«
»Warum sollte er? Er hat weder von meinem Onkel Gutes über dich gehört noch von seiner Mutter; er wurde in allem und jedem so behandelt, als ob er der Erbe wäre; man hat ihn verzogen und verwöhnt – nun, es zahlt sich nicht aus, weiterzusprechen, sonst könnte ich dir noch so manches erzählen! Für ihn bist du eben ein Usurpator.«
Gervase trank seinen Brandy aus und stellte das Glas nieder.
»Ich verstehe. Das ist wirklich traurig! Eine innere Stimme sagt mir, dass ich nicht sehr lange in Stanyon sein werde.«
»Was willst du damit sagen?«, fragte Theo scharf.
Gervase schaute ihn ein wenig bestürzt an. »Was soll ich damit schon sagen wollen?«
»Martin ist unbeherrscht und jähzornig – aber er würde dich niemals ermorden wollen, Gervase!«
»Ermorden! Guter Gott, ich hoffe nicht!«, rief der Earl lachend aus. »Nein, ich meinte bloß, dass ich lieber in Maplefield oder in Studham wohnen würde – doch nein, Studham gehört nicht zu meinem Erbe, nicht wahr? Es gehört Martin!«
»Ja, es gehört Martin, ebenso wie die Besitzungen in Jamaika«, sagte Theo grimmig, »und deine Stiefmutter hat auf Lebenszeit das Haus in London und den Witwensitz.«
»Es sei ihr gegönnt«, antwortete der Earl leichthin.
»Wenn ich dich nur dazu bringen kann, dir über den Zustand Gedanken zu machen, in dem sich dein Erbe befindet, so wird dich vielleicht ein Großteil von dem verdrießen, was die beiden jetzt besitzen«, erwiderte Theo. »Ich dachte manchmal, mein Onkel wäre nicht ganz bei Trost! Und du hast es mir zu verdanken, wenn das Gut noch halbwegs beisammen ist!«
»Ich glaube, ich habe dir für mehr zu danken, als du mich wissen lassen willst!«, sagte St. Erth und lächelte ihm zu. »Du warst mir ein guter Freund, Theo, und ich danke dir dafür.«
»Ich tat, was in meiner Macht stand, um den Besitz zusammenzuhalten«, sagte Theo rau. »Aber ich bin fest entschlossen, dich dazu zu zwingen, dich um deine Angelegenheiten zu kümmern. Lass dir das gesagt sein!«
»Du bist ja ein Tyrann! Aber du tust mir unrecht. Ich habe das Testament meines Vaters gelesen und bilde mir ein, über den Stand der Dinge ziemlich genau Bescheid zu wissen!«
»Dann wundert es mich, dass du einen solchen Aufwand treibst, Gervase!«, sagte Theo offen. »Die Ausgaben, mit denen du das Gut während des ganzen letzten Jahres belastet hast –!«
»Oh, wirft es nicht so viel ab? Dann werde ich wohl eine reiche Erbin heiraten müssen!«
»Ich wollte, du könntest einen Augenblick ernst sein! So schlimm steht die Sache nun wieder nicht, aber du wirst gut daran tun, in Zukunft ein bisschen vorsichtiger zu sein. Wenn du erst siehst, wie die Dinge stehen, wirst du dich hoffentlich dazu überreden lassen, deinen Wohnsitz hier aufzuschlagen. Es tut nicht gut, Stanyon herrenlos zu lassen.«
»Stanyon hat einen sehr guten Herrn an dir, sollte ich meinen.«
»Unsinn! Ich bin nichts als dein Sachwalter.«
»Aber ich würde mich hier zu Tode langweilen!«, wandte Gervase ein. »Bedenke doch, was für einen fürchterlichen Abend ich schon verbracht habe! Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wo Martin hingegangen ist, aber ich finde, man kann ihm seine Flucht nicht verübeln. Ich wollte, ich hätte den Mut gehabt, seinem Beispiel zu folgen! Und wer, ich bitte dich, ist dieses Gänschen? Hat man sie zu meiner Unterhaltung eingeladen? Sag mir jetzt bloß nicht, dass sie eine reiche Erbin ist! Man kann nicht – nein, man kann wirklich nicht von mir erwarten, dass ich mich mit einer Frau abgebe, deren Konversation ebenso uninteressant ist wie ihr Gesicht!«
»Drusilla? Nein, nein, durchaus nicht!«, lächelte Theo. »Ich glaube, meine Tante ist der Ansicht, dass sie eine sehr geeignete Frau für mich abgeben würde!«
»Armer Theo!«
»Oh, sie ist in ihrer Art ein recht nettes Mädchen! Aber nicht ganz nach meinem Geschmack. Sie ist in Stanyon bloß zu Gast, während ihre Eltern auf Besuch ins Seengebiet gefahren sind. Sie wohnen in Gilbourne und sind übrigens deine Pächter. Mylady hat Drusilla in ihr Herz geschlossen, was mich weiter nicht wundert, denn sie ist immer sehr gefällig und wird in Anbetracht ihres uninteressanten Äußeren, wie du es zu nennen beliebst, Lady St. Erths Plänen für Martin kaum je gefährlich werden!« Er stand auf und fügte mit einem Blick auf den Earl hinzu: »Ich hoffe, wir haben eine bessere Unterhaltung für dich! Die Jagd, zum Beispiel, wie du dich erinnern wirst; deine Reviere sollten dir prächtigen Sport bieten können.«
»Mein lieber Theo, ich habe wohl einige Jahre im Ausland gelebt, aber schließlich bin ich in England erzogen worden!«, wandte Gervase ein. »Wenn du mir sagen willst, was ich zu dieser Jahreszeit jagen oder schießen soll –!«
Theo lachte. »Waldtauben!«
»Ja, und Kaninchen! Danke schön!«
»Du wirst zur Saison nach London fahren, nehme ich an!«
»Das magst du mit vollster Überzeugung!«
»Ich sehe, es ist zwecklos, Worte an dich zu verschwenden. Wenn du nur lange genug hierbleibst, um deine Lage genau zu erkennen, werde ich mich schon zufriedengeben! Morgen, mache ich dich gleich aufmerksam, wirst du dich gefälligst den Geschäften widmen. Aber dafür will ich dich heute nicht länger quälen. Schlaf gut!«
»Ich hoffe, es wird mir gelingen! Aber ich fürchte, meine Umgebung wird mir Albträume verursachen! Wo wohnst du, Theo?«
»Oh, im Turm! Er ist langsam zu meiner Domäne geworden. Mein Schlafzimmer liegt über dem Archiv, weißt du.«
»Ein Tagesmarsch bis zu dir! Das muss ja fürchterlich unbequem sein!«
»Im Gegenteil, ich fühle mich sehr wohl dort. Ich kann mir vorstellen, in meinem eigenen Haus zu wohnen, und habe außerdem, wann immer es mir passt, die Möglichkeit, den Turm durch die Tür in den Kapellenhof zu betreten und so der Wachsamkeit meiner Tante zu entgehen. Sonst müsste ich ihr in allen Einzelheiten mitteilen, wo ich war oder wohin ich gehe!«
»Guter Gott! Muss ich mich auch auf solche Verhöre gefasst machen?«
»Meine Tante«, sagte Theo mit verstecktem Blinzeln, »legt größten Wert darauf, zu erfahren, was man tut und warum.«
»Wie entsetzlich! Ich werde sicher nicht länger als eine Woche in Stanyon bleiben!«
Sein Vetter lächelte bloß, schüttelte den Kopf und ging. Der Earl läutete seinem Diener, der sogleich mit einer Kanne heißen Wassers und einer Wärmepfanne erschien. Der Earl starrte diese Gegenstände an und sagte: »Was zum Teufel treiben Sie da?«
»Es scheint, Mylord«, antwortete Turvey mit einer Stimme, deren Ausdruckslosigkeit auf sorgfältiger Berechnung beruhte, »dass in diesem Hause – oder ‹Schlosse›, wie ich fürchte, sagen zu müssen – äußerst zeitige Dienststunden eingehalten werden. Die Dienerschaft ist schon schlafen gegangen, und Eure Lordschaft wird sich wohl kaum in ein kaltes Bett legen wollen.«
»Danke. Aber meine Konstitution ist wirklich nicht so schwach, wie Sie zu glauben scheinen! Nächstens werden Sie mir noch Laudanum als Schlaftrunk bringen. Stellen Sie das Zeug zum Kamin, und seien Sie kein zweites Mal so albern, bitte! Hat man Sie ordentlich untergebracht?«
»Ich klage nicht, Mylord. Ich nehme an, dass das Schloss beträchtlich alt ist.«
»Ja, manche Teile stammen aus dem vierzehnten Jahrhundert«, sagte der Earl und streifte sein Hemd ab. »Einst war es mit einem Wassergraben umgeben, aber von dem ist heute nur mehr der See übrig.«
»Das, Mylord«, sagte Turvey und nahm ihm das Hemd ab, »dürfte zweifelsohne für die Feuchtigkeit der hier herrschenden Atmosphäre verantwortlich sein.«
»Sehr wahrscheinlich!«, antwortete Gervase. »Ich entnehme Ihren Bemerkungen, dass sich Stanyon nicht Ihrer Billigung erfreut!«
»Das Gebäude ist sicherlich sehr interessant, Mylord. Möglicherweise wird man sich auch daran gewöhnen, auf dem Weg zum Zimmer Eurer Lordschaft drei Galerien und sieben Türen durchschreiten zu müssen.«
»Oh!«, sagte der Earl, ein wenig aus der Fassung gebracht, »es wäre sicher besser, wenn Sie mehr in meiner Nähe untergebracht werden könnten.«
»Ich spielte nur auf die Lage des Dienerschaftstraktes an, Mylord; um das Zimmer Eurer Lordschaft von meinem eigenen zu erreichen, muss ich zwei Treppen hinuntersteigen, drei Korridore durchqueren, eine Tür öffnen, die auf eine der Galerien hinausführt, mit denen das Schloss – wenn ich so sagen darf! – einigermaßen verschwenderisch ausgestattet zu sein scheint; dann erst komme ich durch eine Art Vorzimmer oder Vestibül in den Hof, an dem dieser Teil des Schlosses liegt.« Er wartete, bis diese gemessenen Worte in die Seele seines Herrn gedrungen waren, und fügte dann beschwichtigend hinzu: »Eure Lordschaft braucht jedoch nicht zu befürchten, dass ich es verabsäumen werde, am Morgen das Rasierwasser Eurer Lordschaft zu bringen. Ich habe einen der Unterlakaien – einen sehr gefälligen Burschen – ersucht, mir so lange als Führer zu dienen, bis ich mit meiner Umgebung etwas vertrauter bin.« Er hielt inne. »Oder vielleicht sollte ich sagen: bis Eure Lordschaft beschließt, nach London zurückzukehren!«
Kapitel 3
Weder die Gräfinwitwe noch Miss Morville kamen am nächsten Morgen zum Frühstück herunter; und obwohl für den Kaplan gedeckt war, war er aus seinem Schlafzimmer noch nicht aufgetaucht, als sich Gervase in dem sonnigen Wohnzimmer zu Bruder und Vetter gesellte. Sein Eintritt brachte Martin ein wenig aus der Fassung, da er gerade in vollem Schwung war, die Kleidung, die der Earl offensichtlich für das Landleben passend fand, einer vernichtenden Kritik zu unterziehen. Nun war aber Gervase untadelig angezogen, in Reithosen, Stulpenstiefeln und einem praktischen, wenn auch außergewöhnlich gut geschnittenen Rock, sodass Martins empörte Worte sogar in dessen eigenen Ohren mit einem Male sonderbar unpassend klangen. Theo, der ihm in nicht gerade ermutigendem Schweigen zugehört hatte, lächelte beim Anblick des Earl und sagte zu seinem jüngeren Vetter: »Was sagtest du doch gerade?«
»Nichts von Bedeutung!«, schnappte Martin mit einem durchbohrenden Blick.
»Guten Morgen!«, sagte Gervase. »Du brauchst nicht zu läuten, Theo, Abney weiß, dass ich hier bin.«
»Keine Albträume, Gervase, hoffe ich?«, sagte Theo mit feinem Lächeln.
»Nicht die geringsten. Weiß einer von euch vielleicht, ob meine Pferde schon eingetroffen sind?«
»Ja, heute früh, glaube ich. Ihr Stallbursche ist über Nacht in Grantham geblieben. Ein ehemaliger Soldat, nicht wahr?«
»Ja, ein feiner Kerl, aus meinem eigenen Regiment«, erwiderte Gervase, ging zur Anrichte hinüber und begann sich ein großes Stück Schinken herunterzuschneiden.
»Wo haben Sie diesen Grauschimmel her, Gervase?«, fragte Martin.
Der Earl warf einen Blick über seine Schulter. »Aus Irland. Gefällt er dir?«
»Bestes Vollblut! Ich nehme an, Sie wollen uns Melton-Leute damit in den Schatten stellen?«
»Ich habe ihn noch nie auf der Jagd verwendet. Wir werden sehen, wie er sich anstellt. Ich habe ihn hergebracht, um ihn auszuprobieren.«
»Sie werden ihn doch im Sommer nicht ständig reiten!«
»Nein, das werde ich nicht«, sagte der Earl ernsthaft.
»Mein lieber Martin«, sagte Theo, »glaubst du nicht, dass Gervase weit mehr von Pferden versteht als du?«
»Das kann schon sein, aber Kavalleriepferde sind ein Kapitel für sich.«
Darüber musste Gervase lachen. »Sehr richtig, wie ich zu meinem eigenen Schaden gemerkt habe. Aber ich war glücklicher dran als viele: Ich musste nur ein einziges Mal auf einem Kavalleriepferd reiten.«
»Wann war das?«, erkundigte sich Theo.
»In Orthez. An diesem Tag wurden drei Pferde unter mir zusammengeschossen. Ihr könnt mir glauben, ich fand es äußerst unbequem.«
»Du scheinst ja unter dem Schutz einer guten Fee zu stehen, Gervase.«
»Nicht wahr!«, pflichtete der Earl bei und setzte sich zu Tisch.
»Sind Sie wirklich nie verwundet worden?«, fragte Martin neugierig.
»Lediglich ein oder zwei Säbelhiebe und einmal ein Streifschuss von einer versprengten Kugel. Aber sag du mir lieber, was für Pferde hier in den Ställen sind!«
Keine andere Frage hätte Martin schneller zu einer Einstellung der Feindseligkeiten veranlassen können. Ohne dass es einer weiteren Aufforderung bedurfte, stürzte er sich in eine detaillierte technische Beschreibung aller ordentlichen Vollblutpferde, herrlichen Traber und feurigen Füchse, die augenblicklich in den Ställen von Stanyon zu finden waren. Seine dunklen Augen glänzten vor Erregung, und der trotzige Ausdruck war von seinen Lippen gewichen. Der Earl hörte ihm mit einem leichten Lächeln zu, ließ eine Fangfrage über den Zustand des Jagdreviers einschlüpfen und beendete sein Frühstück zur Geräuschkulisse eines Vortrags über die Vorteile von Nahschüssen im Gegensatz zu Streuschüssen, die erstklassige Qualität der von der Firma Manton fabrizierten Gewehre und die Unübertrefflichkeit von Zündhütchen.
»Um die Wahrheit zu sagen«, gestand Martin, »ich bin ein leidenschaftlicher Jäger!«
Der Earl verbiss ein Lachen. »Das merke ich. Aber was tust du im Frühling und im Sommer, Martin?«
»Ach Gott, natürlich ist da nicht viel los«, gab Martin zu. »Aber ein Kaninchen oder ein paar Waldtauben sind immer zu haben.«
»Wenn du eine Waldtaube triffst, bist du ein guter Schütze«, bemerkte Gervase.