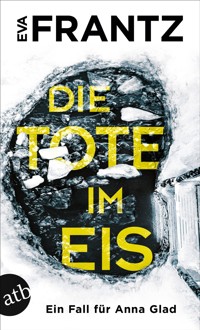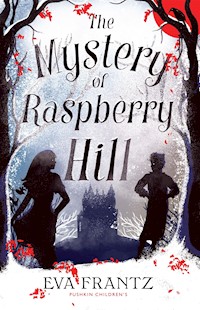8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Anna Glad ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Insel in blutroten Wellen.
Blutspuren führen die Treppe zu Börje Bohmans Haus hinauf, dem einzig verbliebenen auf der neuen Radwegstrecke hinunter in den Ort. Doch der sturköpfige Besitzer, der dem Bauprojekt partout nicht weichen will, ist spurlos verschwunden. Aber was hat das Verschwinden eines alten Mannes mit dem Fund eines Babys in einem fremden Kinderwagen zu tun? Die hochschwangere Ermittlerin Anna Glad ahnt nicht, welch düstere Geheimnisse der Vergangenheit zutage zu kommen drohen und in welche Gefahr sie sich bei ihren Nachforschungen begibt ...
Ein atmosphärischer Finnlandkrimi – Anna Glads zweiter Fall.
»Eva Frantz zeigt einmal mehr, was für eine geschickte Krimiautorin sie ist.« Vasabladet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Ähnliche
Über das Buch
Es ist Anna Glads letzter Sommer vor dem Mutterschutz, doch ihr Telefon in der Polizeistation steht nicht still. So wird nicht nur eine Blutlache auf der Treppe zum Haus eines spurlos verschwundenen Rentners gefunden, sondern auch ein fremdes Neugeborenes in den Kinderwagen einer frischgebackenen Mutter gelegt. Während Anna im Fall von Baby X im Dunkeln tappt, erhält das Verschwinden von Börje Bohman Priorität, als die Ermittlerin gemeinsam mit ihrer Kollegin Märta das Haus des alten Mannes oben auf dem Betesbacken aufsucht. Dem sturköpfigen Besitzer, der als einziger Anwohner nicht dem Bau eines neuen Radwegs weichen will, wird nachgesagt, seine mittlerweile verstorbene Ehefrau misshandelt zu haben – doch was Anna und Märta in seinem Keller finden, übersteigt alles, was sie zuvor glaubten, über ihn zu wissen …
Über Eva Frantz
Eva Frantz, geboren 1980, wuchs in einem Vorort von Helsinki auf. Sie arbeitete als Radiomoderatorin für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Finnland, ehe sie sich ganz dem Schreiben widmete. Sie wohnt mit ihrem Mann und drei Kindern in Esbo, Finnland. Im Aufbau Taschenbuch ist bereits ihr Roman »Die Tote im Eis« erschienen.Mehr zur Autorin unter www.evafrantz.com
Leena Flegler arbeitet als freie Übersetzerin aus dem Schwedischen und Englischen. Sie übertrug unter anderem Romane von Niklas Natt och Dag, Karin Smirnoff und Denise Rudberg ins Deutsche.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Eva Frantz
Der Tod in den Schären
Ein Fall für Anna Glad
Kriminalroman
Aus dem Finnlandschwedischen von Leena Flegler
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Zitat
Prolog
Juni
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Juli
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
August
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Epilog
Danksagung
Impressum
Wer von diesem Kriminalroman begeistert ist, liest auch ...
Helle Wasser, dunkle Wälder und die Sehnsucht sind mein Haus. Komm zu mir und teile mit mir Tag und Wärme, Kälte auch.
Kalliolle kukkulalle finnische Volksweise in der deutschen Nachdichtung von Peter Porsch
Prolog
Samstag, 31. März
»Jetzt komm endlich! Amelie!«
Ungeduldig hüpfen Alma und Wilma auf der Stelle. Alma weiß jetzt schon, dass es ein Riesenfehler war, Amelie zur Osterhexenwanderung mitzunehmen. Sie ist noch zu klein für so etwas. Was für eine blöde Idee von Mama, dass Amelie mitgehen sollte.
Endlich kommt ihre dumme kleine Schwester in ihrem fluffigen weißen Hasenoverall angeschlurft. Rosa Lippenstift auf der Nase, aufgemalte Schnurrhaare auf den Wangen, gelbe Gummistiefel, vergnügter Gesichtsausdruck.
»Los jetzt, Amelie! Wir müssen noch mehr Häuser abklappern, hast du das immer noch nicht kapiert?«
Und auf einmal kommt Bewegung in das Karnickel. Amelie biegt jäh nach rechts ab und watschelt auf eine steile Auffahrt zu.
»Doch nicht da entlang!«, ruft Alma ihrer kleinen Schwester nach, stößt aber auf taube Ohren. Amelie läuft einfach weiter.
Wilma und Alma wechseln einen Blick und seufzen beide. Immer diese Kleinkinder.
»Gibt’s dahinten überhaupt noch Häuser?«, will Wilma wissen.
Alma ist hier auf diesem Hügel noch nie gewesen. Zu beiden Seiten der Auffahrt wachsen dicht an dicht Kiefern, aber dahinter könnten theoretisch jede Menge Häuser stehen.
»Keine Ahnung. Wir können ja mal nachsehen. So viele Hexen sind hier heute bestimmt noch nicht vorbeigekommen.«
»Wenn da Leute wohnen, dann sind die bestimmt superhappy, wenn wir endlich auftauchen, und wir kriegen krass viele Süßigkeiten!«
»Eben.«
Vielleicht ist das mit Amelie letztlich doch nicht so dumm. Womöglich lohnt es sich, den Hang hochzulaufen. Alma rückt ihren spitzen Hexenhut, der ständig verrutscht, sicher zum tausendsten Mal zurecht. Ein Kopftuch, wie Wilma eins trägt, wäre eindeutig schlauer gewesen.
»Komm.«
Im Handumdrehen haben die Hexen das Amelie-Häschen eingeholt.
Und tatsächlich stehen entlang des Weges einige Häuser, doch niemand scheint daheim zu sein. Alma bleibt stehen und sieht noch mal genau nach.
Es hat fast den Anschein, als würde dort schon länger niemand mehr wohnen. In keinem einzigen Fenster brennt Licht, und es ist keine Menschenseele zu sehen. Und auch kein einziges Auto.
Der Weg an sich ist zerfurcht und matschig, und irgendwer hat hier Bäume gefällt, die am Hang aufgeschichtet sind. Der Anstieg ist echt anstrengend.
»O Mann … Gehen wir zurück«, schlägt Wilma nach einer halben Ewigkeit vor.
Alma ärgert sich. Es wäre doch komplett bescheuert, wenn sie diesen Weg jetzt für nichts und wieder nichts hochgestapft wären.
»Ein Haus steht da noch.« Sie zeigt in die entsprechende Richtung. »Da sehen wir noch nach, dann kehren wir um.«
Wilma späht zwischen den Kiefern hindurch zu dem roten Klinkerhaus ganz oben auf dem Berg. Dass sie keine Lust mehr hat, kann man ihr deutlich ansehen.
»Da wohnt doch bestimmt auch keiner mehr.«
»Doch, da brennt Licht im Fenster! Siehst du das nicht?«
»Ach ja … Okay.«
Amelie läuft abermals vorneweg und hat das Haus schon erreicht, während die großen Mädchen gerade erst den halben Weg geschafft haben.
»Guckt mal, die haben ein Schwimmbad!«, ruft sie.
»Besonders schick ist das aber nicht«, stellt Wilma fest.
»Nee … Igitt! Sogar ziemlich eklig!«
Das Haus sieht einfach nur viereckig und grässlich aus. Wer bitte schön will in so einem Haus wohnen? Wenn Alma groß ist und ein eigenes Haus besitzt, soll das hellblau sein, mit Schnitzereien und am liebsten mit einem Türmchen.
Der Garten hingegen sieht halbwegs in Ordnung aus. Hier und da spitzen schon gelbe und lila Krokusse zwischen den letzten Schneehügeln hervor.
»Du klingelst«, sagt Wilma.
Wilma wird immer nervös, wenn sie mit Fremden reden muss. Alma sieht sich nach Amelie um, aber die ist schon wieder auf Abwegen – typisch. Aber selbst schuld, wer nicht mit an die Tür kommt, kriegt hinterher auch keine Süßigkeiten.
Alma drückt auf die Klingel, und sie nehmen ihre Position ein.
Von drinnen sind schwere Schritte zu hören, und Alma sieht Wilma triumphierend an. Sie hatte recht – hier ist jemand zu Hause! Und jetzt geht laut knarzend die Tür auf!
»Klopf, klopf, hier kommen …«, heben die Mädchen an.
»Nichts da! Verschwindet!«
Die Tür schlägt den zwei Osterhexen vor der Nase zu.
»Komm, wir hauen ab«, flüstert Wilma verschreckt.
»Hast du Schiss vor dem? Man braucht ja wohl keinen Schiss zu haben vor solchen SCHEISSALTEN GEIZHÄLSEN!« Letzteres ruft Alma so laut, dass der Blödmann da drin sie hoffentlich klar und deutlich versteht. »DIE NOCH DAZU EINEN EKLIGEN POOL HABEN UND EIN SUPERHÄSSLICHES HAUS!«
Geschieht ihm nur recht. Aber wo ist Amelie?
»Amelie! Wir gehen! Amelieee!«
Sie rufen immer und immer wieder, bekommen aber keine Antwort. Erst hat Alma Schiss, dass Amelie in dieses eklige Becken gefallen sein und sich das Genick gebrochen haben könnte, doch dann ruft Wilma, dass sie sie gefunden hat. Alma muss um das ganze Haus herumlaufen.
Amelie ist in die Hocke gegangen und sieht mit ihrem Pummelpo und dem weißen Puschelschwanz von hinten fast aus wie ein echtes Kaninchen. Sie späht durch ein Fensterchen direkt über der Erde.
»Was machst du denn da? Wir gehen, los, Beeilung!«
Amelie steht auf und winkt in Richtung des Fensters.
»Tschühüüüss«, ruft sie, watschelt los und schwenkt ihren kleinen Flechtkorb hin und her.
Wilma macht sich ebenfalls auf den Weg, und Alma wirft noch einen flüchtigen Blick auf das hässliche Haus.
Für einen winzigen Moment meint sie, in dem Fensterchen über der Erde eine Bewegung zu erhaschen, doch als sie genauer hinsieht, ist da nichts. Bestimmt hat Amelie nur mit ihrem Spiegelbild geredet. Kleine Kinder sind einfach nur komisch.
Sie rückt ihren Hexenhut gerade und läuft ihrer kleinen Schwester und ihrer besten Freundin hinterher. Nach diesem echt unnötigen Umweg müssen sie sich allmählich beeilen, wenn sie ihre Körbe bis zum Mittagessen mit Süßigkeiten vollkriegen wollen.
Dann war jetzt also der Moment gekommen.
Sein Leben lang weiß man, dass es irgendwann so weit ist, trotzdem kommt es urplötzlich.
Man liegt da und kann nur noch die Sterne über einem betrachten.
Dafür hat man sich zuvor nie Zeit genommen.
Einfach nur still dazuliegen und empor in die schwindelerregende Unendlichkeit zu blicken.
Den Sternenhimmel zu betrachten, ist ein bisschen so, wie wenn man einen Ameisenhaufen vor sich hat: Es dauert kurz, ehe das Auge das Gewimmel überhaupt erkennt. Wenn man dann all die Ameisen sieht, die vor einem auf- und abwuseln, versteht man gar nicht, wie man zunächst glauben konnte, dass der Ameisenhaufen verwaist wäre.
Mit dem Sternenhimmel ist es ganz ähnlich: Je länger man hinsieht, umso mehr Sterne tauchen auf, und am Ende dämmert einem, dass die Dunkelheit nur eine optische Täuschung war und dass jedes Pünktchen dort oben in Wahrheit ein Stern ist, der so weit weg ist, dass er eben ein bisschen schwächer leuchtet als andere, die der Erde näher sind.
Und das heißt: Alles, was man sieht, ist Licht, das einfach nur von wahnsinnig weit herkommt. Und Dunkelheit gibt es nicht.
Der Gedanke ist tröstlich – weil es ganz danach aussieht, als wäre Dunkelheit in Wahrheit Licht.
Allerdings leuchtet da jetzt noch etwas anderes.
Ein Auto … Ein Auto, das blau blinkt.
Und da sind Stimmen.
»Die ist einfach so rausgefahren! Ist ganz plötzlich aufgetaucht! Ich hab noch versucht zu bremsen und auszuweichen, aber es ging nicht mehr. Scheiße, ich hätte mit den Sommerreifen noch warten müssen, aber woher hätte ich das denn ahnen sollen …«
»Bitte gehen Sie ein Stück zur Seite«, sagt eine weitere Stimme.
Dann tauchen mehrere Gesichter auf. Dass sich so viele Kerle um einen geschart haben, ist schon eine Zeit lang her.
»Hallo? Können Sie reden? Wie heißen Sie?«
Man kann es ja mal probieren. Aber wie man heißt, ist doch wohl unwichtig.
»Ich bin egal! Sie müssen meiner Tochter helfen!«
Zumindest versucht man, das zu sagen. Nur funktioniert das nicht sonderlich gut mit dem Mund voller Blut.
»Sssmmmdoooooooaaa« – so klingt es eher.
Und sie verstehen es nicht.
»Hallo? Hallo? Versuchen Sie, nicht einzuschlafen! Scheiße, sie geht …«
Ja.
So ist das.
Jetzt ist der Moment gekommen auszugehen.
So viele Sterne …
Moment.
Ausgehen heißt doch, dass aus Licht Dunkelheit wird?
Und Dunkelheit gibt es nicht. Deshalb kann man auch nicht ausgehen.
Aber sterben.
Das kann man in jedem Fall.
Dann stirbt man also jetzt.
Juni
Kapitel 1
He, dumme Nuss
damit ich dich nicht sehen muss
nimm einen Spaten
und buddel ein Grab im Garten
Donnerstag, 8. Juni
Saara Nyman war mit dem Kinderwagen draußen und summte ein Ed-Sheeran-Lied vor sich hin.
Endlich! Sie hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben, dass es in diesem Jahr noch mal Sommer werden könnte. Der Winter hatte sich ewig gehalten – bis Walpurgis –, und auch danach war es wochenlang grau, nass und windig gewesen. Bei solchem Wetter mit dem Baby rauszugehen, war nicht gerade verlockend, und wann immer sie irgendwo hingemusst hatten, war Saara lieber mit dem Auto gefahren.
Aber endlich – endlich hatten die Wettergötter ein Einsehen gehabt. Auf Wiedersehen, Handschuhe, und willkommen, Sonnenbrille!
Tuuli war nach einem ungewöhnlich quengeligen Morgen drauf und dran einzuschlafen (Saara hatte die Zähne in Verdacht), doch jedes Mal, wenn ein Lichtstrahl sich unter das Verdeck des Kinderwagens stahl, verzog sie erneut das Gesicht und presste ein unzufriedenes »Gwääääää« hervor.
Saara blieb stehen, zog ein dünnes Mulltuch aus der Wickeltasche und befestigte es am Verdeck. Dann hob sie das Tuch an und sah nach Tuuli.
So sollte es funktionieren. Das Tuch war dünn genug, so dass die Kleine Luft bekam, schützte jedoch vor der Sonne.
Nach ein paar Minuten wurde es unter dem Tuch still. Tuuli war endlich eingenickt.
Inzwischen war Saara im Stadtzentrum angekommen. Dort hatten wohl mehrere Ladenbesitzer beschlossen, dass nun Sommer wäre: Sowohl beim Optiker als auch beim Eisenwarenhändler standen die Türen sperrangelweit offen, und auf dem Gehweg vor dem Blumenladen erstreckte sich ein Meer aus Petunien und Begonien.
Saara wurde langsamer. Ein paar Töpfe mit Petunien würden sich auf dem Balkon bestimmt gut machen. Mit den Stiefmütterchen ein paar Wochen zuvor war sie zu übereifrig gewesen, die hatten noch Frost abbekommen. Aber jetzt würde es doch bestimmt besser gehen?
Nur dumm, dass sie allein unterwegs war; Tuuli würde garantiert wach werden, sobald sie versuchte, den Kinderwagen in den Laden zu manövrieren, aber sie konnte ihn ja schlecht draußen stehen lassen.
Oder doch?
Wenn sie sich beeilte?
Behutsam bugsierte sie den Kinderwagen an die Fassade. Hier stand er im Schatten, außerdem würde sie durchs Schaufenster das Verdeck sehen können. Hinter dem Tuch war ein zufriedener Seufzer zu hören. Tuuli schlief tief und fest.
Sie brauchte nur ein paar Minuten, dann war Saara mit einer riesigen Papiertüte voller bunter Frühblüher wieder draußen.
Im selben Moment verspürte sie ein Ziehen in der Brust. Hoffentlich würde Tuuli noch bis zu Hause durchhalten, ehe sie hungrig wurde und zu quengeln begann. Sie sollte sich beeilen, denn auch wenn es derzeit sonnig und warm war, hatte Saara den Verdacht, dass noch nicht ganz der Moment gekommen war, um Tuuli draußen auf einer Parkbank zu stillen.
Mit langen Schritten schob sie den Kinderwagen heimwärts. Mit dem zusätzlichen Gewicht der Blumentüte kam sie richtiggehend ins Schwitzen.
Der letzte Anstieg zu ihrer Doppelhaushälfte war eine Herausforderung, doch dann hatte sie es geschafft. Im Kinderwagen war es immer noch still, als sie stehen blieb, nach ihrem Schlüssel kramte und das Mulltuch anhob.
»Sooo, kleine Tuuli, wir sind wieder daheim …«
Saaras Nachbarin, die pensionierte Grundschullehrerin Margit Bergholm, die gerade das Küchenfenster putzte, zuckte heftig zusammen und geriet auf ihrer Trittleiter ins Wanken, als sie Saara kreischen hörte.
»Herr im Himmel! Was ist denn da los?«
Sie war zutiefst erschrocken und zugleich stinksauer – sie hätte stürzen und sich sonst was brechen können.
Wie versteinert stand Saara auf dem Gehweg und starrte ungläubig in den Kinderwagen.
Dann stieß sie heiser hervor: »Notruf! Ruf die Polizei!«
Anna Glad zog den Saum ihres Sportoberteils nach unten. Das blöde Ding rutschte ständig nach oben, während die Hose nach unten rutschte und ihr Bauch wie Muffin-Teig mit zu viel Backpulver dazwischen hervorquoll.
Als Anna mit ihrer Anmeldung zum Schwangerschaftsyoga- und Entspannungskurs herausgerückt war, hatte ihre beste Freundin Linda sofort begeistert ihre alten Schwangerschafts-Sportsachen herausgesucht.
»Natürlich passen die – ist doch Trikotstoff!«, hatte sie behauptet. »Bestimmt sind sie anfangs sogar zu groß, ich hab sie im neunten Monat extrem ausgedehnt.«
Ärgerlicherweise saßen die Sachen um Annas schwangeren Leib eher wie eine Wurstpelle; ihr Bauch war nicht mal unerträglich groß, allerdings war komischerweise der ganze Rest ihres Körpers im Frühling in jeglicher Hinsicht aus dem Leim gegangen – und noch hatte Anna den kompletten Sommer vor sich, ehe das Baby kommen würde.
Weil Anna ausnahmsweise pünktlich und die Erste im Kurs war, nutzte sie die Gunst der Stunde und betrachtete sich in der verspiegelten Studiowand.
Hmm. Nun war es eben, wie es war. Hoffentlich würde ihr Körper wieder schrumpfen, wenn das Kind erst auf der Welt wäre. Und Lindas teure Yogasachen sahen ohne Frage gut aus – auch wenn sie gut und gern zwei, drei Nummern größer hätten sein dürfen. Zum Trost tätschelte Anna sich den Bauch – und war sich nicht ganz sicher, ob sie selbst Trost brauchte oder eher ihr Kind.
»Tja, Calzone, dann machen wir jetzt also Yoga«, murmelte sie in sich hinein.
Sie hatte in letzter Zeit nicht allzu viel Bewegung bekommen; in ihrem Zustand waren Joggingrunden und Krafttraining ihr schlichtweg unmöglich vorgekommen. Yoga funktionierte und fühlte sich gut an: Da saß man meist nur mit überkreuzten Beinen da und machte »Ommm«. Das schaffte sogar eine Anna Glad.
Ansonsten war sie bislang eher schlecht mit sämtlichen Dingen gewesen, die man als Schwangere angeblich tun sollte. Anscheinend hätte sie ihr Zuhause dekorieren und alles umorganisieren müssen – was laut Linda als »Nesting« bezeichnet wurde. Überdies hieß es, man würde Erziehungsratgeber verschlingen, zig Babysachen kaufen und nur noch in Latzhosen herumlaufen …
Bei Anna war nichts dergleichen passiert. Aber vielleicht war das Schwangerschaftsyoga ja der Startschuss zu allem.
Drei jüngere Frauen schlenderten mit aufgerollten Yogamatten unter dem Arm herein. Sie grüßten lächelnd, und Anna lächelte zurück.
Himmel, wie fit die drei aussahen! Überdies sahen sie einander ähnlich. Alle drei hatten sich die Haare lose auf dem Kopf zusammengezwirbelt. Die strammen Babybäuche sahen an ihren schlanken Leibern so perfekt halbkugelrund aus, dass Anna fast den Verdacht hatte, dass unter den Oberteilen eher Kissen steckten als echte Babybäuche. So konnte man anscheinend auch aussehen, wenn man schwanger war … Na dann.
»Wie war das gleich?«, fragte die Frau, die ihre Matte direkt neben Anna ausrollte. »Man kriegt doch sein Geld zurück, wenn das Kind früher kommt? Für die Yogastunden, die man dann verpasst, meine ich.«
Erst zeitverzögert dämmerte es Anna, dass die Frage an sie gerichtet war.
»Öh … ja, richtig. Doch.«
Sie meinte, auf der Webseite des Yogastudios irgendwas in der Art gelesen zu haben.
»Ich hatte bei meinen ersten beiden eine krasse Beckeninstabilität. Diesmal geht es viel besser«, warf eine andere ein.
Anna nickte freundlich. Das klang doch gut.
»Brauchen wir noch etwas anderes als die Matten? Was ist mit dem Block?«, fragte Nummer drei.
Anna war zusehends ratlos. Woher sollte sie das wissen? Doch dann ging ihr ein Licht auf.
»Ihr glaubt, ich bin die Kursleiterin?«
Die Blonde, die sie zuerst angesprochen hatte, musste laut lachen.
»Oh, dann …? Entschuldigung! Du hast nur so … vor dem Spiegel gestanden … und außerdem bist du … na ja, ein Stück älter als wir.«
»Mhm.« Mehr fiel Anna darauf nicht ein.
Im selben Moment betraten weitere sportlich gekleidete Frauen das Studio und zu guter Letzt eine drahtige Mittfünfzigerin, die mit sanfter Stimme verkündete: »Mamas! Schwestern! Freundinnen! Willkommen bei Lotus Wellness! Ich bin Mona. Sucht euch einen Platz, dann können wir loslegen.«
Eilig sah Anna sich nach einer Stelle um, an der sie bestenfalls unsichtbar wäre; sie hatte nie zuvor Yoga gemacht und wusste nur zu gut, dass sie kein Naturtalent war. In der Saalmitte stand eine Säule – dahinter würde sie ihre Matte legen. Doch noch ehe sie sich verkriechen konnte, berührte Mona sie am Arm.
»Wir arbeiten in diesem Kurs teils paarweise, und weil wir eine ungerade Teilnehmerinnenanzahl sind, arbeitest du mit mir. Wie heißt du?«
»Anna«, krächzte sie.
Dann ging die erste Stunde los – und es wurde sekündlich schlimmer. Mona versuchte beharrlich, Annas ungelenken, steifen Körper in die unmöglichsten Positionen zu drehen, während die übrigen Kursteilnehmerinnen keinerlei Probleme zu haben schienen, von der einen Position zur nächsten überzugehen – oder Asana, wie es anscheinend hieß.
»O Gott, ist das schön!«, stöhnte eine der Zwirbelhaarfrauen, kaum dass sie kopfüber in einer Stoffschlaufe hing, die von der Decke baumelte. »Genau das hab ich gebraucht!«
Und ich bräuchte einen ordentlichen Whisky, dachte Anna und krachte im nächsten Moment mit dem Hinterkopf hart auf dem Boden auf, als Mona ohne Vorwarnung ihre Schultern losließ.
»Vertrau deinem Körper! Er weiß, wozu er imstande ist«, dozierte Mona.
Mein Körper weiß so was von, dass er dieses Yogastudio kein zweites Mal von innen sehen wird!, schoss es Anna durch den Kopf, und sie blinzelte hektisch, als ihr der Schweiß in die Augen zu laufen drohte.
Was bitte schön würde das hier werden? Sie war davon ausgegangen, dass Schwangerschaftsyoga eher behutsames Dehnen und Meditation bedeutete. Stattdessen war sie in einem Bootcamp für Akrobatinnen gelandet!
Irgendwo im Raum piepte ein Handy.
Mona schürzte die Lippen.
»Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass wir hier bei Lotus Wellness die Handys in der Umkleide lassen«, sagte sie in lieblich-bissigem Tonfall.
Anna kämpfte sich aus der Schlinge.
»Entschuldigung … Das ist mein Arbeitshandy. Eigentlich hab ich heute frei, da rufen sie nur an, wenn es wirklich wichtig ist … Entschuldigung! Sorry! Namaste! Tschüss!«
Sie schnappte sich ihr Handy und stürmte aus dem Raum.
»Hallo?«
»Tut mir leid, dass ich dich an deinem freien Tag störe«, sagte Annas Vorgesetzte, Hauptkommissarin Annette Käld, »aber sowohl Markus als auch Benny sind krankgeschrieben … Anscheinend geht ein Magen-Darm-Virus herum.«
»Aha …«
»Wir haben einen Notruf reinbekommen, und irgendwer muss sofort hinfahren. In deinem Zustand ist es womöglich unangemessen …«
»Worum geht es denn überhaupt?«
»Um einen Säugling. Schaffst du das?«
Anna stutzte. Glaubte die Chefin etwa, dass mit der Schwangerschaft auch eine Art Persönlichkeitsveränderung eingesetzt hatte? Dass sie zu empfindsam für gewisse polizeiliche Tätigkeiten geworden war?
Sie war bereits halb in ihre Jacke geschlüpft. Bomberjacke und Yogapants waren nicht gerade das typische Polizistinnen-Outfit, aber nachdem Eile geboten war, konnte sie sich nicht erst umziehen. Zum Glück hatte sie ihre Dienstmarke dabei.
»Klar, das geht bestimmt in Ordnung. Wo muss ich hin?«
Der Lokalreporter Jan-Anders Rosbäck gab sich alle Mühe, den vollgelaufenen Schlaglöchern auszuweichen. Trotzdem holperte sein Volvo unkontrolliert über die Straße.
Verdammt, da war irgendetwas gegen den Unterboden gekracht … So was konnte schnell mal teuer werden! Aber wer hätte denn ahnen sollen, dass für den Betesbacken ein verfluchter Geländewagen nötig war?
Börjes Haus stand ganz oben auf dem Berg, und Jan-Anders holperte weiter an den knallgelben Plastiknetzen vorbei, die die Straßenbauarbeiter entlang des geplanten Fahrradwegs aufgehängt hatten. Als Nächstes würden sie den Boden planieren und den ganzen Scheiß asphaltieren. Dann würden die Radler in ihren lächerlichen Radlerhosen hangabwärts hier nur so rasen.
Jan-Anders selbst hatte sein Fahrrad mit achtzehn gegen ein Auto eingetauscht und seither keinen Bedarf mehr an Zweirädern gehabt.
Angeblich sollte der Radweg bis Mittsommer fertig sein – aber ihren Zeitplan konnte die Kommune ja wohl in der Pfeife rauchen: Nie im Leben würde der letzte Streckenabschnitt bis dahin fertiggestellt.
Dabei handelte es sich zwar nur um gut zweihundert Meter, doch ausgerechnet auf dem letzten Stück wohnte Börje Bohman – und das war ein Problem. Ein gewaltiges Problem.
Jan-Anders hatte inzwischen die Kuppe erreicht, fuhr rechts ran und setzte seine Sonnenbrille auf.
Da war er also. Auf dem Betesbacken. Auf dem, was davon noch übrig war.
Der Radweg war schon seit Jahren in den Karten der Stadtplaner eingezeichnet gewesen, doch erst seit Jasper Jokela ein halbes Jahr zuvor zum Bürgermeister gewählt worden war, hatte das Projekt Fahrt aufgenommen.
Drei der Häuser am Betesbacken waren schon aufgekauft, zwei dem Erdboden gleichgemacht worden. Die früheren Bewohner hatten die Entschädigungszahlungen bereitwillig akzeptiert und waren im Frühjahr weggezogen. Jan-Anders wusste nicht genau, was sie bekommen hatten – aber bestimmt ein akzeptables Sümmchen, wenn man bedachte, dass die Häuser schon recht heruntergekommen gewesen waren.
Mit Börje hingegen lag die Sache anders. Der hatte nicht vor, von hier wegzugehen. Zumindest nicht aus freien Stücken.
Jan-Anders hatte genau hinter einem abgestellten Bagger geparkt. Es war öd und menschenleer hier oben, obwohl gerade alle Welt von nichts anderem sprach. Aber es würde ganz sicher noch dauern, bis die Maschinen wieder in Gang gesetzt würden. Derzeit lagen die Bauarbeiten brach. Im Vorbeigehen tätschelte Jan-Anders aufmunternd das Führerhaus des Baggers und machte sich auf den Weg.
Da war es – Börje Bohmans Haus. Verblüfft pfiff Jan-Anders durch die Zähne. Es war schon ein Weilchen her, seit er zuletzt auf dem Betesbacken gewesen war, trotzdem hätte er niemals damit gerechnet, dass das Haus seither so baufällig geworden wäre. Die Klinkerfassade war eher staubgrau als rot, eine Regenrinne hing windschief vom Dach und drohte jeden Moment herunterzukrachen. Jan-Anders glaubte zudem deutliche feuchte Flecken entlang des Fundaments zu erkennen. Doch im Gegensatz zu einigen Nachbarhäusern stand Börjes Haus noch – wie eine trotzige mittelalterliche Burg.
Jan-Anders konnte sich noch gut daran erinnern, dass es früher hier oben richtig schön gewesen war. Struppige Fliederbüsche und knorrige Obstbäume zeugten davon, dass jemand hier einst einen Garten angelegt hatte. Die klassische Garten-Holzschaukel mit zwei sich gegenüberliegenden Bänken stand ein Stück weg und moderte vor sich hin.
In den Fenstern hingen altmodische gerüschte Spitzengardinen, die Marianne, Börjes verstorbene Frau, sicher einst sorgsam gewaschen, gebügelt und aufgehängt hatte. Dass sie gestorben war, war jetzt bestimmt an die fünfzehn Jahre her. Seither hatte Börje die Gardinen garantiert nicht ausgewechselt.
Einige Witwer waren einfach so gottverdammt hilflos. Jan-Anders war Junggeselle und geübt darin, sich selbst zu versorgen. Und er kam wunderbar ohne Gardinen aus. Ohne Frau im Übrigen auch.
Er fluchte laut, als er achtlos in eine tiefe Lehmpfütze trat und Kälte und Nässe sofort bis unter die Zehennägel zu spüren waren. Hier sollte er wohl besser aufpassen, wohin er seine Schritte setzte.
Wo steckte Börje überhaupt? Jan-Anders hatte insgeheim damit gerechnet, dass der Hausherr ihm schon mit der Flinte im Anschlag auf der Vordertreppe entgegentreten würde, bereit, jeden Eindringling – ob nun Zeugen Jehovas oder Fahrradwegplaner – davonzujagen. Aber er war nirgends zu sehen. Allerdings stand die Haustür offen. Jan-Anders beschloss, sich bemerkbar zu machen, um Börje vorzuwarnen.
»Börje? Ich bin’s – Janne!«
Jan-Anders konnte zwar nicht behaupten, dass er mit Börje besser bekannt wäre, aber nachdem sie beide ihr Lebtag in der Stadt gewohnt hatten, kannten sie sich natürlich; und nur deshalb war die Chefredakteurin Lena Brunström der Meinung gewesen, dass Jan-Anders am besten geeignet wäre, den Betesbacken hochzufahren und mit Börje über den Radweg zu reden.
Außerdem war Börje groß und breit gebaut und ziemlich unberechenbar.
Oder wie es die Kollegin Christel Tronning formuliert hatte: »Lieber spiele ich Posaune vor einer Bärenhöhle und reiße jemanden aus dem Winterschlaf, als dass ich Börje Bohman interviewe.«
Jan-Anders war selbst nicht gerade von kleiner Statur und auch nicht leicht einzuschüchtern. Trotzdem war er verunsichert, als er auf seinen Ruf keine Antwort erhielt. Irgendwas war hier faul, das spürte er.
»Börje?«, rief er erneut. »Darf die Lokalzeitung einen Kaffee bei dir schnorren?«
Keine Reaktion.
Er gab sich einen Ruck, stieg über eine riesige Pfütze hinweg und setzte den Fuß auf die unterste Stufe der Vordertreppe.
Er stand immer noch in einer Art unelegantem Spagat da, als sein Blick an etwas Rotbraunem hängen blieb.
Was zum Geier …
War das Blut? Noch dazu eine ziemliche Menge.
Was bitte schön war hier los?
»He, Börje! Sei doch so gut und gib Antwort, wenn man nach dir ruft, sonst mache ich mir Sorgen«, rief er, stieg die Vordertreppe hinauf und trat über die Schwelle.
Rolf Månsson hatte ein seliges Lächeln im Gesicht, als er die Ann-Christin aus dem Jachthafen steuerte. Endlich, der erste Törn dieses Jahres! Auch wenn es nur ein kurzer Ausflug würde – eher nur eine Testfahrt, um zu sehen, wie es seiner Ann-Christin den Winter über ergangen war –, freute er sich wie ein kleines Kind. Dann fiel ihm ein, dass die Leute in alten Filmen bei der Ausfahrt immer Lieder sangen.
»Auf der See begleit’ ich ihn, weit durch Sturm und Wellen hin …«
»Jetzt mal ruhig, du Opernsänger!«, rief Max vom Bug. »Denk an dein Herz!«
»Buuuh«, konterte Rolf, obwohl er insgeheim wusste, dass sein Partner recht hatte.
Eine Zeit lang hatte Rolfs Zukunft als Bootsführer wirklich düster ausgesehen. Das vorangegangene Jahr hatte gleich mehrere gesundheitliche Tiefschläge für ihn bereitgehalten, und Rolf war gezwungen gewesen, seine Arbeit als Polizeioberkommissar an den Nagel zu hängen und in Rente zu gehen – und das gleich mehrere Jahre früher als gedacht. In den letzten Monaten hatten die Ärzte ihn in einem fort daran erinnert, dass er vorsichtig sein sollte: mit dem Essen, mit Alkohol, mit körperlicher Anstrengung. Im Grunde mit allem, was irgendwie Spaß machte.
Doch inzwischen war das Herz operiert, er selbst wieder bei Kräften und der Sommer zum Greifen nah.
»Hör mir gut zu, du Jungspund«, rief Rolf. »Mein Herz hat nie zuvor so rhythmisch und stark geschlagen. So hätte es eigentlich sein sollen, als ich dich kennengelernt habe!«
»O bitte … Jetzt legt er auch noch die Romantikplatte auf!«, ächzte Max. »Wie soll das nur enden?«
Ein so strahlender Tag wie dieser konnte gar nicht schlecht enden. Obwohl es recht kühl an Deck war, hatte Rolf erstmals seit Langem wieder das Gefühl, als wärmte die Sonne sein Gesicht. Die frisch polierten Messingteile der Ann-Christin blitzten und blinkten, und obwohl es erst Anfang Juni war, duftete das Meer bereits nach Sommer. Außerdem musste man sich um diese Jahreszeit noch keine Sorgen um Algen machen.
Im selben Moment blieb Rolfs Blick an etwas hängen, was seine Laune leicht trübte.
»Verdammt noch mal«, brummte er. »Das ist doch wohl ein Skandal! Wirklich ein Skandal!«
»Was denn?«, rief Max nach achtern.
Verbissen zeigte Rolf auf das riesige, terrakottarote Gebäude, das sie jetzt, da sie weit genug hinausgetuckert waren, in Gänze betrachten konnten.
»Dass der eine Baugenehmigung für so einen hässlichen Betonklotz gekriegt hat! Auf so einer schönen Insel! Das ist beschämend und ein Skandal!«
»Von wem redest du?«
»Von diesem Eishockeyspieler. Wie heißt er noch gleich? Samuel Lindberg.«
Max sah ihn immer noch ratlos an, und Rolf musste sich in Erinnerung rufen, dass sein Partner weder sonderlich an Sport noch an irgendwelchen hiesigen Gerüchten interessiert war. Er arbeitete hauptsächlich in seinem Heimatland Schweden, obwohl ihn der Job – und die Liebe natürlich – immer häufiger über die Ostsee nach Finnland führte.
»Das war im letzten Jahr hier in der Gegend groß Gesprächsthema. Dieser Samuel Lindberg hat mal für die Nationalmannschaft gespielt. Und er war richtig gut! Ist dann in die USA gegangen und hat dort in der NHL gespielt, ist jetzt aber wieder hierhergezogen. Und dann kriegt er auch noch die Schulter dafür geklopft, dass er so ein grässliches Haus baut!«
Max hielt sich die Hand über die Augen, um das Haus im Gegenlicht besser sehen zu können. Es war bestimmt gute vierhundert Quadratmeter groß, mitsamt Türmchen, Panoramafenstern und diversen Erkern.
»Na ja, besonders hübsch ist es wirklich nicht, da muss ich dir recht geben.«
»Die Leute reden hier von einem Angeberhaus, aber wenn das meins wäre, könnte ich keine Sekunde damit angeben! Ich würde mich schämen!«
»Wie viele Klos, schätzt du?«
Rolf wieherte vor Lachen.
»Ist das wirklich die erste Frage, die dir in den Sinn kommt?«
»Was denn? Ist doch eine spannende Frage! Ich tippe auf zwölf. Hat er eine große Familie, dieser Lindberg?«
»Soweit ich weiß, nicht. Ich wüsste nur von einer amerikanischen Ehefrau.«
»Da drin hätten jedenfalls zwölf amerikanische Ehefrauen Platz.«
»Du meinst: ein Klo für jede Frau?«
»Stimmt – und wie praktisch! Kein Anstehen am Morgen. Aber mal was anderes: Wie wäre es mit einem Kaffee?«
Max verschwand in der Kajüte, wo sie den Rucksack mit den Thermosbechern abgestellt hatten. Rolf sah wieder zum Horizont.
Derzeit war einiges los in der Stadt – und das eine oder andere fand Rolf tatsächlich fragwürdig. Dass Lindberg eine Baugenehmigung für diese grässliche Villa bekommen hatte, war nur eine Sache unter vielen.
Dass beispielsweise dieser Fahrradweg plötzlich so schnell durchgepeitscht worden war. Hatten die Radler es wirklich so eilig? Und war dieser Weg überhaupt nötig?
Außerdem sollte in wenigen Monaten am Badestrand vor dem Campingplatz ein großes Musikfestival stattfinden. Rolf, der gern Musik hörte, war anfangs Feuer und Flamme gewesen, doch als er die Liste der Künstler gesehen hatte, war ihm aufgegangen, dass das Festival nicht für seinesgleichen gedacht war. Er hatte von keinem der Musiker je gehört – und das, obwohl bei ihm von morgens bis abends das Radio lief.
Garantiert setzte der Veranstalter dabei auf diese Hipster aus der Großstadt. Vielleicht war der Plan, dass die sich in die Kleinstadt vergucken und dann mit ihren Hipsterkindern hierherziehen, Hipsterhäuser bauen und Hipstersteuern zahlen würden? So hatte zumindest die Theorie eines von Rolfs Chorfreunden gelautet.
Der Chor war Rolfs neuestes Hobby. Der Männerchor »Strandjungs« bestand überwiegend aus pensionierten Herrschaften, die zwar nicht sonderlich gut sangen, aber das war auch gar nicht Sinn der Sache. Pflichtschuldig besuchte Rolf jede Probe, und zwar um den jüngsten Klatsch und Tratsch zu hören. Und in diesem Frühjahr hatten die »Strandjungs« so viel zu besprechen gehabt, dass sie mitunter kaum zum Singen gekommen waren.
Aber so war es wohl, wenn der neue Bürgermeister überengagiert war. Jasper Jokela hatte seit Amtsantritt wirklich nicht auf der faulen Haut gelegen, sondern noch im Frühjahr zig Themen durchgeboxt. Manch einer hielt ihn deshalb für tatkräftig und innovativ. Für andere wiederum verhielt er sich verantwortungslos und kindisch. Rolf selbst war sich noch nicht ganz sicher, was er von ihm halten sollte.
Er hatte immer versucht, offen für neue Ideen zu sein und allem, was der Stadt frischen Wind bescherte, erst mal positiv gegenüberzustehen. Doch als er jetzt abermals zu der grässlichen Villa des Eishockeystars Samuel Lindberg zurückblickte, spürte er, wie seine Mundwinkel unwillkürlich nach unten wanderten.
Er wurde doch wohl nicht alt und verbittert?
»Was hältst du eigentlich von diesem Hipsterfestival im August?«, fragte er, als Max mit dem Kaffee zurückkam.
Max sah ihn vorwurfsvoll an.
»Hipsterfestival? Du liebe Güte. Das hier war wirklich das letzte Mal, dass ich dich ohne Hut durch die Sonne segeln lasse.«
Eine Möwe kreischte, und Rolf seufzte wohlig auf. Das Platschen der Wellen und Möwengeschrei – genau so klang für ihn der Sommer.
»Was meinst du, sollen wir noch ein Stück weiter rausfahren? Wir könnten vor Skattkistan anlegen und einen kleinen Spaziergang machen. Da draußen ist es wahnsinnig schön.«
Max sah ihn skeptisch an.
»Hast du nicht etwas von einem kurzen Törn gesagt?«
»Ja, aber jetzt bin ich in den Flow gekommen, wie es so schön heißt.«
»Ich weiß nicht. Ich würde tatsächlich lieber wieder zurücksegeln.«
Rolf sah seinen Partner verdattert an.
»Dass du an einem solchen Tag lieber an Land bleiben willst, sieht dir gar nicht ähnlich!«
»Ich bin irgendwie müde … Vielleicht brüte ich eine Erkältung aus.«
Rolf zuckte mit den Schultern. Da war wohl nichts zu machen. Wenn Max kränkelte, musste Rolf sich mit einer kurzen Ausfahrt begnügen.
»Da sieht man es mal wieder«, sagte Rolf mit einem Zwinkern. »An so etwas merkt man, dass ihr Schweden schon länger nicht mehr an einem Krieg teilgenommen habt.«
Max tat beleidigt.
»Wann hätten wir das denn noch machen sollen? Mit dem Aufbau von Billy-Regalen waren wir ja wohl mehr als gut beschäftigt!«
Jetzt, da Rolf genauer hinsah, wirkte Max wirklich ein wenig angeschlagen; anscheinend tauschten sie jetzt die Rollen: Zuletzt war es immer der um einige Jahre jüngere Max gewesen, der mit Rolf hatte nachsichtig sein müssen, weil der lange zu schwach gewesen war, um Ski zu fahren oder segeln zu gehen. Es war richtiggehend heilsam, zur Abwechslung derjenige zu sein, der vor Energie sprühte.
»Ganz, wie du willst, mein müder Matrose. Fahren wir zurück!«
Alison Lindberg saß auf dem Toilettendeckel, starrte zur Decke und zählte die Sekunden.
»Dreißig, einunddreißig, zweiunddreißig …«
Den Feuchtraum-tauglichen Kronleuchter über ihr hatte sie selbst ausgewählt. Er sah fabelhaft aus, war aber ein grässlicher Staubfänger und musste regelmäßig abgewischt werden. Ihre Schwiegermutter hatte es bei ihrem ersten Blick darauf geahnt, und es ärgerte Alison, dass die alte Frau recht gehabt hatte.
»Vierundsechzig, fünfundsechzig …«
Nicht, dass Alison den Kronleuchter selbst abstauben müsste, das übernahm die Reinigungsfirma. Doch wie Alison feststellen musste, war die nicht allzu gründlich gewesen, und jetzt würde sie es eigens ansprechen müssen, wenn die Putzkräfte das nächste Mal hier wären.
Der Test lag einen halben Meter entfernt auf dem Waschbeckenrand. Sie müsste den Blick nur ein wenig heben, ein klitzekleines bisschen, um das Ergebnis zu sehen, doch sie kämpfte dagegen an.
»Zweiundneunzig, dreiundneunzig …«
Sie erschauderte. Hier im Bad war es kalt. In ganz Finnland war es kalt, obwohl es doch angeblich Sommer wurde. Die Leute gingen davon aus, dass jemand aus Chicago mit der Kälte umgehen konnte wie ein Eisbär – nur galt das für Alison nicht. Was Minustemperaturen anging, war sie immer empfindlich gewesen, und die Kälte in Finnland fühlte sich obendrein anders an als die zu Hause. Sie würde sich für den Sommer komplett neu einkleiden müssen, wenn es nicht alsbald wärmer würde. Pullis, Jeans, Socken, all das. Die Kleider und Shorts würden dann einfach in den Umzugskisten liegen bleiben.
»Einhundertachtzehn, einhundertneunzehn, einhundertzwanzig.«
Jetzt. Jetzt durfte sie hinsehen. Aber erst noch ein schnelles Stoßgebet.
»Lieber allmächtiger Vater, dein Wille geschehe. Amen.«
Alison holte tief Luft, stand von der Toilette auf und sah auf den Test hinab.
Ein Strich. Nur ein verdammter vereinzelter Strich, im Kontrollfenster. Sonst nada.
»Fuck«, sagte sie lauter als gedacht, und ihr Fluch hallte von den Wandfliesen wider, was einen fast klaustrophobischen Effekt hatte.
Ihre Enttäuschung war ebenso groß wie im vergangenen Monat. Und im Monat davor. Und in all den vorherigen Monaten.
Sie hämmerte das Pedal des verchromten Abfalleimers mit solcher Wucht hinunter, dass der Deckel gegen die Duschwand krachte, und warf den Schwangerschaftstest weg. Dann spritzte sie sich kaltes Wasser ins Gesicht und bürstete sich die Haare.
Es war nicht zu übersehen, dass sie in letzter Zeit nicht sonderlich gut schlief. Daran war nur dieses Licht schuld! Wie konnten andere schlafen, wenn es nicht mal mehr dunkel wurde? Sie hatte Schlaftabletten verschrieben bekommen, allerdings war sie damit zögerlich; irgendwie fühlten sich Tabletten so drastisch an. Aber vielleicht war es einen Versuch wert? Besser, als in einem fort wie ein Gespenst auszusehen.
Sie schloss die Lider und atmete ein paarmal tief durch.
»Ruhig, Alison. Ruhig«, redete sie sich gut zu.
Na also. Das fühlte sich doch schon besser an.
Sie schlug die Augen auf, atmete langsam aus und feuerte ein strahlendes Lächeln auf ihr Spiegelbild ab. Ihr Lächeln war immer schon ihre Waffe gewesen: Schon als Kind hatte Alison sich damit aus jeder Klemme ziehen können, in die sie geraten war. Die Erwachsenen hatten ihr damals das Gesicht eines Engels bescheinigt und dass man es ihr schon von Weitem ansehe, dass sie gesegnet sei.
Denselben Trick wandte sie auch in ihrem Job als Eventmanagerin an. Wann immer jemand behauptete, man komme unmöglich an herzförmiges Konfetti oder hinreichend große runde Tischdecken, legte Alison ihr Lächeln auf – und mit einem Mal funktionierte es. Sie hatte sogar mal einen alten Rockstar dazu gebracht, bei einer Hochzeit seinen Achtziger-Smash-Hit zu spielen, den er seit 1994 nicht mehr hatte live spielen wollen. Alison lächelte, der Typ lenkte ein und griff zum Mikrophon.
Vielleicht stimmte es ja wirklich, dass sie gesegnet war. Zumindest was ihre Karriere betraf. Das Eventunternehmen, das sie fünf Jahre zuvor gegründet hatte, war jedenfalls ab Stunde null ein Erfolg gewesen.
Über privaten Kummer hinwegzulächeln, war leider nicht annähernd so leicht. Die Enttäuschung über das negative Testergebnis nagte an ihr. Sie brauchte jetzt Liebe und Zuwendung.
»Sweetie?«
Ein Großteil ihres Alltags ging mittlerweile genau hierfür drauf: durch ihr neues Haus zu wandeln und nach ihrem Mann zu rufen.
Samuel war nicht im Schlafzimmer, nicht im Wohnzimmer, nicht im Arbeitszimmer und auch nicht im sogenannten Spielzimmer, in dem seine Medaillen und Pokale alsbald in die Vitrinen wandern würden, die rings um den noch immer verpackten Billardtisch standen.
Durchs Wohnzimmerfenster sah sie, dass eins der Boote am Anleger fehlte. Es war nicht das erste Mal, dass Samuel rausgefahren war, ohne einen Ton zu sagen. Oder vielleicht hatte er auch gerufen, und sie hatte ihn nicht gehört? Das Haus war so groß, dass dies durchaus vorkam.
Und jetzt, da sie darüber nachdachte, war es womöglich gar nicht schlecht, dass sie allein zu Hause war.
Als die ersten Tests negativ gewesen waren, waren sie gemeinsam enttäuscht gewesen, Samuel und sie. Und Samuel hatte genau die Dinge gesagt, die sie hatte hören müssen.
Dass es keine Rolle spiele.
Dass es nicht ihre Schuld sei.
Dass sie es weiter probieren würden und am wichtigsten sei, dass sie einander hätten.
Dass sie auf Gottes Plan vertrauen und an den Widrigkeiten wachsen würden.
Dass er sie liebe.
Doch mit der Zeit war seine Reaktion anders ausgefallen; er hatte überwiegend irritiert reagiert. Sich gefragt, ob sie sich verzählt hätte. Vielleicht hatte sie ihren Eisprung gar nicht am errechneten Tag gehabt? Vielleicht hatte sie zu viel trainiert? Zu wenig trainiert? Irgendwas anderes getan, was dazu geführt hatte, dass die Eizelle nicht mehr getaugt hatte?
Als sie eingewandt hatte, es könne wohl ebenso gut an ihm liegen, war er wütend geworden und hatte sie einen geschlagenen Tag lang komplett ignoriert.
Aber so war er nicht wirklich, ihr Ehemann. Er war derzeit bloß gestresst und überarbeitet, nur deshalb reagierte er so heftig.
Alison schob die Verandatür auf und trat in die Sonne. Sie wünschte sich, die Sonne würde sie wärmen, aber es funktionierte nicht, es war einfach zu windig. Sie machte kehrt und ging wieder nach drinnen.
Sie vermisste Samuel. Nicht, weil er im Augenblick weg war – denn bestimmt wäre er in ein, zwei Stunden wieder zurück auf der Insel. Nein, sie vermisste Samuel auch, wenn er hier war. Sie vermisste jenen Samuel, in den sie sich einst verliebt hatte und der schon seit einiger Zeit nicht mehr da war.
Nur ein Leistungssportler konnte verstehen, wie schwer es war, Leistungssportler zu sein. Ständig Hochleistungen zu erbringen und sich nonstop in Form zu halten. Je nachdem, wie die vergangene Saison gelaufen war, wechselten astronomische Summen den Besitzer. Und wer immer bezahlt hatte, nahm für sich das Recht in Anspruch, Forderungen zu stellen.
Klar laugte der Druck einen aus.
Und nicht nur der sportliche Leistungsdruck – ein Eishockeyweltstar musste sich auch in einem fort anständig benehmen, jederzeit Selfies mit Fans machen, Autogramme geben und durfte abwechselnd Lob und vernichtende Kritik einstecken.
Alison wusste, dass Samuel in seinem Heimatland einen fast gottgleichen Status innehatte. Sie waren noch keine Woche hier gewesen, als sie sich kurz vor Weihnachten von Kopf bis Fuß fein anziehen und dem Präsidenten persönlich und seiner Püppchenfrau die Hand hatten schütteln müssen.
Doch obwohl Samuel derzeit an der Weltspitze stand, war es nicht selbstverständlich, dass das für immer so blieb. Seinen Titel als unangefochtener Torkönig hatte er in der vergangenen Saison nicht mehr verteidigen können. In den USA war die Kritik halbwegs sachlich geblieben, doch in den finnischen Medien waren einige Sportreporter vollkommen hemmungslos gewesen.
Alisons Finnischkenntnisse waren nicht gut genug, um die Artikel über ihren Ehemann zu lesen, aber der Grundtenor war selbst ihr klar.
Eine Überschrift, die besonders schicksalhaft ausgesehen hatte, hatte sie durch Google Translate gejagt.
Zeit, in Rente zu gehen, Lindberg!
Da war es auch nicht wahnsinnig überraschend, dass man auf heimischem Boden plötzlich mürrisch wurde.
Alison hatte versucht, ihm auf ihre Art beizustehen. Sie hatte wie eine Wahnsinnige geschuftet, um ihr bildschönes, neues Haus in eine Oase, einen Zufluchtsort, ein Nest zu verwandeln.
Und auch sie selbst würde nach und nach lernen, ihr Haus und ihr neues Heimatland zu lieben, obgleich sie ihre Familie auf der anderen Seite des Ozeans schmerzlich vermisste.
Sie hatten sich darauf geeinigt, dass die Familie Lindberg über kurz oder lang zwei Standorte haben würde. Doch noch war nicht entschieden, wann genau sie zurück in die USA ziehen würden – und in welche Stadt. Das hing von Samuel und seinen künftigen Verträgen ab.
Deshalb muss ich für uns beide stark sein, dachte Alison. Ich will Samuels Fels in der Brandung sein, bis es ihm wieder besser geht.
So funktionierte eine Ehe nun mal. Jenes heilige Versprechen, einander zu lieben, in guten wie in schlechten Zeiten. Unter Hormon- und Eishockey-Einfluss. Angesichts von Eisprüngen und Jahresverträgen.
Sie warf ihren Morgenmantel beiseite und schlüpfte in einen Hoodie und Leggins. So war es wärmer, und da sie ohnehin allein zu Hause war, hätte es doch keinen Zweck, weiter in dem hübschen, aber zu dünnen Morgenrock herumzulaufen, den sie von Samuel zum ersten Jahrestag ihrer Verlobung geschenkt bekommen hatte.
Sie ging in die Küche und zog den Kühlschrank auf.
Die Enttäuschung angesichts des Testresultats steckte ihr immer noch in den Knochen. Sie würde sie mit einem Glas Chablis hinunterspülen.
Die Anschrift, zu der Annette Anna geschickt hatte, war nur wenige Autominuten vom Yogastudio entfernt. Anna fuhr entlang der Spazierwege langsam einmal quer durch die ganze begrünte Wohnsiedlung. Sie traute sich nicht, schneller zu fahren, weil hier bekanntermaßen viele Kinder wohnten, und jeden Moment konnte ein kleiner Temposünder auf seinem Fahrrad oder Tretroller um die nächste Ecke gesaust kommen.
Sie brauchte sich gar nicht erst rückzuversichern, dass sie bei der richtigen Adresse angelangt war. Auf dem Gehweg schienen sich mehrere Leute um einen Kinderwagen geschart zu haben.
Anna stieg aus und zückte ihre Dienstmarke.
»Polizeioberkommissarin Anna Glad, guten Tag. Einer von Ihnen hat den Notruf gewählt?«
Die Ansammlung bestand aus drei Teenager-Mädchen, zwei kleinen Jungs, einem älteren Mann mit Rollator, einer älteren Dame und einer jungen Frau, die ein Baby im Arm hielt und aufgewühlt wirkte.
Die ältere Dame hob die Hand.
»Das war ich. Margit Bergholm. Saara hatte mich gebeten, die Polizei zu rufen, und das habe ich gemacht.«
»Saara …?«
Die Frau mit dem Baby sah verstört zu Anna.
»D… Das bin ich.«
Aufmerksam betrachtete Anna das Kind in Saaras Armen. Es blickte mit großen Augen neugierig zurück.
»Was stimmt denn nun nicht mit dem Baby?«, erkundigte sie sich.
Sie hatte von Annette nur vage Informationen erhalten. Aus dem Notruf war lediglich hervorgegangen, dass eine Säuglingsmutter kurz anderweitig beschäftigt gewesen und ihrem Kind im Kinderwagen unterdessen etwas zugestoßen war. Allerdings sah dieses Würmchen nicht aus, als wäre etwas Schlimmes passiert.
»Was mit dem Baby nicht …?«, wiederholte Saara verwirrt. »Mit Tuuli scheint zum Glück alles in Ordnung zu sein.«
Anna verstand nur Bahnhof.
»Und warum haben Sie dann angerufen?«
Saara brachte kein Wort heraus. Sie hob nur die zitternde Hand und zeigte auf den Kinderwagen. Über dem Verdeck lag ein dünnes Stofftuch.
Anna hatte immer noch nicht begriffen, was hier vor sich ging, doch als sie auf den Kinderwagen zuhielt, hatte sie urplötzlich ein mulmiges Gefühl. Worauf musste sie sich hier gefasst machen?
»Äh … Aha?«
In dem Kinderwagen lag ein weiterer Säugling. Die Augen waren geschlossen, und die schmale Brust hob und senkte sich in einem ruhigen Takt. Das Kind schlief tief und fest. Und es schien ihm gut zu gehen.
»Wessen Kind ist das?«
»Genau das weiß ich nicht!«, presste Saara panisch hervor.
Und endlich fiel bei Anna der Groschen.
»Dann haben Sie den Notruf gewählt, weil … ein Kind zu viel im Kinderwagen lag, als Sie nach Hause kamen?«
»Genau«, piepste Saara. »Keine Ahnung, was das für ein Kind ist! Das muss dort reingelegt worden sein, als ich kurz im Blumenladen an der Storgatan war. Das waren gerade mal ein, zwei Minuten! Aber in der Zwischenzeit hat jemand Tuuli zur Seite geschoben, damit dieses da Platz neben ihr hatte.«
Anna wusste kurz nicht, was sie sagen sollte. Dies hier war das Merkwürdigste, was sie in ihrer Polizeilaufbahn bislang je erlebt hatte.
Dass Kinder vermisst wurden, passierte immer wieder. Anna hätte nicht mal mehr sagen können, wie oft sie schon an Orte gerufen worden war, von denen ein Kind verschwunden war. Zum Glück waren bislang alle recht schnell wieder aufgetaucht. Die meisten waren einfach in die falsche Richtung losmarschiert und irgendwann so verängstigt gewesen, dass sie sich versteckt hatten.
Aber das hier war neu.
»Und Sie sind sich sicher, dass Sie dieses Kind nie zuvor gesehen haben?«, fragte sie Saara.
»Zu einhundert Prozent! So was ist doch krank. Wer bitte schön legt einfach so sein Kind in einen fremden Kinderwagen? Und es kann ja wohl nicht sein, dass jemand den Kinderwagen verwechselt hat, denn Tuuli lag da ja drin! Gott, hab ich jetzt ein fremdes Kind gekidnappt? Aber das hab ich doch nicht, oder? Oder doch? O Gott …«
Saara war kurz davor, hysterisch zu werden, und Margit Bergholm versuchte, sie zu beruhigen, während Anna ihr Handy zückte. Sie ging ein Stück, um ungestört telefonieren zu können. Als sie zurückkam, hatte Saara sich wieder halbwegs im Griff.
Im nächsten Moment war aus dem Wagen ein Quengeln zu hören, und alle zuckten zusammen.
»Es ist aufgewacht!«, rief eins der Teenager-Mädchen.
»Okay, wir gehen jetzt folgendermaßen vor«, sagte Anna. »Ich habe einen Krankenwagen angefordert. Diese unbekannte kleine Person wird aus Sicherheitsgründen ins Krankenhaus gebracht. Dort vergewissern wir uns, dass es ihr gut geht. Der Krankenwagen sollte jeden Moment hier sein.«
Doch das Baby im Kinderwagen dachte gar nicht daran, auf den Krankenwagen zu warten. Es riss den Mund auf und fing an, laut zu kreischen.
»Ähm …« Anna versuchte verzweifelt, so souverän und selbstbewusst wie nur möglich zu klingen. »Es ist alles unter Kontrolle. Ich schlage vor, dass der Rest von Ihnen nach Hause geht. Saara, auch Sie. Ich komme gleich nach, ich muss Ihnen noch ein paar Fragen stellen.«
Die kleine Versammlung löste sich widerwillig auf, während das Baby im Wagen immer lauter schrie, was Saaras kleine Tuuli wohl dazu inspirierte, ebenfalls zu weinen. Anna zögerte kurz, doch dann nahm sie das kleine Bündel aus dem Kinderwagen. Das Kind war federleicht, es konnte kaum älter als ein paar Monate sein.
»So, so, Kleines. Gleich wird alles gut.«
Anna war nicht sonderlich gut darin, ein Baby zu halten. Sie wusste, dass man den Kopf stützen musste, aber wie sollte sie so ein kleines Geschöpf beruhigen, ohne ihm Schaden zuzufügen? Das würde sie schleunigst lernen müssen.
»He, ich bin doch jetzt hier, und wir finden heraus, wie du in diesen Wagen gekommen bist, und suchen deine Mama.«
Das Baby verstummte und schnaubte dann leise an Annas Schulter. Es roch nach Wolle, Waschmittel und … tja, nach Baby. Es hatte einen schwer zu beschreibenden, warmen, weichen Duft.
Im selben Moment spürte Anna ein merkwürdiges Drücken im Bauch.
Ihr eigenes Baby, das getreten hatte.
Walpurgis 1970
Der Weißwein war zimmerwarm und hatte einen komischen Beigeschmack. War das Kiefer? Oder Harz? Marianne kam nicht darauf – und sie hätte auch nicht sagen können, ob ihr der Wein sonderlich schmeckte –, aber der Junge, der ihn eingeschenkt hatte, sah sie so erwartungsvoll an, dass ihr nichts weiter einfiel, als zu nicken und ihn anzulächeln.
»Hmm!«
»Gut, oder? Aus Griechenland. Der beste Wein, den es gibt!«
Der Junge und die Flasche verschwanden ebenso schnell, wie sie aufgetaucht waren, und Marianne blieb mit ihrem Harzwein allein zurück. Wobei – allein war sie nicht wirklich. Schätzungsweise hatten sich gut vierzig Leute zur Walpurgisfeier in die Dreizimmerwohnung gequetscht.
Trotzdem fühlte sich Marianne einsam.
Verdammt noch mal, Birgitta. Die Freundin, die Marianne auf dieses Fest gelockt hatte. »Das wird lustig«, hatte Birgitta versprochen. »Jede Menge nette Menschen! Und höchste Eisenbahn, dass du neue Leute kennenlernst, jetzt, da du den Sommer über hier in der Stadt arbeitest. Und ich bin ja auch noch da.«
Natürlich war Birgitta auch noch da. Sie stand vor dem Plattenspieler, schnickte sich die Haare über die Schulter und tanzte mit zwei Jungs gleichzeitig zu Spinning Wheel. Dass sie Marianne versprochen hatte, ihr den Abend über Gesellschaft zu leisten, hatte sie wohl vergessen.
»Geht auf den Balkon, wenn ihr rauchen müsst!«, rief jemand, und im nächsten Moment bekam Marianne einen so harten Knuff ab, dass sie sich fast den ganzen Wein über den Pullover schüttete.
Der Junge, der sie angerempelt hatte, hatte es nicht mal bemerkt und hielt wie eine Dampfwalze weiter auf die Balkontür zu. In seinem Arm kicherte eine verzückte Blondine.
Verflixt und zugenäht … Der Pullover war fast neu gewesen! Machte griechischer Wein Flecken?
Marianne seufzte tief auf und sah zum anderen Ende des Zimmers, um mit Birgitta Blickkontakt aufzunehmen. Ihr reichte es allmählich, sie wollte heim, ihren Pullover einweichen und einen Tee trinken. Derlei Feste und Feiern waren nichts für sie – so war es nun mal. Sie würde nur schnell Birgitta Bescheid sagen, dass sie jetzt gehen würde.
Doch als sie Blickkontakt herstellte, war es nicht mit Birgitta.
Sondern mit einem Jungen. Oder eher: einem jungen Mann.
Er saß auf einem braunen Samtsofa neben dem Bücherregal. In seinem braunen Sakko verschmolz er fast mit dem Sofastoff, vielleicht war er ihr deshalb zuvor nicht aufgefallen. Er ähnelte einem Chamäleon.
Dass er sie ansah, machte Marianne verlegen. Sie war es nicht gewöhnt, dass Jungs sie so anblickten. Normalerweise starrten sie wie verzaubert Birgitta an, das sommersprossige Gesicht, diese niedliche Zahnlücke zwischen ihren Schneidezähnen, das lange, kastanienbraune Haar. Dass eine blasse, kleine Blondine namens Marianne danebenstand, übersahen die meisten.
Doch dieser Junge hatte sie nicht übersehen. Er blickte sie immer noch an, und sie konnte nicht anders, als zurückzustarren. Keiner der Jungs, mit denen sie bislang zusammen gewesen war, hatte sie je so interessiert betrachtet, nicht einmal Lennart.
Der Junge hatte dunkle Haare, eine leicht altmodische Frisur und ein recht kantiges Gesicht; die tief sitzenden Augen waren ebenfalls dunkel, der Blick durchdringend, aber nicht unangenehm.
Er würde vielleicht nicht gerade als gut aussehend durchgehen, trotzdem gefiel er ihr. Er trug Sakko und Krawatte, im Gegensatz zu den anderen, die T-Shirts, Jeans oder weite, flattrige Leinenhemden anhatten, die sie nicht einmal ganz zugeknöpft hatten.
Der Junge passte ebenso wenig auf dieses Fest wie Marianne. Möglicherweise gefiel er ihr genau deshalb.
Dumm nur, dass sie jetzt gehen würde.
Und wenn nicht? So eilig hatte sie es auch wieder nicht. Der Pullover war sowieso hinüber. Ein bisschen konnte sie ja noch bleiben.
Sie holte tief Luft und gab sich einen Ruck. Normalerweise wartete Marianne – oftmals vergebens –, dass andere Leute sie ansprachen. Doch diesmal würde sie einen auf selbstbewusst machen und selbst das Gespräch eröffnen.
Der Junge ließ sie nicht aus den Augen, als sie sich an den Tänzern im Wohnzimmer vorbeizwängte, sich auf die Armlehne des Sofas kauerte und versuchte, so abgeklärt und ungerührt wie nur möglich zu wirken.
»Hey, ich bin Marianne.«
Der Junge ergriff ihre ausgestreckte Hand und sah ihr dabei ernst ins Gesicht.
Seine Hand fühlte sich warm, straff und riesig an.
»Börje.«
Kapitel 2
Ene mene mölf
Kriegst gleich auf die zwölf
Anna stieg vor dem Krankenhaus aus ihrem Wagen und versuchte verzweifelt, sich nichts anmerken zu lassen, als sie in der linken Gesäßhälfte ein heftiges Ziehen verspürte. Die schlimmsten Schwangerschaftskrämpfe waren ihr bislang erspart geblieben, doch dieses Krampfen im Hintern verspürte sie jetzt regelmäßig.
Allerdings wusste sie, dass sie damit noch glimpflich davongekommen war. Sie war unzähligen Frauen begegnet – ob nun wildfremden oder bekannten, jungen oder älteren –, die auf die Nachricht, Anna sei schwanger, sofort ihre eigenen Horrorgeschichten zum Besten gegeben hatten.
»Also, ich hab von der neunten bis zur neununddreißigsten Woche quasi durchgekotzt.«
»Wie weit bist du jetzt? Ah, dann warte ab, das Schlimmste steht dir noch bevor.«
»Krämpfe – hast du die auch? Als würde einem das Bein ohne Betäubung amputiert werden, und das gleich mehrmals pro Nacht!«
Anna hatte sich antrainiert, mit »Oje!« darauf zu reagieren und »Du Arme!« zu sagen, während sie gleichzeitig auf Durchzug stellte. Anderer Frauen Schwangerschaftsanekdötchen fand sie in etwa so spannend wie die Wehrdienstgeschichten ihrer männlichen Kollegen.
Aber ja, ein paar Krämpfe im Hinterteil waren anscheinend das geringste Problem … Trotzdem tat es weh.
Anna zückte ihr Handy, um ihrer Vorgesetzten, Hauptkommissarin Annette Käld, einen kurzen Zwischenbericht zu vermelden.
Das Baby in Saara Nymans Kinderwagen hatte sich als kleines Mädchen entpuppt. Die Kinderärztin hatte das Alter auf wenige Monate geschätzt.
Der ersten Untersuchung zufolge war das Mädchen kerngesund und wohlauf. Es hatte die Untersuchung geduldig über sich ergehen lassen, ein Fläschchen bekommen und war daraufhin wieder eingeschlafen. Und es war mit seinen flaumigen hellblonden Haaren, dem rosa Schmollmund und dem kleinen Stupsnäschen zuckersüß anzusehen.
Es zerriss Anna das Herz. Wie war es möglich, dass sich noch niemand gemeldet und dieses Würmchen vermisste?
Natürlich kannte Anna Geschichten von übermüdeten Müttern, die nach zig schlaflosen Monaten mit ihrem Baby im Kinderwagen einkaufen und in ihrem übernächtigten Zustand ohne das Kind nach Hause gegangen waren. Doch diese Mütter waren ausnahmslos nach wenigen Minuten panisch zurückgekehrt. Inzwischen waren drei Stunden vergangen, seit Saara Nyman mit einem Baby zu viel im Wagen nach Hause gegangen war, und noch immer hatte kein panisches Elternteil sich bei der Polizei gemeldet.
Es war unbegreiflich.
Anna hatte die Babysachen gründlich abgesucht, weil sie sich davon einen Hinweis auf die Identität des Kindes erhofft hatte; schließlich nähten manche Eltern kleine Etiketten mit ihrer Telefonnummer in die Kleidung oder schrieben den Namen des Kindes mit einem Textilstift auf das Zettelchen mit den Waschhinweisen. Doch im Fall des unbekannten Mädchens hatte sie nichts dergleichen finden können.
Also erstellte sie eine Liste:
Weiße Strickmütze. Selbst gestrickt?
Weißer Babybody. Leicht verwaschen, gebraucht – Markenetikett abgeschnitten.
Gelbe Hose, gebraucht. H&M?
Eine rote Socke (die zweite fehlt, lag auch nicht in Saara Nymans Kinderwagen)
Libero-Windel
Das Mädchen war also mehr oder weniger wie Tausende Babys im Land angezogen.
Annette Käld lauschte konzentriert Annas Bericht.
»Die Kinderärztin hat empfohlen, dass die Kleine sicherheitshalber fürs Erste auf der Kinderstation bleibt«, führte Anna aus.
»Klingt vernünftig. Das Jugendamt schickt eine Sozialarbeiterin. Sie dürfte jeden Moment vor Ort sein. Wenn sich die Eltern nicht alsbald melden, müssen wir für das Kind eine Lösung finden. Säuglinge unterzubringen, scheint nicht ganz leicht zu sein.«
Sofort hatte Anna einen Kloß im Hals, und ihr dämmerte, dass sie mit ihrer Annahme falschgelegen hatte, ihre eigene Schwangerschaft würde sich auf ihr Verhalten im Job nicht auswirken: Dieses kleine Mädchen hatte sie eiskalt erwischt.
»In Ordnung«, murmelte sie.
»Hoffen wir mal, dass hier nur irgendeine Verwechslung vorliegt, eine Art Missverständnis …«
»Schon, trotzdem will es mir nicht in den Kopf. Dass jemand sein Baby in den falschen Kinderwagen legt, kann ich ja noch irgendwie nachvollziehen, sofern man einen ähnlichen Wagen hat … Aber doch nicht, wenn da schon ein Kind im Wagen liegt? Das sieht man doch!«
»Ja, es ist wirklich komisch. Aber Anna, sobald die Sozialarbeiterin vor Ort ist, muss ich dich noch woandershin schicken … Märta ist schon unterwegs, aber ich hielte es für besser, wenn ihr beide dort wärt.«
So viel zum freien Tag, schoss es Anna durch den Kopf.
»Worum geht es denn?«
»Um einen Rentner, der anscheinend verschwunden ist.«
»Ist das denn wirklich akut? Vielleicht ist er ja nur bei der Wassergymnastik oder so.«
»Ausgerechnet dieser Rentner hat sein Haus angeblich schon länger nicht mehr verlassen. Außerdem scheint auf seiner Vordertreppe jede Menge Blut vergossen worden zu sein. Da lohnt ein genauerer Blick.«
»Okay, verstehe. Und wo ist das?«
»Oben auf dem Betesbacken. Du weißt schon, dort, wo der neue Fahrradweg gebaut werden soll.«
Anna verzog das Gesicht und musste das Gewicht verlagern, weil sie erneut Krämpfe im Hintern hatte.
»Auf dem Betesbacken? Stehen da wirklich noch Häuser?«
»Zumindest eins steht noch – und genau dort sollst du hin.«
Bürgermeister Jasper Jokela raste auf seinem türkisblauen Bianchi-Fahrrad die Långgatan entlang.
Er bog auf den Hof des Rathauses ab, bremste so scharf, dass die Bremsen quietschten, und warf einen erwartungsvollen Blick auf seinen Fitnesstracker.
Yes! Neuer Rekord! Von Haustür zu Haustür in 18,27 Minuten. Und sobald der neue Fahrradweg fertig wäre, würde er für den Arbeitsweg sogar die zehn Minuten knacken.
Er schloss sein Rad an den Fahrradständer (am liebsten hätte er es mit in sein Dienstzimmer genommen, aber da hatte irgendein Denkmalschutztyp protestiert – wegen des ursprünglichen Parketts oder etwas ähnlich Bescheuertem). Immer noch mit dem Fahrradhelm auf dem Kopf betrat er das Amtsgebäude.
»Du liebe Güte!«, rief Rut Gundell am Empfangstresen und hielt sich die Augen zu – wie jedes Mal, wenn Jasper in Radlerhosen auftauchte.
»Ich ziehe mich gleich um, keine Sorge.«
Rut murmelte irgendwas in sich hinein. Die Alte schien gegen seinen Charme immun zu sein, aber eines Tages würde er sie schon herumkriegen, da war Jasper sich sicher.
Er huschte in sein Dienstzimmer und tauschte seine Sportsachen gegen einen »Büro-Casual-Schick« aus (den er selbst hatte verlautbaren lassen): grüne Chino-Hosen und ein weißes Kurzarmhemd mit kleinen Pinguinen, die kaum auffielen. Er hatte mehrere Sakkos und Schuhe in seinem Büroschrank deponiert, um sie nicht in seine Satteltaschen stopfen zu müssen, und musste so lediglich Sachen auswählen, die ihm für den Tag angemessen erschienen. Er entschied sich für ein rotes Sommersakko und dazu passende Loafers. Am Ende zerzauste er sich noch die Haare, um nicht allzu bürokratenhaft auszusehen – und damit war der Herr Bürgermeister bereit für die Ratsversammlung, die später am Tag stattfinden sollte.
Er schlenderte über den Flur und klopfte bei Verner Jansson an.
Der technische Leiter saß vor seinem Rechner.
»Morgen, Verner. Hast du vor der Besprechung nachher noch kurz Zeit für mich?«
»Ja … Vielleicht jetzt gleich? Setz dich.«
Jasper ließ sich auf dem Besuchersessel nieder und sah Verner nachdenklich an. Der Kollege sah schlecht aus, irgendwie angeschlagen. Sein Anzug gehörte in die Reinigung, und anscheinend war Verner schon länger nicht mehr beim Friseur gewesen.
»Geht’s um etwas Spezielles?«
»Was? Nein. Ich habe mich nur gefragt, ob es etwas Neues zum Fahrradweg gibt.«
Verner seufzte tief auf, nahm seine Brille ab und legte sie auf den Schreibtisch.
»Also, ich … Ich hab gerade erst mit Sjögren gesprochen …«
»Sjögren?«
»Mats Sjögren, der Vorarbeiter oben bei den Straßenarbeiten. Es steht schon wieder alles still.«
Jasper setzte sich gerade auf.
»Und warum?«