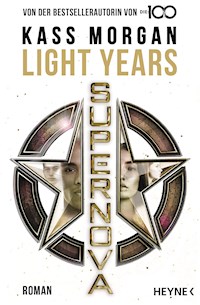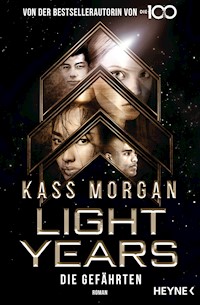13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Die komplette Saga in einem Band
Seit einem vernichtenden Atomkrieg lebt die Menschheit auf Raumschiffen. Dreihundert Jahre lang hat niemand mehr die Erde betreten. Doch nun sollen hundert jugendliche Straftäter das Unmögliche wagen: zurückkehren und herausfinden, ob ein Leben auf dem blauen Planeten wieder möglich ist. Doch was die idealistische Clarke, der geheimnisvolle Bellamy und die anderen Verurteilten nach ihrer Ankunft vorfinden, raubt ihnen den Atem. Ein tödliches Abenteuer beginnt, auf das sie kein Training der Welt hätte vorbereiten können ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1319
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
Dreihundert Jahre in der Zukunft: Seit einem verheerenden Atomkrieg ist die Erde so verstrahlt, dass Leben auf ihr nicht mehr möglich ist. Die wenigen Menschen, die sich retten konnten, flohen ins All. Ihre Nachfahren leben noch immer auf den Raumschiffen, die den blauen Planeten umkreisen, doch die altersschwache Technik versagt zunehmend, und der Sauerstoff wird knapp. Daher entschließt sich die Regierung zu einem Experiment: Einhundert jugendliche Straftäter, die nach den strengen Gesetzen der Kolonie zum Tode verurteilt sind, sollen auf die Erde geschickt werden, um festzustellen, ob die Strahlung soweit zurückgegangen ist, dass wieder Menschen auf ihr leben können. Unter den Hundert sind die idealistische Medizinstudentin Clarke, deren Eltern unaussprechliche Verbrechen begangen haben. Wells, der Sohn des Kanzlers und Clarkes Ex-Freund, liebt sie nach wie vor so sehr, dass er alles für sie tun würde – selbst wenn das bedeutet, der Strahlenkrankheit zum Opfer zu fallen. Und der geheimnisvolle Bellamy hat nur ein Ziel: Seine kleine Schwester Octavia, die es nach den Regeln der Kolonie gar nicht geben dürfte, zu beschützen. Was die Hundert auf dem blauen Planeten vorfinden, raubt ihnen den Atem – und wird die Geschichte der Menschheit für immer verändern.
Die Autorin
Kass Morgan studierte Literaturwissenschaft an der Brown University und in Oxford. Noch vor Erscheinen ihres ersten Buches, Die 100, konnte sie bereits die Rechte der Serienverfilmung verkaufen. Die 100 schaffte es auf Anhieb auf die SPIEGEL-Bestsellerliste, und auch mit den Folgebänden der Serie, Die 100 – Tag 21, Die 100 – Die Heimkehr und Die 100 – Rebellion, knüpfte Kass Morgan an ihren sensationellen Erfolg an. Mit Light Years – Die Gefährten beginnt die Erfolgsautorin nun ihre zweite große Science-Fiction-Saga, und zusammen mit Danielle Paige schreibt sie zudem an der Urban-Fantasy-Serie Der Club der Rabenschwestern. Kass Morgan arbeitet als Lektorin und freie Autorin, sie lebt in Brooklyn.
Mehr über Kass Morgan und ihre Werke erfahren Sie auf:
Kass Morgan
DIE SAGA
IN EINEM BAND
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Titel der Originalausgaben
THE 100
aus dem Amerikanischen von Michael Pfingstl
THE 100 – DAY 21
aus dem Amerikanischen von Michaela Link
THE 100 – HOMECOMING
THE 100 – REBELLION
aus dem Amerikanischen von Michael Pfingstl
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Ausgabe 09/2021
Copyright © 2013, 2014, 2015, 2016 by Kass Morgan
Copyright © 2021 dieser Ausgabe und der Übersetzung
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: DAS ILLUSTRAT, München,unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (Dotted Yeti, wgraphiks)
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-26866-4V001
www.diezukunft.de
Inhaltsverzeichnis
DIE 100
DIE 100 – TAG 21
DIE 100 – HEIMKEHR
DIE 100 – REBELLION
DIE 100
1
Clarke
Die Tür glitt zur Seite, und Clarke wusste, dass es Zeit war zu sterben.
Sie sah nur die Stiefel des Gardisten, der in ihre Zelle kam, und setzte sich auf. Ihr schweißnasses Hemd löste sich schmatzend von der Pritsche, und sie machte sich bereit für die Angst, das Adrenalin, den Anfall wilder Panik. Doch alles, was sie spürte, war Erleichterung.
Nachdem sie eine der Wachen angegriffen hatte, war sie in eine Einzelzelle verlegt worden, doch für Clarke gab es so etwas wie Einsamkeit nicht. Sie hörte Stimmen, überall. Aus den dunklen Ecken der Zelle riefen sie ihr zu, füllten die Stille zwischen ihren Herzschlägen, schrien aus den tiefsten Schlupfwinkeln ihres Bewusstseins. Sie sehnte sich nicht nach dem Tod, aber wenn es der einzige Ausweg war, um diesen Stimmen zu entkommen, dann war sie bereit zu sterben.
Sie war wegen Verrats verurteilt worden, doch die Wahrheit war viel schlimmer. Selbst wenn ein Wunder geschah und sie im Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen wurde – für Clarke gab es keine Erlösung. Ihre Erinnerungen waren entsetzlicher als jede Strafe.
Der Gardist trat unruhig von einem Fuß auf den anderen und räusperte sich. »Gefangene Nummer 319, bitte stehen Sie auf.« Er war jünger, als sie erwartet hatte, und die Uniform hing ihm lose von den schmalen Schultern. Offensichtlich war er gerade erst rekrutiert worden. Ein paar Monate Soldatenrationen reichten nicht aus, um das Gespenst der Unterernährung zu vertreiben, das auf den äußeren Kolonieschiffen Walden und Arcadia umging.
Clarke atmete tief durch und erhob sich.
»Strecken Sie die Hände vor«, sagte er und nahm ein paar Handschellen aus der Brusttasche seiner blauen Uniform.
Clarke erschauerte, als sie die Haut seiner Hände an ihrer spürte. Seit sie in Einzelhaft war, hatte sie nicht einen einzigen Menschen gesehen, geschweige denn berührt.
»Zu fest?« Der Hauch von Mitgefühl in seiner Stimme versetzte Clarke einen Stich. Der letzte Mensch, der sich um ihr Wohlergehen gesorgt hatte, war Thalia gewesen, ihre ehemalige Zellengenossin und einzige Freundin in diesem Leben, und das war eine Ewigkeit her. Sie schüttelte den Kopf.
»Setzen Sie sich einfach aufs Bett. Der Arzt ist schon auf dem Weg.«
»Sie wollen es hier tun?«, fragte Clarke heiser. Wenn der Arzt bereits unterwegs war, bedeutete dies, dass sie das Wiederaufnahmeverfahren gar nicht erst abwarteten. Doch das war nicht besonders überraschend. Laut Gesetz wurden Erwachsene sofort nach ihrer Verurteilung exekutiert. Minderjährige wurden bis zu ihrem achtzehnten Geburtstag unter Arrest gestellt und bekamen dann ein Berufungsverfahren. Doch in letzter Zeit wurden praktisch alle Verurteilten schon wenige Stunden nach der zweiten Verhandlung hingerichtet, wegen Verbrechen, für die sie noch vor ein paar Jahren begnadigt worden wären.
Trotzdem war es schwer zu glauben, dass es tatsächlich in ihrer Zelle passieren würde. Clarke hatte sich, so pervers es auch war, beinahe auf diesen letzten Gang zur Krankenstation gefreut, wo sie während ihrer medizinischen Ausbildung so viel Zeit verbracht hatte. Auf diese letzte Chance, etwas Vertrautes zu erleben, auch wenn es nur der Geruch von Desinfektionsmitteln und das Summen des Ventilationssystems waren, bevor ihre Sinne für immer ausgelöscht wurden.
»Sie müssen sich setzen«, sagte der Gardist, ohne sie anzusehen.
Clarke ging noch ein paar Schritte durch die Zelle, dann setzte sie sich steif auf den Rand der schmalen Pritsche. In der Isolationshaft veränderte sich das Zeitgefühl, das wusste sie. Trotzdem konnte Clarke kaum glauben, dass sie beinahe sechs Monate allein hier ausgeharrt hatte. Das Jahr davor hatte sich im Vergleich dazu wie eine Ewigkeit angefühlt. Sie waren zu dritt in der Zelle gewesen: Clarke, Thalia und Lise, ein Mädchen mit strengem Blick, das erst gelächelt hatte, als Clarke in die Isolationshaft verlegt wurde. Trotzdem gab es keine andere Erklärung: Heute musste ihr achtzehnter Geburtstag sein, und ihr einziges Geschenk war eine Spritze, die ihre Muskeln lähmte, bis ihr Herz aufhörte zu schlagen. Danach würde ihre Leiche, wie es in der Kolonie üblich war, dem Weltraum überantwortet und bis ans Ende aller Zeiten durchs All treiben.
Eine Gestalt erschien im Türrahmen, und ein großer schlanker Mann trat in die Zelle. Obwohl sein graues schulterlanges Haar die Plakette am Kragen des Laborkittels teilweise verdeckte, erkannte Clarke ihn als den medizinischen Chefberater des Rats. Vor ihrer Verurteilung war sie Doktor Lahiri über ein halbes Jahr lang praktisch auf Schritt und Tritt gefolgt. Die Stunden, die sie im Operationssaal an seiner Seite verbracht hatte, konnte sie gar nicht mehr zählen. Die anderen Auszubildenden hatten Clarke beneidet und auf der Stelle Bevorzugung gewittert, als sie herausfanden, dass Doktor Lahiri einer der engsten Freunde ihres Vaters war. Oder es zumindest vor der Hinrichtung ihrer Eltern gewesen war.
»Hallo, Clarke«, sagte er freundlich, als wären sie in der Krankenhauskantine und nicht in einer Todeszelle. »Wie geht es dir?«
»Besser als in ein paar Minuten, schätze ich.«
Doktor Lahiri hatte Clarkes schwarzen Humor immer gemocht, doch diesmal lachte er nicht. »Wenn Sie ihr bitte die Handschellen abnehmen und uns einen Moment allein lassen würden?«, sagte er zu dem Gardisten.
Der Wachsoldat wand sich unbehaglich. »Meine Befehle lauten, die Gefangene nicht aus den Augen zu lassen.«
»Sie können gleich vor der Tür warten«, erwiderte Lahiri betont gelassen. »Sie ist unbewaffnet und erst siebzehn. Ich denke, ich habe die Situation im Griff.«
Der Gardist wich Clarkes Blick aus, als er ihr die Handschellen abnahm. Dann nickte er Doktor Lahiri kurz zu und ging hinaus.
»Sie meinen: Ich bin achtzehn und unbewaffnet«, korrigierte Clarke und zwang sich zu einem Lächeln. »Oder gehören Sie jetzt auch zu diesen verrückten Wissenschaftlern, die nicht einmal mehr wissen, welches Jahr wir haben?« Ihr Vater war so einer gewesen. Immer wieder hatte er vergessen, die Lichtautomatik zu programmieren, und war um 0400 zur Arbeit gegangen, so sehr in seine Forschungen versunken, dass er nicht merkte, wie verlassen sämtliche Korridore auf dem Weg dorthin waren.
»Du bist immer noch siebzehn, Clarke«, berichtigte Doktor Lahiri und sprach so langsam, wie er es sonst nur bei Patienten tat, die gerade aus der Narkose erwachten. »Deine Isolationshaft dauert erst drei Monate.«
»Was tun Sie dann hier?«, fragte sie und konnte die Panik in ihrer Stimme nicht unterdrücken. »Laut Gesetz müssen Sie warten, bis ich achtzehn bin.«
»Das Verfahren hat sich geändert. Das ist alles, was ich dir sagen darf.«
»Aha, hinrichten dürfen Sie mich also, aber nicht mit mir sprechen.« Sie dachte an Lahiris Gesichtsausdruck während der Verhandlung ihrer Eltern. Damals hatte sie seine versteinerte Miene als ein Zeichen der Missbilligung gedeutet, doch jetzt war sie sich nicht mehr so sicher. Lahiri hatte nichts zu ihrer Verteidigung gesagt. Genau wie alle anderen hatte er nur stumm dagesessen, während der Rat Clarkes Eltern – zwei der brillantesten Wissenschaftler auf der Phoenix – für schuldig befand, gegen die Gaia-Doktrin verstoßen zu haben, die nach der Stunde Null verhängt worden war.
»Wie war das mit meinen Eltern? Haben Sie die auch umgebracht?«, fragte sie.
Doktor Lahiri schloss die Augen, als hätten Clarkes Worte sich in ein Monster verwandelt, das ihm jetzt höhnisch ins Gesicht grinste. »Ich bin nicht hier, um dich zu töten«, erwiderte er leise. Er öffnete die Augen wieder und deutete auf den Hocker, der am Ende von Clarkes Pritsche stand. »Darf ich?«
Als Clarke keine Antwort gab, nahm er den Hocker und setzte sich direkt vor sie. »Darf ich deinen Arm sehen?«
Clarke spürte, wie es ihr die Brust zusammenschnürte. Lahiri war ein verdammter Heuchler. Diese ganze Prozedur war grausam und pervers, aber in einer Minute würde alles vorbei sein. Sie streckte den Arm aus.
Doktor Lahiri griff in die Brusttasche seines Kittels und zog ein Tuch heraus, das nach Desinfektionsmittel roch. Clarke zitterte, als er damit über die Innenseite ihres Handgelenks fuhr.
»Keine Sorge. Es wird nicht wehtun.«
Clarke schloss die Augen. Sie dachte an Wells’ verzweifelten Blick, als die Wachen ihre Eltern aus der Ratskammer eskortiert hatten. Der Zorn, der sie während der Verhandlung beinahe aufgefressen hatte, war längst verflogen, doch jetzt durchzuckte sie die Erinnerung an Wells wie ein Blitz, wie das letzte Gleißen eines Sterns, kurz bevor er für immer verlosch. Ihre Eltern waren tot, und das war seine Schuld.
Lahiri umfasste ihr Handgelenk und tastete nach der Vene.
Wir sehen uns gleich, Mom und Dad.
Sein Griff wurde fester. Es war so weit. Clarke spürte einen kleinen Einstich und atmete tief ein.
»Fertig«, sagte Lahiri.
Sie riss die Augen auf und blickte nach unten. Ein Metallarmband umschloss ihr Handgelenk. Als sie es ungläubig betastete, spürte sie tausend kleine Nadelstiche an der Stelle, wo die Pulsadern verliefen. Clarke fuhr zusammen. »Was ist das?«, rief sie panisch und riss sich von dem Arzt los.
»Entspann dich«, erwiderte er mit unerträglicher Gelassenheit. »Das ist ein Vital-Transponder. Er überwacht deine Atmung und die Blutwerte und sammelt noch allerlei andere nützliche Informationen.«
»Nützlich für wen?«, hakte Clarke nach, auch wenn ihr das ungute Gefühl in ihrem Magen bereits sagte, in welche Richtung die Antwort gehen würde.
»Es hat ein paar aufregende Entwicklungen gegeben«, erklärte Lahiri und klang wie eine billige Imitation von Wells’ Vater, Kanzler Jaha, wenn er eine seiner Gedenktagsreden hielt. »Du solltest stolz sein. Das alles haben wir allein deinen Eltern zu verdanken.«
»Meine Eltern wurden wegen Verrats hingerichtet.«
Doktor Lahiri warf ihr einen missbilligenden Blick zu. Noch vor einem Jahr wäre Clarke vor Scham im Boden versunken, aber jetzt zuckte sie nicht mit der Wimper. »Vergib diese Chance nicht. Du hast die Möglichkeit, das Richtige zu tun und das entsetzliche Verbrechen deiner Eltern wiedergutzumachen.«
Mit einem lauten Krachen landete Clarkes Faust mitten in Lahiris Gesicht, gefolgt von einem dumpfen Knall, als sein Hinterkopf gegen die Wand schlug. Der Wachposten, der draußen gewartet hatte, kam hereingestürmt und drehte Clarke die Hände auf den Rücken. »Alles in Ordnung, Sir?«, fragte er.
Lahiri setzte sich langsam auf und rieb sich das Kinn, während er Clarke halb wütend, halb amüsiert musterte. »Zumindest wissen wir jetzt, dass du dich unter den anderen Delinquenten behaupten kannst, wenn ihr dort seid.«
»Wenn wir wo sind?«, schnaubte Clarke und versuchte, sich aus dem Haltegriff zu befreien.
»Noch heute wird der gesamte Arrestflügel geräumt. Einhundert Kriminelle wie du bekommen die Chance, Geschichte zu schreiben.« Lahiris Lippen verzogen sich zu einem Grinsen. »Ihr fliegt zur Erde.«
2
Wells
Der Kanzler war alt geworden. Obwohl Wells seinen Vater erst vor weniger als sechs Wochen zuletzt gesehen hatte, wirkte er um Jahre gealtert. An den Schläfen entdeckte Wells neue graue Strähnen, und die Falten um seine Augen waren tiefer geworden.
»Sagst du mir jetzt endlich, warum du es getan hast?«, fragte der Kanzler mit einem erschöpften Seufzen.
Wells rutschte auf seinem Stuhl hin und her. Er spürte, wie die Wahrheit versuchte, aus ihm herauszubrechen. Er hätte alles gegeben, um die Enttäuschung aus dem Gesicht seines Vaters zu verscheuchen, aber er konnte es nicht riskieren. Nicht bevor er wusste, ob sein gefährlicher Plan aufgegangen war. Er vermied jeden Augenkontakt und ließ seinen Blick über die Reliquien gleiten, die er vielleicht zum letzten Mal sah: das Adlerskelett in der Glasvitrine, die wenigen Gemälde, die den Brand des Louvre überlebt hatten, und die Fotos all der wunderschönen entvölkerten Städte, deren Namen Wells nach wie vor Schauder über den Rücken jagten.
»War es eine Mutprobe? Wolltest du vor deinen Freunden angeben?« Der Kanzler sprach in demselben leisen, getragenen Tonfall, den er bei Anhörungen vor dem Rat benutzte. Schließlich hob er eine Augenbraue als Zeichen dafür, dass er eine Antwort erwartete.
»Nein, Sir.«
»Bist du vorübergehend dem Wahnsinn verfallen? Warst du auf Drogen?« In seiner Stimme schwang ein Anflug von Hoffnung mit, den Wells in einer anderen Situation durchaus amüsant gefunden hätte. Aber im Blick seines Vaters lag nicht das kleinste bisschen Humor, sondern eine Mischung aus Erschöpfung und Verwirrung, die Wells seit der Beerdigung seiner Mutter nicht mehr an ihm gesehen hatte.
»Nein, Sir.«
Einen Moment lang verspürte Wells den Wunsch, seinen Vater zu berühren. Doch es lag nicht an den Fesseln um seine Handgelenke, dass er es nicht tat. Etwas anderes hielt ihn davon ab, ihm über den Tisch hinweg die Arme entgegenzustrecken. Selbst als sie vor der Schleuse gestanden hatten, um seiner Mutter ein letztes Lebewohl zu sagen, hatte er die dreißig Zentimeter Abstand zwischen ihnen nicht überbrücken können. Es war, als hätte die Trauer sie zu gleichpoligen Magneten gemacht, die einander abstießen.
»Wolltest du ein politisches Statement abgeben?« Sein Vater zuckte leicht, als wäre der Gedanke für ihn wie eine Ohrfeige. »Hat jemand von der Walden oder der Arcadia es dir eingeredet?«
»Nein, Sir«, antwortete Wells und unterdrückte den aufsteigenden Ärger. Anscheinend hatte sein Vater die letzten sechs Wochen damit verbracht, sein Bild von Wells zu dem eines Rebellen umzugestalten. Offenbar verstand er einfach nicht, wie der ehemalige Musterschüler und vorbildliche Kadett den öffentlichsten Gesetzesbruch aller Zeiten hatte begehen können. Aber selbst die Wahrheit hätte seine Verwirrung nicht gelindert. Für den Kanzler gab es keine Rechtfertigung dafür, den Eden-Baum in Brand zu stecken, jenen Setzling, der kurz vor dem großen Exodus an Bord der Phoenix gebracht worden war. Trotzdem war Wells keine andere Wahl geblieben. Nachdem er herausgefunden hatte, dass Clarke zu den hundert Delinquenten gehörte, die auf die Erde geschickt wurden, hatte er etwas unternehmen müssen, um ebenfalls dabei zu sein. Und als Sohn des Kanzlers konnte ihn nur ein schweres öffentliches Verbrechen in die Arrestzelle bringen.
Er dachte daran zurück, wie er sich während der Gedenktagsfeierlichkeiten durch die Menge geschoben hatte. Hunderte Augen waren auf ihn gerichtet gewesen, und seine Hand hatte gezittert, als er das Feuerzeug hervorgezogen und ihm einen grellen Funken entlockt hatte. Einen Moment lang hatten alle nur stumm auf die Flammen gestarrt, die den Baum umschlossen. Dann waren die Wachen vorwärtsgestürzt und hatten Wells gepackt, und trotz des entstandenen Chaos hatte jeder genau mitbekommen, wer da fortgeschleppt worden war.
»Was zum Teufel hast du dir dabei gedacht?«, fragte der Kanzler und starrte ihn ungläubig an. »Du hättest den ganzen Saal niederbrennen und jeden darin töten können.«
Besser, er log. Sein Vater würde leichter damit zurechtkommen, wenn er glaubte, es wäre eine Mutprobe gewesen. Oder Wells tat so, als wäre er tatsächlich auf Drogen gewesen. Beide Möglichkeiten waren für den Kanzler besser zu ertragen als die Wahrheit: dass er es wegen eines Mädchens getan hatte.
Die Tür der Krankenstation schloss sich hinter ihm, aber Wells’ Lächeln blieb wie eingefroren, als hätte die Kraft, die es gekostet hatte, die Mundwinkel nach oben zu ziehen, seine Gesichtsmuskeln dauerhaft beschädigt. In ihrem von Medikamenten benebelten Zustand hatte seine Mutter das erstarrte Grinsen wahrscheinlich für echt gehalten, und das war alles, was zählte. Sie hatte seine Hand gehalten, während die Lügen aus Wells herausströmten. Bittere, aber harmlose Lügen. Ja, Dad und mir geht es gut. Sie brauchte nicht zu wissen, dass die beiden in Wirklichkeit seit Wochen kaum mehr als ein paar Worte miteinander gesprochen hatten. Wenn es dir wieder besser geht, lesen wir Verfall und Untergang des Römischen Reiches zu Ende. Sie hatten beide gewusst, dass seine Mutter es nie bis zum letzten Kapitel schaffen würde.
Wells verließ das Krankenhaus und überquerte Deck B, das glücklicherweise vollkommen menschenleer war. Um diese Zeit waren die meisten entweder bei den Lernprogrammen, bei der Arbeit oder der Tauschbörse. Wells hätte eigentlich im Geschichtsunterricht sein sollen, seinem Lieblingsfach. Er liebte die Berichte über altehrwürdige Städte wie Rom oder New York, deren einstige Größe nur noch vom Drama ihres Untergangs übertroffen wurde. Aber er konnte den Gedanken nicht ertragen, geschlagene zwei Stunden umgeben von Mitschülern zu verbringen, die seine Nachrichtenbox mit vagen, hilflosen Beileidsbekundungen überflutet hatten. Der einzige Mensch, mit dem er über seine Mutter sprechen konnte, war Glass, doch die war in letzter Zeit eigenartig distanziert gewesen.
Wells wusste nicht, wie lange er vor der Tür gestanden hatte, bis er merkte, dass er schon bei der Bibliothek angekommen war. Er wartete, bis der Scanner seine Augen abgetastet hatte, dann drückte er den Daumen auf das Erkennungsfeld. Die Tür glitt gerade so lange zur Seite, dass er hindurchschlüpfen konnte, und schloss sich sofort wieder mit einem verärgerten Schnappen, als hätte sie ihm einen unermesslichen Gefallen getan, ihn überhaupt durchzulassen.
Als er in die Stille und das Schummerlicht der Bibliothek eintauchte, entspannte er sich ein wenig. Die Bücher, die vor der Stunde Null auf die Phoenix gebracht worden waren, wurden in hohen, sauerstofffreien Vitrinen aufbewahrt, um den Verfallsprozess zu verlangsamen. Das war auch der Grund, warum man sie ausschließlich in der Bibliothek lesen durfte und selbst dann immer nur für ein paar Stunden. Der riesige Saal war vom künstlichen Tageslicht abgeschirmt und lag in ewigem Halbdunkel.
So lang er sich zurückerinnern konnte, hatte Wells jeden Sonntagabend hier mit seiner Mutter verbracht. Als er noch klein war, hatte sie ihm vorgelesen, später hatten sie mit ihren jeweiligen Büchern nebeneinandergesessen. Doch als ihre Krankheit voranschritt und die Kopfschmerzen immer schlimmer wurden, hatte Wells die Rolle des Vorlesers übernommen. Sie hatten gerade mit dem zweiten Band von Verfall und Untergang angefangen, als sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde.
Er zwängte sich durch die schmalen Gänge bis zur Sektion mit den englischsprachigen Büchern und ging dort zu der dunklen Ecke mit der Geschichtsabteilung. Die Sammlung war kleiner, als sie hätte sein sollen. Zahlreiche Texte waren vor dem Exodus digital archiviert worden, doch knapp hundert Jahre später hatte ein Virus sie beinahe vollständig ausradiert. Die wenigen Bücher, die auf der Phoenix übrig geblieben waren, hatten sich alle in Privathänden befunden – Erbstücke aus Familienbesitz, die von Generation zu Generation weitergegeben worden waren. Nach und nach hatten die Eigentümer sie schließlich der Bibliothek gespendet.
Wells beugte sich hinunter zum Buchstaben G und drückte seinen Daumen auf das Schloss. Mit einem Zischen entwich das Vakuum, und die Glastür glitt zur Seite. Er wollte gerade nach Verfall und Untergang greifen, da hielt er plötzlich inne. Eigentlich hatte er vorgehabt, ein Stückchen weiterzulesen und dann seiner Mutter davon zu erzählen. Doch jetzt kam es ihm vor, als könnte er ebenso gut mit ihrem Grabstein an ihr Bett kommen und sie fragen, was darauf stehen sollte.
»Man soll die Vitrinen nicht offen lassen«, sagte eine Stimme hinter ihm.
»Ja, danke«, erwiderte Wells etwas schärfer, als er beabsichtigt hatte. Er stand auf und drehte sich um. Hinter ihm stand ein Mädchen und starrte ihn an. Das Gesicht kam ihm bekannt vor. Es gehörte der Arztschülerin aus dem Krankenhaus. Wells spürte einen Anflug von Wut angesichts dieser Überschneidung der Welten. Schließlich war die Bibliothek der Ort, an den er kam, um das Hospital zu vergessen – den Desinfektionsmittelgeruch und das Piepen des Herzmonitors, das schon lange kein Lebenszeichen mehr war, sondern ein Countdown zum Tod.
Das Mädchen machte einen Schritt zurück und neigte den Kopf zur Seite, sodass ihr helles Haar auf die linke Schulter fiel. »Ach, du bist es.«
Wells wartete auf die zuckenden Augenbewegungen, die verrieten, dass sie ihren Freunden über den Netzhauttransmitter eine Nachricht schickte. Doch der Blick des Mädchens blieb starr auf ihn gerichtet, als schaue sie direkt in ihn hinein und zerre all die Gedanken ans Licht, die er so sorgsam verbarg.
»Wolltest du das Buch nicht haben?« Sie deutete mit dem Kinn auf die Vitrine.
Wells schüttelte den Kopf. »Ich werde es ein andermal lesen.«
Sie schwieg einen Moment. »Ich glaube, du solltest es jetzt tun.« Wells’ Kiefermuskeln zuckten, aber er sagte nichts, also sprach sie weiter. »Ich hab dich oft mit deiner Mutter hier gesehen. Du solltest es ihr mitbringen.«
»Nur weil mein Vater Chef des Rats ist, kann ich nicht einfach ein dreihundert Jahre altes Gesetz brechen«, erwiderte er mit einem Hauch von Herablassung in der Stimme.
»Wegen ein paar Stunden wird dem Buch schon nichts passieren. Die negativen Auswirkungen von Sauerstoff werden überschätzt.«
Wells zog eine Augenbraue nach oben. »Und wird der Scanner am Ausgang auch überschätzt?« An fast jeder Durchgangstür auf der Phoenix befand sich ein programmierbarer Scanner. Am Eingang der Bibliothek durchleuchtete er jeden, der hinein- oder hinausging, nach Büchern, um sicherzugehen, dass niemand eins nach draußen schmuggelte.
Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. »Dafür habe ich schon vor langer Zeit eine Lösung gefunden.« Sie warf einen kurzen Blick über die Schulter den schummrigen Gang entlang, dann griff sie in ihre Tasche und zog ein graues Stück Stoff hervor. »Das verhindert, dass der Scanner die Zellulose im Papier erfasst.« Sie hielt es ihm hin. »Hier. Nimm es.«
Wells machte einen Schritt zurück. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Mädchen ihn bloßstellen wollte, war weit größer als die, dass sie auf Schritt und Tritt ein Wundertuch mit sich herumtrug. »Wieso hast du das?«
Sie zuckte die Achseln. »Ich lese gern außerhalb der Bibliothek.« Als Wells nichts erwiderte, lächelte sie und streckte auch noch die andere Hand aus. »Gib mir einfach das Buch. Ich nehme es für dich mit ins Krankenhaus.«
Wells war selbst überrascht, als er gehorchte. »Wie heißt du?«, fragte er.
»Damit du weißt, wem du auf immer und ewig zu tiefster Dankbarkeit verpflichtet bist?«
»Damit ich weiß, wer schuld ist, wenn ich verhaftet werde.«
Das Mädchen klemmte sich das Buch unter den Arm und hielt ihm die Hand hin. »Clarke.«
»Wells.« Er lächelte, und diesmal tat es nicht einmal weh.
»Sie konnten den Baum gerade noch retten.« Der Kanzler starrte Wells an, als suche er nach einem Hinweis auf Reue oder wenigstens Schadenfreude, irgendetwas, das ihm verstehen half, weshalb sein Sohn versucht hatte, den einzigen Baum niederzubrennen, der es von der Erde ins All geschafft hatte. »Nicht wenige Ratsmitglieder wollten dich noch an Ort und Stelle hinrichten lassen, minderjährig oder nicht. Ich konnte es nur verhindern, indem ich sie überredete, dich auf die Erde zu schicken.«
Wells atmete erleichtert auf. Weniger als hundertfünfzig Jugendliche befanden sich im Moment unter Arrest. Wells war davon ausgegangen, dass nur die ältesten unter ihnen auf die Erde geschickt würden. Bis zu diesem Moment hatte er nicht sicher sein können, ob auch er dazugehörte.
Die Augen seines Vaters weiteten sich vor Überraschung, dann verstand er endlich. »Das war es, was du wolltest, oder?«
Wells nickte. Der Kanzler verzog das Gesicht. »Hätte ich gewusst, dass du unbedingt auf die Erde willst, hätte ich das leicht arrangieren können. Mit der zweiten Expedition, wenn wir wissen, dass es sicher ist.«
»Ich wollte nicht warten. Ich möchte zu den ersten Hundert gehören.«
Der Kanzler kniff die Augen ein Stück zusammen und musterte Wells’ teilnahmsloses Gesicht. »Warum? Gerade du weißt, wie gefährlich es ist.«
»Bei allem Respekt, du warst doch derjenige, der den Rat davon überzeugt hat, dass der nukleare Winter vorbei ist. Du hast gesagt, es wäre sicher.«
»Ja. Sicher genug für einhundert verurteilte Kriminelle, die so oder so sterben werden«, erwiderte der Kanzler mit einer Mischung aus Arroganz und Ungläubigkeit. »Ich habe nicht gemeint, sicher für meinen Sohn.«
Der Zorn, den Wells die ganze Zeit unterdrückt hatte, brach sich endlich Bahn und vertrieb seine Schuldgefühle. Er ballte die Fäuste und zerrte wütend an seinen Handschellen. »Wie es aussieht, bin ich jetzt einer von diesen verurteilten Kriminellen.«
»Deine Mutter würde das nicht wollen, Wells. Nur weil sie oft von der Erde geträumt hat, heißt das noch lange nicht, dass sie dich einer solchen Gefahr ausgesetzt hätte.«
Wells beugte sich nach vorn und ignorierte den Schmerz, mit dem das Metall in seine Haut schnitt. »Ich mache das nicht ihretwegen«, fauchte er und blickte seinem Vater zum ersten Mal, seit er den Raum betreten hatte, in die Augen. »Auch wenn ich glaube, dass sie stolz auf mich wäre.«
Das stimmte sogar, zumindest teilweise. Sie hatte eine romantische Ader gehabt und hätte Wells’ Wunsch verstanden, das Mädchen, das er liebte, zu beschützen. Allerdings gab es noch etwas, das er getan hatte, und damit wäre sie kaum einverstanden gewesen. Den Eden-Baum anzuzünden erschien im Vergleich dazu wie ein harmloser Kinderstreich.
Sein Vater starrte ihn fassungslos an. »Willst du mir damit sagen, du hast dich wegen eines Mädchens in diese Lage gebracht?«
Wells nickte langsam. »Es ist meine Schuld, dass sie wie eine Laborratte da runtergeschickt wird. Und ich werde alles tun, damit sie lebend wieder zurückkommt.«
Der Kanzler blieb einen Moment lang still. Als er wieder etwas sagte, klang seine Stimme vollkommen ruhig. »Das wird nicht nötig sein.« Er zog etwas aus der Schublade und legte es vor Wells auf den Tisch. Es war ein Metallring mit einem etwa daumennagelgroßen Chip darauf. »Jeder der Expeditionsteilnehmer bekommt eins von diesen Armbändern«, erklärte er. »Sie stehen in ständiger Verbindung mit dem Schiff, damit wir euch orten und die Vitalfunktionen überwachen können. Sobald wir sicher sein können, dass der Planet wieder bewohnbar ist, beginnen wir mit der Wiederbesiedelung.« Er zwang sich zu einem entschlossenen Lächeln. »Wenn alles nach Plan läuft, kommen wir bald nach, und dann ist all das« – er deutete auf Wells’ Handfesseln – »vergeben und vergessen.«
Die Tür ging auf, und eine Wache trat ein. »Es ist Zeit, Sir.«
Auf ein Nicken des Kanzlers hin ging der Gardist zu Wells’ Stuhl und zog ihn auf die Beine.
»Viel Glück«, sagte sein Vater in dem für ihn typischen kühlen Tonfall. »Wenn irgendjemand diese Mission zum Erfolg führen kann, dann du.«
Er streckte den Arm aus, um Wells die Hand zu schütteln, ließ ihn aber gleich wieder fallen – die Hände seines einzigen Sohnes waren nach wie vor hinter seinem Rücken gefesselt.
3
Bellamy
Natürlich verspätete sich der eingebildete Scheißkerl. Bellamy tippte ungeduldig mit dem Fuß und scherte sich nicht um das Echo, das durch den Lagerraum hallte. Niemand kam mehr hierher, alles von Wert war schon vor Jahren nach oben gebracht worden. Jeder Quadratzentimeter war mit Müll bedeckt: Maschinenersatzteile, von denen niemand mehr wusste, wozu sie überhaupt gut waren, Papiergeld, endlose Stapel Kabelrollen, Bildschirme mit zersprungenen Displays.
Bellamy spürte eine Hand auf seiner Schulter. Er wirbelte herum und duckte sich, die Fäuste vors Gesicht gehoben.
»Entspann dich, Kumpel«, sagte Colton und leuchtete ihm mit einer Taschenlampe direkt ins Gesicht. Er musterte Bellamy amüsiert. »Warum wolltest du mich ausgerechnet hier unten treffen?«, fragte er grinsend. »Hoffst du, auf einem der kaputten Computer alte Pornos zu finden? Ist nicht böse gemeint. Wenn ich wie du auf der Walden ein Mädchen am Hals hätte, würde ich wahrscheinlich auch ein paar seltsame Angewohnheiten entwickeln.«
Bellamy ignorierte die Stichelei. Sein ehemaliger Freund Colton mochte jetzt zur Garde gehören, aber ein Mädchen würde er trotzdem nie bekommen, egal auf welchem Schiff. »Sag mir einfach, was läuft, okay?«, erwiderte Bellamy bemüht freundlich.
Colton lehnte sich lächelnd gegen die Wand. »Lass dich von der Uniform nicht verwirren, Bruder. Ich habe die oberste Geschäftsregel nicht vergessen.« Er streckte die Hand aus. »Gib her.«
»Du bist hier der Verwirrte, Colt. Du weißt, ich liefere immer.« Er tätschelte die Tasche, in der er den Chip mit den gestohlenen Rationspunkten aufbewahrte. »Und jetzt sag mir, wo sie ist.«
Als Colton die Mundwinkel nach oben zog, spürte Bellamy unwillkürlich einen Druck auf der Brust. Seit Octavia verhaftet worden war, schmierte er Colt, damit er ihn auf dem Laufenden hielt, und der Idiot genoss es offenbar, schlechte Nachrichten zu überbringen.
»Sie werden heute losgeschickt.« Die Worte schlugen ein wie Fausthiebe. »Auf Deck G haben sie einen der alten Transporter wieder flugtauglich gemacht.« Wieder streckte er die Hand aus. »Jetzt gib schon her. Genug geplappert. Die Mission ist streng geheim, und ich riskiere hier meinen Arsch für dich.«
Bellamys Magen krampfte sich zusammen, als die Bilder vor seinem inneren Auge aufstiegen: seine kleine Schwester, die in einer fliegenden Metallkiste mit tausend Kilometern pro Stunde durchs All rast. Ihr Gesicht, das langsam blau anläuft, als sie versucht, die giftige Luft zu atmen. Ihr Körper, der am Boden liegt, reglos wie …
Bellamy machte einen Schritt auf Colt zu. »Tut mir leid, Mann.«
Coltons Blick wurde hart. »Was tut dir leid?«
»Das hier.« Bellamy holte aus und verpasste ihm einen Schlag direkt auf die Kinnspitze. Er hörte ein lautes Krachen, und sein Puls raste, als er sah, wie Colton zu Boden ging.
Dreißig Minuten später versuchte Bellamy die bizarre Szene zu begreifen, die sich vor seinen Augen abspielte. Er stand mit dem Rücken zur Wand in einem breiten Korridor und beobachtete, wie die grau gekleideten Verurteilten von einer Handvoll Wachen eine steile Rampe hinuntergeführt wurden. Am Ende der Rampe stand ein zylindrisches Gefährt mit schier endlosen Sitzreihen in seinem Frachtraum – der Transporter, der diesen ahnungslosen Haufen Kinder zur Erde bringen sollte.
Die ganze Sache war einfach nur krank, aber wahrscheinlich immer noch besser als die Alternative. An seinem achtzehnten Geburtstag bekam man zwar ein Wiederaufnahmeverfahren, aber seit dem letzten Jahr wurde praktisch jeder jugendliche Straftäter auch bei der zweiten Verhandlung für schuldig befunden. Gäbe es diese Mission nicht, würden sie immer noch in ihren Zellen sitzen und die Tage bis zu ihrer Hinrichtung zählen.
Als er eine zweite Rampe entdeckte, spürte Bellamy einen Stich im Herzen. Hoffentlich hatte er Octavia nicht schon verpasst. Doch eigentlich spielte es keine Rolle. Er musste nicht sehen, wie sie an Bord ging. Sie wären so oder so bald wieder vereint.
Er zupfte die Ärmel von Coltons Uniform zurecht. Sie passte denkbar schlecht, aber bis jetzt schien das niemandem aufgefallen zu sein. Alle hatten den Blick starr auf das Ende der Rampe gerichtet, wo Kanzler Jaha gerade das Wort an die Verurteilten richtete.
»Euch wurde die einmalige Gelegenheit gegeben, eure Vergangenheit hinter euch zu lassen«, sagte er. »Der Einsatz, zu dem ihr unterwegs seid, ist gefährlich, aber euer Mut soll belohnt werden. Wenn ihr Erfolg habt, sind all eure Vergehen vergessen, und ihr könnt auf der Erde ein neues Leben beginnen.«
Bellamy unterdrückte ein verächtliches Schnauben. Der Kanzler hatte vielleicht Nerven, sich hinzustellen und diesen Mist zu erzählen, den er sich wahrscheinlich nur ausgedacht hatte, damit er nachts überhaupt noch ruhig schlafen konnte.
»Wir werden eure Fortschritte genau verfolgen, damit wir für euer aller Sicherheit garantieren können«, fuhr der Kanzler fort, während weitere zehn Gefangene an ihm vorbeigeführt wurden. Der Gardist, der sie bewachte, salutierte zackig, schob die Gefangenen in den Transporter und stellte sich dann ins Spalier zu den anderen Wachen. Bellamy suchte die Menge nach Luke ab, dem einzigen Waldener, der nicht zu einem absoluten Arschloch geworden war, seit er sich der Garde angeschlossen hatte, konnte ihn aber nirgendwo entdecken. Insgesamt zählte er gerade einmal zehn Gardisten auf dem Startdeck. Offensichtlich legte der Rat in dieser Angelegenheit mehr Wert auf Geheimhaltung als auf Sicherheitsvorkehrungen.
Er unterdrückte den Impuls, ungeduldig mit dem Fuß zu wippen, während weitere Gefangene die Rampe hinuntergingen. Falls sie ihn erwischten, wäre die Liste seiner Vergehen endlos: Bestechung, Erpressung, Identitätsdiebstahl, Verschwörung und was sich der Rat sonst noch so einfallen ließ. Bellamy war bereits zwanzig. Für ihn würde es keinen Arrest geben. Innerhalb von vierundzwanzig Stunden nach seiner Verurteilung wäre er tot.
Am Ende des Korridors entdeckte er, halb verborgen unter einem dichten Schopf glänzend schwarzen Haares, ein vertrautes rotes Zopfband. Sein Herz setzte einen Schlag lang aus. Octavia.
Während der letzten zehn Monate hatte er sich die schlimmsten Sorgen gemacht. Bekam sie im Arrest genug zu essen? Gab es irgendetwas, womit sie sich halbwegs sinnvoll beschäftigen konnte, oder würde sie dort den Verstand verlieren? Der Arrest war für niemanden ein Spaß, aber für O musste er die Hölle sein.
Bellamy hatte seine jüngere Schwester praktisch allein großgezogen. Oder es zumindest versucht. Nach dem Unfall ihrer Mutter hatte der Rat die Fürsorge übernommen. Es gab keine Regeln für den Umgang mit verwaisten Geschwistern. Die strengen Bevölkerungsgesetze erlaubten jedem Paar nur ein Kind, manchmal auch gar keins. Deshalb hatte niemand in der gesamten Kolonie eine Ahnung, was es bedeutete, einen Bruder oder eine Schwester zu haben. Mehrere Jahre lang hatten die beiden in separaten Gemeinschaftsunterkünften gelebt, aber Bellamy hatte stets ein Auge auf Octavia gehabt, hatte auf »Spaziergängen« zu den zugangsbeschränkten Lagerräumen Extrarationen für sie besorgt und sich die älteren Mädchen vorgeknöpft, die sich einen Spaß daraus machten, auf dem pausbäckigen Waisenkind mit den großen blauen Augen herumzuhacken. Octavia war etwas Besonderes, und Bellamy tat alles, um ihr ein besseres Leben zu ermöglichen. Alles, um das wiedergutzumachen, was sie hatte ertragen müssen.
Als Octavia die Rampe erreichte, hätte Bellamy beinahe gelächelt. Während alle anderen wie in Trance auf den Transporter zustolperten, schlenderte sie gemütlich dahin und zwang die Wachen, ihren Schritt zu verlangsamen. Sie sah sogar besser aus als bei ihrer letzten Begegnung, doch das war nur logisch. Octavia hatte vier Jahre Arrest bekommen, an deren Ende ihre Hinrichtung wartete. Jetzt hatte sie die Chance auf ein neues Leben, und Bellamy würde dafür sorgen, dass sie dieses neue Leben auch bekam. Koste es, was es wolle. Dafür würde er sogar mit ihr auf die Erde kommen.
Die Stimme des Kanzlers dröhnte über die lärmenden Schritte und das nervöse Geflüster hinweg. Seine Haltung war immer noch die eines Soldaten, aber all die Jahre als Vorstand des Rats hatten seinem Auftreten zusätzlich den Schliff eines Politikers verliehen. »Niemand in der Kolonie weiß von eurer Mission, doch wenn sie erfolgreich verläuft, schuldet jeder Einzelne von uns euch sein Leben. Ich weiß, dass ihr euer Bestes geben werdet, um eurer selbst willen, für eure Familien und für jeden anderen auf diesem Schiff – für die gesamte Menschheit.«
Als Octavia ihren Bruder entdeckte, klappte ihr Kiefer nach unten. Bellamy spürte förmlich, wie sie versuchte, schlau aus dem zu werden, was sie da sah. Sie wussten beide, dass er nie und nimmer in die Garde berufen worden sein konnte, also musste er die Uniform gestohlen haben. Sie wollte ihm gerade etwas zuflüstern, da sprach der Kanzler weiter. Sie drehte zögerlich den Kopf weg, doch Bellamy sah die Anspannung in ihren Schultern.
Bellamys Puls beschleunigte sich, als der Kanzler seine Rede endlich beendete und den Wachen befahl, die letzten Passagiere an Bord zu bringen. Er musste den richtigen Moment abwarten. Wenn er zu früh losschlug, bestand die Gefahr, dass die Gardisten ihn doch noch überwältigten. Wartete er zu lang, würde Octavia allein zur vergifteten Erde fliegen, während er hier zurückblieb und die Konsequenzen dafür tragen musste, dass er den Startablauf unterbrochen hatte.
Schließlich war Octavia an der Reihe. Sie fing Bellamys Blick auf und schüttelte unmerklich den Kopf – eine Warnung an ihn, jetzt keine Dummheiten zu machen. Doch Bellamy hatte sein ganzes Leben lang nichts als Dummheiten gemacht, und er hatte nicht vor, jetzt damit aufzuhören.
Der Kanzler nickte einer Frau in schwarzer Uniform zu, die daraufhin an das Kontrollpult neben dem Transporter trat und mehrere Knöpfe drückte. Auf dem Schirm erschienen blinkende Ziffern. Der Startcountdown hatte begonnen.
Bellamy blieben noch drei Minuten, um durch die Schleuse zu kommen und sich über die Rampe einen Weg in den Transporter zu bahnen, wenn er seine Schwester nicht für immer verlieren wollte.
Als die Letzten an Bord waren, veränderte sich die Stimmung merklich. Die Wachen gleich neben Bellamy entspannten sich und begannen leise miteinander zu tuscheln, auf der gegenüberliegenden Rampe lachte jemand.
2:48 … 2:47 … 2:46 …
Bellamy wurde so wütend, dass er für einen Moment alle Anspannung vergaß. Wie konnten diese Arschlöcher lachen, während seine Schwester zusammen mit neunundneunzig anderen Kindern auf ein Selbstmordkommando geschickt wurde?
2:32 … 2:31 … 2:30 …
Die Frau am Kontrollpult flüsterte dem Kanzler lächelnd etwas zu, aber Jaha drehte sich mit versteinertem Gesichtsausdruck weg, ohne zu antworten.
Die Gardisten neben dem Transporter begannen, das Startdeck zu verlassen. Entweder hatten sie etwas Besseres vor, als zuzusehen, wie die Menschheit zum ersten Mal überhaupt versuchte, ihren Heimatplaneten zurückzuerobern, oder sie fürchteten, der alte Kasten von einem Raumschiff könnte explodieren, und brachten sich lieber rechtzeitig in Sicherheit.
2:14 … 2:13 … 2:12 …
Bellamy atmete tief durch. Es war so weit.
Er schob sich an den anderen vorbei und schlich sich von hinten an einen untersetzten Kerl heran, dessen Waffe ungesichert im Halfter steckte. Er packte den Griff, riss sie heraus und rannte die Rampe hinunter. Noch bevor irgendjemand begriff, was geschah, rammte er dem Kanzler den Ellbogen in die Magengrube, schlang ihm einen Arm um den Hals und nahm ihn in einen Würgegriff. Auf dem Startdeck erhob sich wildes Geschrei, und Schritte trampelten in Bellamys Richtung. Er hob die Waffe und presste Jaha den Lauf an die Schläfe. Er wollte auf keinen Fall abdrücken, aber wenn sein Plan gelingen sollte, mussten die Wachen glauben, dass er es ernst meinte.
1:12 … 1:11 … 1:10 …
»Alle zurück!«, brüllte Bellamy und verstärkte seinen Griff. Der Kanzler ächzte. Ein lautes Piepen ertönte, und die Ziffern auf dem Schirm blinkten nicht mehr grün, sondern rot. Nur noch weniger als eine Minute. Jetzt musste er lediglich abwarten, bis die Einstiegsluke des Transporters sich zu schließen begann. In genau diesem Moment würde er den Kanzler zur Seite stoßen und durch den Spalt an Bord springen. Keiner konnte ihn dann mehr aufhalten.
»Lasst mich auf den Transporter, oder ich schieße!«, schrie er.
Aller Lärm erstarb. Das einzige Geräusch war das Klicken, mit dem die Gardisten ihre Waffen entsicherten.
Noch dreißig Sekunden, dann war Bellamy entweder gemeinsam mit Octavia auf dem Weg zur Erde, oder seine Leiche wurde in einem Plastiksack zurück zur Walden gebracht.
4
Glass
Glass hatte gerade ihre Gurte festgezogen, als sie Schreie hörte. Vor der Einstiegsluke des Transporters umzingelten die Wachen zwei Gestalten. In dem hektischen Gewirr konnte sie kaum etwas erkennen, sah nicht mehr als einen Anzugärmel, einen Schopf grauen Haars und das Schimmern von Metall. Im nächsten Moment ging die eine Hälfte der Wachen in die Hocke und brachte die Gewehre in Anschlag. Nun hatte sie freie Sicht. Jemand hatte den Kanzler als Geisel genommen.
»Zurück!«, brüllte der Geiselnehmer mit zitternder Stimme. Er trug eine Uniform, gehörte aber eindeutig nicht zur Garde. Sein Haar war viel zu lang, die Jacke saß schlecht, und der eigenartige Griff, mit dem er die Pistole umklammert hielt, zeigte, dass er nie gelernt hatte, damit umzugehen.
Nichts passierte. »Ich sagte: zurück!«
Die Benommenheit, die sich während des langen Marsches von der Zelle zum Startdeck über sie gelegt hatte, löste sich auf wie ein Komet, der an der Sonne vorbeiflog und dabei einen Schweif aus Hoffnung hinter sich herzog. Glass gehörte nicht hierher. Sie konnte nicht so tun, als wäre sie unterwegs zu einem Abenteuer von historischer Bedeutung, wie der Kanzler es dargestellt hatte. Falls sie immer noch an Bord war, wenn der Transporter abhob, würde ihr Herz unweigerlich zerbrechen. Das ist meine Chance, schoss es ihr durch den Kopf.
Sie öffnete ihren Gurt und sprang auf die Füße. Ein paar der anderen bemerkten es, aber die meisten beobachteten mit offenen Mündern das Drama, das sich gerade vor der Einstiegsluke abspielte. Glass fuhr herum und rannte zur anderen Seite, wo eine zweite Einstiegsrampe hinunter zum Startdeck führte.
»Ich fliege mit!«, rief der Junge und ging rückwärts auf die Luke zu, den Kanzler im Schlepptau. »Ich bleibe bei meiner Schwester.«
Verblüfftes Schweigen senkte sich über das Deck. Schwester. Das Wort hallte in Glass’ Kopf wider, aber noch bevor sie die ganze Tragweite begriff, riss eine vertraute Stimme sie aus ihren Gedanken.
»Lass ihn los!«
Glass warf einen Blick über die Schulter und blieb wie angewurzelt stehen, als sie das Gesicht ihres besten Freundes erkannte. Natürlich hatte sie die lächerlichen Gerüchte gehört, Wells sei unter Arrest genommen worden, hatte aber kein Wort geglaubt. Doch jetzt, da sie mit eigenen Augen sah, wie er zitternd dasaß, die grauen Augen starr auf seinen Vater gerichtet, verstand sie es. Wells wollte bei Clarke sein. Er tat alles, um die zu schützen, die ihm am Herzen lagen. Vor allem Clarke.
Ein ohrenbetäubender Knall hallte über das Deck – ein Schuss? –, und in Glass’ Kopf legte sich ein Schalter um. Ohne nachzudenken, sprang sie durch die Luke und rannte die Zugangsrampe hinauf, so schnell sie konnte, den Blick stur geradeaus gerichtet.
Sie hatte genau den richtigen Moment erwischt. Die Wachen standen wie erstarrt da, als hätte der Schuss sie gelähmt. Doch dann sahen sie sie.
»Gefangene auf der Flucht!«, rief einer von ihnen, und alle Köpfe drehten sich in ihre Richtung. Der Ruf rüttelte die Reflexe wach, die den Gardisten während der Ausbildung antrainiert worden waren. Es spielte keine Rolle, dass Glass ein siebzehnjähriges Mädchen war. Sie waren darauf konditioniert, das wehende blonde Haar und die großen blauen Augen, die Glass auf den ersten Blick so liebenswert machten, gar nicht erst zu bemerken. Alles, was sie sahen, war eine flüchtige Verbrecherin.
Sie ignorierte das wilde Geschrei und preschte durch den Korridor zurück zur Phoenix. Ihr Herz schlug wie wild.
»Du! Bleib sofort stehen!«, rief eine der Wachen.
Glass hörte seine Schritte in ihrem Rücken und rannte weiter. Falls sie schnell genug war und das Glück, das sie ihr ganzes Leben lang im Stich gelassen hatte, doch noch in letzter Sekunde auf den Plan trat, würde sie Luke vielleicht noch einmal wiedersehen. Und vielleicht, nur vielleicht, würde er ihr verzeihen.
Keuchend stolperte sie einen Flur entlang, der von mehreren unbeschrifteten Türen gesäumt war. Ihre Sicht begann zu verschwimmen, dann knickte ihr rechtes Bein ein, und sie musste sich an der Wand abstützen. Glass drehte panisch den Kopf hin und her und sah undeutlich die Umrisse eines Lüftungsgitters in der Wand. Sie griff mit den Fingern durch die Stäbe und zog, aber der Rost rührte sich nicht. Mit einem Stöhnen mobilisierte sie alle Kraft und riss, bis das Gitter endlich nachgab und sie den engen, dunklen Schacht dahinter sehen konnte.
Glass stemmte sich hoch auf das schmale Sims und robbte hinein. Das Metall fühlte sich auf ihrer heißen Haut kühl an. Sie kroch ein Stück, drehte sich um und schloss das Gitter hinter sich. Dann lauschte sie angestrengt, ob sie verfolgt wurde, doch sie hörte keine Schreie mehr, keine Schritte, nur das verzweifelte Hämmern ihres Herzens.
Glass drehte den Kopf und spähte in die Dunkelheit, konnte aber nur die Rohrleitungen an der Tunnelwand erkennen. Alles war von einer dicken Staubschicht bedeckt. Das hier musste ein Teil des inzwischen stillgelegten Belüftungs- und Filtersystems sein. Glass hatte keine Ahnung, wo der Schacht hinführte, aber ihr blieb keine Wahl. Also kroch sie weiter.
Nach Stunden, so kam es ihr zumindest vor, als sie ihre Knie schon gar nicht mehr spürte und ihre Handflächen wie Feuer brannten, erreichte sie eine Gabelung. Falls ihre Orientierung sie nicht täuschte, führte die linke Abzweigung zurück zur Phoenix, während die andere parallel zur Verbindungsbrücke verlief und sie zur Walden bringen würde – und damit zu Luke.
Luke, der Junge, den sie liebte und den sie vor all diesen Monaten hatte im Stich lassen müssen. An den sie während jeder einzelnen Nacht im Arrest gedacht hatte, nach dessen Berührung sie sich so sehr gesehnt hatte, dass sie seine Umarmung beinahe spüren konnte.
Mit einem Seufzen wandte sie sich nach rechts, ohne zu wissen, ob der Schacht sie in die Freiheit führen würde oder in den sicheren Tod.
Zehn Minuten später hatte Glass das Ende erreicht und ließ sich lautlos zu Boden gleiten. Eine Wolke aus Staub folgte ihr, blieb an ihrer schweißnassen Haut kleben, und sie musste husten. Sie befand sich in einer Art Lagerraum. Nachdem sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, konnte sie Zeichnungen an den Wänden erkennen. Sie sahen aus wie Buchstaben. Glass ging darauf zu und weitete überrascht die Augen. Es waren Wörter, ganze Nachrichten, die jemand hier hineingeritzt hatte.
Ruhe in Frieden
In memoriam
Von den Sternen in den Himmel
Sie war auf dem Quarantänedeck, der ältesten Sektion auf der Walden. Als Atomkrieg und biologische Waffen die Erde verwüsteten, war denen, die das Glück gehabt hatten, die Stunde Null unbeschadet zu überstehen, nur noch die Flucht in den Weltraum geblieben. Einem Teil der infizierten Überlebenden war es gelungen, sich an Bord der Transportkapseln zu stehlen, doch als sie die Phoenix erreichten, wurde ihnen der Zugang verweigert. Stattdessen kamen sie auf die Walden. Zum Sterben. Selbst jetzt wurde jeder, der Anzeichen einer Krankheit zeigte, sofort unter Quarantäne gestellt und strikt vom Rest der Bevölkerung ferngehalten – von den letzten Überlebenden der Menschheit.
Zitternd eilte Glass zur Ausgangstür und betete, dass sie nicht zugerostet war. Zu ihrer endlosen Erleichterung ließ sie sich öffnen, und Glass rannte den dahinterliegenden Korridor hinunter. Noch im Laufen zog sie die schweißdurchtränkte Jacke aus. Nur mit einem weißen T-Shirt und den Gefängnishosen bekleidet sah sie aus wie eine Reinigungsarbeiterin. Glass betrachtete nervös das Armband an ihrem Handgelenk. Sie war nicht sicher, ob es auch hier auf den Schiffen aktiv oder nur darauf programmiert war, Daten von der Erde zu übermitteln. Egal, was von beidem zutraf, sie musste das Ding so schnell wie möglich loswerden. Selbst wenn sie die Flure mit den Retinascannern umging – mittlerweile hielt wahrscheinlich jeder Gardist in der gesamten Kolonie nach ihr Ausschau.
Glass hoffte, dass sie davon ausgingen, sie hätte sich auf der Phoenix versteckt. Niemand konnte damit rechnen, dass sie auf der Walden war. Sie erklomm die Haupttreppe, bis sie den Korridor erreichte, der zu Lukes Wohnkomplex führte. Auf dem Flur blieb sie noch einmal stehen und wischte sich die feuchten Hände an den Hosenbeinen ab. Plötzlich war sie sogar noch angespannter als auf dem Transporter.
Sie hatte keine Ahnung, wie Luke reagieren würde. Wie würde er sie empfangen, wenn sie neun Monate nach ihrem spurlosen Verschwinden plötzlich vor seiner Tür stand? Vielleicht würde er auch gar nichts sagen, sondern sie, während die Worte nur so aus ihr heraussprudelten, mit einem Kuss zum Verstummen bringen, ihr mit den Lippen zu verstehen geben, dass alles in Ordnung war. Dass er ihr verziehen hatte.
Glass blickte über die Schulter und schlüpfte durch die Tür. Sie glaubte nicht, dass jemand sie gesehen hatte, aber sie musste vorsichtig sein. Eine Verpartnerungs-Zeremonie vorzeitig zu verlassen war ein entsetzlicher Affront, aber sie konnte es einfach nicht mehr ertragen, neben Cassius zu sitzen. Sein stinkender Atem und das ständige Grapschen erinnerten sie an Carter, Lukes doppelzüngigen Mitbewohner, der sein wahres Gesicht nur dann zeigte, wenn Luke auf Patrouille war.
Glass ging hinauf zum Beobachtungsdeck und hob bei jedem Schritt sorgsam den Saum ihres Rocks an. Es war dumm gewesen, so viele Rationspunkte für dieses Stück silberfarbenen Stoffs zu verschwenden, den sie in mühsamer Handarbeit zu einem Trägerkleid umgearbeitet hatte. Luke war nicht einmal hier, um sie darin zu sehen.
Sie hasste es, den Abend mit anderen Jungs zu verbringen. Aber ihre Mutter wusste nichts von Luke und weigerte sich strikt, Glass ohne männliche Begleitung ausgehen zu lassen. Sie verstand einfach nicht, warum Glass sich nicht Wells Jaha geschnappt hatte, wie sie es ausdrückte. Glass konnte ihr so oft erklären, wie sie wollte, dass sie nicht in ihn verliebt war. Ihre Mutter seufzte jedes Mal nur und murmelte, was für eine Schande es doch sei, Wells dieser schlecht gekleideten Möchtegern-Ärztin zu überlassen. Dabei war Glass froh, dass Wells sich in die wunderschöne, wenn auch etwas ernste Clarke Griffin verliebt hatte. Liebend gerne hätte sie ihrer Mutter die Wahrheit gesagt: dass auch sie verliebt war, und zwar in einen hübschen und klugen jungen Mann, der sie nur leider nie zu einem Konzert oder einer Verpartnerungs-Zeremonie begleiten konnte.
»Darf ich um diesen Tanz bitten?«
Glass fuhr erschrocken herum. Als sie die braunen Augen direkt hinter ihr erkannte, trat ein strahlendes Lächeln auf ihr Gesicht. »Was tust du hier?«, flüsterte sie und hoffte, dass niemand sie beobachtete.
»Ich kann dich doch nicht einfach mit diesen schnöseligen Phoenix-Jungsalleine lassen.« Luke machte einen Schritt zurück und bewunderte Glass’ Kleid. »Nicht, wenn du so aussiehst.«
»Weißt du, wie viel Ärger du kriegst, wenn sie dich erwischen?«
»Da müssen sie schon früher aufstehen.« Die Musik von unten wurde lauter. Luke schlang die Arme um ihre Hüfte und wirbelte sie durch die Luft.
»Lass mich runter«, flüsterte Glass lachend und schlug ihm sanft auf die Schulter.
»Ist das etwa die Art einer jungen Dame, sich bei einem glühenden Verehrer zu bedanken?«, fragte er und imitierte dabei diesen schrecklichen Phoenix-Akzent.
»Komm schon«, sagte sie kichernd und nahm seine Hand. »Du darfst gar nicht hier sein.«
Luke rührte sich nicht von der Stelle und zog sie an sich. »Wo immer du bist, ist der Ort, wo auch ich sein muss.«
»Es ist zu gefährlich«, erwiderte sie leise und kuschelte sich an ihn.
Luke grinste. »Dann sorgen wir wenigstens dafür, dass es sich lohnt.« Er umfasste ihren Hinterkopf und zog sie an sich, bis ihre Lippen sich berührten.
Glass hob die Hand und klopfte ein zweites Mal. Als endlich die Tür aufging, blieb ihr das Herz stehen.
Da stand er, das dunkelblonde Haar und die tiefbraunen Augen genau so, wie Glass sie in Erinnerung hatte. Genau so, wie sie sie Nacht für Nacht in der Arrestzelle vor sich gesehen hatte. Er schaute sie verdutzt an.
»Luke«, keuchte sie, und beinahe wären all die aufgestauten Gefühle der letzten neun Monate aus ihr herausgebrochen. Sie musste ihm unbedingt erzählen, was passiert war, warum sie mit ihm Schluss gemacht hatte und dann spurlos verschwunden war. Dass sie jede Minute dieses neun Monate langen Albtraums an ihn gedacht hatte. Dass sie nie aufgehört hatte, ihn zu lieben.
»Luke«, sagte sie noch einmal, und eine Träne kullerte über ihre Wange. Nach den unzähligen Malen, die sie in ihrer Zelle auf die Knie gesunken war und schluchzend seinen Namen geflüstert hatte, war es beinahe unwirklich, ihm endlich gegenüberzustehen. Doch noch bevor sie auch nur einen der Sätze aussprechen konnte, die ihr durch den Kopf schossen, tauchte eine zweite Gestalt im Türrahmen auf, ein Mädchen mit gewelltem rotem Haar.
»Glass?«
Glass versuchte zu lächeln. Luke und Camille kannten einander schon, seit sie Kinder waren, sie war seine Freundin gewesen, so wie Glass Wells’ Freundin gewesen war. Doch jetzt stand sie hier, in Lukes Wohnung. Natürlich, dachte Glass verbittert. Sie hatte sich schon immer gefragt, ob nicht mehr zwischen den beiden war, als Luke zugab.
»Möchtest du nicht reinkommen?«, fragte Camille übertrieben freundlich. Beiläufig schlang sie die Finger um Lukes Hand, doch für Glass fühlte es sich an, als würde Camille ihr das Herz zerquetschen. Während sie sich so sehr nach Luke verzehrt hatte, dass es ihr beinahe körperliche Schmerzen bereitete, hatte er sich eine Neue gesucht.
»Nein … nein, schon gut«, erwiderte Glass heiser. Selbst wenn sie die richtigen Worte fand, war es unmöglich, Luke hier und jetzt die Wahrheit zu sagen. Die beiden zusammen zu sehen ließ das Risiko, das sie eingegangen war, geradezu lächerlich erscheinen. Sie hatte es tatsächlich geschafft herzukommen, nur um dann herauszufinden, dass er jetzt mit einer anderen zusammen war. »Ich wollte nur kurz Hallo sagen.«
»Du wolltest Hallo sagen?«, wiederholte Luke. »Nachdem du fast ein Jahr lang alle meine Nachrichten ignoriert hast, schaust du einfach so vorbei?« Er versuchte nicht einmal, seine Wut zu verbergen.
Camille ließ seine Hand los. Ihr Lächeln verzog sich zu einer Grimasse.
»Ich weiß. Es … es tut mir leid. Ich lasse euch beide wohl besser allein.«
»Was ist eigentlich mit dir los?«, fragte Luke und warf Camille einen Blick zu, bei dem Glass nur noch einsamer ums Herz wurde, der ihr in aller Deutlichkeit sagte, wie dumm sie die ganze Zeit über gewesen war.
»Nichts«, sagte sie hastig und versuchte vergeblich, das Beben in ihrer Stimme zu unterdrücken. »Ich erzähl’s dir … Ich erzähl’s dir, wenn …« Glass biss sich auf die Zunge und kämpfte mit aller Macht den Wunsch nieder, unter allen Umständen in seiner Nähe zu bleiben. Gerade als sie sich zum Gehen wandte, sah sie einen Gardisten in ihre Richtung kommen. Sie hielt die Luft an und drehte das Gesicht wieder Luke zu, während der Gardist an ihnen vorbeiging, ohne Notiz von ihr zu nehmen.
Luke erwiderte ihren Blick nicht. Er starrte wie durch sie hindurch, während er die Nachricht auf seinem Netzhauttransmitter las. Als er dann auch noch die Lippen zusammenpresste, kam Glass der entsetzliche Gedanke, dass es darin nur um sie gehen konnte. Lukes Augen wurden immer größer – erst vor Überraschung, dann vor Entsetzen. »Glass«, krächzte er schließlich. »Du wurdest verhaftet.«
Sie nickte.
Er schaute ihr einen Moment lang direkt in die Augen, dann legte er ihr seufzend eine Hand auf die Schulter. Sie spürte seine Finger durch den dünnen T-Shirt-Stoff, und trotz aller Anspannung genoss sie die Berührung zutiefst. »Komm«, sagte er und zog sie nach drinnen.
Glass stolperte in die Wohnung, während Camille mit säuerlichem Gesicht zur Seite trat und Luke eilig die Tür hinter ihr zuzog. Der kleine Wohnbereich war dunkel – Luke und Camille hatten das Licht ausgemacht. Glass versuchte, die offensichtliche Schlussfolgerung zu ignorieren, während sie beobachtete, wie Camille es sich auf dem Armsessel bequem machte, den Lukes Urgroßmutter auf der Tauschbörse entdeckt hatte. Glass trat unsicher von einem Fuß auf den anderen, wusste nicht, ob sie sich setzen sollte. Es war schlimm genug, ein entflohener Sträfling zu sein, aber hier als Lukes Ex-Freundin zu stehen war schlimmer. Im Arrest hatte Glass genug Zeit gehabt, sich mit ihrem Strafregister zu arrangieren – doch an die Möglichkeit, sich in Lukes Wohnung wie eine Fremde vorzukommen, hatte sie nie auch nur einen einzigen Gedanken verschwendet.
»Wie bist du entkommen?«, fragte er.
Glass schwieg. Sie hatte so viel Zeit damit verbracht, sich auszumalen, was sie sagen würde, falls sie je die Chance bekam, Luke noch einmal wiederzusehen. Doch jetzt, als es endlich so weit war, kamen ihr die vorbereiteten Worte hohl und egoistisch vor. Es ging ihm gut, das war überdeutlich. Warum sollte Glass ihm die Wahrheit sagen, außer um ihn zurückzugewinnen, damit sie nicht mehr so einsam war? Also erzählte sie nur mit zitternder Stimme von den hundert Delinquenten und ihrem geheimen Auftrag, von der Geiselnahme und ihrer Flucht.
»Ich verstehe es immer noch nicht«, sagte Luke und warf Camille, die es aufgegeben hatte, so zu tun, als würde sie nicht zuhören, einen kurzen Blick zu. »Warum bist du überhaupt verhaftet worden?«
Glass schaute weg und suchte fieberhaft nach irgendeiner Ausrede. Die Wahrheit konnte sie ihm unmöglich sagen, jetzt, da er eine andere hatte und es so offensichtlich war, dass er nicht mehr dasselbe empfand wie sie.
»Ich kann nicht darüber sprechen«, erwiderte sie leise. »Du würdest es nicht …«
»Schon gut«, schnitt er ihr das Wort ab. »Ich weiß, ich verstehe ja so vieles nicht.«
Einen kurzen Moment lang wünschte Glass, sie wäre bei Clarke und Wells auf dem Transporter geblieben. Obwohl sie direkt vor dem Jungen stand, den sie liebte, hätte sie sich auf der verlassenen Erde wohl kaum einsamer fühlen können als jetzt.
5
Clarke
Einige Minuten lang waren die Gefangenen derart erschüttert wegen des Schusses, dass ihnen gar nicht bewusst wurde, was sie gerade taten, nämlich als erste Menschen seit fast dreihundert Jahren die Kolonie zu verlassen. Der falsche Gardist hatte zwar bekommen, was er wollte. Als die Einstiegsrampe sich schloss, hatte er den reglosen Körper des Kanzlers von sich gestoßen und war auf einen der leeren Sitze zugetaumelt. Aber der geschockte Ausdruck in seinem blassen Gesicht sagte Clarke, dass Blutvergießen keinesfalls Teil seines Plans gewesen war.
Für sie war der Zwischenfall mit dem Kanzler allerdings weit weniger aufwühlend als das, was sie nur Sekunden vor dem Schuss entdeckt hatte: Wells war an Bord.
Als sie ihn in der Tür erblickte, hatte sie geglaubt, es sei eine Halluzination. Dass sie in der Einzelhaft den Verstand verloren hatte, schien ihr weit wahrscheinlicher als die Möglichkeit, dass Jahas Sohn tatsächlich unter Arrest gestellt worden war. Als einen Monat nach ihrer eigenen Verurteilung Wells’ beste Freundin, Glass, in die Nachbarzelle gebracht worden war, war das schockierend genug gewesen. Und jetzt auch noch Wells? Vollkommen ausgeschlossen. Trotzdem war er hier. Clarke hatte mit eigenen Augen gesehen, wie er zuerst aufgesprungen und dann, nachdem einer der echten Gardisten seine Waffe abgefeuert hatte, verstört in sich zusammengesunken war, während der falsche, mit dem Blut seines Vaters bespritzt, in den Transporter flüchtete. Den Bruchteil einer Sekunde lang hatte sie sogar den Drang verspürt, Wells zu trösten, aber etwas, das noch stärker war als die Gurte, die sie im Sitz festhielten, ließ sie innehalten. Wells war schuld am Tod ihrer Eltern. Egal wie groß sein Schmerz auch sein mochte, er hatte ihn verdient.
»Clarke!«
Sie blickte auf und sah, wie Thalia den Kopf so weit herumdrehte, wie sie nur irgend konnte, und Clarke von ein paar Sitzreihen weiter vorne aus angrinste. Ihre ehemalige Zellengenossin war die Einzige an Bord, die den falschen Gardisten nicht anstarrte. Trotz der grauenvollen Lage, in der sie sich alle befanden, konnte Clarke gar nicht anders, als das Lächeln zu erwidern. Thalias gute Laune war einfach ansteckend. Selbst während der ersten Tage nach der Hinrichtung ihrer Eltern, als Clarke beinahe umkam vor Trauer, hatte Thalia sie oft zum Lachen gebracht, indem sie einen der Gardisten nachahmte, der mehr schlecht als recht versuchte, den Mädchen zu imponieren.
»Ist er das?«, fragte Thalia mit stummen Lippenbewegungen und deutete mit dem Kinn in Wells’ Richtung. Sie war die Einzige, die über alles Bescheid wusste. Nicht nur über Clarkes Eltern, sondern auch über das schreckliche Verbrechen, das Clarke begangen hatte.
Clarke fand die Situation denkbar unpassend und schüttelte den Kopf, aber Thalia ließ nicht locker. Doch genau in dem Moment, als Clarke ihr sagen wollte, sie solle den Mund halten, brüllten die Triebwerke los und verschluckten jedes weitere Wort. Es war tatsächlich passiert: Nach mehreren Jahrhunderten hatten sie als erste Menschen die Kolonie verlassen und waren auf dem Weg zur Erde. Clarke musterte die anderen Passagiere, die alle genauso ergriffen schwiegen wie sie selbst. Es war beinahe, als wollten sie die Welt, die sie soeben hinter sich gelassen hatten, mit einer spontanen Gedenkminute ehren.