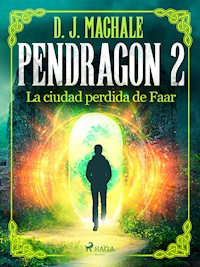9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Bibliothek der Geister-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Notruf aus der Geisterbibliothek
Während Marcus mit seinen Eltern beim Abendessen sitzt, wird der magische Schlüssel, den er an einem Lederband um den Hals trägt, plötzlich unglaublich heiß. Will ihm der Bibliothekar aus der »Bibliothek der Geister« eine Botschaft übermitteln? Tatsächlich: Everett wartet bereits ungeduldig auf Marcus, denn er soll eine Geschichte, die in der Gegenwart spielt, zu einem guten Ende bringen. Unter großem Zeitdruck muss Marcus herausfinden, wer oder was hinter den Unglücksfällen an der Coppel Mittelschule steckt – bevor Menschen zu Schaden kommen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 334
Ähnliche
D. J. MacHale
Der schwarze Mond
Aus dem Amerikanischen
von Bettina Obrecht
Starken Zauber eingemischt,
Höllenbrei im Kessel zischt.
Doppelt plagt euch, mengt und mischt!
Kessel brodelt, Feuer zischt.
aus William Shakespeare: Macbeth
Vorwort
Du bist also zurückgekommen? Na, das ist ja sehr tapfer. Das gefällt mir. Nicht nur, weil du meine Bücher offensichtlich magst, sondern weil du eindeutig ein bisschen merkwürdig bist. Versteh das bitte als Kompliment. Ich mag merkwürdige Menschen. Ich kann zwar nicht erklären, warum ich so gerne Geschichten über Übernatürliches schreibe und warum ich diese Art von Geschichten gerne lese.
Ich wette, du kannst auch nicht erklären, warum du so etwas gerne liest. Warum fühlen wir uns von Gruselgeschichten magisch angezogen? Kriegen wir gerne Herzklopfen, wenn die Helden unserer Geschichten sich in immer größere Gefahr begeben? Macht es Spaß, sich vorzustellen, welche scheußliche Gestalt sich in den Schatten verstecken könnte? Oder liegt der Reiz darin, dass wir die Puzzleteile eines gefährlichen Rätsels zusammenfügen müssen? Vielleicht genießen wir es auch, dass uns die ganze Zeit klar ist: Ganz egal, wie grauenhaft die Ereignisse sind, wir können das Buch jederzeit zuklappen und alles ist vorbei.
Es sei denn, die Schatten haben beschlossen, uns in unsere Träume zu verfolgen. Ich glaube, die Antworten auf all diese Fragen lauten: Ja.
Alle diese Erklärungen treffen zu. Jeder Mensch besitzt eine lebhafte Fantasie. Ich schreibe jetzt schon seit sehr langer Zeit Gruselgeschichten, und wenn ich eines gelernt habe, dann das: Am besten kommen sie bei jenen Lesern an, die es schaffen, ihr logisches Denken mal einen Moment lang abzuschalten, und die bereit sind, sich alles Mögliche und Unmögliche vorzustellen.
Und jede Menge solcher Geschichten befinden sich in der Bibliothek der Geister. Everett, der Bibliothekar, sagt in Der magische Schlüssel: »In dieser Welt wirken Kräfte, über die wir kaum etwas wissen. Ständig geschehen Dinge, welche die Gesetze der Naturwissenschaft infrage stellen. Merkwürdige Dinge. Unlogisches. Unerklärliche Phänomene.«
Ob das für das wirkliche Leben auch zutrifft, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber eines ist sicher: Sobald du die Große Bibliothek betrittst, befindest du dich in einer Welt, auf die das hundertprozentig zutrifft. Deswegen bist du ja zurückgekommen.
Wie immer möchte ich mich bei einigen Menschen bedanken, die dafür verantwortlich sind, dass dieses Buch nun vor dir liegt. Wir Autoren haben eine großartige Verbindung zu unseren Lesern. Wir schreiben etwas und ihr lest es später. Das ist eine direkte Linie, aber an dieser Linie arbeiten Hunderte von Menschen, ohne die es unsere wunderbare Verbindung gar nicht geben könnte.
Die meisten dieser Leute arbeiten bei Random House Children’s Books, angefangen mit dem Lektoratsteam: Diane Landolf, Michelle Nagler und Mallory Loehr. Zu diesem talentierten Trio kommen Werbeleute, Illustratoren, Verkäufer, Marketingleute, Journalisten und viele Menschen, die sie bei ihrer Arbeit unterstützen. Und danach machen sich dann die Lieferanten und Buchhändler, Bibliothekare und Lehrer, Leute auf Buchmessen und Lesefestivals an die Arbeit. Alle sorgen gemeinsam dafür, dass meine Worte bei euch ankommen.
Und aus meinem engeren Umfeld möchte ich Richard Curton und Peter Nelson erwähnen, meinen wunderbaren Agenten und meinen Anwalt. Ich habe eine großartige Familie, die es mir ermöglicht, einem Beruf nachzugehen, der an sich schon ein bisschen unheimlich und übernatürlich ist. Ich habe einen Hund, der mir Gesellschaft leistet, sich auf meine Füße legt, wenn ich schreibe, und als Gegenleistung nur ab und zu einen Spaziergang und ein Leckerli erwartet.
Bei dieser Aufzählung habe ich nur an der Oberfläche gekratzt, aber ihr könnt sicher sein, dass jede der erwähnten Personen eine wichtige Rolle bei der Erstellung dieses Buches gespielt hat. Wenn du also heute Nacht Albträume bekommst, schieb die Schuld bitte auch ein bisschen auf sie, ja?
Also gut, uns bleibt keine Zeit mehr. Der Paradoxschlüssel wird schon wärmer. Die magische Bibliothek ruft. Wer weiß, was dich hinter dieser Tür erwartet? Na ja, ich weiß es. Und bald … weißt es auch du.
Steck den Schlüssel ins Schloss, drehe ihn um. Spürst du, wie der Riegel mit einem lauten Klack aufspringt? Jetzt mach die Tür ganz auf. Wir sind wieder da. Ich wünsche viel Spaß … und angenehme Träume.
D. J. MacHale, 2017
Prolog
EINE WEITERFÜHRENDE SCHULE ist eigentlich kein gefährlicher Ort. Normalerweise jedenfalls nicht. Aber an den unheimlichen Ereignissen, die an der Coppell Middle School passierten, war nichts normal. Das erste Schulhalbjahr hatte so angefangen wie jedes andere, aber es dauerte nicht lang, da geschahen Dinge, die kein Schüler je wieder vergessen würde. Obwohl die meisten sie sicherlich gerne vergessen hätten.
Manche waren der Ansicht, die Schule sei verflucht. Andere hielten das Ganze nur für eine Pechsträhne. Niemand konnte jedoch bestreiten, dass eine unheilvolle schwarze Wolke über der Schule aufgezogen war, eine Wolke, die eine unbegreifliche Serie von Unglücksfällen auslöste. Niemand wusste, warum das geschah, wann diese Phase wieder enden würde … und ob sie überhaupt wieder enden würde.
An dem Tag, an dem das erste Basketballspiel dieser Saison stattfinden sollte, gab es vorher eine Show-Veranstaltung, um das Basketballteam der Schule zu motivieren. Auf der Tribüne in der Sporthalle saßen dicht gedrängt Hunderte aufgeputschter Schüler, die ihr Basketballteam anfeuern wollten. Ein Teil der Tribüne war von der Schulband besetzt. Im dröhnenden Rhythmus des Schlagzeugs gingen die Blechbläser vollkommen unter, die Holzbläser hatten überhaupt keine Chance. Aber niemand beschwerte sich. Es war ja sowieso keine besonders gute Band.
Die Lehrer saßen auf der untersten Bank der Tribüne. Eigentlich hätten sie sich zwischen die Schüler setzen sollen, um für Ruhe zu sorgen, aber da der einzige Sinn einer »Pep Rally« darin bestand, möglichst viel Lärm zu machen, griffen sie nicht ein.
Das Motivationsteam hatte gegenüber der Band Stellung bezogen. Es gab Jubelrufe, die mit dem, was die Band da gerade spielte, nicht das Geringste zu tun hatten. Cheerleader bewegten sich Rad schlagend und mit Flickflack-sprüngen über den Boden der Turnhalle. Jedes Mal, wenn eine von ihnen auf den Füßen landete, kreischten alle Schüler aus vollem Hals. Wenn eine Cheerleaderin einen Fehler machte und auf dem Hintern landete, schrien die Zuschauer noch lauter. Sie schrien, wenn das Motivationsteam mit Papierbändern wedelte und wenn der Bandleader seinen Stab schwang. Im Grunde genommen schrien sie die ganze Zeit.
Es war ein nur halbwegs organisiertes Chaos, und dabei war das Basketballteam noch gar nicht aufgetaucht. An der Spitze des Durcheinanders stand die Jahrgangssprecherin der 8. Klassen, Ainsley Murcer. Sie befand sich auf der anderen Seite der Turnhalle, gegenüber der Tribüne. An ihrer Seite stand der Lehrer für audiovisuelle Medien, der das Mischpult bediente. Ainsley hatte das Spektakel eigentlich minutiös durchgeplant und für die ganze Show eine genaue Choreografie erstellt, um einen möglichst dramatischen Effekt zu erzielen. Die Band sollte ein Lied spielen, die Show dann an das Motivationsteam übergeben, das ordentlich jubeln würde. Dann sollten die Cheerleader das Publikum mit ihrer gewagten Akrobatik begeistern. Und schließlich würden sie dem Schuldirektor die Bühne überlassen, damit er seine Rede halten konnte. Auf dem Höhepunkt der Veranstaltung sollte die Band die Schulhymne spielen und das Basketballteam einziehen.
In Ainsleys Vorstellung würde alles wie am Schnürchen funktionieren. Allerdings entpuppte sich das Ganze jetzt eher als Chaos, weil alle Programmpunkte gleichzeitig abliefen.
»Die Band sollte jetzt noch nicht spielen!«, beschwerte sich Ainsley beim Lehrer am Mischpult. »Keiner kann das Motivationsteam hören und die Cheerleader machen einfach, was ihnen gefällt, nur um anzugeben.«
Der Lehrer bedachte sie mit einem mitfühlenden Blick und zuckte mit den Schultern. Sie hatten die Veranstaltung nicht mehr in der Hand.
»Wann ist meine Rede dran?«, rief Mr Jackson, der Schulleiter, Ainsley zu.
»Gleich!«, antwortete Ainsley. Sie versuchte zu klingen, als habe sie alles unter Kontrolle. Sie hatte dem Schulleiter diese Veranstaltung vorgeschlagen, und nun drohte alles im Chaos zu enden. Sie drückte ihm ein Mikrofon in die Hand und sagte: »Ich gebe Ihnen ein Zeichen.«
»Soll ich für Ruhe sorgen?«, fragte Mr Jackson.
»Nein!«, wehrte sich Ainsley energisch. »Ich schaffe das schon. Ich sorge dafür, dass die Band aufhört zu spielen, damit das Motivationsteam loslegen kann.«
Ainsley war fest entschlossen, die Veranstaltung wieder in den Griff zu bekommen. Als sie in Richtung Tribüne rannte, kam sie an einer Gruppe von Jungs vorbei, die mit gelangweilten Mienen an der Wand lehnten. Sie sahen eigentlich aus, als wären sie viel zu cool, um an einer Pep Rally teilzunehmen.
»Wie läuft’s denn so, Mercer?«, rief einer der Jungs Ainsley zu. Es war Nate Christmas, der Anführer der Clique. Er freute sich, dass der perfekte Plan der Jahrgangssprecherin so gar nicht aufging.
»Super!«, rief Ainsley ihm im Vorbeirennen fröhlich zu. »Könnte nicht besser sein!«
Nate und seine Freunde grölten, dann gab er ihnen ein Zeichen und sie folgten ihm aus der Halle.
Als Ainsley sich der Band näherte, entdeckte sie ein Mädchen, das in halber Höhe auf der Tribüne saß. Sie wurde von einer Gruppe völlig ausgeflippter Schüler, die sie offenbar nicht einmal bemerkt hatten, an die Wand gedrückt. Sie stach aus der Gruppe hervor, weil sie als Einzige weder schrie noch jubelte und insgesamt nicht so wirkte, als hätte sie auch nur das kleinste Quäntchen Spaß. Das Mädchen hieß Kayla Eggers, und am gequälten Ausdruck auf ihrem Gesicht war zu sehen, dass sie sich ganz weit weg wünschte.
Ainsley begegnete Kaylas Blick und nickte ihr zu, als wollte sie sich entschuldigen. Kayla reagierte nicht darauf, sondern sank noch mehr in sich zusammen.
Ainsley hatte inzwischen den Bandleader erreicht. »Hört jetzt auf mit dem Lied!«, rief sie.
»Was sagst du?«, schrie der Bandleader zurück.
»Hört auf! Ihr sollt noch gar nicht spielen!«
»Danke!«, schrie der Bandleader. »Wir spielen noch eins, wenn du willst.«
»Nein! Hört auf!«
Ainsley wandte sich um, rannte zurück in Richtung Mischpult und kollidierte auf halber Strecke mit einer Cheerleaderin. Die beiden purzelten in einem Gewirr von Armen und Beinen auf den Boden und ernteten lautes Gelächter von der Tribüne.
»Was machst du denn?«, brüllte die Cheerleaderin wütend. »Geh aus dem Weg!«
»Tut mir leid, tut mir echt leid«, sagte Ainsley und half dem Mädchen auf die Füße.
Die Cheerleaderin riss sich unwirsch los, setzte ein künstliches Lächeln auf und stolperte weiter. Ainsley raste zurück zum Mischpult. Mr Jackson erwartete sie geduldig.
»Moment, ich sorge jetzt mal für Ruhe!«, rief er ihr über den Lärm hinweg zu.
»Nein! Das ist meine Show!«, schnauzte Ainsley ihn an.
Mr Jackson runzelte die Stirn. Er war es nicht gewöhnt, dass eine Schülerin so mit ihm redete.
»Entschuldigung.« Ainsley versuchte, sich wieder in den Griff zu bekommen. »Ich bin nur ein bisschen … im Stress.«
»Ja, das ist mir nicht entgangen«, erwiderte Mr Jackson.
Ohrenbetäubender Jubel brandete auf. Die Basketballmannschaft war eingetroffen. Die Spieler trabten einer nach dem anderen zwischen den beiden Tribünen herein und rannten auf das Spielfeld. Das Gejohle der Menge sprengte beinahe die Halle. Endlich verstummte die Band. Es hörte ja sowieso keiner zu.
Die Spieler umrundeten das Spielfeld, dribbelten ihre Basketbälle und spielten sie einander zu. Der Boden vibrierte unter den aufprallenden Bällen. Diese zusätzliche Vibration ließ den Lärmpegel erneut durch die Decke gehen.
»Wann soll ich meine Rede halten?«, rief Mr Jackson Ainsley zu.
»Eigentlich sollten Sie reden, bevor die Mannschaft einläuft«, blaffte Ainsley frustriert. »Warum läuft denn alles schief? Das ist eine Katastrophe!«
»Wenigstens kann es nicht mehr schlimmer werden«, sagte der Lehrer am Mischpult. Doch da täuschte er sich.
Bamm. Bamm. Bamm.
Mehrere kleinere Explosionen zerrissen die Luft. Die Schüler erschraken und schrien überrascht auf. Jemand hatte unter der Tribüne einige Knallfrösche gezündet … genau unter der Stelle, an der Kayla Eggers saß.
Es knallte und krachte und Kayla drückte sich noch dichter an die Wand. Die Kinder um sie herum sprangen auf, schubsten einander aus dem Weg und flüchteten. Die Knallgeräusche dauerten nur ein paar Sekunden, aber der Schaden war nicht mehr gutzumachen. Das Johlen der Menge und das Geräusch der prellenden Basketbälle war verstummt. Jetzt saß Kayla ganz allein direkt über der Stelle, an der das Chaos ausgebrochen war. Rauch waberte unter ihrem Sitz hervor. Sie kauerte sich an die Backsteinmauer und war vor Angst wie gelähmt. Sie weinte leise vor sich hin.
Hunderte von Menschen sahen stumm in ihre Richtung. Einen Moment lang geschah nichts. Aber während alle anderen ihre Aufmerksamkeit auf Kayla konzentrierten, erspähte Ainsley an einer anderen Stelle eine Bewegung. Unter der Tribüne kroch eine Gestalt hervor: Nate Christmas.
Das war zu viel. Wut und Enttäuschung brachen aus Ainsley heraus. Sie riss Mr Jackson das Mikrofon aus der Hand und drückte auf den Einschaltknopf. Zuerst entstand eine durchdringend kreischende Rückkopplung, dann war sie Herrin der Lage.
»Ich sehe dich, Nate Christmas.«
Ihre wütende Stimme drang durch Hallenlautsprecher und hallte durch die ansonsten stille Sporthalle. Jetzt richteten alle ihre Aufmerksamkeit auf Ainsley. Und in diesem Moment geschah es: Der Abschnitt der Tribüne, auf dem Kayla saß, begann leise zu zittern. Es war, als hätte ein Erdbeben die Turnhalle erfasst. Aber die Einzigen, die es spürten, waren jene, die sich noch auf der Tribüne befanden. Die Schüler brachen in Panik aus, schubsten und drängelten einander von den Sitzreihen. Nur Kayla war so verwirrt und verängstigt, dass sie sich nicht regte. Die Schüler stolperten auf ihrer kopflosen Flucht übereinander.
»Kayla!«, schrie Ainsley.
Mit dem markerschütternden Kreischen von berstendem Metall löste sich ein Abschnitt der Tribüne von der Wand und fiel wie ein riesiges Akkordeon in sich zusammen. Schüler schrien entsetzt auf, als die schwere Konstruktion sich verdrehte und in ihre Einzelteile auflöste, sodass viele sich gerade noch mit einem Sprung in Sicherheit bringen konnten. Innerhalb weniger Sekunden war vom gesamten Tribünenabschnitt nur noch verbogenes Metall und zersplittertes Holz übrig. Einen Moment lang waren alle wie versteinert, starrten ungläubig auf die Trümmer. Mr Jackson und ein paar Lehrern gelang es zuerst, den Bann zu brechen und zu reagieren. Während die Schüler in Richtung Ausgang strömten, rannten die Erwachsenen direkt auf die zerstörte Tribüne zu und halfen den Schülern, sich in Sicherheit zu bringen.
Wie durch ein Wunder war niemand ernsthaft verletzt worden. Viele hatten Kratzer und blaue Flecken davongetragen. Ein Schüler hatte sich den Fuß gebrochen, aber keine Verletzung war lebensgefährlich.
Als sich der Staub allmählich gelegt hatte, befand sich nur noch eine Schülerin auf dem Berg aus Holz und Stahl, der eben noch eine Tribüne gewesen war. Kayla lag auf dem Trümmerhaufen, hatte ihr Gesicht in den Armen vergraben und schluchzte.
Ainsley stand mitten in der Turnhalle, sah mit großen Augen auf die Zerstörung und das verzweifelte Mädchen, das sich nicht mehr rühren konnte.
Ein junger Lehrer, Mr Martin, kletterte über die Trümmer, half Kayla hoch und trug sie aus der Gefahrenzone.
»Alles klar bei dir?«, fragte er.
Kayla schniefte und nickte.
Er setzte sie sanft auf die Füße und eine Lehrerin, Miss Tomac, legte ihren Arm um das Mädchen und führte sie aus der Halle, wischte ihr dabei sanft die Tränen aus dem Gesicht.
Nicht nur Kayla war in Tränen ausgebrochen. Jetzt, wo der erste Schock allmählich nachließ, weinten viele Schüler, die am anderen Ende der Sporthalle auf dem Boden saßen. Bei einigen waren es Tränen der Erleichterung. Anderen wurde jetzt erst klar, dass sie knapp einer Katastrophe entronnen waren. Die meisten waren einfach nur fassungslos angesichts des so plötzlich eingetretenen Unglücks.
Es war nicht der erste gefährliche Vorfall, der sich in diesem Herbst an der Coppell Middle School ereignet hatte. Es war nur ein weiterer in einer ganzen Reihe. Inzwischen wurde geflüstert. Gerüchte machten die Runde. Was auch immer hier geschah, das war nicht normal. Etwas war nicht in Ordnung. Eine Schule sollte kein gefährlicher Ort sein.
Kapitel 1
»Ich bin erledigt. Ich bin vollkommen erledigt.«
»Du machst mal wieder aus einer Mücke einen Elefanten«, sagte Theo McLean ungerührt. »Davon geht die Welt nicht unter.«
»Du hast gut reden«, fauchte Lu ihn an. »Was hast du für eine Note? Eine Eins, ja?«
»Nein, genau genommen nicht«, erwiderte Theo. »Ich habe eine Eins plus. Aber die Sonderpunkte habe ich nicht gekriegt.«
»Blödmann«, schnaubte Lu.
Meine beiden besten Freunde vertragen sich nicht immer. Wenn ich nicht wäre, wären sie wahrscheinlich nicht einmal befreundet. Annabella Lu lässt sich ganz von ihren Gefühlen lenken. Sie reagiert vollkommen emotional und ist immer gleich auf hundertachtzig. Theo McLean dagegen ist ein Denker. Ein übertriebener Denker genau genommen. Bis er ein Problem analysiert und aus allen erdenklichen Blickwinkeln betrachtet hat, ist in der Regel ein Tag vergangen und kein Mensch kann sich daran erinnern, worin das ursprüngliche Problem bestand.
Ich würde mich selbst irgendwo dazwischen einordnen. Ich kann ein Problem schnell durchdenken und habe keine Angst davor, eine gewagte Entscheidung zu treffen. Auf der anderen Seite erweisen sich meine gewagten Entscheidungen nicht immer als die besten. Und es ist kein Geheimnis, dass ich es manchmal schaffe, ein Problem zu lösen, indem ich ein noch größeres Problem heraufbeschwöre. Aber, na ja, immerhin schlage ich mich irgendwie durch.
Lu hat asiatische Wurzeln. Theo ist afroamerikanischer Abstammung und ich selbst bin Amerikaner mit bunt gemischten europäischen Vorfahren. Wir sehen aus wie die ethnisch vorbildlich zusammengestellte Besetzung einer Serie im Kinderfernsehen.
»Es ist nur die Note in einer Arbeit«, sage ich, bemüht, als Stimme der Vernunft aufzutreten. »Dein Vater wird dich schon nicht gleich umbringen, nur weil du mal eine Drei hast.«
»Das ist nicht nur mal eine Drei, Marcus«, sagte Lu und fuhr nervös mit ihren Rollerskatern hin und her. Lu spielt Roller-Derby. Ihre Rollschuhe zieht sie nur deswegen manchmal aus, weil sie auf dem Gelände der Stony Brook Middle School verboten sind. Theo und ich saßen dicht neben dem Vordereingang der Schule, sodass Lu ganz legal über den Bürgersteig rollern und sich abreagieren konnte.
»Ich habe schon ein paar andere Tests in Physik verhauen und meinen Eltern nichts davon erzählt, und jetzt blüht mir für das ganze Halbjahr eine dicke, fette Drei. Mein Vater geht garantiert die Wände hoch.«
»Tut er nicht. Deine Eltern sind doch ganz in Ordnung«, widersprach ich.
»Klar. Wenn es um meine Freunde geht und darum, dass ich Derby spiele und dass ich nicht ständig mein Zimmer aufräume, sind sie cool, aber Schule ist ein ganz anderes Thema. Meine Mutter wird zum Drachen, mein Vater zum Tiger. Für sie ist jede Note außer einer Eins gleichbedeutend mit Sitzenbleiben.«
»Was könnten sie denn deiner Meinung nach tun?«, fragte Theo.
»Keine Ahnung!«, schrie Lu wütend. »Bis jetzt musste ich das nicht erleben! Sie könnten mir Hausarrest aufbrummen oder mir einen Nachhilfelehrer beschaffen und mich sogar dazu zwingen, Roller Derby aufzugeben.«
»Nur wegen einer einzigen lächerlichen Drei?«, fragte ich ungläubig.
»Für meine Eltern ist es nicht nur eine lächerliche Drei. Diese Note ist ein glühendes Messer, das sich direkt in ihre Seelen gräbt und dort so fürchterliche, quälende Wunden bohrt, dass sie bis ans Ende ihrer Tage unter den Schmerzen leiden werden.«
»Dann mach es eben das nächste Mal besser«, sagte Theo sachlich. »Ich meine, du bist ja nicht doof. Nicht wirklich.«
»Oh, danke schön.« Lus Stimme troff vor Ironie. »Vielleicht sollte ich das in meinen Grabstein einmeißeln lassen: Sie war ja nicht doof. Nicht wirklich.«
»Bist du ja auch nicht«, sagte Theo unschuldig.
»O Mann«, ächzte Lu und sauste auf ihren Rollerblades davon. Dann kam sie zurück und sagte: »Wenn ich morgen nicht in die Schule komme, haben sie mich in ein Internat gesteckt.«
»Du übertreibst wirklich maßlos!«, rief ich ihr zu, während sie wendete und davonflitzte.
Sie winkte nur noch, ohne sich noch einmal umzusehen.
»Ich kann mir nicht vorstellen, warum sich ihre Eltern so aufregen sollten«, sagte Theo. »Ich meine, vielleicht schafft sie einfach nur eine Drei.«
Ich stand auf und schwang meinen Rucksack auf den Rücken. »Diese Meinung solltest du lieber für dich behalten, es sei denn, du legst Wert auf Rollerblade-Fahrspuren auf deinem Rücken.«
Theo stand jetzt auch auf. »Und was für eine Note hast du in der Arbeit?«
»Eine Eins plus«, antwortete ich, ohne zu zögern. »Und die Sonderpunkte habe ich auch kassiert. Aber bitte verrate Lu das nicht.«
Theo und ich wohnen ziemlich nah an der Schule in einem Vorstadtviertel von Stony Brook im US-Staat Connecticut. Wir gehen immer zusammen nach Hause. Es war Ende Oktober und die Färbung des Herbstlaubs hatte gerade einen spektakulären Höhepunkt erreicht. Die Laubbäume leuchteten in den verblüffendsten Orange-, Gelb- und Rottönen. Dahinter wirkte der Himmel geradezu aberwitzig blau. Es sah aus wie eine Doppelseite aus einem perfekten Halloween-Bilderbuch.
Unterwegs warf mir Theo immer wieder Blicke zu, so als wolle er mich etwas fragen, traue sich aber nicht. Die ganze Zeit über zupfte er an seinem Ohrläppchen. Das ist sein nervöser Tick, der immer dann einsetzt, wenn er angestrengt nachdenkt.
Dann hielt ich es nicht mehr aus. »Was ist denn los?«
Er zuckte zusammen. »Nichts«, sagte er schnell, aber das bedeutete, dass definitiv etwas los war.
»Okay.« Ich zuckte gleichgültig mit den Schultern.
Wieder zupfte er an seinem Ohrläppchen. »Naja, eigentlich ist schon was.«
»Aha!«
»Komm schon, Marcus. Wir müssen darüber reden.«
»Worüber denn?« Eigentlich wusste ich genau, was er meinte.
»Es ist jetzt über eine Woche her und wir tun so, als wäre nichts passiert.«
»Ich weiß nicht genau, was du meinst«, sagte ich unschuldig.
»Mann, jetzt hör auf damit!«, rief Theo ungeduldig.
»Ach so! Du meinst, wir haben nicht mehr darüber geredet, dass wir drei einen jahrhundertealten bösen Geist in eine Metallkiste gesperrt und ins Meer vor Long Island geworfen haben, damit er nie wieder auftauchen und Leute in Angst und Schrecken versetzen kann? Redest du davon?«
»Kluges Kerlchen. Genau davon. Und von der Bibliothek.«
Die magische Bibliothek. Theo hatte recht. Ich versuchte, so zu tun, als wäre all das überhaupt nicht passiert. Wir hatten nicht mehr über den Vorfall gesprochen, seit wir den grauenhaften Boggin unschädlich gemacht hatten.
»Ich weiß«, sagte ich ernst. »Ich wollte nicht darüber reden.«
»Ich dachte, du wolltest Everett dabei helfen, noch ein paar Geschichten zu Ende zu bringen. Wo ist das Problem?«
»Es gibt kein Problem«, sagte ich. »Es ist nur … das alles kommt mir jetzt wie ein Traum vor. Ich meine, du hast doch diese Regale gesehen. Da stehen Abertausende unvollendete Geschichten. Wie komme ich überhaupt auf die Idee, dass ich da etwas ausrichten könnte?«
»Vielleicht kannst du nicht alle zu Ende bringen, aber ein paar vielleicht schon. Zum Beispiel … naja, ich weiß nicht … meine. Oder die von Lu.«
Damit hatte er mich kalt erwischt. In den unvollendeten Geschichten dieser Bibliothek ging es um Menschen, die unerklärliche Dinge erlebt hatten. Merkwürdige Vorfälle. Übernatürliches. Das Einzige, was diese Geschichten alle gemeinsam hatten, war, dass ihnen das Ende fehlte. Durch alle Zeiten hindurch hatten Agenten der Bibliothek die Möglichkeit genutzt, in diese Geschichten einzutauchen – wie auch immer das funktionierte – und sich um eine Lösung des jeweiligen Problems zu bemühen.
Wie mein biologischer Vater vor mir war auch ich ein Agent der Großen Bibliothek. Glückskind. Ich hatte mich nicht um diese Aufgabe gerissen, aber nun war sie mir trotzdem zugefallen. Und um die Sache noch ein bisschen komplizierter zu machen: Sowohl Theo als auch Lu fürchteten, selbst in merkwürdige Ereignisse verwickelt zu sein. Lus Cousine war auf rätselhafte Weise spurlos verschwunden. Niemand in der Familie hatte eine Ahnung, was ihr zugestoßen sein konnte.
Theo dagegen war in einem Vergnügungspark an einen dieser bekloppten Wahrsageautomaten geraten. Der hatte ihm prophezeit, sein Leben, so wie er es kenne, ende an seinem 14. Geburtstag. Eigentlich kein Grund zur Aufregung – allerdings hatten sich seine beiden Brüder vom selben Automaten die Zukunft vorhersagen lassen, und in beiden Fällen war das, was dieser ihnen prophezeit hatte, auch eingetreten.
Theo und Lu fürchteten – oder vielleicht hofften sie es auch –, ihre Geschichten seien irgendwo in den Regalen der Bibliothek zu finden, irgendwo inmitten der anderen unvollendeten Geschichten. War dies der Fall, dann bestand immerhin die Möglichkeit, diese Rätsel zu lösen. Ich hatte ihnen versprochen, nach den Geschichten zu suchen, aber irgendwie hatte ich bisher nicht den Mut aufgebracht, in die Bibliothek zurückzukehren.
»Mit dem Boggin haben wir Glück gehabt«, sagte ich. »Genauso gut hätte die ganze Sache schieflaufen können.«
»Und was ist mit der Geschichte deines Vaters?«, fragte Theo. »Ich meine, deines biologischen Vaters. Und deiner Mutter. Ich dachte, du willst herausfinden, wie sie gestorben sind.«
»Ja, schon, aber …«
»Aber was?«, rief er aufgebracht. »Ich kann zwar nicht erklären, warum es diese Bibliothek gibt und warum Geister in der Lage sind, solche Geschichten zu schreiben, über – wie hat Everett sie genannt? Störungen? Oder warum Agenten diese Geschichten zu Ende bringen können. Aber das alles existiert und es steht eine ganze Menge auf dem Spiel.«
»Weiß ich, ist mir alles klar.« Ich war genervt. »Aber das ist alles ein bisschen viel für mich? Ich habe ein bisschen …«
Ich konnte den Satz nicht zu Ende sprechen. Theo nahm mir das ab.
»Angst?«
»Ja. Angst. Klar? Wirfst du mir das vor?«
»Kein bisschen«, sagte Theo. »Ich will nicht, dass du etwas machst, was du eigentlich nicht willst. Es war ja nur so ein blöder Wahrsageautomat. Ich werde meinen Geburtstag schon überleben.«
Ich hielt an und sah ihm direkt in die Augen.
»Jetzt willst du mir ein schlechtes Gewissen machen!«
»Nein. Wirklich nicht. Aber du sollst wissen: Wenn du irgendwann wieder in die Bibliothek zurückgehst, bin ich dabei. Und Lu nervt zwar, aber sie kommt auch mit. Vergiss das nicht, ja?«
»Ja, alles klar.«
Wir erreichten meine Straße. Hier trennten sich unsere Wege. Als ich zu Hause angekommen war, ging ich direkt in mein Zimmer und versuchte, meine Hausaufgaben zu erledigen. Versuchte, wohlgemerkt. Wie sollte ich mich auf Mathe konzentrieren, solange ich nur an diesen schweren, altmodischen Schlüssel denken konnte, der um meinen Hals hing? Im Laufe der letzten Woche war ich mehr als nur einmal versucht gewesen, den Schlüssel in die Nähe einer Tür zu halten und dadurch den Zauber auszulösen, der mich in die Bibliothek führte. Ich war hin- und hergerissen – einerseits wollte ich mich gern in ein neues Abenteuer stürzen, andererseits war mir mulmig zumute. Ich wusste ja nicht, wohin mich neue Geschichten führen würden. Es war ja keine Einbildung. Es war alles echt. Wir waren dem Tod entronnen, als wir den Boggin eingefangen hatten. Andere hatten kein Glück gehabt. Menschen waren gestorben. Ein Teil von mir wollte aufhören, solange alles im grünen Bereich war, und einfach so tun, als sei die Bibliothek nur ein komischer Traum, den ich vergessen konnte. Vielleicht hätte ich genau das getan, wenn nicht ausgerechnet meine besten Freunde ihre eigenen »Störungen« hätten erleben müssen.
Außerdem bot mir die magische Bibliothek die Möglichkeit, das Geheimnis um den Tod meiner biologischen Eltern zu lüften. Dass ich nicht gewusst hatte, wer sie gewesen waren oder wer ich selbst eigentlich war, hatte mich mein ganzes Leben lang verfolgt. Der Paradoxschlüssel war so eine Art Geschenk aus der Vergangenheit. Mein richtiger Vater wollte, dass ich die Wahrheit über ihn, meine Mutter und über ihren Tod erfuhr. Wie also konnte ich die Sache abbrechen? Und wie konnte ich meinen Freunden meine Hilfe verweigern? Wo doch so viel auf dem Spiel stand, wie konnte ich da nur daran denken, so zu tun, als gäbe es die Große Bibliothek gar nicht?
Ich glaube, in dieser Nacht schlief ich nicht viel. Ich umklammerte den Paradoxschlüssel, ließ meine Finger über die feinen eingravierten Muster gleiten und versuchte, meine Angst zu überwinden. Als der Morgen dämmerte, war ich einer Entscheidung über mein weiteres Vorgehen keinen Schritt nähergekommen. Vielleicht war das Treffen gewagter und folgenschwerer Entscheidungen doch nicht meine allergrößte Stärke.
»Marcus! Frühstück!«
Mom und Dad saßen bereits am Küchentisch. Sofort spürte ich die Anspannung. Darin war ich Experte. Ich hatte ja auch genügend Übung. Aus dem einen oder anderen Grund hatten sie immer ein Problem mit mir, und an diesem Morgen war es nicht anders.
»Zeit für eine Familienkonferenz«, verkündete Mom, als ich mich setzte.
Oh-oh. Mir war klar, was das bedeutete. Sie würden mir jetzt gleich etwas um die Ohren hauen, was mir gar nicht gefiel.
»Was gibt’s denn?«, fragte ich unschuldig.
»Mom und ich haben uns unterhalten«, fing Dad an.
Noch einmal oh-oh. Das versprach nie etwas Gutes. Ich hasste es, wenn sie sich »mal unterhielten«. Vor allem, wenn es dabei um mich ging. In solchen Gesprächen war erfahrungsgemäß nie die Rede davon, dass man mir einen Orden verleihen wollte oder so. Nein, was auch immer da auf mich zukam – es war etwas Schlechtes.
»Du machst dich in der Schule gut«, sagte Dad. »Wir sind stolz auf dich.«
Am liebsten wäre ich aufgesprungen und hätte gesagt: »Danke! Gutes Gespräch! Schönen Tag noch!«, und wäre dann schnell verschwunden. Aber mir klar, dass ich damit nicht durchkommen würde.
»Aber im Leben geht es nicht nur um die Schule«, sagte er.
Dagegen ließ sich nichts einwenden.
»Was ich meine, ist: Wir möchten, dass du noch andere Erfahrungen sammelst und dich außerschulisch engagierst. Du weißt schon, Dinge, die nicht auf dem Lehrplan stehen.«
»Zum Beispiel?«, erkundigte ich mich misstrauisch.
»Zum Beispiel im Sportverein«, sagte Mom. »In einem Club. Eine ehrenamtliche Arbeit. Zwischen Unterrichtsende und Abendessen bleibt jede Menge Zeit, die du sinnvoll nutzen kannst. Zu einer guten Ausbildung gehört mehr als nur Hausaufgaben machen.«
Auch dagegen ließ sich nichts einwenden.
»Außerdem …«, sagte Dad, »versteh das bitte nicht falsch, aber du arbeitest wirklich nicht viel für die Schule und kriegst trotzdem lauter Einsen.«
Wieder war kein Widerspruch möglich. Die Schule war ein Kinderspiel für mich.
»Das ist wunderbar«, fügte Dad hinzu. »Wir sind stolz auf dich, aber wir würden es gerne sehen, wenn du dich mal ein bisschen anstrengen würdest.«
»Okay, ich denke drüber nach«, sagte ich und stürzte mich auf meine Cornflakes, in der Hoffnung, sie würden sich mit meiner Antwort zufriedengeben. Aber das Glück war mir nicht hold. Ich konnte spüren, dass sie einander vielsagende Blicke zuwarfen, um festzulegen, wer von ihnen das nächste Argument anführen sollte.
»Es ist uns ernst, Marcus«, sagte Mom. »Es ist wichtig, dass du so viele Erfahrungen wie möglich sammelst. Außerdem kannst du auf diese Weise neue Freunde finden.«
»Was habt ihr gegen meine alten Freunde?«, wollte ich wissen.
»Nichts«, versicherte Mom schnell. »Aber du bist schon dein ganzes Leben mit denselben Kindern zusammen. Vielleicht solltest du deinen Horizont mal etwas erweitern.«
»Ich mag meinen Horizont genau da, wo er ist«, antwortete ich. »Ich trete bestimmt nicht in den Schachclub ein. Oder in die Redaktion der Schülerzeitung. Oder in einen bescheuerten Papierfliegerclub. Das passt nicht zu mir. Vielleicht mache ich Leichtathletik, aber das Training fängt erst im Frühling wieder an. Ich finde, ihr könnt ganz zufrieden mit mir sein. Ich kriege gute Noten und mache keine Probleme.«
Daraufhin warfen die beiden einander erneut vielsagende Blicke zu.
»Na gut«, fügte ich hinzu. »Ich mache kaum Probleme. Also seid doch einfach zufrieden, dass es ganz gut läuft.«
»Jetzt werde nicht sauer«, sagte Dad. »Wir wollen ja nur das Beste für dich.«
»Ich brauche keine Hilfe. Ich komme gut klar. Ich brauche keine Gruppe von Strebern, die …«
Die Worte blieben mir im Hals stecken: Ich spürte etwas Merkwürdiges. Zuerst dachte ich, mir würde vielleicht übel. Oder ich bekäme einen Anfall. Es dauerte kurz, bis ich verstand, was wirklich ablief. Der Paradoxschlüssel hatte sich auf meiner Brust erwärmt.
»Was ist los?«, fragte Dad.
Ich machte den Mund auf und wollte ihm antworten, aber es kamen keine Worte heraus. Jedenfalls keine, die ich laut aussprechen wollte. Mom und Dad hatten keine Ahnung von der magischen Bibliothek und ich wollte ihnen auf keinen Fall davon erzählen.
Der Schlüssel wurde immer wärmer. Eine Sekunde lang fürchtete ich, er würde ein Loch in mein Hemd brennen. Oder in meine Brust.
»Ich … ich … ich muss mal aufs Klo«, stammelte ich und rannte in Richtung Treppe.
Als ich aus dem Raum rannte, sagte Dad zu Mum: »Wo brennt’s denn?«
Ich nahm zwei Stufen auf einmal, raste direkt ins Bad und verriegelte die Tür hinter mir. Ich griff nach der Schnur, die um meinen Hals lag und an der dieser alte Schlüssel hing, und zog sie mir über den Kopf. Der Schlüssel war eindeutig warm. Ich umklammerte ihn und spürte ein Pulsieren. Es war fast, als riefe er mir etwas zu. War das möglich? Das musste ich herausfinden. Das, was sich allmählich nur noch wie ein Traum angefühlt hatte, würde nun wieder Wirklichkeit werden.
Ich hielt den Schlüssel in Richtung der verschlossenen Badezimmertür und spürte, wie seine Wärme durch meine Hand und meinen Arm entlangströmte. Als ich ihn näher an die Tür hielt, erschien der vertraute dunkle Fleck unter dem Türknauf. Der dunkle Fleck wurde immer größer und verwandelte sich in eine runde Messingplatte mit einem altmodischen Schlüsselloch. Ich führte den Schlüssel ein, bis der Bart einrastete. Es war, als hätte der Schlüssel die Entscheidung getroffen, zu der ich mich selbst nicht hatte durchringen können.
»Wenn meine Eltern meinen, ich solle meinen Horizont erweitern …«, sagte ich vor mich hin. »Ich würde mal sagen, außerschulischer geht es nicht.«
Ich drehte den Schlüssel und hörte, wie das Schloss mit einem Klacken aufsprang. Mit der anderen Hand packte ich den Türknauf, drehte ihn und zog.
Die Tür ging ganz leicht auf … und ich betrat die magische Bibliothek.
Kapitel 2
»Everett!« Ich rief nach dem Geist, einem älteren Herrn, der diese sonderbare Bibliothek verwaltete. Mein Ruf hallte in den dunklen Winkeln des uralten Gebäudes wider. Nichts hatte sich seit meinem letzten Besuch verändert – und das war nicht weiter erstaunlich. Der Ort sah so aus, als stamme er aus dem 19. Jahrhundert … warum also sollte sich da innerhalb einer Woche etwas ändern?
Mehrere Gaslampen hingen von der Decke und spendeten warmes, flackerndes Licht. Everett behauptete, diese Bibliothek befinde sich außerhalb der Zeit. Vermutlich gab es deswegen keine Fenster. Würde man die Sonne über den Himmel wandern sehen, bedeutete das ja, dass die Zeit verging. Aber das warf neue Fragen auf: Was war außerhalb der Bibliothek? Wo befand sich diese Bibliothek überhaupt? Im Weltraum? In der Vorhölle? Einer Schattenwelt?
Links von mir führten zahllose Gänge zwischen Regalen aus poliertem Holz hindurch. Tausende Bücher, die unvollendete Geschichten enthielten, standen dort … der eigentliche Grund für die Existenz der Bibliothek. In den Regalen links von mir standen jene Bücher, welche die Agenten der Großen Bibliothek »zu Ende geschrieben« hatten. Nirgendwo war auch nur ein Staubkorn zu sehen. Bedeutete das, dass Everett hier regelmäßig mit einem Staubwedel in der Hand herumwanderte? Oder erledigten andere Geister diese Aufgabe? Vielleicht hatte der Staub, falls die Zeit hier tatsächlich keine Bedeutung hatte, gar keine Gelegenheit, sich irgendwo abzusetzen. Ich hatte keine Ahnung.
Schnell marschierte ich in Richtung Ausleihtheke und rechnete damit, Everett auf seinem Hocker sitzend beim Lesen anzutreffen. Aber er war nicht da. Vielleicht war er irgendwo mit seinem Staubwedel zugange. Plötzlich fühlte ich mich sehr allein.
»Everett!«, rief ich diesmal lauter.
»Nur die Ruhe!«, antwortete er direkt hinter mir. Ich zuckte zusammen. »Du weckst ja die Toten auf!« Schmunzelnd fügte er hinzu: »Na ja, eigentlich bin ich ja schon wach.«
Everett sah so aus wie um die siebzig. Er war klein, hatte eine Halbglatze und ein Kranz weißer Haare legte sich um seinen Hinterkopf. Buschige Koteletten wuchsen an seinen Wangen und auf seiner Nase saß eine Brille mit einem so feinen Drahtgestell, dass es aussah, als schwebten die Gläser vor seinen Augen. Er trug eine graue Tweedhose mit einer passenden Weste über einem blütenweißen Hemd, dessen Ärmel er hochgekrempelt hatte. Ebenso wie die Große Bibliothek selbst sah er aus, als entspränge er direkt dem 19. Jahrhundert. Ach ja, und außerdem: Er war ein Geist.
»Was ist mit dem Schlüssel los?«, fragte ich. »Er ist heiß geworden. Ist das so eine Art Notruf, der mich direkt hierherbestellt?«
»So könnte man es sagen.« Everett sprach mit leichtem irischen Akzent. »Ich musste ja etwas tun, um deine Aufmerksamkeit zu erregen.«
Er watschelte zu einem hölzernen Lesepult am Ende eines Gangs. Es handelte sich um das Pult, auf dem jeweils das Buch lag, dessen Ende es zu schreiben galt. Jetzt lag ein kleiner roter Band darauf.
»Na ja, ich war … beschäftigt«, sagte ich und starrte auf das ungeöffnete Buch.
»Beschäftigt? Oder vielleicht hattest du nur ein wenig Angst.« Er zwinkerte mir vielsagend zu.
»Hatte ich nicht! Ich war nur … nur … Also gut, ich hatte Angst. Na und?«
»Das ist keine Schande, Marcus. Es ist ja alles noch neu für dich. Aber da ist ein Fall aufgetaucht, um den wir uns kümmern müssen. Da habe ich es für klug gehalten, dich ein bisschen anzustupsen.«
»Geht es um Lus verschwundene Cousine?«, fragte ich hoffnungsvoll.
»Nein.«
»Um Theos Zukunft?«
»Nein.«
Ich sank in mich zusammen.
»Haben Sie überhaupt danach gesucht?«
Everett runzelte die Stirn. »Sieh dich um, Jungchen. Hast du auch nur eine entfernte Vorstellung davon, wie viele Bände ich durcharbeiten muss?«
»Nein.«
»Ich auch nicht. Jedenfalls sind es viele! Ich habe nach den Geschichten deiner Freunde Ausschau gehalten, das versichere ich dir. Aber ich bin ein Geist, kein Zauberer. Es wird noch eine Weile dauern.«
»Und Zeit spielt hier keine Rolle, nicht wahr?«
»Du hast vollkommen recht, aber nun bin ich auf etwas gestoßen, das offenbar an die Zeit gebunden ist. Hin und wieder kommt so etwas vor.«
Er legte seine Hand auf das rote Buch und tätschelte es ein paarmal.
»Eine neue Geschichte?«, fragte ich.
»Nicht nur neu. Sie spielt gerade jetzt. Es ist nichts, was in der Vergangenheit passiert ist. Die Ereignisse, von denen hier berichtet wird, finden in der Gegenwart statt. Heute. In deiner Zeit. Deswegen können sie nicht warten.«
Es war verrückt – die Geister waren allgegenwärtig, beobachteten seltsame Vorkommnisse, dokumentierten sie, schufen diese Bücher. Wenn ich mir das genauer vorstellte, konnte ich gar nicht mehr unbefangen auf die Toilette gehen.
»Fassen Sie die wichtigsten Punkte kurz zusammen«, sagte ich.
Everett griff nach dem Buch und blätterte darin herum.
»Es geht um eine Schule in Massachusetts. Die Coppell-Mittelschule. Es wäre untertrieben, wenn man sagen würde, dass die Leute dort seit einiger Zeit eine Pechsträhne erleben, aber das wäre so in etwa das Thema. Hier, lies mal ein bisschen.«
Er reichte mir das aufgeschlagene Buch und deutete auf einen Absatz. Ich las:
SEIT BEGINN DES SCHULJAHRES hatte es eine Reihe von Vorfällen gegeben, die weit über das hinausgehen, was man als normal betrachten kann. Es fing recht harmlos an. Ein Servierwagen voller Gläser fiel um, obwohl niemand in der Nähe war. Fensterscheiben zersprangen ohne erkennbaren Grund. In der Schulküche geriet Öl in Brand. Zu Beginn waren es keine ernsten Vorfälle. Es kam niemand zu Schaden. Aber die Unglücksfälle wurden schlimmer. Ein Transformator explodierte und in der Schule fiel der Strom aus. Ein Kletterseil in der Turnhalle riss, als ein Junge bis auf halbe Höhe daran hochgeklettert war. Der Hausmeister verlor die Kontrolle über seinen Rasentraktor, der in der Folge ein komplettes Rosenbeet abmähte.
»Bin ich froh, dass das nicht meine Schule ist«, sagte ich.
»O ja, und es wird immer schlimmer. Eine junge Frau, die an der Schule vorbeifuhr, riss plötzlich das Steuer herum und raste auf das Schulgrundstück, durch eine Glastür und direkt in den Speisesaal – und das während der Mittagspause. Sie war vollkommen durch den Wind, wie du es vielleicht ausdrücken würdest. Sie erzählte später, es habe sich angefühlt, als besäße ihr Auto einen eigenen Willen.«
»Speisesaal?«
»Cafeteria. Egal wie du es nennen willst. Spar dir deine Kritik.«
Everett schnappte sich das Buch wieder und watschelte den Korridor hinunter auf die lange Ausleihtheke zu. Ich war dicht hinter ihm.
»Das ist wirklich ausgesprochenes Pech.«
»O ja. Aber jetzt hat das Ganze eine neue Stufe erreicht. Die Schüler hatten sich anlässlich einer Sportveranstaltung in ihrer Turnhalle versammelt. Ohne Vorwarnung oder ersichtlichen Grund ist ein großer Teil der Tribüne in sich zusammengebrochen.«
»O Mann. Gab es Verletzte?«