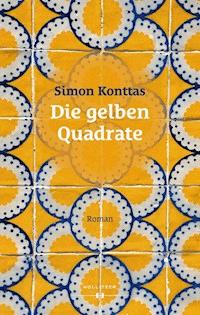
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: HOLLITZER Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Der Philosophiestudent Sebastian Calan lebt mit drei Mitbewohnern in einer Wiener Wohngemeinschaft. Calan ist sowohl seines am pulsierenden Leben vorbeiexerzierenden Scheindaseins als Student als auch seiner Beschäftigung als Assistent bei Professor Wilmitsch überdrüssig. Und auch die Beziehung zu seiner Freundin Lydia, deren Trägheit ihn mehr und mehr aufbringt, steht auf der Kippe. Als Sebastian den jungen Star-Philosophen Geronimo, Wilmitschs Neffen, kennenlernt, verstrickt er sich ganz und gar nicht widerwillig in dessen undurchschaubare Pläne, die ihm eine andere Lebenswirklichkeit näherbringen. So, gänzlich verwandelt, trifft er eine Entscheidung, die nicht nur seine WG-Mitbewohner verstört.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SIMON KONTTAS
DIE GELBEN QUADRATE
Roman
Lektorat: Teresa Profanter
Umschlaggestaltung: Daniela Seiler
Satz: Daniela Seiler
Hergestellt in der EU
Simon Konttas: Die gelben Quadrate
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung von:
MA 7 – Kulturabteilung der Stadt Wien
Alle Rechte vorbehalten
© HOLLITZER Verlag, Wien 2018
www.hollitzer.at
ISBN 978-3-99012-530-4
1
„Stört’s dich, wenn ich zumache?“, fragte die zwanzigjährige, etwas dickliche junge Frau, nachdem sie ihre ausgerauchte Zigarette in den Innenhof des Altbaus geworfen hatte, und mit glasigen Augen dem zischelnden Verlöschen des Stummels in einer der Pfützen folgte.
„Pfui, dieser Regen, schon seit drei Tagen“, sagte sie und wandte sich dabei wieder dem Brett zu, auf dem geschälte Kartoffeln im fleckigen Licht der Küche matt glänzten.
„Nein, nein“, sagte Sebastian, geistesabwesend und in Gedanken an den seit gestern Abend erwarteten Anruf.
Sebastian Calan, Student der Philosophie, bewohnte mit zwei weiteren – er pflegte nicht „Mitbewohner“, sondern nur das unverfänglichere Wort „Menschen“ auf diese anzuwenden – Menschen also eine Wohnung eines alten Hauses im fünften Wiener Gemeindebezirk mit hohen Zimmerdecken und knarrenden Fußböden.
Betrat man die in vier einzelne Zimmer mit gemeinsamer Küche geteilte Wohnung, durchquerte man einen immer im Dunkeln liegenden Vorraum mit einem im Laufe der vielen Jahre schon schwarz gewordenen Parkettboden; linkerhand befand sich ein kleines Badezimmer; geradeaus gehend gelangte man in einen gemeinschaftlich genutzten Raum, in dessen einer Ecke ein Aquarium stand und an dessen Ende sich ein weiterer Flur in das mit vielen Teppichen ausgelegte Zimmer des anderen „Menschen“ öffnete. Von der Diele kommend, gellte einem sogleich das Weiß der alten Kacheln der Küche entgegen, in deren einem Eck sich der Raum mit der Toilette befand, die einer der ehemaligen und schon längst ausgezogenen Bewohner mit alten Filmplakaten, Werbebändern und eigenen Zeichnungen beklebt hatte: ein winzig kleiner Raum, in welchem man stets das Gefühl hatte, als ob ein eiskalter Luftzug die entblößten Beine umwehte, in welchem sich länger als notwendig aufzuhalten jedoch um der vielen Bildchen willen nicht unbedingt unangenehm war, wie Sebastian schon oft festgestellt hatte.
So saß auch jetzt der dritte „Mensch“, Bruno, ein vierzigjähriger und, wie auch die junge Frau, etwas dickerer Mann, auf ebenjenem Ort, wobei sein ausgestoßenes Gepfeife die Räume halb mit Lustigkeit, halb mit einer gekünstelten und darum, zumal für Sebastian, nicht unbedingt leicht erträglichen Unbefangenheit erfüllte. Das Mädchen, ähnlich unbedarft wie ihr älterer Mitbewohner und von weniger anspruchsvollem Gemüt, begann zu lächeln. Zwischen den beiden entspann sich ein sorgloses Geplänkel, das mit der knarrenden Wasserspülung, deren krachendes und schäumendes Kreischen die gesamte Wohnung auszufüllen schien, ein jähes Ende fand. Der Mann, der eine einer Tonsur ähnelnde Glatze hatte, strich sich, aus dem kleinen, kalten Raum tretend, mit selbstgefälliger Zufriedenheit über den Bauch und platzierte sich auf einer der Arbeitsflächen. Während er sich streckte, wippte er mit den Beinen hin und her, wobei er, nach einigem Gähnen und Knacken mit den wulstigen Fingern – Sebastian wunderte sich immer aufs Neue, dass aus diesem weichen Wulst sich ein derartiges Knacken überhaupt vernehmen ließ – sagte: „Mmhh, das riecht gut. Was wird das, wenn’s fertig ist?“
„Ein ganz normaler Kartoffelauflauf“, sagte Beate.
„Mmhh, ich mag Kartoffeln sehr“, sagte Bruno.
Die beiden „Menschen“ hatten, nachdem sie hier, einige Monate vor Sebastian, eingezogen waren, Gefallen gefunden an der Tatsache, dass die Initialen ihrer Namen sich deckten; dies in mundfertig-rascher Schalkhaftigkeit als Schicksal ausgelegt und beschlossen, dass, nach Aufnahme der vierten und letzten Mitbewohnerin, man in der Wohngemeinschaft ein Herz und eine Seele sein wolle; welches Vorhaben weniger durch die nach Sebastians Einzug an ihm spürbar werdende Abstandnahme von einer allzu raschen und voreiligen Berührung der Lebenskreise anderer Menschen vereitelt wurde, denn eher durch die gereizte Verschlossenheit der neuen Mitbewohnerin Carolina, die sich, außer abends, kaum je blicken ließ und sich auch sonst in einer schweigsamen Ummanteltheit gefiel, in der sie, wie Sebastian beobachten konnte, ihr vorgeblich durch die Männer verursachtes Leid ungestört bejammern konnte. Auch an diesem Septembervormittag saß sie in ihrem Zimmer und versteckte sich vor den anderen. Man wusste davon. Um aber etwas zu sagen, flüsterte Bruno mit ernstem Gesichtsausdruck und so, als ob er auf Grundlage dieses Wissens weitere Aussagen tätigen wollte: „Und die Caro, wo ist die?“
„Im Zimmer, natürlich.“
„Ach so“, war die Antwort des ältesten der Mitbewohner. Dann schwieg man wieder und die vorgebliche Wichtigkeit der Sache verebbte.
Sebastian hatte für Bruno weder eine Zuneigung, noch war ihm dieser Mensch sonderlich angenehm. An die unteren Küchenschränke gelehnt, glitt sein Blick an Brunos Gestalt ab und er fragte sich: ‚Was ist eigentlich an diesem Menschen dran? Wie kann es sein, dass er schon vierzig Jahre alt ist, sich aber benimmt wie ein Zwanzigjähriger? Was hat er sein Lebtag lang eigentlich gemacht? Wozu auch muss er sich in seinem Aquarium seit Neuestem eine kleine Schildkröte halten?‘ – Und indem Sebastian zugleich an das kleine Tier und an den dicken Menschen dachte, der in wippender Selbstgefälligkeit vor ihm stand, empfand er so etwas wie Mitleid mit der Schildkröte, die in einförmiger Nichtigkeit ihre traurigen Runden im Aquarium drehte, ab und an ihr Köpflein aus dem Wasser streckend, angewiesen auf die Gutmütigkeit von Menschen wie Bruno oder Beate, die, wenn sie geruhten, es nicht zu vergessen, das Tier fütterten; wobei sie dies aber häufig zu tun vergaßen. Das bald in erstickender Größe wie aufplatzende und bald wie unverhältnismäßig aufgequollene Mitleid mit dem Tier verdichtete sich in einem prüfend-wägenden Blick auf Bruno, der wieder mit seinem Pfeifen begann und an das schmale und hohe Fenster getreten war, dann das Pfeifen unterbrach und sagte: „Pfoah, so ein Wetter. Ich mag das Wetter im September überhaupt nicht. Eigentlich mag ich nur den Sommer. Im Sommer geh ich ins Gänsehäufl, aber man kann ja auch auswärts schwimmen gehen, oder? Ich meine, was willst du im Winter eigentlich machen; kannst ja nur zu Hause sitzen und nichts tun, ich meine: Was willst du im Winter machen? Ich verstehe die Caro schon irgendwie. Die liest ja viel, oder? Aber ich hab gar keine Kraft zu lesen. Das Wetter schlägt mir einfach zu sehr aufs Gemüt …“ Sebastian horchte auf: Hatte Bruno soeben das Wort „Gemüt“ verwendet? Aber wie sollte man sich diesen, nun, zwar nicht Koloss, aber anständig beleibten Menschen beim Schwimmen vorstellen, und das auch noch gemütvoll …? „…und dann fühl ich mich einfach so müd beim Lesen. Ich bewundere das, keine Frage, das muss ich schon sagen, genau. Ich habe letztens ein Buch über die Aura des Menschen ausgelesen. Sehr interessant. Du musst die Aura von unten bis oben entoden oder so irgendwie heißt das: Ich glaube, da sagt man ‚entoden‘. Das heißt: du musst dich hinstellen und dann dich ganz auf die Mitte deines Körpers konzentrieren und dann musst du gut und langsam atmen. Das ist deshalb, damit du deine Aura reinigst. Dann fühlst du dich sauber und kannst dich ganz mit voller Energie den Sachen widmen, genau.“ Bruno hatte die Angewohnheit, am Ende seiner Ausführungen das Wörtchen „genau“ zu verwenden, so als ob er jene Bestätigung, deren er auswärts nicht teilhaftig wurde, sich einfach selber gebe.
„Und, kommt die Lydia heut übrigens?“, fragte Bruno, sich in einem jähen Ruck vom Fenster zu Sebastian wendend, der, noch am Faden wie tropfenweise sich formender Gedanken spinnend, nicht sofort zu antworten vermochte. Nach einigen Augenblicken erst nickte er. Dann, als sich Bruno erneut zum Fenster drehen wollte, um sein Selbstgespräch fortzusetzen, sagte Sebastian: „Ach so, nein, nein, sie kommt nicht. Ich fahre hin. Ich fahre zu ihr.“
„Ach so, du fährst heute nach Blumau?“, fragte Beate.
„Ja, ja“, sagte Sebastian.
„Blumau ist übrigens ein schöner Ortsname, findest du nicht? Lass dir das auf der Zunge zergehen: Blum. Au. Die Au, wo die Blumen blühen, fast wie im Paradies, oder? Die Lydia hat dort ein Pferd stehen, oder?“ Sebastian bejahte die Frage.
„Seit wann kennt ihr euch eigentlich?“, fragte Bruno, wobei er aber, ohne die Antwort abzuwarten, fortsetzte: „Genau. Blum. Au. Finde ich schön, oder? Da gibt es ja das Sommertheater und die Steinerschule ist dort, oder? Ich war einmal dort, in der Gegend, Fliesen legen. Ja, das ist aber auch schon zwanzig Jahre her. Da hab ich noch Kraft in den Muskeln gehabt, echt wahr. Ordentliche Muskeln und sogar einen Waschbrettbauch hab ich gehabt.“ Beate wandte sich um: „Echt?“, fragte sie, das „E“ in die Länge ziehend.
„Pfoah, wenn ich noch Fotos hätte, könnt ich die euch zeigen. Anfang der Neunziger war das, genau. Da habe ich noch einen Waschbrettbauch gehabt. Aber, na ja, man kann ja nicht alles haben. Die Zeiten ändern sich eben, oder? Ich mein, so ist das halt, da kannst du nichts machen. Ich weiß nicht, was ich heute als Student tun würde, wenn ich kein Geld hätte. Damals ist es uns wirtschaftlich ja noch gut gegangen. Du hast dich wo hingestellt, hast gesagt: Hallo, da bin ich, nehmt mich und – zack, bum – da haben sie dich dann genommen. Und ich hab wirklich gut verdient, als Student. Ich mein, ich war ja auch fesch, ich mein, mit Verlaub, jetzt kann ich das sagen. Ich hätte mehr Freundinnen haben können. Ich sage: ‚hätte‘. Ich weiß wirklich nicht, was ich heute tun würde, um zu Geld zu kommen. Heute kannst du einfach nichts machen. Du bist heute einfach total hilflos, ich meine, die Wirtschaftskrise und das alles. Was kannst du schon machen? Du kannst Plasma spenden oder Schmuck stehlen, genau … und dann verkaufen, oder du kannst drei Handys … – die kannst du anmelden und dann gleich wieder verkaufen, genau … aber ich meine: Wer macht das, wer tut sich das an? Aber so ist das halt, genau. Die Zeiten ändern sich und wir müssen uns an die Zeit anpassen, da hilft nichts. Wenn du nichts machen kannst, kannst du eben nichts machen, da hilft das Jammern auch nichts. Ich meine, du brauchst ja nur aus dem Fenster schauen. Das Wetter war einfach auch besser, damals. Ich meine auch: Wie soll ich jetzt noch trainieren? So einen strammen Waschbrettbauch bekomme ich nie mehr wieder zusammen, aber die Zeiten ändern sich eben, genau.“
„Dann musst du dich eben entoden“, sagte Beate.
„Ja, genau, deshalb hab ich ja auch das Buch gekauft. Ich hab’s ja nicht umsonst gekauft. Du kannst ja nichts machen, was willst du tun? Im Kaffeehaus kann ich auch nicht den ganzen Tag sitzen, das Spazierengehen wird auch langweilig mit der Zeit. Pfoah, jetzt hab ich mich geschreckt!“, rief Bruno plötzlich aus.
„Huh, ich mich auch.“ Das an der Wand angebrachte Telefon klingelte, ein richtiges Festnetztelefon, dessen Notwendigkeit von der alten Vermieterin, die in einer Villa im neunzehnten Bezirk wohnte und sich immer mit dem Taxi in die Cafés des ersten Bezirks fahren ließ, aufs Entschiedenste verteidigt wurde.
„Ist das jetzt dein Professor?“, fragte Bruno, während Sebastian, innerlich unwillig sowohl über diese ihm dreist anmutende Frage wie auch über den Anruf selber, den er mehr gefürchtet denn erwartet hatte, sich dem laut und aufdringlich läutenden Apparat näherte. ‚Alles ist in dieser Wohnung laut und aufdringlich: die knarrenden Bretter, die Toilettenspülung, das Telefon, dieser Bruno. Zum Glück geht mein Zimmer auf eine Sackgasse. Gott sei Dank ist es in meinem Zimmer ruhig.‘ Sebastian atmete, in dieser Mischung von Beklemmung und Glück, schwer und ihm war plötzlich – ‚Wie lange schon‘, fragte er sich, habe ich nicht so gefühlt? Und warum nicht?‘ – nach Weinen zumute: ‚Ja, warum habe ich nicht so gefühlt? Und jetzt das. Jetzt ruft dieser Wilmitsch mich an. Seinetwegen fühle ich so. Seinetwegen erlebe ich ein Gefühl. Dann aber wird er mich vereinnahmen, dann wird er mich binden und ich werde sein Mitarbeiter sein und dann werde ich nichts mehr empfinden, dann werde ich abstumpfen und versauern in der stickigen Luft der Archive und des Kellers. Und wozu das alles? Für die neue Edition irgendeines Werks, für das sich niemand interessiert? Wozu das alles? Kurzes Erleben, kurzes Aufflackern einer menschlichen Regung und dann soll das alles aus sein, überfrachtet und überstickt von der erbärmlichen Nichtigkeit der Wissenschaft und wozu, wozu …?‘ Sebastian hörte Professor Wilmitschs fröhliche, bubenhafte Stimme, der das beständige Lächeln eingeschrieben war wie einem Baumblatt seine Adern. Und kaum hatte Sebastian sich versehen, sagte er ein ‚Ja‘ und in diesem Augenblick, als er es aussprach, schien ihm, dass alles egal und gleichgültig sei; nicht einmal mehr der trotzende Unmut, verursacht durch die dreiste Ungezwungenheit Brunos, vermochte ihn noch zu stören. ‚Mich stört nichts, weil mir alles egal ist. Mir ist alles egal, weil ich plötzlich innerlich abgestorben bin.‘ Sebastian war, als ob er ausspucken müsste, wie nach einer langen Anstrengung, die er bald auskostete und die er zugleich lächerlich übertrieben fand. Er sprach mit Wilmitsch.
2
Die Mutter von Sebastians Freundin Lydia, eine kleine, schwarzhaarige Frau, die, hierin ganz das Gegenteil ihrer trägen und schwerblütigen Tochter, großen Gefallen fand an Gartenarbeit und an haushälterischen Verrichtungen, wohnte – schon seit Langem von ihrem Mann geschieden – in einem heruntergekommen wirkenden Häuschen am Rande des Örtchens Blumau. Das Häuschen ähnelte einem englischen Cottage. Seine Wände waren weiß getüncht, es war einstöckig, hatte an einer Stelle ein sehr weit hervorragendes Dach und war niedrig, viel zu niedrig für Sebastians Geschmack. So sehr Lydias Mutter Helga in der Arbeit im Freien Sinn und Kraft fand, so wenig tat sie dies innerhalb ihrer eigenen vier Wände. Die innerhäuslichen Verhältnisse waren zwar nicht unsauber oder gar unhygienisch, aber es herrschte ein ziemliches Durcheinander, das durch die dösende und lustwandelnde Anwesenheit von zehn Katzen und Katern nicht wenig unterstrichen wurde; die Enge der Zimmer sowie die Niedrigkeit der Zimmerdecken trugen das Ihre bei, um dem Haushalt einen Anstrich von sorgloser Wildheit zu verleihen. Auch tummelten sich in dem Haus zwei Hunde, die dank des großen Gartens jedoch so gut wie nie ausgeführt wurden. Die zwei großen Tiere, gutmütig und ihres an Gerüchen reichen Lebens froh, waren von derselben dahingefläzten Urwüchsigkeit wie sie auch die Katzen auszeichnete und wie sie Sebastian – leider zu oft – auch an Lydia glaubte ausmachen zu können.
In diesem Haus nun hielt sich Sebastian vor einem Jahr auf. Seit seiner Verbindung mit Lydia war es zu sehr vielen Besuchen gekommen, die, wenngleich die inneren Verhältnisse nicht ganz Sebastians Erwartung übersichtlicher Reinlichkeit entsprachen, er dennoch nicht ungern über sich ergehen ließ, zumal die Nähe des Waldes, heller Lichtungen und kleiner Flüsse seinem Wesen, wie ihm schien, sehr schmeichelte. Auch hatte Helga eine eigentümlich mütterliche Sympathie für den Lebensgefährten ihrer Tochter entwickelt, nicht zuletzt weil Sebastian sich immer einem der beiden Hunde annahm, um diesen auszuführen, wobei er oft mehrere Stunden lang mit dem Tier ausblieb, das dann, von solchem ungewöhnlichen Abenteuer ermattet zurückkehrend, sich gleich in sein Körbchen legte, um in seliger Indolenz einzuschlafen. Besondere Vorliebe hatte Sebastian für den schwarzen Mischlingshund, der auch an diesem Tag vor einem Jahr zu seinen Füßen lag, als er, Äpfel für einen Kuchen schälend (Helga hatte ihn darum gebeten), dem pausenlos laufenden Radioprogramm seine Aufmerksamkeit schenkte.
Helga besaß keinen Fernseher oder andere ähnliche ‚Kontakte zur Außenwelt‘, wie sie, in einer ihrer Tochter ganz entgegengesetzten Verschmitztheit zu sagen pflegte, stolz auf ihre Abgeschiedenheit, die es ihr auch gestattete, in solch dem Durcheinander ergebenen Wohnverhältnissen zu hausen, ohne dabei auf andere mit einer allzu übertriebenen Reinlichkeit Rücksicht nehmen zu müssen.
Es war ein gutes Radioprogramm, das neben klassischer Musik und World Music Reportagen aus anderen Ländern brachte sowie Diskussionssendungen. ‚Ich versteh zwar nicht viel von dem, was die Leut da reden, aber ich hör mir’s schon gern an, weil sie so schön sprechen. Das mag ich‘, hatte Helga einmal gesagt. An jenem Nachmittag, nachdem ein tönender Gong die Nachrichten eingeläutet hatte, folgte eine Diskussionsrunde. Es wurde über literarische und philosophische Neuerscheinungen gesprochen. Der Moderator, bekannt für seine weiche und tragend-tiefe Stimme, beherrschte mit milder Teilnahme die sich Unterhaltenden, von denen einer über ein erst neulich erschienenes Werk eines gewissen Geronimo Weißler zu sprechen begann. Sebastian hatte am Vortag, im Café sitzend, zufällig einen Artikel über eben diesen Weißler gelesen, dessen Foto, beinah größer als der Text selber, neben diesem abgedruckt war: ein gutaussehender, dreiunddreißig Jahre alter Mann, der, eine schlanke Blondine im Arm, mit in den Nacken geworfenem Haar, in seines Erfolgs sicherer Selbstgewissheit in die Kamera lächelte. Sebastian hatte den Text nur überflogen und nicht viel von dem aus Weißlers Buch Zusammengefassten verstanden. Der Artikel handelte mehr von des ‚Pop‘-Philosophen (wie Weißler betitelt wurde) schöner Freundin, die, selbst eine Philosophin, sich zuerst als Model, wie es in dem Artikel hieß, ‚durchgeschlagen‘ hatte, bevor sie, vermittels der Berühmtheit ihres Lebensgefährten, jener Aufmerksamkeit teilhaftig geworden war, die ihr eigentlich schon vor seinem Ruhm gebührt hätte. Es war ein Frauenmagazin, das Sebastian durchgeblättert hatte. Vergeblich versuchte er aus dem Artikel herauszulesen, worin die denkerische Leistung der Model-Philosophin bestanden haben sollte, die, wenn sie in gedruckter Form vorläge, sicherlich nicht wenig einschlägig wäre, wie Sebastian dachte.
Helgas Hund blickte, zu Sebastians Füßen liegend, auf, als sich dieser nun doch erhob, um das Radiogerät lauter zu stellen.
Die eigentliche Gesprächsrunde über Weißlers zwar nicht erstes, aber neuestes und vorgeblich bahnbrechendes Werk, hatte erst begonnen. Ölig weich eine nicht gerade leicht nachvollziehbare Frage formulierend, wandte sich der Moderator an einen der Philosophen, der, nach einem Räuspern, den offenbar ebenso wenig leicht nachvollziehbaren Versuch wagte, das in Weißlers Buch Dargestellte der Hörerschaft zu vermitteln: Der eigentlich interessante Gedanke, so der Philosoph, bestehe darin, dass die Welt, laut Weißlers Untersuchungen, in Wirklichkeit gar nicht existiere; nicht, weil sie nicht etwa in actu existiere, sondern weil das denkende Subjekt nicht vermöge, sich seiner Beteiligtheit an dem, was Welt sei, zu entschlagen, sprich (der Philosoph verwendete, so wie Bruno das Wörtchen ‚genau‘, ebenso häufig das Wörtchen ‚sprich‘) aus der Welt herauszutreten. Da sei nun einmal ‚gleichsam‘ die ‚axiomatische Annahme‘ des Philosophen Weißler. Es handle sich dabei um einen ‚radikalen Realismus‘, den Weißler ja, wie bekannt sei, vor einem Jahr an einem heißen Juliabend in Rom mit seinem Freund und Mitdenker Karl Rank, ausgerufen habe, indem die beiden Denker sich durch ein Fachblatt an die denkerische Öffentlichkeit gewandt hatten, diesem Ausruf zu folgen, um ‚gleichsam‘ ein neues Zeitalter des ‚fühlenden Denkens, in dem nichts unmöglich sein soll‘ auszurufen. Das aber wolle er nur am Rande für die ‚Hörerinnen und Hörer ins Gedächtnis rufen‘. Es sei also insofern ein ‚radikaler Realismus‘, als er sich ‚diametral‘ vom Konstruktivismus unterscheide, indem dieser behaupte, es gebe in einer Situation nur so viele Glieder, wie es Glieder gibt; was man sich konkret so denken könne: Man sitze hier im Radiostudio in Wien und so gebe es die Hörerschaft, das Radio und das Thema, über das geredet werde; der ‚radikale Realismus‘ jedoch gehe davon aus, dass es zu jedem Bezugspunkt der Realität einen weiteren Bezugspunkt gäbe, indem er denselben von innen heraus konstruiere, wobei man sich das Ergebnis wie ein Netz vorstellen könne. Der Moderator fragte, ob er dies anhand eines Beispiels den ‚Hörerinnen und Hörern‘ näher erläutern können; das sei ja doch ‚durchaus kompliziert‘. Nein, da dürfe man, so der Philosoph, nicht zu kompliziert denken und so sagte er: „Stellen Sie sich vor, Sie lesen ein Buch, wobei Ihnen jemand zuschaut. Für den Konstruktivismus gibt es das Buch, den Leser, den Zuschauer. Für Weißler jedoch gibt es das Buch, das Buch für den Leser, das Buch für den Zuschauer; und, weiter gesprochen, gibt es laut Weißler den Zuschauer für den Zuschauer, den Zuschauer für das Buch und so weiter …“ – Man müsse sich also, so der Interviewte, die Welt wie ein großes Geflecht vorstellen, in dem die Interaktionen nicht mehr einseitig perzipiert werden dürfen, sondern man ‚gleichsam‘ eine Perspektive des ‚äußeren Innen‘ und ‚inneren Außen‘ einnehmen müsse, was ja bekanntlich auch Weißler in seinem neuesten Werk sehr schön mit Gedichten von Rilke illustriere, in welchen – vor allem im Stundenbuch – die Perichorese der Dinge gewürdigt würde. Der Moderator sagte: „Wir sollten hier vielleicht das Wort ‚Perichorese‘ als Durchdringung …“, aber der Interviewte unterbrach ihn: „Richtig, als Durchdringung begreifen. Das ist ein aus der russischen Orthodoxie entlehnter Begriff, genauer, aus der Dogmatik, durch welchen die wechselseitige Durchdringung der drei Hypostasen der Trinität bezeichnet wird.“ – Rilke nun habe dieses Gefühl der Durchdringung, das ja auch ‚gleichsam eminent‘ ein Gefühl des Weltzusammenhangs sei, in seiner Philosophie des ‚Außen ist Innen und Innen ist Außen‘ gelebt und ‚kongenial‘ in seinen Gedichten darzustellen gewusst; Weißler nun falle hier der Verdienst zu, das von Rilke und vielen anderen im Laufe der Geistesgeschichte ‚gleichsam‘ nur mystisch Empfundene in klare Kategorien überführt zu haben, wobei Weißler auch Konsequenzen fürs eigene Handeln und für den Diskurs ziehe; wobei sich Weißler auch dieses Begriffes zu Genüge bediene, um darzustellen, dass kein Diskurs nur an sich selber Genüge finde, sondern nur im Rahmen eines Netzwerkes ‚konfigurierter Interaktion‘ Sinn habe.
Nachdem der Philosoph geendet hatte, fragte, seine Frage noch zögerlich, in stirnrunzelndem Nachdenken sich bilden lassend, der Moderator, inwieweit Weißlers Thesen dem Zeitgeist entsprächen, zumal der Gedanke des ‚Netzes‘ in ‚unserer vernetzten Zeit‘ auf der Hand liege. Wieder räusperte sich der so Gefragte und setzte an: dass natürlich jede Philosophie einer zeitgeistigen Strömung ihre ‚Reverenz‘ erweise, sie aber nichtsdestotrotz als ‚gleichsam‘ eigenständige Substanz, wenn man das so plakativ und ‚salopp‘ sagen wolle, wahrgenommen werden müsse, da nur die konzentrierte, aus dem Zusammenhang gerissene Betrachtung, ‚gleichsam‘ im Stile der ‚epoché‘ der Phänomenologen, einen Anhaltspunkt bieten könne für ein der Sache gemäßes Verstehen, wobei man natürlich, wenn man sich an die Sache aus diesem Blickwinkel herantaste, durchaus die Geschichte und den Diskurs mit ins Spiel nehmen dürfe, um nicht einer solipsistischen, ‚gleichsam‘ autistischen Betrachtungsweise zu verfallen …
Sebastian erhob sich, schaltete das Radio ab und setzte das Schälen der Äpfel fort. Es war still im Haus. Die Katzen bewegten sich lautlos, der schwarze Hund schlief, der andere Hund war im Garten, Lydia befand sich bei ihrem Pferd im Stall und Helga war weggefahren, um Einkäufe zu erledigen. Die Ausführungen des langsam und gewählt sprechenden Philosophen – er sprach so, als ob er jedes einzelne Füllwort, deren er viele gebrauchte, zehnmal abwägen müsste – hatten in Sebastians Kopf eine sonderbare Leere erzeugt. Er betrachtete den Apfel, den er in der Hand hielt, und sah dann aus dem Fenster. Es war sehr warm für einen Septembertag, und es schien die Sonne. Sebastian war, als könne er sich, im Überschwang eines kitzelnden Augenblicks, in den im Garten im Erdreich wühlenden Hund hineindenken. Es wühlte und grub in ihm und schwere, trockene Erdklumpen warfen sich ihm ins Gesichts; er grub und grub, bis er auf etwas Hartes stieß, ein Stück Stein; dann trat er einen Schritt beiseite und grub an einer anderen Stelle weiter, so lange, bis er ausglitt und auf etwas Flüssiges stieß. Dann macht er kehrt und trottete durch den Garten, in dem schon seit Jahren verstreutes Plastikspielzeug lag, das eines der Nachbarskinder, als es sich mit seinen Eltern hier aufhielt, vergessen hatte. Über eine der Plastikgießkannen wucherte schon etwas Moosartiges und in zwei, drei Jahren würde die Erde diese Kanne vielleicht schon ganz verschluckt haben; so wie Bäume, die an Maschendrahtzäunen wachsen, diese überwuchern und den Zaun in sich aufnehmen; gerade so, als hätte der Baum einen Mund, der sich auf immer und ewig um den Zaun schließe, ihn nie mehr wieder loszulassen. Sebastian fühlte plötzlich einen seltsamen Ekel in sich aufsteigen und schüttelte sich. Ein Apfel fiel zu Boden. Der Hund, aus seinem Schlaf gerissen, erschrak, stieß an Sebastians Fuß.
„Ach, lass liegen“, sagte Sebastian zu dem Hund. Der blickte ihn an, groß und erwartungsvoll. „Blödsinn“, sagte Sebastian und hob den Apfel auf, um ihn zur Abwasch zu tragen. Dort wusch er den Apfel und legte ihn ungeschält in die Schale. „So, steh auf“, sagte er zu dem Hund, der gehorchte, sich streckte und reckte und begann, Sebastian nachzutrotten.
„Ich gehe jetzt in den Garten und du gehst da jetzt auch hin und pinkelst dann, ja?“ Der Hund blickte Sebastian an. „Du sollst Lulu machen gehen“, sagte er und lachte dabei. Plötzlich war ihm nach Lachen zumute. „Lulu geh machen, ja, gelt, Lulu!“, rief er dem Hund zu, der, sich immer ungestümer bewegend, es gar nicht mehr erwarten zu können schien, weiteren Anweisungen Sebastians Folge zu leisten.
Der September verging, nachdem er so manchen sonnigen Tag ins Land gesandt hatte, windig und regnerisch. Von abweisender Widersinnigkeit wie das Wetter erschien Sebastian auch der Besuch der Universität, deren entweder überheizte, unterkühlte oder stickige Säle nur ein Gleichnis und Bildnis für jene innere Gestimmtheit abgaben, die ihn schon seit mehreren Jahren daran hinderten, Sinn und Zweck der ihm angedeihenden Ausbildung klar ins Auge zu fassen, ohne dass er dabei die Kraft und den Mut gefunden hätte, entweder den angestrebten Zweig der Ausbildung zu wechseln oder gar auf einen Besuch dieser ‚Anstalt‘, wie er sie nannte, zu verzichten. Der durch diese Unschlüssigkeit verursachte Zwist mit seiner eigenen Redlichkeit war ein weiterer Grund, ihm schon die schiere Anwesenheit in diesen Räumen zu verleiden. Schon vor zwei Jahren hatte sich Sebastian gesagt: ‚Ich muss etwas tun, ich muss etwas dagegen tun; ich muss etwas erleben. Das ist nicht das Leben. Das macht mich krank.‘ – Und doch hatte er nichts getan, hatte Jahr um Jahr in nicht gerade vorbildloser Anständigkeit seine wissenschaftliche Ausbildung durchlaufen, so wie Menschen eben, die ihrer Arbeit überdrüssig sind, diese durchführen, weil sie nicht anders können, weil sie es sich nicht ‚leisten‘ können, auf diese Arbeit zu verzichten. ‚Ich kann es mir nicht leisten, ich kann es mir nicht leisten‘, hatte auch Sebastian immer wieder für sich selber wiederholt; dann jedoch, wenn er sich fragte, worin dieses Leisten bestünde und worin auch der Verlust, würde er dem zwar nicht Gehassten, aber ihn in verschiedener Weise seelisch Drückenden den Rücken kehren, fand er darauf keine Antwort; und wenn er eine fand, so ließ ihn diese nur mit einem Entsetzen zurück, gerade so, als ob ein plötzlicher Ekel vor seiner eigenen Person Besitz ergreife von ihm; ein Ekel, gerade noch unscheinbar und klein genug, als dass dieser nicht die Kraft hatte, ihn entweder vor inneren Schmerz zu zerfressen oder eine Änderung in dem Drückenden herbeizuführen. Dass dieser Ekel mit so lascher Halbheit ihn fasste, schwärzte zusätzlich zu aller Missgestimmtheit Sebastians Gemüt. Gerne hätte er den großen Ekel empfunden, einen ‚gigantischen Hass‘, wie er einmal zu einem guten Freund gesagt hatte; denn ihm schien in solchen Moment des Halbhalben, dass erst der große und ganze Hass und der große und ganze Ekel befreien könnte; dass erst in dem Nichtgedachten, in dem Unüberlegten, in dem nicht von der Angst Zerfressenen sich der Ekel Bahn brechen könne, weil er so groß würde, so übermächtig groß, dass er, wie das Moos die Gießkanne, alle Angst überwuchere und in sich einsauge wie eine Schlange ihre Beute, mag sie noch so groß sein, mag sie auch so groß sein, dass die Schlange an dieser Beute innerlich zerplatze, und so groß auch, dass sie tatsächlich zerplatze: dass also ihre Haut reiße und alles Gedärm sich ihr entwinde, samt der Beute, samt allen Eingeweiden. Solch einen Hass und Ekel hätte sich Sebastian gerne herbeigewünscht; und ihm schien, dass einer der Gründe, weshalb er solcher Aufwallungen nicht fähig sei, in Lydia bestünde. Nicht in ihrer Lethargie und langsamen Verfasstheit, sondern darin, dass sie einfach da war: er hatte eine Freundin; und manchmal hasste er sich dafür; aber der Hass reichte nicht aus, um den einen großen Hass zu bilden und zu gestalten, der es vermocht hätte, eine Veränderung herbeizuführen. Das spürte und wusste Sebastian; und indem er es spürte, hasste er Lydia. Aber das war kein Hass, nur ein Hässchen, kein Ekel, sondern ein Ekelchen, etwas nicht Ganzes, etwas Halbes, etwas, im Grunde, Unwürdiges. Was war es dann? Indolenz? Feigheit? War es ein Sicheinrichten im Leben, in den Gewohnheiten; eine rein intellektuelle Einstellung, eine Verkostung der Dinge des Lebens, eines Lebens, das immer die anderen lebten, man selber aber niemals? Man verkostete da ein bisschen, dort ein bisschen, schließlich war man ja gebildet; man las hier ein bisschen, dort ein bisschen; informierte sich da ein bisschen über diese und jene gedankliche Strömung, las und studierte ein bisschen diese Theorie und jene Gedanken, aber leben … das sollen die anderen machen. Sebastian schien es trivial, sich solche Vorwürfe zu machen; und gerade darin, dass es ihm trivial erschien, glaubte er einen Hauch der Möglichkeit wahren Lebens in sich auszumachen; dann beherrschte ihn eine Vorfreude und Gewissheit. Fand er diese Gedanken jedoch nicht trivial, sondern spann er sie, gerade so, als ob es keine besseren gäbe, dann war ihm, als ob alles so wäre wie ein Septemberwetter: bald herbstlich, bald nachsommerlich, dann aber wieder grau und regnerisch; es schien ihm dann alles eintönig, farblos und dumm.
An einem solchen Tag dummen Zwistes mit seinem eigenen Gemüt besuchte Sebastian die Vorlesung von Professor Wilmitsch, nachdem er erfahren hatte, dass dieser der Onkel des nun allerorten gelobten Geronimo Weißler war. Nachdem Wilmitsch, ein oft, viel und gern lächelnder Mann von kaum fünfzig Jahren, im Zuge eines Symposiums ein langes Gespräch mit Sebastian geführt hatte, versprach ihm dieser, regelmäßig seine Vorlesungen zu besuchen. Er tat es, weil er nicht wusste, was er sonst tun sollte; und er tat es, weil er sich verpflichtet glaubte, den Professor nicht zu enttäuschen. Man sprach oft miteinander; der Professor entpuppte sich als nicht nur leutselig, sondern gar als freundschaftlich, einladend und ‚einfach‘. Er lud Sebastian zu Vorträgen ein; man sah einander oft, stand manches Mal vor dem Kaffeeautomaten, scherzte und plauderte. Ein Jahr verging, bis Wilmitsch Sebastian den Vorschlag machte, dieser solle doch sein Assistent werden: „Sie sind ja so belesen, Herr Calan! So einen wie Sie, der den Schopenhauer auswendig kennt, brauche ich, wissen Sie. Worüber wollen Sie eigentlich Ihre Diplomarbeit schreiben? Wissen Sie das schon? …“ – und Wilmitsch ließ nicht ab, Sebastian zu bedrängen, freundlich lächelnd und ihm immer wieder einen oder mehrere Kaffees aus dem Automaten spendierend.
3
„Und, und?“, fragte Bruno, nachdem Sebastian den Hörer aufgelegt hatte: „Wie fühlt sich das jetzt an? Jetzt freust du dich sicherlich, oder? Gratulation jedenfalls“, sagte der dicke Mann und reichte Sebastian seine Hand.
„Also, ich muss jedenfalls sagen, dass ich mich freuen würde, ich meine: das kommt ja nicht alle Tage vor, dass dich einer anruft und dich bittet, ich meine: bittet!, bei ihm zu arbeiten, und wir reden hier nicht vom Bau oder von einem Kebabstand oder von sonst etwas, sondern von der Universität, genau. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich so alt war wie du, Sebastian, damals, wie das mit den Fliesen war, da hab ich auch einmal einen Anruf bekommen von meinem Chef – das war übrigens ein Cousin dritten Grades vom Fendrich, vom Rainhard, meine ich –, da hab ich einen Anruf bekommen von dem und der hat gesagt: ‚Herr Wald, wir haben da so einen Fall und so weiter …‘ – so, wie die Hollywoodstars immer sagen: ‚Und eines Nachmittags, da hat mich der Woody Allen angerufen und hat mich gefragt, ob ich einen Film mit ihm machen will.‘ So hat sich das angefühlt, genau. Ich meine: Ich war gut in meinem Metier, das darfst du nicht vergessen, ich meine, ich war kräftig, ich war sportlich damals, wie gesagt … und das war nicht so wie heute. Heute kannst du nichts machen, du bist total im Abseits, genau. Du gehst ins Arbeitsamt: nichts, zum Vergessen. Du kennst wen – das kannst eigentlich auch vergessen. Das ist heute alles nur eine Freunderlwirtschaft, und deshalb bin ich auch auf der Seite der Grünen, nicht, weil ich ‚Wald‘ heiß, haha … weil die Grünen sind gegen Freunderlwirtschaft, genau.“
„Das hat es immer schon gegeben“, sagte Sebastian, noch immer beim Telefon stehend.
„Ja, ich weiß, ich weiß, schon die alten Römer waren korrupt, ich weiß. Ich hab da neulich, das war gestern, abends im Fernsehen eine Doku erwischt. Da hab ich mich echt gewundert. Die haben gesagt, dass die Römer in ihrem Bauwesen extrem korrupt waren. Deshalb sind die Mietskasernen auch dauernd zusammengestürzt: wegen der konkurrierenden Baufirmen, ich meine: Stell dir das vor! Schon vor mehr als zweitausend Jahren, das ist der helle Wahnsinn, der Mensch ändert sich gar nicht!“
„Eben, ich sage ja, dass es Freunderlwirtschaft schon immer gegeben hat“, wiederholte Sebastian, gereizt und sinnlos.
„Und du hast damals echt einen Waschbrettbauch gehabt?“, tönte es aus der Küche. Bruno wandte sich mit einem Mal rasch um, klopfte auf seinen Bauch und versetzte: „Ja, hab ich, in der Tat!“
„Und du hast echt keine Fotos aus der Zeit mehr?“, fragte Beate.
„Warte, jetzt, wo du’s sagst. Wart da, warte, ich geh schnell nachschauen“, sagte Bruno und ging über den knarrenden Parkett in sein Zimmer, vorbei an dem Aquarium, in dem die kleine Schildkröte, sich soeben auf eine kleine Insel setzend, die Beate vor wenigen Wochen in einem Haustierladen erworben hatte, ihr Köpfchen in die Luft streckte. Bruno klopfte im Vorbeigehen auf das Glas des Wasserbehälters.
„Ah, hallo, Caro“, sagte er, die Schwelle zu einem hinter dem Gemeinschaftszimmer liegenden kleinen Raum überschreitend. Die vierte Mitbewohnerin trat, langsam und wie verschlafen, in die Diele, schwieg zuerst und wandte sich dann weder an Beate noch an Sebastian noch an beide zugleich, sondern vielmehr an eine Allgemeinheit, der sie ihre in die Stille hinein gestellte Frage zu überantworten schien.
„Was soll ich machen?“, fragte sie schleppend, während sie sich langsam mit der linken Hand durchs zerwühlte Haar fuhr: „Was soll ich machen? Der Jan ruft nicht an.“
„Wird schon anrufen“, sagte Beate, ohne sich Carolina zuzuwenden, noch immer die Kartoffeln schneidend.
„Aber was, wenn er nicht anruft? Was soll ich dann machen?“
„Dann ruf selber an“, entgegnete die junge Frau, wobei sie wieder das Fenster in den Innenhof öffnete und sich eine Zigarette anzündete.
„Nein, ich ruf ihn sicher nicht an. Soll ich mich erniedrigen, oder was?“
„Du willst ja etwas von ihm, oder?“, fragte Beate. Sebastian stand nur da und hörte den beiden zu.
„Wer sagt, dass ich was von ihm will?“, entgegnete Carolina, indem sie ihrem Tonfall etwas Gereiztes und Angriffslustiges verlieh.
„Warum soll er dich dann anrufen?“
„Weil er anrufen soll. Was … ich … was meinst du …?“
„Entweder du willst was von ihm oder du willst nichts von ihm“, versetzte Beate, die sich zum Fenster gestellt hatte.
„Ah, du verstehst das nicht, du bist zu jung, warum rede ich überhaupt mit euch?“, sagte Carolina, schon wieder im Begriff, sich in ihre selbstgewählte Klausur zu begeben.
„Euch?“, fragte Sebastian. Aber schon im nächsten Augenblick ärgerte er sich über diese Frage.
„Ja, euch. Ihr versteht das nicht, wie das ist, wenn man … wenn man … ach!“, sagte die Schmerzbeladene von Neuem und wandte sich in einer weiteren Drehung dem Aquarium zu; um aber wieder stehen zu bleiben, gerade so, als ob sie angewiesen sei auf eine Entgegnung, ohne die sie, sei sie auch noch so fadenscheinig, nicht weiter leben zu können schien. ‚Weiter zu vegetieren‘, dachte Sebastian und er seufzte, in sein Zimmer gehend, um das für die Fahrt nach Blumau Notwendige einzupacken.
„Was ist, wohin gehst du?“, fragte Carolina. Sebastian spürte einen Groll aufsteigen und zugleich war ihm, als ob er lachen müsse, ein abgehacktes, verächtliches Lachen; er unterdrückte es und sagte: „Ich muss einpacken. Ich fahre heute zur Lydia.“
„Ach, du hast es gut“, jammerte Carolina. „Du kannst irgendwohin fahren, und ich muss hierbleiben und … ach, du hast es so gut.“
„Du kannst ja auch hinausgehen, es hindert dich daran doch keiner, oder?“, fragte Sebastian, wobei er die im ersten Teil der Frage liegende Wut durch eine rasch eingestreute Gutmütigkeit im Ton zu verbergen wusste.
„Ja, schon, aber wo soll ich denn hingehen?“, erwiderte sie und, nach einer Pause: „Wieso ruft er nicht an?“
„Caro, bitte. Jetzt ist doch erst ein Tag vergangen“, sagte Beate.
„Ja, aber trotzdem, du verstehst das nicht.“
„Und wieso redest du dann mit mir?“, fragte Beate.
„Ich hab da was gefunden!“, rief Bruno mit lauter Stimme aus seinem Zimmer. „Ich hab da wirklich was gefunden!“
„Ich red ja gar nicht mit dir. Ich meine, nicht speziell mit dir, ich meine, ich rede einfach nur so“, sagte Carolina.
„Aha“, sagte Beate, den Qualm der Zigarette ausstoßend, und, in Richtung Bruno rufend: „Ja! Warte, ich komme gleich, ich bin schon gespannt!“
„Was hat der Bruno gefunden?“, fragte Carolina.
„Irgendwelche Bilder aus der Zeit, wo er Fliesen gelegt hat.“
„Aha. Beate. Verstehst du mich?“
„Ja, ja, ich versteh dich schon.“
„Wieso ruft er dann nicht an? Ich werde noch ganz wahnsinnig.“
„Geh ein bisschen spazieren, das hilft dir sicher, Caro, dann kommst du auf andere Gedanken.“
„Beate!“, rief es aus dem Hinterzimmer.
„Ja, warte, ich komm gleich!“, rief die Angesprochene zurück. Man hörte Bruno lachen.
„Nein, ich mag nicht spazieren gehen. Es ist so kalt draußen und so nass. Hast du was Süßes zum Essen?“
„Du hast gestern gesagt, dass du auf Diät bist“, sagte Beate.
„Jetzt ist mir alles egal, alles, alles …“, antwortete Carolina, weinerlich und gereizt zugleich.
„Ja, du weißt doch, wo die Schokolade ist.“
„Nein, Schokolade mag ich jetzt keine haben.“
„Na, dann geh runter und kauf dir etwas. Der Türke ist ja gleich ums Eck“, sagte Beate.
„Ich kann nicht, ich kann einfach nicht. Verstehst du: Ich kann nicht, mein Leben …“, seufzte Carolina.
„Wann musst du in die Arbeit heute?“, fragte Beate.
„Am Abend erst. Wir haben heute Nachtschicht.“ Carolina arbeitete in der Technikabteilung des Rundfunks. „Warum fragst du? Geh ich dir schon auf die Nerven, oder was? Ja, ich kann das verstehen, dass ich dir auf die Nerven gehe“, sagte sie, mit einer um Anerkennung heischenden Weinerlichkeit in der Stimme.
„Nein, du gehst mir nicht auf die Nerven. Ich dachte nur, wenn du dann gehst, dann kannst du mich vielleicht im Auto mitnehmen.“
„Ja, kann ich. Wo musst du denn hin? Beate, ich versteh das nicht.“
„Beate!“, rief Bruno wieder.
„Ja, ja, ich komm ja schon“, rief Beate und ging raschen Schrittes ins Hinterzimmer. Carolina seufzte, stand eine Weile unschlüssig in der Diele, wippte hin und her, fuhr sich durchs Haar. Sebastian, mit einem kleinen Rucksack bepackt, trat aus seinem Zimmer.
„Ja, du gehst jetzt auch. Alle gehen irgendwohin. Nur ich muss dableiben. Und dann kann ich in die Scheißarbeit gehen und dann komm ich wieder nach Hause und morgen und übermorgen dasselbe … Schau, es wär ja alles nicht so schlimm, wenn er anrufen würde. Diese Ungewissheit, verstehst du, diese schreckliche Ungewissheit! Warum macht er das, warum quält er mich? Aus Rache? Warum will er sich … nein, aber wenn er glaubt … er braucht gar nicht glauben … Ich kann auch Rache üben, oh ja, das kann ich auch … aber wenn er nicht so wär, wie er wär, also, wie er ist, seine schöne, oh ja, ich kann das auch, und wie ich das kann, das wird er noch sehen, aber ich li… das, nein, nein … oh Gott, warum ist … seine …. Ich …“
„Wo wohnt er denn?“
„Was? … Wohnen? … Wieso? … Im Siebenten.“
„Na, dann fahr hin und läut bei ihm an. Es tut dir vielleicht gut, wenn du ein bisschen hinauskommst, oder?“
„Was hinfahren, wie hinfahren?“
„Zu ihm hinfahren, ganz einfach.“ – Sebastian war dieses Gespräch zuwider. Er wollte Lydias Halbbruder, mit dem er nach Blumau mitfahren konnte, nicht warten lassen; auch empfand er die bewegungslose Unentschlossenheit Carolinas wie eine an seinem eigenen Leib klebende Unsauberkeit, deren er sich an der frischen Luft entledigen zu können glaubte.
„Nein!“, rief sie, plötzlich leidenschaftlich werdend: „Ich fahre sicher nicht hin! Bist du wahnsinnig! Zu ihm! Zu diesem … Ich, ha! Nein, eher krepiere ich hier, dass ich zu ihm hingehe oder fahre oder von mir aus auf allen Vieren trotte, nein!“
„Na schön, dann weiß ich auch nicht, was ich sagen soll“, versetzte Sebastian, rief einen Gruß, den auch die beiden soeben im Hinterzimmer Kichernden hätten hören können, und trat aus der Wohnung.
In den hohen Korridoren des Altbaus lauerte die Herbstkälte. Schon allein der Anblick der alten Mauern machte einen frösteln. Als Sebastian ins Freie trat, ärgerte er sich. Er hatte seinen Regenschirm vergessen. ‚Und das wegen dieser Carolina.‘ Es nieselte. Der Asphalt war schwarz. Der Ärger machte aber bald einem Gefühl der Befreitheit Platz. Sebastian dachte an das Buch, das er soeben eingepackt hatte. Das erste, die Arbeitsbelange sondierende Treffen mit Professor Wilmitsch schien plötzlich nicht mehr die den Körper von allen Seiten beengende Dichte einer die Gedanken lähmenden Wirklichkeit zu haben, sondern löste sich in dem sprühenden Nieselregen auf wie Sand, den man aus der Hand wirft. Die Gleichgültigkeit, in die sich der Geist geflüchtet hatte, hatte zwar nicht gänzlich einer Zuversicht Platz gemacht, war aber hier, an der frischen Luft, ihrer Wirklichkeit beraubt worden.
Sebastian hatte oft schon ähnliches empfunden: dann, wenn ihm eine Aufgabe als unüberwindlich oder als die eigenen Pläne zeitvergeudend durchkreuzende Bürde erschien, vermochte ein Aufenthalt im Freien und an der frischen Luft die Dinge wieder in ihr rechtes Maß zu rücken. ‚Das vorgebliche Leid der Menschen und ihre Beengtheit und Beklemmungen rühren daher, dass sie sich zu oft und zu regelmäßig in geschlossenen Räumen mit niedrigen Decken aufhalten. Wenn sie, um eine Schwierigkeit zu bewältigen, zuerst ins Freie träten, sähen sie die Größenverhältnisse zwischen dem als unüberwindlich Eingestuften und dem, was einfach zu verwinden wäre‘, hatte Sebastian nicht nur einmal erst gedacht. Er erinnerte sich jetzt an eine Nacht in den Alpen. Er hatte dort, in einer Alpenhütte übernachtend, das erste Mal in seinem Leben den ganzen Sternenhimmel gesehen. Ihm war, als ob der blaue Himmel des Tages ein künstlich eingezogener Plafond sei, der einer gigantischen Glaskuppel gewichen wäre, die es ihm ermöglichte, in die Tiefe des Alls zu schauen. Er erinnerte sich, wie ihn damals ein seltsamer Schauer überrieselt hatte, gerade so, als fiele er, je tiefer er in die Tiefe dieser sternerhellten Dunkelheit blickte, in dieselbe hinein; ihm war, als sei ihm der Boden unter den Füßen weggezogen worden und als stünde er auf einer dünnen Kruste; ja, nachgerade so, als schwebe er zwischen einer schmalen Erde und einem unermesslich weiten Himmel.
Sebastian hörte das Hupen zuerst nicht.
„Ah, du bist schon da!“, rief er dann und stieg in Gerhards Auto. Lydias Halbbruder war der Sohn von Lydias Vater. Er war von ähnlich stillem und schweigsamem Wesen wie seine Halbschwester und zeichnete sich überhaupt durch eine ganz passable Mittelmäßigkeit aus, die ihm den Anschein eines Gegenstands verlieh, den man beachtete, wenn einem gerade danach war, oder dem man keine Aufmerksamkeit schenkte, wenn dies geboten zu sein schien. Sebastian war heute nach Letzterem zumute, was ihm durch Gerhards angeborene Schweigsamkeit kein sonderlich schlechtes Gewissen bereitete. Das Autoradio lief und Sebastian, der Gerhard schon einmal gebeten hatte, es doch bitte etwas leiser zu schalten, erwähnte den Lärm nicht mehr.
Als man nach etwa einer Dreiviertelstunde Fahrt in die Ortschaft gelangte, bat Sebastian, Gerhard möge ihn doch bitte hier schon aussteigen lassen.
„Was, magst du schon hier aussteigen?“
„Ja, ich bin heute noch kaum zu Fuß gegangen. Sag der Helga, dass ich später komme. Sie ist ja selber erst am Abend da, oder?“
„Ja, schon. Na gut, von mir aus. Dann nehme ich deine Tasche mit, oder?“
„Ja, bitte, das ist aufmerksam, danke.“ – Und Sebastian stieg aus, beinah verwundert über die ihm geltende Höflichkeit eines Menschen, mit dem gewichtige Worte zu wechseln ihm nie ein Bedürfnis gewesen war.
‚Es hat wohl nur in Wien geregnet‘, dachte Sebastian, als er in eine von der Hauptstraße abzweigende Waldlichtung bog. Es flirrten, wie lästige Mücken, plötzlich Verse in seinen Gedanken und er sagte sie sich vor, die Hände in die Jacke steckend, lauter murmelnd, im Wissen, dass ihn hier im beginnenden Wald niemand hören würde: „Es klärt der Saum am Himmel sich … es klärt sich auch mein Sinn …“ Das Wort ‚Saum‘ schien ihm in diesem Augenblick besonders schön und passend und darum wiederholte er immer wieder: „Saum des Himmels. Himmelssaum.“
Er seufzte, trat vorsichtig über einen auf der sandig werdenden Straße liegenden Ast und wiederholte das Wort. Dann blieb er stehen, blickte in den Himmel hinauf. ‚Warum mache ich das?‘, fragte er sich und zwang sich schneller zu gehen. ‚Luft, Luft, freie Luft!‘, dachte er und, im nächsten Augenblick, murmelnd im Abwägen der Worte, sagte er sich: ‚Freie Luft ist ein Blödsinn. Die Luft ist immer frei.‘ – Und dann blieb er plötzlich stehen, griff nach Stift und Papier und begann, etwas auf den kleinen Zettel zu notieren. Nachdem er es notiert hatte, strich er es heftig durch, las es durch, notierte etwas Neues, blickte bald nach links, bald nach rechts, senkte wieder den Kopf und setzte das Schreiben fort. Dann steckte er den Stift wieder weg, faltete das Papier und setzte sein Murmeln fort: ‚Saum des Himmels. Die Nacht hat keinen Saum. Die Sterne sind Löcher im Himmel‘, dachte er und erinnerte sich an ein Gedicht, an das er schon lange nicht gedacht hatte, an ein eigenes Gedicht in freien Rhythmen, in dem ihm das Bild von Sternen als Löchern im Himmel der Nacht sehr wirkungsvoll erschienen war.
Er ging weiter, immer wieder tief einatmend, bis er an einen Bach gelangte. Er stellte sich ans Ufer und dachte: ‚Das ist kein Ufer, das ist eigentlich ein Saum.‘ Dann ärgerte er sich wieder über sich: dass ihm das Wort ‚Saum‘ nicht aus dem Kopf gehen wollte; er entnahm seiner Jackentasche den Zettel, las das Geschriebene erneut durch, schürzte die Lippen und steckte den Zettel wieder ein. Es standen Birken am Rande des Bachs. Ihre herabhängenden Zweige winkten ihren im metallenen Glanz des Bachs schwimmenden Spiegelbildern windig zu. Es war eine abschüssige Stelle, an der Sebastian einmal Angler gesehen hatte. Jetzt schien hier in der Gegend keine Menschenseele sich aufzuhalten. Eine Ente ließ sich im Strom des Bachs treiben. Jenseits der Birken war ein Feld, das begrenzt wurde von einer dunklen Baumreihe. Überall Stille und nur das plätschernde Kräuseln des Wassers. Der Waldboden war weich von den absterbenden und sich farblich dem Erdboden anpassenden Blättern. Sebastian ging weiter, gedankenlos und die Hände in die Taschen versteckt. Er dachte an Wilmitsch; dachte daran, dass dieser jetzt vielleicht in seinem Büro säße, seine Pfeife rauchte; dachte daran, dass in dem Zimmer wohl eine sehr stickige Luft herrschte, und plötzlich empfand er wieder das Bedürfnis, etwas Unangenehmes und Hinderliches von sich abzuschütteln.
Der Waldweg mündete in eine Art Allee aus Föhren. Föhren erinnerten Sebastian immer an Nachmittage; Birken hatten für ihn etwas von Abend. ‚Warum ist das so?‘, fragte er sich und ging weiter. Am Kopf der Allee öffnete sich eine Lichtung, an deren linkem Ende, beschattet von hohen Bäumen, deren Namen Sebastian nicht kannte, sich ein Gasthaus befand. Ohne nachzudenken, betrat er es. Er setzte sich auf eine Eckbank. Es herrschte erstaunlich viel Betrieb in der kleinen Gastwirtschaft, sodass sich der Wirt, ein magerer alter Mann von, dem Aussehen nach, mindestens siebzig Jahren, durch die bei der Schank stehenden Gäste zwängen musste, indem er immer wieder sagte ‚Gestatten, gestatten‘. Sebastian bestellte einen Apfelsaft.
Einige Tische weiter saßen drei Männer. Sebastian sah nur den Hinterkopf des Sprechers, dessen halblanges, ins Rötliche spielende Haar ihn an jemanden erinnerte, ohne dass ihm eingefallen wäre, an wen. Die drei unterhielten sich angeregt und, im Gegensatz zu den anderen Anwesenden, in klarem und – Sebastian fühlte hier die Eigenschaft – spitzem Deutsch, so als ob sie einander von etwas überzeugen wollten, ohne dabei aber ihre Stimmen erheben zu müssen. Unwillkürlich wurde seine Aufmerksamkeit in die Richtung des Gesprächs gelenkt, als der mit dem rötlichen Haar sagte: „Du verstehst das nicht, Karli. Er ist ein Mann, der nicht hinausgeht, wenn’s auch nur ein bisschen geregnet hat, und der sich sofort Wollsocken anzieht, sobald es auch nur einige Grade weniger hat; einer von denen, aus deren tiefen Sehnsüchten seichte Taten steigen. Verstehst du das? Er ist aufgewühlte Erde, sonst nichts. Ich weiß: Er ist ein Verwandter von mir, na und? Zu was verpflichtet mich das? Ich sage dir, zu was mich das verpflichtet und ich sage es ein für allemal: zu nichts. Seine Frau soll machen, was sie will. Es ist seine Frau, was dieses ‚seine‘ hier auch weiter bedeutet, weiß Gott, was es bedeutet. Ich weiß nur, was es für mich bedeutet und zu was es mich verpflichtet, verstehst du?“
„Du sagst immer ‚seine Frau‘, ist dir das aufgefallen?“, hörte Sebastian den Angesprochenen fragen.
„Natürlich ist mir das aufgefallen, weil ich es – du wirst ja nicht so blöd sein, das nicht bemerkt zu haben – absichtlich sage. Und ich will das nicht hören, das ‚ihr habt was miteinander.‘ Wir haben gar nichts. Das, was ist, ist. Sonst nichts. Ich weiß, dass du das begreifst. Josef, du sagst nichts?“ Der Dritte in der Runde machte den Eindruck, als ob er aus tiefen Gedanken aufschreckte, sagte dann: „Nein, nein, passt schon.“
„Ja, hast recht. Besser, nichts sagen. Es sind sowieso alle Worte viel zu bewohnt. Viel zu zertrampelt von allen Menschen. Auch sie spricht zu viel.“
„Du sagst entweder ‚seine Frau‘ oder ‚sie‘, niemals aber …“
„Ja, ich weiß, lass gut sein, Karli. Übrigens, nur um das noch einmal klarzustellen: Es geht darum, dass ich mich zur Tat verpflichte. Ich. Mich. Nicht irgendwer. Die Leute sagen immer nur ‚Ich‘, meinen aber irgendwen, verstehst du? Roma locuta, causa finita. Darum geht es. Ich weiß, mein Lieber, was du jetzt sagen willst, ich kenn dich doch, aber das ist kein Dogmatismus.“
„Das behaupte ich auch gar nicht“, versetzte der mit ‚Karli‘ Angesprochene.
„Nein, ich weiß, dass du das gar nicht behauptest. Ja, lassen wir’s gut sein, stoßen wir an.“
„Um es nur abschließend zu sagen“, setzte der Sprecher an; nach einer Pause, während der er sein Bierglas auf dem Tisch hin- und herrückte, sagte er: „Ich will es. Ich will …“
„Komm, lass, das ist alles so unangenehm.“
„Ja, das Leben ist unangenehm. Sei kein Waschlappen. Entweder du ziehst die Konsequenz aus dem, was du sagst, oder du erschießt dich gleich; ich mache es so, dass ich erst die Konsequenz ziehe und mich dann, na ja … verstehst du?“ Der Schweigsame seufzte.
Sebastian winkte den Wirt herbei und zahlte. Dann verließ er das Gasthaus.
4
Das halbherzige Licht des grauen, nasskalten Oktobermorgens bleichte die Fliesen in der Küche und leuchtete in einem schneeig blendenden Milchweiß, sodass Sebastian mehrere Male blinzeln musste, als er, in der Nähe des Fensters stehend, seine Jausenbrote für den Arbeitstag belegte. Das Fenster quietschte und, wie hinter vorgehaltener Hand, hörte Sebastian Beates leise Stimme, die ein verstohlenes, verschlafenes „Guten Morgen“ hauchte. Die junge Frau stellte sich ans Fenster, reckte sich und beugte sich hinaus, ihre Zigarette in Höhe der Stirn haltend.
„Puh, es ist kalt“, sagte sie dann, hüstelnd und das Fenster schließend, sodass die dünnen Scheiben schepperten.





























