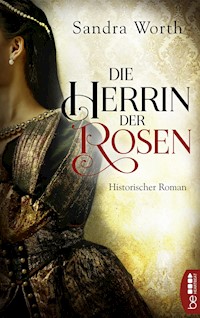
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Rosenkriege
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Vor Romeo und Julia gab es John und Isobel ...
England 1456. Die Adelshäuser Lancaster und York ringen erbittert um die englische Thronfolge. Als Isobel an den lancastrianischen Hof von Königin Marguerite kommt, stehen die Verehrer Schlange. Doch Isobel hat nur Augen für einen: Sir John Neville, einen Ritter aus dem verfeindeten Hause York. Während rings um sie ein erbarmungsloser Krieg tobt, kämpfen John und Isobel um ihre Liebe ...
Eine mitreißende und historisch belegte Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der englischen Rosenkriege - von ROMANCE REVIEWS TODAY zum besten historischen Roman des Jahres 2008 gewählt.
"Sandra Worth beweist, dass Geschichte genauso fesselnd ist wie Fiktion." Romantic Times Magazine
Lesen Sie auch Band 2 der Rosenkriege-Reihe: Die Tochter der Rosen.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 661
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
DANKSAGUNG
DIE HÄUSER York, Lancaster und Neville, 1399 bis 1476
DAS HAUS Neville
DAS HAUS Lancaster
PROLOG
ENGLAND UNTER DEM HAUS LANCASTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ENGLAND UNTER DEM HAUS YORK
19
20
21
22
23
24
25
26
27
EPILOG
ANMERKUNGEN DER AUTORIN
HISTORISCHE FIGUREN
Über dieses Buch
Vor Romeo und Julia gab es John und Isobel …
England 1456. Die Adelshäuser Lancaster und York ringen erbittert um die englische Thronfolge. Als Isobel an den lancastrianischen Hof von Königin Marguerite kommt, stehen die Verehrer Schlange. Doch Isobel hat nur Augen für einen: Sir John Neville, einen Ritter aus dem verfeindeten Hause York. Während rings um sie ein erbarmungsloser Krieg tobt, kämpfen John und Isobel um ihre Liebe …
Eine mitreißende und historisch belegte Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der englischen Rosenkriege – von ROMANCE REVIEWS TODAY zum besten historischen Roman des Jahres 2008 gewählt.
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Sandra Worth hat in Toronto Politikwissenschaft und Wirtschaft studiert und lebt heute in Houston, Texas. Sie ist Spezialistin für die englischen Rosenkriege und hat fünf historische Romane über den Niedergang der Plantagenet-Dynastie und den Aufstieg der Tudors geschrieben. Ihre Romane wurden mir zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Besuchen Sie die Homepage der Autorin: https://sandraworth.com/.
Sandra Worth
DIEHERRINDER ROSEN
Historischer Roman
Aus dem amerikanischen Englisch vonSabine Schilasky
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2008 by Sandra Worth
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Lady of the Roses«
Originalverlag: US Berkley
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2012/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven von © GettyImages/ master1305; © Istock/ master1305
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-1025-1
be-ebooks.de
lesejury.de
DIESES BUCHISTFÜR KARLA
DANKSAGUNG
Ich möchte meiner Agentin Irene Kraas für ihr Vertrauen in mich danken und meiner Verlegerin Jackie Cantor für all die Zeit und Arbeit, die sie diesem Buch widmete. Außerdem danke ich der bekannten Grafologin Florence Graving, deren Fachkenntnis mir bei der Gestaltung vieler meiner historischen Figuren half.
PROLOG
SEATON DELAVAL, APRIL 1471
»Mylady.«
Die vertraute Stimme erschreckte mich, zumal ihr auffallend sanfter Tonfall schlechte Neuigkeiten verhieß. Bangen Herzens blickte ich auf und hielt den Atem an. Tom Gower, der Knappe meines Gemahls, stand auf der Schwelle der kleinen Kammer, und seine Miene vermochte die Kälte nicht einzudämmen, die sich in mir ausbreitete. Der Umhang, an dem ich stickte, glitt mir aus den Händen, als ich mich mühsam erhob. Ich musste mich an der Stuhllehne abstützen, weil mir die Beine zitterten. Dann trat er vor, und ich erkannte, dass er einen Brief bei sich hatte. Vor lauter Erleichterung wollte ich einen Freudenschrei ausstoßen. Gelobt sei Gott, er ist nicht gekommen, um mir schreckliche Nachricht aus der Schlacht zu bringen, sondern um mir einen Brief meines geliebten Gemahls zu überreichen!, dachte ich. Mein Lächeln, als ich auf ihn zuging, war so strahlend, dass es sich anfühlte, als wollte es mir die Wangen spalten.
»Tom, mein lieber Tom, ich bitte dich, erhebe dich! Für einen Moment dachte ich … Ach, wen kümmert, was ich dachte!« Immer noch lächelnd, nahm ich den Brief entgegen und drückte ihn an mein Herz. Nun jedoch bemerkte ich, dass mein Lächeln unerwidert blieb und Toms Gesicht so blass und ernst war wie in jenem eisigen Moment, in dem ich erstmals seine Stimme vernommen hatte. »Tom, wie steht es im Krieg für die Lancastrianer?«
Er zögerte, ehe er antwortete: »Ich weiß es nicht, Mylady. Nachdem ich Mylord half, die Rüstung anzulegen, bat er mich zu gehen und Euch diese Nachricht und … diesen Ring zu bringen. Da hatte die Schlacht noch nicht begonnen.« Er griff in sein Wams. Mir fiel auf, dass seine Finger steif wirkten, als könnte er sie nur mit einiger Mühe bewegen, und seinem Blick nach zu urteilen, verheimlichte er mir etwas.
Ich nahm das Samtbeutelchen, das er mir reichte, und zog den Ring heraus. Dabei war mir, als schwebte ich außerhalb meiner selbst und betrachtete die Szenerie gleichsam von oben. Im schwindenden Tageslicht blinkte der Stein auf die gleiche Art wie Johns dunkelblaue Augen.
Plötzlich wurde die Welt um mich herum sehr still, und im Geiste sah ich ein fünfzehnjähriges Mädchen an einem Fenster sitzen. Das Herz schwer vor Einsamkeit, schaute es dem Sonnenuntergang zu. An jenem Tag ging es einen Handel mit dem Schicksal ein und wurde erhört. Ihm wurde gewährt, was es erbat.
Jenes Mädchen war ich. Im Gegenzug für eine Gabe leistete ich ein Versprechen, und die Zeit war gekommen, es einzulösen. So dunkel die Schatten nun auch sein mochten, hatte ich nie vergessen, dass ich die glücklichste aller Frauen bin. Zwar hatte ich mein Maß an Kummer und Not erlebt, doch war ich überdies mit einer Liebe gesegnet worden, wie sie nur wenigen zuteilwird, einer Liebe, deren Glanz mein Leben überstrahlte wie die Sonne die Erde. Die Wärme dieser Liebe trocknet alle Tränen, denn sie überwindet alles, sogar die Zeit, sogar den Tod. Ich bereue nichts.
Ich fand meine Fassung wieder, hob den Kopf und sah Gower an. »Du hattest einen weiten Weg, Tom«, sagte ich und war dankbar, dass meine Stimme nicht zitterte. »Bitte die Köchin, dir das beste Mahl zu bereiten, das wir anbieten können, und ruh dich aus!« Leider brannten doch Tränen in meinen Augen, und meine Lippen bebten. Rasch wandte ich mich ab. Ich hörte Gowers Schritte den Korridor entlanghallen, als er ging.
ENGLANDUNTERDEMHAUS LANCASTER
1456–1461
1
JUNI 1456
Inmitten der Blitze, des Donners und des Platzregens eines Sommergewitters tauchte in der Ferne eine Burg auf. Meine Gebete waren erhört worden. »Dort!«, rief ich, außerstande, meine Freude zu verbergen. »Dort können wir Zuflucht suchen, nicht wahr, Sœur Madeleine?«
Die Nonne, deren Umhang der Wind um ihre kleine, plumpe Gestalt peitschte, drehte sich in ihrem Sattel, beachtete den jungen Landsknecht Guy gar nicht und wandte sich stattdessen an den Knappen, der uns auf unserer Reise begleitete. »Master Giles, ist Euch dieser merkwürdige Ort bekannt?«, fragte sie. Bei ihrem starken Anjou-Akzent musste ich stets genau hinhören, um zu unterscheiden, ob sie Englisch sprach oder Französisch. Was die Burg betraf, hatte sie recht, stand das Gemäuer doch auf einer weiten, sattgrünen Ebene, nicht auf einem Hügel, und wirkte eher wie ein vornehmer, einladender Landsitz und nicht wie eine Festung. Mit den sechseckigen roten Ziegelsteintürmen sowie den großen Fenstern bot der hohe, schmale Bau fürwahr einen recht seltsamen Anblick.
»Ich glaube, die Burg gehört Lord Ralph Cromwell, Schwester«, antwortete Master Giles. Die Hufe seines Pferdes sanken bei jedem Schritt tief im Schlamm ein. »Ich hörte, dass er eine Burg aus rotem Stein in Lincolnshire baute. Tattershall Castle.«
»Und mit wem ist dieser Lord verbunden, mit der Roten Rose oder der Weißen?«
Master Giles bedachte Sœur Madeleine mit einem kurzen, spöttischen Lachen. »Das kann niemand mit Sicherheit sagen, Schwester. Es heißt, Lord Cromwell wechselt die Farbe mit dem Wind. In den Dreißigern war er Lordkanzler unter König Henry, überwarf sich allerdings vor wenigen Jahren mit den Lancastrianern und vermählte seine Nichte mit einem Yorkisten-Lord. Nach der St-Albans-Schlacht hieß es, er hätte ein Zerwürfnis mit den Yorkisten und gäbe sich neuerdings als loyaler Lancastrianer der Königin.«
Sœur Madeleine war entsetzt. »Solch ein Mann ist ein Verräter! In Frankreich wüssten wir, was wir mit ihm machen.«
Zwischen dem durchnässten Wollhut und dem Kragen sah ich genug von Master Giles’ Gesicht, um zu erkennen, was er dachte: Wir sind in England, und das ist auch gut so. Daran hat nicht einmal die französische Königin etwas ändern können, die unseren König Henry geheiratet hat.
»Dann sollten wir lieber nicht anhalten«, sagte Sœur Madeleine plötzlich und riss ein wenig zu fest am Zügel. Ihr Pferd rutschte beinahe auf dem matschigen Grund aus und schnaubte entrüstet. »Mon Dieu, er könnte wieder zu York gewechselt sein, und ich will die Gastfreundschaft eines Verräters nicht!«
Master Giles und Guy sahen mich an, da sie offenbar einzig mir zutrauten, die Nonne umzustimmen. Es war mehr als ungewiss, dass wir jenseits der Burg einen Weiler fanden, in dem man uns Unterkunft bieten konnte, und wir nicht genötigt wären, die Nacht unter einem Baum zu lagern. Nass und bibbernd im kalten Regen, hatte auch mich die Aussicht auf eine warme Mahlzeit und trockene Kleidung erfreut. Nun war beides fraglich. So gern ich Sœur Madeleine hatte, konnte sie bisweilen recht unpraktisch sein. Daher war es ein Glück, dass sie in den Wochen, die wir uns kannten, eine nachgerade mütterliche Zuneigung zu mir gefasst hatte, die ich während unserer Reise von der Abtei Marrick in Yorkshire nach London bereits zu unser aller Vorteil hatte nutzen können. Ich schöpfte einmal Atem, bevor ich sprach.
»Sœur Madeleine, unser Herr Jesus sagt, Sünder, die den wahren Weg finden, werden erlöst. Falls also der Yorkisten-Lord wieder zur rechten Lancaster-Seite zurückgefunden hat, wird der Herr ihm vergeben. Sollten wir es dann nicht auch versuchen?«
Sœur Madeleine hob das Gesicht gen Himmel, als wollte sie abwägen, was stärker war – das Unwetter oder die Kraft göttlicher Vergebung. »Alors, mon enfant, du bist sehr weis’ für fünfzehn Jahr’, muss ich sagen. Es kann keinen anderen Grund geben, weshalb Gott uns in solch abscheulichem Wetter zu dieser Burg führte. Er muss wollen, dass wir die Nacht hier verbringen, chère Isabelle.« Gleichsam zur Bekräftigung sprach sie meinen Namen französisch aus.
Master Giles verlor keine Zeit, gab seinem Pferd die Sporen und jagte es im Galopp auf die Burg zu. Gewiss wollte er auf diese Weise ausschließen, dass Sœur Madeleine sich eines anderen besann. Ich galoppierte auf meinem Zelter hinter ihm her, so gut es mir auf der rutschigen Straße möglich war. Auch der Landsknecht Guy, dessen Pferd meine Truhe zog, folgte, wurde aber durch den kleinen Karren hinter sich verlangsamt. Immer wieder rutschte sein Pferd in tiefe Pfützen, und er erreichte das Burgtor als Letzter.
Als ich neben Master Giles war, rief es vom Wachturm hinunter: »Wer da?«
»Das Mündel der Königin, Lady Isobel Ingoldesthorpe, und ihre Begleiterin, Schwester Madeleine aus der Abtei Marrick. Wir erbitten Unterkunft für die Nacht«, antwortete Master Giles nach oben, wobei ihm Regen ins Gesicht prasselte.
Knarrend öffnete sich das Fallgatter. Ich lenkte meinen Zelter zum schützenden Burgtor und stieg dort mit Master Giles’ Hilfe ab. Als der Wächter aus seinem Torhaus kam, lächelte ich ihm dankbar zu.
»Ihr habt Glück, werte Leute«, sagte er. »Hier bei Mylord Cromwell findet Ihr sichere Zuflucht, ob Lancastrianer oder Yorkisten.«
»Ihr habt Yorkisten hier?«, rief Sœur Madeleine.
Donnerkrachen übertönte die Antwort des Mannes auf diese heikle Frage, und ich nutzte die Gelegenheit, alle abzulenken, indem ich vortäuschte, ohnmächtig zu werden. Sœur Madeleine und der Burgwächter eilten mir zu Hilfe.
»Tief atmen, meine Liebe!«, sagte Sœur Madeleine, und ich befolgte ihren Rat.
»Gut, dass Ihr hier seid«, meinte der Wächter. »Die junge Dame braucht Ruhe, und das Unwetter wird schlimmer.«
Als hätte der Himmel beschlossen, uns zu helfen, nahmen sogleich das Donnergrollen und der Regen zu. Dennoch wollte Sœur Madeleine nicht vom Thema lassen.
»Ist Euer Lord Cromwell derselbe, der König Henry und unserer edlen Königin Marguerite d’Anjou als Kanzler diente?«, fragte sie, wenn auch etwas weniger streng als zuvor. Ich hielt den Atem an.
»Derselbe. Und wohin führt Euch die Reise?«, erkundigte der Wächter sich freundlich. Unterdes übergab er die Pferde zwei jungen durchnässten Stallburschen.
»Zum Hof, Sir«, sagte Sœur Madeleine hochnäsig. »Ich bin Sœur Madeleine vom Benediktinerorden der Abtei Notre-Dame de Wisques, und mein Schützling ist Lady Isobel Ingoldesthorpe, Mündel von Königin Marguerite d’Anjou. Ihr Vater war der treue Lancastrianer-Ritter Sir Edmund Ingoldesthorpe von Newmarket, Cambridgeshire, und ihre Mutter die getreue Lancastrianer-Lady Joan Tiptoft aus Cambridgeshire. Beide sind verstorben, möge Gott ihren Seelen gnädig sein.« Sie bekreuzigte sich, schürzte die Lippen und reckte stolz das Kinn.
Ich lächelte dem Wächter zu, um die frostige Antwort Sœur Madeleines zu mildern, und senkte den Blick, auf dass mir niemand sonst ansah, was in meinem Kopf vorging. Anders als die Nonne eben gesagt hatte, war mein Vater kein waschechter Lancastrianer gewesen. Um nicht für Lancaster kämpfen zu müssen, hatte er zahlreiche königliche Rufe missachtet, sein Handeln erklärt und teure Straferlasse bezahlt. »Ein korrupter Haufen« war seine Bezeichnung für die französische Königin und ihre Günstlinge gewesen, die das Land während der häufigen Erkrankungen König Henrys regierten. Solche Reden kamen jedoch einem Hochverrat gleich, weshalb er achtgab, seine Yorkisten-Sympathien für sich zu behalten. Ich schob die Erinnerung beiseite, zog die Kapuze ab und schüttelte mein Haar. Dabei bemerkte ich, dass der Wächter mich ansah und sein Blick auf meinem Gesicht verharrte. Was Sœur Madeleine ebenfalls nicht entging.
»Ihr seid dreist, Sir«, schalt sie ihn. »Hoffentlich hat Euer Lord bessere Manieren als Ihr.« Der Mann errötete. »Durchaus, Schwester, seid es versichert. Er ist ein wahrhafter Ritter und geübt im Umgang mit feinen Damen. Bitte, folgt mir!«
Lord Cromwell, ein liebenswürdiger Mann, dessen Haar die Farbe von Raureif hatte, kam uns begrüßen, sobald wir in der großen Halle angekündigt wurden. Dort befand er sich gerade im Gespräch mit dem Kämmerer. Diener eilten geschäftig umher und bereiteten ein großes Festmahl vor. Manche deckten die langen Tische mit weißem Leinen, arrangierten Obstschalen und Salzteller, Zinnschüsseln, Stahlmesser, Silberlöffel und Tassen. Andere stellten eiserne Leuchter auf, ersetzten heruntergebrannte Kerzen und steckten Fackeln in die Wandhalterungen. Wieder andere fegten Schmutz, Knochenreste, Hundeexkremente und welke Binsen fort. Holzfässer mit duftenden Rosenblättern, Ysop und süßem Fenchel waren aus dem Keller herbeigerollt worden und warteten darauf, dass ihr Inhalt auf dem sauberen Boden verteilt wurde. Lord Cromwell scheute offenbar keine Kosten.
»Ehrwürdige Schwester, meine teure junge Dame, ich heiße Euch beide herzlich willkommen!«, sagte er strahlend, küsste mir die Hand und verneigte sich vor Sœur Madeleine. »Euer Besuch kommt zu einem günstigen Zeitpunkt. Nicht bloß wegen des unbarmherzigen Wetters, oh nein! Wie es der Zufall will, findet heute Abend ein Bankett statt – ein sehr besonderes Bankett, wie ich behaupten darf. Meine Nichte, Lady Maude Neville, wird in Kürze mit ihrem Gemahl und einer Entourage junger Freunde eintreffen, die verzückt sein werden, Eure Bekanntschaft zu machen, teure Lady Isobel. Zweifellos werdet Ihr mit ihnen eine Menge zu bereden haben – Ihr wisst schon, über jene Angelegenheiten, die hübsche junge Damen am meisten beschäftigen: junge Herren.« Er zwinkerte mir zu, woraufhin ich lächelte und Sœur Madeleine die Stirn runzelte. »Es gibt Musik, Tanz, einen Troubadour, der uns unterhält, und Feuerschlucker. Also solltet Ihr Euch ausruhen und erfrischen, auf dass Ihr das abendliche Vergnügen gebührend genießen könnt.«
Wir wurden zu unserem Gemach geführt, einem angenehmen Zimmer oben im zweiten Stockwerk, von dem aus man in den Innenhof blickte. Meine Truhe war bereits nach oben gebracht worden. Trotz des Regens draußen wirkten die Räumlichkeiten so munter wie ihr Besitzer. Auf einer Seite bildete die rote Steinwand einen leuchtenden Hintergrund für die goldenen Bettvorhänge und Überdecken, die Wand auf einer anderen Seite wurde fast vollständig von einem farbenfrohen Gobelin eingenommen; durch ein großes Fenster fiel Tageslicht auf den Wandbehang. Zwei Bedienstete brachten einen Krug Wein, eine Platte mit Käse, zwei große Kelche und eine silberne Waschschüssel, die sie auf eine hohe Kommode stellten. Ein weiterer entzündete die Kerzen an einem Kandelaber; und ein anderer nahm unsere nassen, schlammbespritzten Umhänge und hängte sie zum Trocknen in die Schrankkammer, bevor er ging. Als er die Tür hinter sich schloss, überkam mich eine kribbelige Vorfreude, und ich lief zu meiner Truhe, um mein schönstes, bislang ungetragenes Kleid auszupacken.
»Isabelle!«, ermahnte Sœur Madeleine mich streng.
Was dieser Tonfall bedeutete, wusste ich leider. Langsam drehte ich mich zu ihr um.
»Wir werden nicht an dem Bankett teilnehmen. Es ist mithin unnötig, dass du dich umkleidest.«
»Darf ich fragen, warum, Sœur Madeleine?«, erkundigte ich mich kleinlaut.
»Hast du den Namen seiner Nichte nicht gehört? Sie ist eine Neville.«
»Nicht alle Mitglieder der Neville-Familie unterstützen den Duke of York. Viele sind Lancastrianer.«
»Peut-être, aber lassen wir es nicht darauf ankommen, Isabelle. Wir werden auf unserem Zimmer speisen und früh zu Bett gehen. Für die morgige Reise sollten wir ausgeruht sein. Und jetzt hilf mir aus meinem Kleid, bevor ich erfriere!«
Ihre resolute Miene gewährte keinerlei Spielraum für Hoffnung, und ich wusste, dass Bitten nutzlos wäre. Also schluckte ich meine Enttäuschung herunter und schloss die Truhe wieder. »Ja, Sœur Madeleine.«
Die Nonne löste den Stoffgürtel, der ihr Kleid in der Mitte zusammenhielt, nahm den Rosenkranz ab und drückte ihn an die Lippen, ehe sie ihn auf die Kommode legte. Ich öffnete die Brosche unten an ihrem Schleier, befreite Sœur Madeleine von ihrem weißen Schultertuch, dem Kopftuch, der Nonnenhaube und dem weichen weißen Baumwollkleid darunter. Nachdem ich alles zusammen- und beiseitegelegt hatte, half ich ihr aus dem weiten weißen Habit, wie ihn die Benediktinerinnen trugen. Diesen hängte ich an einen Haken im Kleiderschrank. Anschließend stützte ich sie beim Erklimmen des hohen Bettes und brachte ihr einen Kelch mit Wein, den sie hastig leerte. Ich reichte ihr auch den Käse, doch sie lehnte ihn wortlos ab. In ihrem schlichten Baumwollhemd, das dünne graue Haar offen und die Decke bis zu den Schultern hochgezogen, wirkte sie nicht mehr plump und kräftig, sondern vielmehr alt und gebrechlich. Mitgefühl überkam mich. Ich füllte ihr Wein nach und tupfte ihr die Stirn mit einem Handtuch, dessen eine Ecke ich in das parfümierte Waschwasser getunkt hatte. Danach strich ich behutsam das schüttere Haar, das rosige Kopfhaut sehen ließ, mit meiner Wildschweinbürste glatt. »Ist es so besser, Sœur Madeleine?«, fragte ich.
Sie seufzte wonnig. »Oui, mon enfant«, sagte sie leise und schloss die Augen.
Ich begab mich ans Fenster. Nach und nach trafen die Gäste ein, deren Lachen bis hinauf in meine Kemenate drang und mir ins Herz schnitt. Die letzten achtzehn Monate hatte ich in einem Kloster gelebt, und ich sehnte mich nach der Gesellschaft junger Menschen, nach Lachen, Musik und Tanz, kurz: nach allem, was mir seit meines Vaters Tod fehlte.
»Isabelle, sing mir etwas vor!«, forderte Sœur Madeleine auf einmal.
Ich ging zur Truhe und holte meine kleine hölzerne Leier heraus. Im Kloster hatte sie mir gute Dienste geleistet, war sie doch nicht laut, sodass ich selbst bei Nacht meine Einsamkeit in den süßen Klängen hatte ertränken können. Ich trug die Leier zur Fensterbank und öffnete das Fenster. Kühle, feuchte Luft wehte über meine Wange. Das Gewitter hatte sich verzogen, der Wind die Wolken fortgetrieben, und nun kündigte sich ein lieblicher Juniabend an. Im Osten war ein blassrosa Schleier zu erkennen, und im Westen färbte ein Pfirsichton die letzten Wolken sowie das Dorf, in dem bereits erste Lichter funkelten. Seit dem Tod meines Vaters stellte ich fest, dass die Schönheit der Natur nicht etwa tröstlich auf mich wirkte, sondern eine unerklärliche Traurigkeit tief in mir weckte.
Ich vermisste meine Mutter und meinen Vater, und Geschwister hatte ich keine. Nun war ich unterwegs zum Hof, wo ich vermählt werden sollte. Doch so sehr sich mein Herz nach jener Liebe sehnte, wie sie Troubadoure besangen und Poeten in ihren schönen Versen beschrieben – dieselbe Art Liebe, wie meine Mutter und mein Vater sie füreinander gehegt hatten –, ahnte ich, dass sie mir wohl kaum beschieden sein dürfte. Ländereien und Vermögen entschieden über Ehen, nicht Liebe, und die wenigsten jungen Damen, die einem Ehemann Land bieten konnten, durften deshalb auf eine Liebesheirat hoffen. Sogar königliche Hoheiten heirateten, um Verbündete oder Handelsabkommen zu gewinnen, und meine Zukunft lag in den Händen der Lancastrianer-Königin Marguerite d’Anjou, die mit fünfzehn Jahren einen wahnsinnigen König hatte heiraten müssen. Welches Mitgefühl konnte ich von ihr erwarten? Ihr Interesse galt einzig meiner Vormundschaft und Heirat, denn die Vormundschaft bescherte ihr ein angenehmes jährliches Einkommen, und meine Heirat würde ihr einen hübschen Gewinn einbringen.
Ich begriff nicht, warum die Welt so bitter war, aber das Schicksal suchte sich fraglos seine Lieblinge aus, und ein klein wenig hoffte ich – närrischerweise –, ich könnte zu den wenigen von ihm Begünstigten zählen. Bis dahin sehnte ich mich nach kleinen Freuden wie dem Bankett an diesem Abend, wo ich lachen, unter Männern meines Alters sein und die Leichtigkeit des Lebens spüren könnte.
Ein scharfer Verlustschmerz regte sich in mir, als ich den Kopf neigte und die ersten Töne des neuesten Klageliedes zupfte. Mit dem Lied sang ich all meinen Kummer hinaus, und die Melodie nahm mich derart gefangen, dass ich glaubte, meine eigenen Tränen in der Musik zu hören.
Wärmt mich nie der Sonne Strahl? Bleibt mir der Himmelgrau?Wird mein Herz nie Tanzen lernen? Stirbt es trüb und lau?Bleibt die Liebe mir versagt, die schmerzlich ich ersehne?Verloren bist du mir, auf immer, meine Schöne …
Ich blickte zum Himmel auf, den der Sonnenuntergang in ein Farbenspiel verwandelte. Während ich sang, nahmen die Wolken einen kräftigen Goldton an, der sich rosig vertiefte. Ein einsamer Vogel stieg hoch in die Lüfte, frei, überall hinzufliegen, wo es ihm beliebte. Abermals wandelten sich die Farben, und nun erfasste ein rotes Leuchten die Erde und tauchte alles in eine zarte Schönheit. Ich weiß nicht, was über mich kam, aber plötzlich empfand ich ein unbeschreibliches Sehnen, das ich weder definieren noch verstehen konnte. Indes fühlte ich, dass diese Leere und Einsamkeit einzig durch jenes Phänomen durchbrochen werden konnte, das die Poeten Liebe nannten. Ich beendete das Lied, senkte den Kopf und schloss die Augen. Stumme Worte kamen aus meinem Herzen, wandten sich flehend an das Schicksal und gaben ein Versprechen.
»Isabelle.«
Ich blinzelte. Es brauchte einen Moment, bevor ich wieder ganz bei Sinnen war. »Ja, Sœur Madeleine?«
»Wir können zu dem Bankett gehen, wenn du es wünschst.«
Staunen und Unglauben machten mich sprachlos. Meine Gedanken überschlugen sich wirr, und als ich schließlich die Bedeutung ihrer Worte erfasste, lachte ich vor Freude. Ich lachte zum Himmel, zu den Wolken, zu den Bediensteten, die unten im Hof den Gästen die Pferde abnahmen. Ich warf die Arme in die Höhe und lachte, wirbelte vom Fenstersitz weg und tanzte durchs Zimmer. Dann legte ich die Hände vor meinem Mund zusammen und sprach ein stummes Dankgebet, halb lachend, halb weinend, ehe ich mich aufs Neue im Tanz drehte. Als ich zu Sœur Madeleine blickte, entdeckte ich ein zartes Lächeln auf ihren Zügen.
Ich eilte zu ihr, ergriff ihre Hand und küsste die faltige Haut. »Ich danke Euch, liebste Sœur Madeleine.«
Sie wurde rot. »C’est rien«, murmelte sie. »Es ist nichts. Aber wenn wir gehen, würde ich empfehlen, dass wir uns beeilen, ma petite.«
Sogleich lief ich zu meiner Truhe und suchte nach meinem neuen Kleid aus edler lavendelblauer Seide und silbernem Sarsenett, das mit kleinen silbernen Blättern bestickt war. Noch nie hatte ich Gelegenheit gehabt, es zu tragen. Es hatte eine hohe Taille, einen tiefen Halsausschnitt mit Feh-Besatz, und auf dem Rücken bildeten breite Falten eine Schleppe. Beim Auspacken schimmerte es wie Mondenschein.
»Du musst sehr vorsichtig sein, Isabelle«, sagte Sœur Madeleine, als sie mir in das herrliche Kleid half und mein langes Haar lose auffächerte.
»Warum?«, fragte ich, halb trunken vor Freude.
»Du bist zu wunderschön, mit deinem Schwanenhals und den großen Augen, und ich fürchte, es sind Yorkisten bei dem Bankett. Frauenschänder und Mörder allesamt.«
»Wirklich alle?«, neckte ich sie in meinem Freudenrausch. Ich fragte mich, ob Sœur Madeleine zu viel Wein getrunken hatte. Es war das erste Mal, dass sie mir Komplimente machte, und warum sollte sie? Meine Augen waren braun, nicht blau, mein Haar nicht golden, sondern dunkel wie Kastanien. Hätte ich doch nur einen Spiegel! Aber in der Abtei waren Spiegel verboten gewesen, denn wie uns die Nonnen wiederholt erinnert hatten, waren die einzigen Augen, auf die es ankam, die Gottes. »Ich sah einmal einige Yorkisten«, plapperte ich vergnügt, »und sie schauten mir nicht wie Frauenschänder oder Mörder aus.«
Sœur Madeleine stieß einen entsetzten Schrei aus, und einen Moment lang fürchtete ich, einen schrecklichen Fehler begangen zu haben, der mich das Bankett kostete, doch dann sagte sie nur: »Mon Dieu, was wird aus dieser Welt?«
»Ich fand sie sogar recht passabel«, kicherte ich. Natürlich war ich angetrunken, sonst hätte ich mich niemals zu solch einem Geständnis hinreißen lassen.
Sie sah mich entgeistert an. »Ich sollte dich der Königin melden!«
Schmunzelnd neigte ich mich vor und küsste sie auf die Stirn. Eigentlich beugte ich mich schon von allein in Gegenwart von Damen, denn obgleich ich einen Kopf kleiner war als der Großteil der Männer, überragte ich die meisten Frauen. »Aber das tut Ihr nicht, nicht wahr?« Ich lachte. Was mich so kühn machte, wusste ich selbst nicht.
»Mon enfant, du bist unmöglich. Ich weiß nicht, wieso ich mich von dir um den kleinen Finger wickeln lasse. Es liegt wohl daran, dass ich dich liebe wie eine eigene Tochter. Vielleicht sind es deine dunklen Haare und die Augen, die mich erinnern an …«, sie verstummte und musste sich offenbar fassen, »an Anjou.« Nun nahm ihr Gesicht einen verträumten Ausdruck an.
Auch ich hing meinen Träumen nach, nur brachte mich das Bild, das ich mir ausmalte, zum Kichern.
»Was amüsiert dich?«
»Nichts«, log ich und bemühte mich, ernst zu werden. Ein Erlebnis hatte ich bislang keinem anvertraut, und ganz gewiss würde ich es nicht Sœur Madeleine verraten, egal, wie freudetrunken ich sein mochte. Im vorherigen Frühling war ich in den Norden Yorkshires gereist, um Freundinnen zu besuchen. Nach einem Ausflug mit Picknick auf einer von Wildblumen übersäten Wiese kehrten wir nach Wemsleydale zurück. Singend und lachend fuhren wir auf einem großen Wagen durch den Sonnenschein, während die Blütenblätter der Birnbäume auf uns herabrieselten. An der Biegung des Flusses Ure, noch ein gutes Stück vom Herrenhaus entfernt, teilte sich der Wald, und plötzlich stiegen zwei junge Männer aus dem Fluss. Starr vor Schreck standen sie für einen Augenblick splitternackt da, ehe sie sich besannen und rasch bedeckten. Allerdings hielt einer von ihnen die Hände vor sein Gesicht statt vor seine männlichen Körperstellen. Meine Freundinnen und ich schütteten uns aus vor Lachen und wollten unbedingt mehr sehen. Unterdes fluchten unsere beiden Leibwächter, und der Kutscher peitschte auf die Pferde ein, um möglichst schnell vorbeizukommen. Jener Anblick, das erste Mal, dass wir einen nackten Mann sahen, belustigte uns wochenlang.
In all den Monaten seither hatte ich nie den einen Mann vergessen, der sein Gesicht bedeckt hatte, und manchmal sah ich ihn sogar im Traum, wenn auch nur flüchtig.
»Hör mich an, mon enfant«, sagte Sœur Madeleine auf einmal sehr ernst und legte die Hände auf meine Schultern. Ich bekam Angst. »Du bist jung, romantisch, aber du musst vernünftig sein. Für die Liebe ist wenig Platz im Leben. Ein junges Mädchen, das eine Lancastrianerin ist, muss einen Lancastrianer heiraten. Hat sie kein Vermögen, muss sie einen reichen Gemahl wählen, und sei er noch so alt, hässlich und zahnlos; und besitzt sie etwas Land wie du, muss sie einen Mann mit mehr Land wählen. Zu lieben bedeutet, sich empfänglich für Schmerz zu machen, und in dieser Welt voller Wirren und Mühen gibt es bereits genug Schwierigkeiten, ohne dass die Liebe es uns noch schwerer macht. Es ist das Beste, alle Yorkisten als Frauenschänder und Mörder anzusehen. Hast du mich verstanden, Isabelle? Ja?«
Mir kam der Gedanke, dass alte Menschen immerfort unnötige Warnungen aussprachen, und schon fühlte ich mich erleichtert. Ihre Worte konnte ich mit der gleichen Leichtigkeit abtun wie das nunmehr ferne Donnergrollen. »Ja, Sœur Madeleine, ich habe verstanden«, sagte ich, um sie zu beruhigen. Meine Stimmung blieb ungetrübt.
2
DER TANZ, 1456
Beim ersten Ruf des Horns zum Abendessen überquerte ich mit Sœur Madeleine den Burghof. Ein einsamer Stern funkelte am violetten Himmel. Mit klopfendem Herzen stieg ich die Treppe hinauf zur großen Halle. Mit uns schwärmten die anderen Gäste herbei. Das Raunen der Stimmen wurde lauter, je höher wir gelangten, bis uns ein gewaltiger Lärm verriet, dass wir den Gang zur Halle erreicht hatten. Männer und Frauen drängten sich durch den Eingang, manche plauderten angeregt, manche warteten stumm, dass man ihnen einen Platz zuwies. Mehrere schauten im Vorbeigehen zu mir, und ich freute mich über mein schönes Kleid, die Verneigungen und die bewundernden Blicke, die mir folgten.
Obwohl ich die Vorbereitungen bereits gesehen hatte, konnte ich nicht umhin, über die Pracht der Festhalle zu staunen. Schwerer Rosenduft stieg von den Blättern am Boden auf, und der Saal funkelte von den vielen Fackeln und Kerzen auf Tischen und in Fensternischen. Hinter dem Podest, auf dem Lord Cromwell sitzen würde, knisterte ein Feuer in dem riesigen Kamin mit dem Wappen des Lords. Silber, Zinn und Glasscheiben spiegelten die Flammen, sodass selbst die Fahnen und Gobelins an den vertäfelten Wänden in Lichterglanz getaucht waren.
Einige Ritter und Damen hatten schon ihre Plätze an den Tischen unter den Fenstern eingenommen, zu denen uns der Haushofmeister führte. Ich entdeckte auch Master Giles und Guy, die man zu den anderen Herolden, Knappen, Sekretären und Schreibern an einen niedrigeren Tisch gesetzt hatte, der für das gemeine Volk reserviert war. Dort standen weder Salz noch Früchte, und anstelle von Zinn und Horn hatten sie Holzschalen und hölzerne Becher vor sich. Master Giles und Guy erhoben und verneigten sich, als wir vorbeigingen, und die Bewunderung in ihren Blicken machte mich noch leichtfüßiger. An unserem Tisch angekommen, stellte ich mit Freuden fest, dass wir neben dem Podest sitzen würden. Nach einer kurzen Begrüßung und einem Nicken von Sœur Madeleine ließ ich mich als Erste neben einen stämmigen, alten Ritter mit rötlichem Gesicht nieder, der aufstand und sich höflich verbeugte. Sœur Madeleine wählte das Ende der Bank und nickte dem Mann übertrieben ernst zu, weshalb ich ihm ein Lächeln schenkte, das ich bald bereuen sollte.
Weitere Ritter und Damen, Geistliche und andere Leute von Rang gesellten sich zu uns, und mit jedem neuen Gast rückte der Ritter dichter an mich heran, sodass ich wiederum immer näher zur Nonne rutschen musste, bis kein Platz mehr zum Ausweichen war, wenn ich nicht entweder die Schwester von der Bank schubsen oder sie auf die Zudringlichkeit des Ritters aufmerksam machen wollte. Letzteres hätte wiederum eine Szene nach sich gezogen. Also litt ich stumm und versuchte, weder auf seinen Schenkel und die Schulter zu achten, die gegen mich drückten, noch auf die dreisten Blicke zu meinem Ausschnitt.
Ein plötzlicher Fanfarenstoß ließ sämtliche Gespräche verstummen. Wie alle anderen erhob ich mich hastig und trug so zu dem allgemeinen Stoffrascheln in der Halle bei.
Mit einem strahlenden Lächeln auf dem rosigen Gesicht und gefolgt von einer Entourage aus Lords und Ladys, betrat Lord Cromwell die Halle. An seinem Arm war eine hübsche, hellhaarige junge Dame, von der ich annahm, dass sie seine Nichte, Lady Maude, sein musste. Früher hatte ich meinen Vater hin und wieder zu Banketten begleitet. In den vergangenen Monaten indes hatte ich mich so sehr an das strenge, karge Klosterleben gewöhnt, dass ich nun fasziniert den farbenfrohen Auftritt bestaunte, den kostbaren Samt, das Gold und die Juwelen. Dann bemerkte ich den Hund am Ende der Prozession. Er zockelte mit solch einer Hochnäsigkeit und sichtlichen Langeweile hinter der Gruppe her, dass ich beinahe laut gelacht hätte. Ich sah zu seinem Herrn und hatte das Gefühl, ihn wiederzuerkennen. Doch woher kannte ich diesen Ritter? Und wenn ich ihm schon einmal begegnet war, wie hatte ich dann dieses Gesicht vergessen können?
Abgesehen von dem Hund hinter ihm, ging er allein am Ende der Gruppe. Er war schmal von Statur, aber größer als die anderen und breitschultrig. Sein braunes Haar schimmerte im Kerzenschein, und sein Blick wanderte die Halle ab, als suchte er nach jemandem. Ich ahnte, dass es eine junge Dame sein musste, und der Gedanke versetzte mir seltsamerweise einen Stich. Für einen so großen Mann bewegte er sich auffallend elegant und strahlte ritterliche Vornehmheit aus, angefangen bei der hübschen geraden Nase und dem kantigen Kinn bis hin zu den hohen Stiefeln anstelle der spitzen Schuhe der Höflinge. Seine modische Kleidung aus grünem, goldbesticktem Samt täuschte jedoch nicht darüber hinweg, dass er eindeutig mehr Zeit mit Reiten als auf Festen verbrachte. Dafür sprach allein schon sein sonnengebräuntes Gesicht. Eine Stimme in mir regte sich: Ah, ja. Wer immer diejenige sein mag, nach der er Ausschau hält, sie darf sich sehr glücklich schätzen.
In dem Moment drehte er den Kopf und begegnete meinem Blick. Die Andeutung eines Lächelns umspielte seine Lippen, und auf seinen Wangen zeigten sich kleine Grübchen. Mir stockte der Atem. Ich wusste, dass sein Lächeln nicht mir galt, und dennoch wurde ich rot und senkte den Blick.
Lord Cromwell nahm seinen Platz in der Mitte des breiten Podests ein und hieß seine Gäste offiziell willkommen. Während er sprach, glaubte ich zu spüren, dass mich der grüne Ritter ansah, bemühte mich aber, nicht hinüber zur Empore zu schauen, wo er saß. Ich lenkte mich ab, indem ich die Schönheiten in der Halle zählte; es waren mindestens vier, und ihre Haare leuchteten wie gesponnenes Gold. Verstohlen blickte ich zu meinem eigenen Haar hinab. Obwohl es dick und glänzend war und mir fast bis zu den Hüften reichte, fühlte es sich auf meinem Rücken gerade wie eine Römerstraße an und wirkte im Kerzenlicht rabenschwarz. Ein Gefühl von Unzulänglichkeit überkam mich. Wäre ich geneigt gewesen, Neid zu empfinden, hätte ich es gewiss in diesem Augenblick. Doch ich bewunderte die blonden Schönheiten um mich herum und fand mich damit ab, dass ich mit ihrem Liebreiz nicht aufwarten konnte. Nein, der Ritter konnte mich nicht bemerkt haben; ich bildete es mir bloß ein, wünschte mir, es wäre so. Wünschte …
Mir fielen die Worte ein, die mein Vater oft gesagt hatte: »Sei zufrieden und bedenke, dass es stets jene gibt, die mehr haben als du, und stets solche, die weniger haben.«
Also beschloss ich, mich glücklich zu schätzen. Ich hatte gebeten, auf das Fest zu dürfen, und nun würde ich es genießen, so gut ich konnte.
Nach dem Dankgebet schenkten die Diener Rosenwasser in die Handschälchen. Ich tunkte meine Finger in meines und hielt sie einem Diener hin, der sie mit einem Leinentuch trocknete. Nachdem sich alle die Hände gesäubert hatten, wurden die Schalen fortgeräumt, und der Brotmeister verteilte Brot, Butter und Schweineschmalz, während der Kellermeister und sein Gehilfe Wein und Bier ausschenkten. Die Nonne leerte ihren Becher eilig und ließ ihn nachfüllen.
»Pah!«, sagte der Ritter neben mir, worauf ich erschrak. Er stellte seinen Weinkelch ab, spuckte auf den Boden und wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. »Der Wein ist sauer und schmeckt nach Pech! Kann unser Lord sich keinen besseren leisten?«
»Wo hattet Ihr besseren?«, erwiderte jemand weiter unten am Tisch. »Verratet es uns, dann gehen wir dorthin!« Diese Bemerkung erntete einiges Gelächter.
»Ihr irrt Euch, Monsieur. Der Wein ist exzellent, sehr gut sogar«, verkündete Sœur Madeleine, die ihren Kelch wieder an die Lippen setzte und einen kräftigen Schluck nahm. »Da er aus Bordeaux kommt, kann es daran keinen Zweifel geben.«
Ich nippte an meinem Wein. Er schmeckte nach Pech, doch in der Abtei war der Wein schlimmer: so ölig, fad und trübe von Ablagerungen, dass ich beim Trinken jedes Mal die Augen geschlossen und ihn durch meine Zähne gefiltert hatte. Die Schwester hatte recht. Verglichen mit dem Klosterwein, war dieser hier sehr gut.
Der Ritter tat ihren Widerspruch mit einem »Hmpf« ab, das keinen Zweifel daran ließ, wie er in der Sache dachte, und wandte sich der frischen Heringspastete zu, die mit Ingwer, Pfeffer und Zimt gewürzt war und ihm eben auf den Teller gelegt wurde. Als er den Arm vor mir ausstreckte, um seine Pastete ins Salz zu stippen, schlug mir sein Knoblauchatem entgegen, und mir verging der Appetit.
»Was denn, esst Ihr nicht?«, fragte er mit vollem Mund, riss sich ein Stück Brot ab und bestrich es dick mit Schweineschmalz. »Eine junge Dame wie Ihr sollte den Appetit auf das Leben noch nicht verloren haben.« Er zwinkerte mir zu und drückte den Schenkel gegen mein Bein, woraufhin ich tief errötete.
»Oui, mon enfant«, pflichtete die Nonne ihm bei. »Du bist viel zu hager. Mange, ma petite!« Dann tippte sie mir aufs Knie und sagte: »Du erregst einiges Interesse bei den Leuten. Ermuntere sie nicht, Isabelle!«
Ich sah in die Richtung, in die sie wies. Einige junge Männer, die um einen Tisch herum saßen, beäugten mich tatsächlich, und kaum blickte ich zu ihnen, hob ein Bursche mit Lockenschopf den Kelch und prostete mir zu. Da er keinerlei Ähnlichkeit mit dem Edelmann auf dem Podest hatte, schaute ich wieder nach unten. »Nein, Sœur Madeleine.« Meine Stimme hatte eine leicht melancholische Note.
Brav ignorierte ich die jungen Herren und knabberte an meinem Brot, während der rotgesichtige Ritter neben mir laut rülpste und sich mit einem dreckigen Fingernagel zwischen den Zähnen schabte. Mir kam der Gedanke, dass er wahrscheinlich verheiratet war, und ich schwor, niemals einem von der Königin bestimmten Gemahl zuzustimmen, sofern ich nicht ein wenig Zuneigung zu dem Betreffenden aufbringen konnte, ganz gleich, wie sehr sie mich bedrängte. Da würde ich ein Kloster vorziehen. Wehmütig linste ich zu dem Ritter oben an der Haupttafel. Wie prachtvoll er war! Er lachte über einen Scherz, den jemand gemacht hatte, und unsinnigerweise überkam mich abermals das schmerzliche Sehnen, das ich beim Betrachten des Sonnenuntergangs gefühlt hatte.
Da ich mich sonst an niemanden wenden konnte, entschied ich, das Beste aus dem Abend zu machen. »Wisst Ihr, wer die Leute an der hohen Tafel sind?«, fragte ich den grobschlächtigen alten Ritter und wappnete mich, mit der Antwort auch gleich freie Sicht auf zerkautes Essen zu bekommen.
»Und ob ich das weiß!«, antwortete er schmatzend. »Die Dame neben Lord Cromwell ist seine Nichte, Lady Maude, und sie ist mit dem dunkelhaarigen Ritter rechts von ihr verheiratet. Sein Name ist Sir Thomas Neville. Und seht Ihr da drüben? Das ist sein jüngerer Bruder, Sir John Neville, der links neben Lord Cromwell.«
Bei dem Namen Neville blickte ich ängstlich zur Nonne hinüber. Zum Glück war es in der Halle recht belebt, und die Schwester war so sehr mit ihrem Kapaun und dem Wein beschäftigt, dass sie gar nichts hörte. Obgleich sie viel trank, war ihr Kelch immerfort gefüllt. Plötzlich fiel mir auf, dass ein Diener ganz in ihrer Nähe stand und ihr eifrig nachschenkte, als wäre sie adlig. Was mich keineswegs stutzig machte; vielmehr war ich froh, die Erklärungen des Ritters ohne ihre Maßregelungen aufnehmen zu dürfen, auch wenn sich meine Stimmung rapide verfinsterte.
Ich konnte zwar mit einem Onkel aufwarten, der zum Earl geadelt worden war, doch die Nevilles waren von Geburt adlig und hatten viele Lords, Earls und Duchesses in ihren Reihen. Ihr Aufstieg zur Macht hatte im zwölften Jahrhundert mittels Heirat begonnen, als Robert Fitzmaldred die Erbin von Henry de Neville aus Neuville im Calvados geheiratet hatte und ihre gemeinsamen Kinder den Namen der Mutter angenommen hatten.
Fehden in den Nachfolgegenerationen spalteten die Familie in zwei zutiefst verfeindete Zweige, von denen der eine die Weiße Rose von York, der andere die Rote Rose von Lancaster unterstützte. Die Erfolge der Yorkisten-Nevilles trugen ihnen überdies die Feindschaft eines anderen mächtigen Clans ein – der Percys. In Northumberland waren die Percys über lange Zeit Herrscher von eigenen Gnaden gewesen, weshalb sie den durch die Nevilles herbeigeführten Schwund an Macht und Wohlstand mit reichlich Unmut aufnahmen. In ihren Augen waren die Nevilles nichts als Emporkömmlinge. Bei all dem Groll, den sie auf sich zogen, blieb den Yorkisten-Nevilles das Schicksal hold, und sie konnten weiterhin per Heirat große Eroberungen machen. Richard Neville, der älteste von vier Söhnen des Earl of Salisbury, war im Alter von acht Jahren mit Nan Beauchamp vermählt worden, was ihm unlängst den Titel des Earl of Warwick eingetragen hatte, des obersten Earls im Lande.
»Ihr kennt Euch gut aus«, sagte ich zu dem Ritter, der mich ein kleines bisschen weniger abstieß. Seine ungehobelten Manieren und die wiederholten Seitenblicke zu meinem Busen störten mich nicht mehr ganz so sehr, da er sich als hilfreich erwies. »Könnt Ihr mir mehr erzählen?« Ich neigte mich näher zu ihm, auf dass seine Worte nicht im lauten Gelächter weiter seitlich am Tisch untergingen, wo andere den neuesten Klatsch austauschten.
»Der junge Mann neben Lady Maude ist ein recht verwegener Ritter, pardieu! Also, da gibt es eine Geschichte …«
Ich blickte zu Sir John Neville. Er hatte den Stuhl nach hinten gekippt und unterhielt sich hinter Lord Cromwells Rücken mit Lady Maude. Ehe er mich bemerkte, sah ich wieder weg und stellte die Frage, die mir auf der Zunge brannte.
»Gehören diese Nevilles zum Yorkisten- oder zum Lancastrianer-Zweig?«, fragte ich möglichst beiläufig. Und für den Fall, dass meine Miene preisgab, was in meinem Kopf vor sich ging, senkte ich den Blick, gabelte ein Stück gerösteten Hasen von meinem Teller auf und benetzte es überaus gründlich mit der würzigen Senfsauce. Leider erschreckte mich der Ritter mit einem dröhnenden, bebenden Lachen, das ihn eine ganze Weile durchschüttelte, sodass ich doch neugierig zu ihm aufsah.
»Ihr seid eine ganz Ahnungslose, was?« Immer noch lachend, wandte er sich an die anderen am Tisch. »Sie will wissen, ob diese Nevilles Yorkisten oder Lancastrianer sind!«
»Ich habe in einem Kloster gelebt, Sir«, erklärte ich mit vor Scham glühenden Wangen.
»Dann habt Ihr eine Menge aufzuholen. Welch Glück für den Mann, der Euch lehren darf!«, polterte er.
Die Damen lächelten, und einige der Männer schnaubten vor Lachen. Einer, der sich als Lord Cromwells Seneschall entpuppte, hatte Mitleid mit mir und sagte: »Sie sind die Yorkisten, Mylady.«
Ich wandte mich wieder dem grobschlächtigen Ritter zu, und er fuhr fort, wo er aufgehört hatte. »Fürwahr, jedes Mal, wenn König Henry in den Wahnsinn abgleitet – Verzeihung, krank wird –, zanken sich die Königin und Richard, der Herzog von York, darum, wer das Land als Beschützer des Reiches regieren soll. Mal gewinnt York die Oberhand, mal die Königin. Vor allem aber standen diese Nevilles felsenfest zu York, von Anbeginn der Streitigkeiten und durch dick und dünn. Ja, ich sehe, jetzt begreift Ihr. Sie sind die Söhne des Earl of Salisbury und Brüder des Earl of Warwick.«
Mir war, als hätte ich einen brutalen Schlag eingesteckt, und ich musste blass geworden sein, denn wie durch einen Nebel hörte ich ihn fragen: »Fühlt Ihr Euch nicht gut, Lady Isobel?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, es ist nur … der Hase ist zäh«, stammelte ich, legte das Fleischstückchen ab und schluckte. »Bitte, fahrt fort!«
»Tja, dann habe ich eine Geschichte für Euch. Es gibt die Nevilles und die Percys, zwei Clans, die einander spinnefeind sind, aber das wisst Ihr schon, nicht? Schön. Nun, dort seht Ihr Lady Maude, die Erbin von Cromwells Ländereien und Häusern, zu denen mehrere ehemalige Percy-Anwesen gehören. Henry IV. konfiszierte sie Anfang 1400 wegen Landesverrats. Als Lady Maude vor zwei Jahren in ebendieser Burg mit Sir Thomas Neville vermählt wurde, erhielten die Nevilles folglich Zugriff auf mehrere Festungen, die einst im Besitz der Percys waren. Anscheinend nahm es Lord Egremont, ein hitzköpfiger Sohn des Earl of Northumberland und seinerseits ohne Landbesitz, obendrein ein solch ungeschlachter Bursche, dass keine Erbin ihn heiraten will, nicht gut auf, dass Percy-Länderein in Neville-Hände fielen, egal, ob sie vor über fünfzig Jahren konfisziert wurden oder nicht. Und so lauerte Egremont der Hochzeitsgesellschaft an der Stamford-Brücke auf. Man sagt, es wäre dem jüngeren Sohn, Sir John, zu verdanken – ein wackerer Kämpfer, wie man ihn sich geschickter nicht vorstellen kann –, dass die zahlenmäßig unterlegenen Nevilles bei dem Überfall die Percys schlagen konnten. Sir John ist der dritte Sohn und erst fünfundzwanzig Jahre alt. Dennoch gibt sein Vater, der Earl of Salisbury, viel auf seinen Rat. Ja, Mylady, ich würde jederzeit mit Sir John Neville kämpfen … das heißt, wenn Lord Cromwell es befiehlt. Ich stehe in seinen Diensten.«
»Aha.« Ein Gemüsegang mit Erbsen und Zwiebeln in Safran war serviert und meine Portion unangetastet wieder abgeräumt worden. Nun sah ich auf die Feigen hinab, die, hübsch mit Mandeln und Puderzucker verziert, auf meinem Dessertteller lagen. Ich nahm eine auf und versuchte zu schlucken. Was mit mir war, wusste ich selbst nicht. Hier saß ich bei dem Bankett, von dem ich gefürchtet hatte, es zu versäumen, und auf einmal wünschte ich mir sehnlichst, es wäre vorbei.
Aber die Nonne war offensichtlich noch nicht gewillt zu gehen. Sie drehte sich zu mir, versetzte mir einen Klaps und verkündete kindlich munter: »Die Feuerschlucker sind hier, Isabelle!« Sœur Madeleine zeigte auf zwei barbrüstige junge Männer mit Perlenketten um den Hals, die unter Fanfarentönen von der Musikergalerie herabstiegen. Sie jonglierten das Feuer mit erstaunlicher Geschicklichkeit und beendeten die Vorführung damit, die Flammen zu schlucken. Triumphierend hielten sie die erloschenen Fackeln in die Höhe, verneigten sich unter tosendem Applaus und fingen die Silbermünzen ein, die auf sie niederregneten. Als Nächstes kam ein Troubadour mit seiner Ghiterna und sang ein recht zotiges Lied über eine untreue Fischhändlersfrau, gefolgt von einem Klagelied über Elaines unglückliche Liebe zu Sir Lancelot, in dem es von Seufzern, Tränen und Verlangen nur so wimmelte. Unterdes waren meine Gedanken ganz bei dem Lord mit dem betörenden Lächeln. Inzwischen war ich froh über die Gesellschaft des rotgesichtigen alten Ritters und konzentrierte meine Aufmerksamkeit auf ihn, damit ich nicht zu dem anderen hinaufsah, der so weit über mir war.
Schließlich verbeugte der Troubadour sich und sagte: »Hier endet meine Geschichte. Gott segne diese holde Gesellschaft – Amen!« Die Musiker auf der Galerie stimmten laute Akkorde an, und der Boden wurde für den Tanz frei geräumt. Die sinnlichen keltischen Rhythmen, die sie auf der Harfe, dem Rebek, den Flöten und Lauten spielten, besangen mit jeder Note die Liebe; doch ich hockte steif auf meiner Bank, entschlossen, mich nicht von der Musik mitreißen zu lassen. Lords und Ladys erhoben sich zum Tanz, und der grobe Ritter knallte die Hand auf den Tisch.
»Ho, meine teure Lady! Zeit für ein wenig Ausgelassenheit. Lasst uns …«
Er verstummte mitten im Satz, und ich blickte in die Richtung, in die er sah, um geradewegs in die dunkelblauen Augen Sir John Nevilles zu schauen. Ich bekam keine Luft mehr.
»Lady Isobel, gewährt Ihr mir die Ehre dieses Tanzes?«, fragte er mit tiefem, wohlklingendem Timbre und einem Hauch nördlichen Akzents.
Er kannte meinen Namen! Ich öffnete den Mund, um Atem zu schöpfen, und richtete mich stumm auf. Nachdem er sich vor Sœur Madeleine verneigt hatte, stand sie auf und ließ mich aus der Bank. Ihr gefiel die Aufforderung eindeutig nicht, aber ich beachtete ihr Stirnrunzeln nicht und reichte ihm meine Hand. Mit einer Berührung, die gleichermaßen leicht wie sicher war, führte er mich in die Mitte der Halle. Wir nahmen unsere Plätze zwischen den übrigen Tanzenden auf dem mit Rosenblättern bestreuten Boden ein und bewegten uns im Takt zu den exotischen Klängen, die etwas von den wilden Hochmooren heraufbeschworen. Die Tanzfolge bestand in einem kleinen Seitwärtsschritt, dreien nach vorn, zweien zurück und einem Hüpfer. Ich wusste gar nicht recht, was ich tat, denn Sir Johns Augen hielten meine in ihrem Bann, und ich konnte nicht wegsehen. Wir verkehrten die Tanzschritte, bewegten uns mit einem Schritt voneinander weg und kamen wieder zusammen. Dabei fühlte ich seinen Atem über mich hinwegwehen. Im Hintergrund verschwammen die Kerzen mitsamt den Wänden und den anderen Tänzern, bis es nur noch ihn und mich auf der Welt zu geben schien, eingehüllt von Musik und angetrieben vom Wind unter meinen Füßen, der mich vorwärts- und rückwärtstrug. Sir John kniete sich hin, und ich umkreiste ihn langsam wie im Traum, ohne einen Moment seine Hand loszulassen oder den Blick von seinen Augen zu wenden. Dann sprang er wieder auf und tanzte um mich herum. Die Zeit stand still. Hilflos verharrte ich, während er tanzte und mein sehnendes Herz entflammte.
Wir machten einen Doppelschritt nach vorn, einen zurück, hüpften und gingen einen kleinen Schritt zur Seite. Hand in Hand, von Angesicht zu Angesicht tanzten wir in vollkommener Harmonie, mal in die eine Richtung, mal in die andere. Zwei Hälften eines Kreises waren wir, die sich zusammen in alle Ewigkeit drehten und drehten … Die Melodie füllte die Luft aus, ließ mir keine mehr zum Atmen, und ich wollte mir nicht einmal vorstellen, ihm nicht in die Augen zu sehen, nicht von ihm gehalten zu werden. Mein größter Wunsch war, dass es niemals endete, dieser Tanz immer weiterging und ich nie wieder in meine armselige Welt zurückkehren müsste.
Aber natürlich endete der Tanz. Mit einem klirrenden Zimbelton brach er ab. Wir verharrten mitten im Schritt. Nach wie vor blickten wir einander in die Augen und atmeten im gleichen Rhythmus, während die Töne bebend verklangen. Das Lied war vorbei, die Welt hörte auf, sich zu drehen. Sogleich lenkte ich all meine Kraft darauf, mich wieder zu fangen, doch mein Herz pochte so heftig, dass ich fürchtete, mein Busen würde meine Gefühle verraten. Ein befremdlicher Schwindel, hervorgerufen von Scham, Hitze und Erregung, schwächte mich, und ich hob eine Hand an meine Stirn.
»Mylady«, sagte er und stützte meinen Ellbogen, »mir scheint, wir sollten ein wenig frische Luft schnappen. Die Wärme hier drinnen ist erdrückend.«
Ich nickte lächelnd, aber leider fiel mir die Nonne ein. Sie würde nie erlauben, dass ich die Halle mit jemandem verließ, erst recht nicht einem Ritter und schon gar nicht einem Neville.
»Aber …«, begann ich und wandte mich zu unserem Tisch um.
»Wir werden um Erlaubnis bitten, wie es sich ziemt«, sagte er unüberhörbar amüsiert.
Als wir bei Sœur Madeleine ankamen, begriff ich auch, warum. Sie saß nicht mehr auf der Bank, sondern auf einem stoffbespannten Stuhl in der Ecke, den Kopf zu einer Seite geknickt und laut schnarchend. Ein Weinkelch hing lose in ihrer Hand, die tief in die Falten ihres Habits eingesunken war. Die letzten Tropfen hatten eine Pfütze neben ihrem Knie gebildet, die nun mit jedem ihrer Atemzüge auf und ab schwappte.
Ich unterdrückte mein Lachen und blickte zu dem Ritter auf.
»Ich würde meinen, Sœur Madeleine ist nicht in der Verfassung, uns die Erlaubnis zu versagen, Mylady«, sagte er zwinkernd und zeigte beim Lächeln seine unwiderstehlichen Grübchen. Als er mir die Hand hinstreckte, ergriff ich sie höchst unelegant. Der Umstand, dass ich mich an den Diener erinnerte, der stets in ihrer Nähe geblieben war und sie absichtlich in Versuchung geführt hatte, zu viel zu trinken, störte mich nicht im Geringsten.
Draußen war die Luft frisch, die Nacht wundervoll und der kleine ummauerte Garten eine tropfenverzierte Blütenpracht. Aus den offenen Fenstern der großen Halle waberte Musik herbei, als wir einen Diener mit einem Orangentablett und eine Gruppe von Höflingen und Damen passierten, die lachend um einen kleinen, von Rosen umgebenen Springbrunnen standen.
»Mir wurde erzählt, Ihr seid Lancastrianerin«, sagte er.
»Mir erzählte man, Ihr seid Yorkist und dass alle Yorkisten Frauenschänder und Mörder sind«, entgegnete ich mit einem verstohlenen Seitenblick zu ihm, als wir durch den Garten schlenderten.
Er lachte so herzlich, dass sich auf seinen Wangen Falten und, zu meinem Entzücken, auch die Grübchen zeigten. Seine dunkelblauen Augen blitzten. »Glaubt nicht alles, was Ihr hört. Es gibt einige Ausnahmen.«
Ich blickte hinunter zu dem Hund, der ihm vergnügt folgte. »Und was ist er, Yorkist oder Lancastrianer?«
»Yorkist, allerdings vergisst er es bisweilen und leckt einem Lancastrianer die Hand«, antwortete er sehr ernst, wobei jedoch sein einer Mundwinkel zuckte.
Ich lächelte, überwältigt von Glück. »Ist er stets bei Euch?«
»Immerzu, ausgenommen in Gefahr, etwa in der Schlacht … oder beim Tanz. Dann beobachtet er alles vom Zelt aus – oder von unterm Tisch. Er besitzt mehr Verstand als ich, müsst Ihr wissen.« Sir John sah mir in die Augen, und selbst im Sternenlicht fühlte ich das Feuer, das mich beim gemeinsamen Tanz erfasst hatte.
Ich wandte rasch den Blick ab. »Northumbria ist sehr schön. Ich war einmal dort«, sagte ich mit gesenktem Haupt.
»Cambridgeshire ist noch hübscher. Ich würde gern häufiger dorthin reisen.«
Nun sah ich doch zu ihm auf. Seinem verhaltenen Lächeln nach wusste er, dass ich verstanden hatte, was er meinte. Wieder errötete ich, ja, meine Wangen glühten, und ich war dankbar, dass es recht dunkel war.
Wir spazierten weiter in den Garten. Bald erhellten nicht länger Fackeln den Weg, aber es gab auch keine neugierigen Augen mehr, die uns beobachteten, einzig die funkelnden Sterne über uns. Die Musik wurde leiser, bis nur noch das Zirpen der Grillen die nächtliche Stille ausfüllte. Ich war mir seiner Nähe sehr deutlich gewahr, und eine brennende Spannung durchströmte mich und ließ mich schmerzlich nach seiner Berührung verlangen.
»Ich hatte nie die Ehre, Euren Vater kennenzulernen, möge Gott seiner Seele gnädig sein«, sagte er, »aber ich kenne Euren Onkel. Der Earl of Worcester ist ein gottesfürchtiger, gelehrter Mann.«
»Ja, ist er. Er liebt das Studium und lehrte mich früh, welche Freuden Schriften bergen.«
»Was habt Ihr gelesen?«
»Ovid, Christine de Pisan, Euripides, Sokrates, Homer und Plato und …«
»Meiner Seel’!«, rief er lachend. »Das ist eine rechte Sammlung, obgleich ich es bei der Nichte eines solchen Mannes nicht anders erwarten würde. Leider kam ich nicht in den Genuss, größere Werke zu lesen, es sei denn, Ihr zählt De Rei Militari mit dazu.«
Seine Erwähnung eines der bedeutendsten Werke zur Kriegsführung stimmte mich traurig, enthüllte sie mir doch etwas, das ich aus seinem Auftreten niemals folgern würde. Die Bürde der Gegenwart lastete schwer auf diesem Ritter, so unbekümmert er auch reden mochte. Und ich fühlte, dass sein sorgloses Äußeres das tiefsinnige, nachdenkliche Wesen eines Mannes maskierte, der viel grübelte. Prompt ging mir das Herz auf.
»Habt Ihr gewusst, dass wir verwandt sind, Lady Isobel? Euer Onkel, der Earl of Worcester, wurde einst mit meiner Schwester Cecily vermählt – Gott habe sie selig!«
Ungläubig sah ich ihn an. Nein, das hatte ich nicht gewusst.
»Natürlich ist es viele Jahre her, als er Lord Tiptoft war und noch nicht Earl of Worcester. Meine Schwester war seine erste Frau, und sie waren nur wenige Monate verheiratet, bevor sie starb.«
Ich murmelte mein Beileid, immer noch verblüfft ob dieser Neuigkeit. »Das wurde mir nie erzählt«, sagte ich. »Ich entsinne mich lediglich meiner Tante Elizabeth. Sie starb, als ich noch klein war.«
Er lächelte betrübt. »Elizabeth Greyndour war seine zweite Gemahlin. Ihr wart noch ein Säugling, als er und meine Schwester vermählt wurden, und ich würde sagen, dass verwandtschaftliche Beziehungen zu Yorkisten nichts sind, womit man sich dieser Tage brüstet.«
Hierauf antwortete ich nicht, weil ich es nicht leugnen konnte und ohnedies noch mit der Eröffnung haderte, dass unsere Familien durch Heirat verbunden waren – nicht zu vergessen die Hoffnung, die diese Tatsache in meinem Busen weckte.
»Euer Onkel ist als Abgesandter in Irland, wie ich hörte. Wie geht es ihm?«, erkundigte er sich.
»Oh, gut«, sagte ich deutlich munterer, denn mein Herz hatte sich mit der Neuigkeit arrangiert, und Freude regte sich in mir. »Er schrieb, dass er eine Pilgerreise nach Jerusalem plane, wenn er aus Irland zurück ist, und vielleicht einige Zeit in Padua verbringen wolle, um die Schrift, Latein und Griechisch zu studieren.«
»Ja, richtig, das erzählte er mir auch, bevor er im letzten Jahr aufbrach. Ich glaube, er wollte Ovid aus dem Lateinischen übersetzen.« Plötzlich fragte er: »Wie alt seid Ihr?«
Als ich zögerte, grinste er. »Falls Ihr wegen Rufus besorgt seid, kann ich Euch versichern, dass er es keinem verraten wird.«
Ich konnte nicht anders, ich musste lachen. »Fünfzehn«, antwortete ich, sobald ich mich wieder gefangen hatte.
»Stimmt es, dass Ihr ein Mündel von Marguerite d’Anjou seid?«
Die Wirkung dieser Frage auf mich hatte ich unmöglich vorhersehen können. Mit einem Schlag rief sie mir in Erinnerung, dass Nevilles bei Hofe nicht wohlgelitten waren, woraufhin mein hübscher Fantasiekokon zerriss und ich jäh in die Wirklichkeit zurückgeworfen wurde. Vielleicht klärte auch die frische Luft mein Denken und erschütterte jene Gefühle in mir, die einer zügellosen Maid in einer Taverne besser angestanden hätten; oder es waren die Worte meines Vaters, die mir einfielen: »Strebe nicht zu hoch hinaus; verlange nicht zu viel! Der größte Kummer ist der, den wir uns selbst bereiten.«
Wie auch immer, wurde ich mir inne, wie unbesonnen und närrisch ich gewesen war. Die Heirat, die einst unsere Familien verbunden hatte, war Geschichte, ein Band, das längst gekappt worden war. Die Zeiten hatten sich geändert, der Hass sich gefestigt, und die Kluft, die uns trennte, war so unüberbrückbar wie die stürmische See. Dieser Ritter gehörte einer der mächtigsten Familien des Christentums an und war mit der Königin verfeindet, der ich gehörte. Wie konnte ich sicher sein, dass er nicht zur Belustigung mit mir spielte und mich als Instrument benutzte, um die von ihm verachtete Königin zu beschämen? Und selbst wenn dem nicht so war, was zählten schon seine angenehmen Eigenschaften? Für mich war und blieb er so unerreichbar wie die Sterne über uns. Ich hatte meine Stellung vergessen, zu hoch gegriffen und nach dem Unmöglichen verlangt. Die Götter antworteten mir, indem sie mir Feuer sandten. Ich musste fort, solange noch Hoffnung auf Genesung bestand. Meine Amme hatte recht gehabt: Ich war unvernünftig, närrisch und wild. Wann würde ich endlich klug werden?
»Mylord, es ist wahr, dass ich ein Mündel der Königin bin. Wir dürfen nicht hier sein, wie Ihr sehr wohl wisst. Deshalb bitte ich Euch, mich zu meiner Beschützerin zurückzubringen und zu vergessen, dass wir uns begegnet sind.« Die Worte waren wie Steine auf meiner Zunge.
Für einen Moment schaute Sir John seltsam befremdet drein und rührte sich nicht. Dann jedoch richtete er sich zu seiner vollen Größe auf und sagte in einem Tonfall, der mir das Herz durchbohrte: »Ihr habt recht, Mylady. Bitte verzeiht mir! Ich geleite Euch umgehend zurück.« Er bot mir steif seinen Ellbogen an, und ich legte meine Hand so sacht auf seinen Ärmel, als berührte ich heißes Eisen. Stumm gingen wir durch den Garten zurück in die große Halle, die wir niemals hätten verlassen dürfen.
In jener Nacht schlief ich nicht. Ich lag in der Dunkelheit und weinte in mein Kissen, während ich dem Schnarchen von Sœur Madeleine lauschte und die Glockenschläge zum Ende jeder Stunde zählte. Nie würde ich die köstliche, überwältigende Süße des Tanzes vergessen, aber die Zeit würde diesen Jammer heilen und das Leben weitergehen. Dessen war ich gewiss, weil es in den Büchern stand.
Der Morgen brach sonnig und schön heran, nur verursachte mir der fröhliche Gesang der Lerche Herzeleid und jagte mir Furcht ein. Letztere war unnötig, wie sich erweisen sollte, denn Sir John Neville frühstückte nicht mit uns in der großen Halle. Wie ich hörte, war er mit dem ersten Hahnenschrei fortgeritten. Ich hatte keinen Appetit und nagte lieblos an einem Brot, das zu essen Sœur Madeleine mich zwang. Wir standen im Innenhof und sahen zu, wie die Stallburschen unsere Pferde sattelten. Das Gebell der Hunde betrübte mich auf eine bis dahin ungekannte Weise. Als die Glocke zur Prim läutete, brachen wir auf. Hinter uns fiel das Burggatter zu. Der rote Ziegelsteinbau wurde kleiner und kleiner, je weiter wir ritten, und unsere Mitreisenden wurden weniger. Die Holzhäuser des Dorfes um die Burg wurden von vereinzelten Cottages abgelöst, von Feldern und Scheunen, bis schließlich offene Moorlandschaft vor uns lag. Beim Anblick der hohen Gräser und Blumen, die sich in der Sonne wiegten, und umgeben von einer Stille, die nach dem bunten Treiben in der Burg nachgerade grotesk anmutete, überkam mich das schaurige Gefühl, ich würde in eine unendliche Ödnis reiten. Die Hufe meines Zelters klopften auf der Straße, klippedi-klapp, klippedi-klapp, und ihr Pochen wurde zu einem Dröhnen in meinen Ohren. Unwillkürlich ließ ich das Pferd langsamer gehen, fiel hinter den anderen zurück und blickte nach hinten, vorbei an der Sommerheide nach Tattershall Castle.
»Gestern Abend konntest du gar nicht aufhören, zu tanzen und zu lachen, und nun bist du still wie ein Mäuschen, wenn die Katz’ naht«, sagte Sœur Madeleine, die sich in ihrem Sattel zu mir umdrehte. »Was ist dir, ma chérie?«
Ich konnte nicht antworten. Überhaupt glaubte ich, nie wieder sprechen zu wollen. Tränen beschwerten mir das Herz und machten meine Augen blind. Mein Zelter schloss mit dem Pferd der Nonne auf, und ich senkte den Kopf, damit sie mein Gesicht nicht sah.
Sœur Madeleine streckte einen Arm aus und drückte meine Hand. »Du bist jung, meine Kleine«, sagte sie leise. »Eines Tages kommt ein anderer und lässt dich vergessen.«
Da blickte ich doch zu ihr, und mir war, als sähe ich sie zum ersten Mal richtig.





























