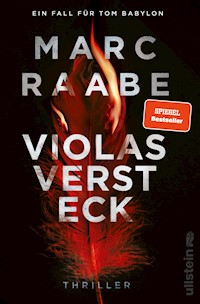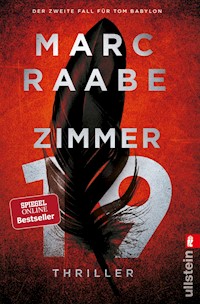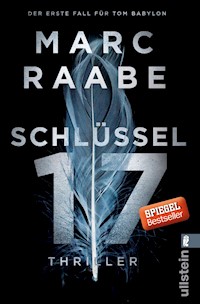9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Wer ist Die Hornisse? »I love you all«, ruft der gefeierte Rockstar Brad Galloway seinen 22.000 Fans in der Berliner Waldbühne zu. Plötzlich tritt eine Frau ins Scheinwerferlicht und überreicht ihm einen Umschlag. Am nächsten Abend wird der tote Galloway, ausgeblutet und ans Bett gefesselt, im Gästehaus der Polizei gefunden. LKA-Ermittler Tom Babylon sucht gemeinsam mit der Psychologin Sita Johanns nach der Unbekannten. Die Spur führt dreißig Jahre zurück – zu einer heimtückischen Kindesentführung mit dem Decknamen »Hornisse« – und zu einer Frau, die zwischen zwei Männern stand. Beide waren bereit zu töten. Einer sinnt noch heute auf Rache. Und das kann Tom Babylon alles kosten, was er liebt. Der neue Thriller von Bestsellerautor Marc Raabe!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Die Hornisse
Der Autor
MARC RAABE, 1968 geboren, ist Geschäftsführer und Gesellschafter einer TV- und Medienproduktion. Seine Thriller Schlüssel 17 und Zimmer 19, Auftakt der Serie mit Kommissar Tom Babylon, waren monatelang auf der LITERATUR SPIEGEL Paperback-Bestsellerliste.Raabes Romane sind in über zehn Sprachen übersetzt.Er lebt mit seiner Familie in Köln.
Das Buch
»I love you all«, ruft der gefeierte Rockstar Brad Galloway seinen 22.000 Fans in der Berliner Waldbühne zu.Plötzlich tritt eine unbekannte Frau ins Scheinwerferlicht und überreicht ihm einen mysteriösen Umschlag. Am nächsten Abend wird Galloways ausgeblutete Leiche ans Bett gefesselt im Gästehaus der Polizei gefunden.LKA-Ermittler Tom Babylon wird zum Tatort gerufen und fahndet gemeinsam mit der Psychologin Sita Johanns nach der unbekannten Frau. Die Spur führt dreißig Jahre zurück – zu einer heimtückischen Kindesentführung mit dem Decknamen »Hornisse« – und zu einer Frau, die zwischen zwei Männern stand. Beide waren bereit zu töten.Einer sinnt noch heute auf Rache. Und das kann Tom Babylon alles kosten, was er liebt.
Marc Raabe
Die Hornisse
Thriller
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Originalausgabe im Ullstein Paperback© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2020© 2020 by Marc RaabeUmschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenUmschlagabbildung: FinePic®, MünchenAutorenfoto: © Gerald von ForisE-Book-Konvertierung powered by pepyrus.comAlle Rechte vorbehalten.ISBN 978-3-8437-2446-3
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Epilog
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Standing in the middle of the road is very dangerous;
you get knocked down by the traffic from both sides.
Margaret Thatcher
Prolog
Berlin, WaldbühneFreitag, 18. Oktober21:38 Uhr
Seine Nerven sind gespannt wie eine Bogensehne. Der DIN-A4-Umschlag, den er unter dem Innenfutter seiner Jacke versteckt hält, macht ihn nervös. Ihm ist warm, er weiß, dass er nach Schweiß riecht.
Er zeigt ein weiteres Mal seinen scheckkartengroßen Ausweis, wobei er versucht, seine Augen im Schatten der Mütze zu halten. Die zwei Typen nicken unterkühlt. Winken ihn durch. Der eine rümpft die Nase. Und so was nennt sich Security! Er hört schon die Fragen der Polizei. Die spitzen Formulierungen, den Vorwurf, dass ihnen doch etwas hätte auffallen müssen. Vermutlich werden die zwei ihren Job verlieren. Vielleicht verlieren auch noch andere ihren Job. Selbst schuld, wenn man einer blöden Plastikkarte glaubt.
Er geht zwischen mannshohen Absperrgittern das letzte Stück durch den Wald. Links, hinter dem Sichtschutz, sind die Massen. 22 290 Menschen, schreiend, jubelnd, sich im Takt wiegend und klatschend.
Gut, dass er sie nicht hört.
Gut, dass er fast gar nichts hört von all dem Aufruhr.
Er wirft noch einmal einen Blick auf das Foto in seinem Handy, prägt sich das Gesicht der Frau ein. Ende dreißig, blond. Ein wirklich hübsches Gesicht, das muss er zugeben. Aber das steht jetzt nicht zur Debatte. Er steckt das Handy wieder ein. Der Ausweis schaukelt an dem langen blauen Band um seinen Hals. Die Bäume über ihm greifen in den dunklen Himmel. Der Umschlag unter seiner Jacke wiegt schwer, obwohl er recht leicht ist. Im Inneren ist etwas Längliches, Rechteckiges – so viel konnte er ertasten. Was ist länglich, rechteckig und »von zerstörerischer Kraft«?
Denn genau das war das Versprechen gewesen, der Umschlag sei »von zerstörerischer Kraft«. Mehr hat er bei der Übergabe nicht erfahren.
Schweiß läuft ihm zwischen den Schulterblättern den Rücken hinab. Die Schaumstoffpfropfen in seinen Ohren drücken. Er hasst das taube Gefühl, das sie im Kopf machen. Doch noch mehr hasst er den Lärm, der hier herrscht. Ohne die Pfropfen in den Ohren würde ihn das alles irremachen.
Er bremst seine Schritte. Die Rückseite der Bühne liegt vor ihm, ein Klotz aus Stein und Beton, der noch aus der Zeit des Nationalsozialismus stammt. Für die Zuschauer ist das hässliche Ding nicht zu sehen, von vorne dominiert das geschwungene weiße Dach der Waldbühne mit seinen zeltartigen Spitzen. Direkt am Hintereingang sind ein paar Dixi-Klos aufgestellt; für alle Fälle. Laminierte Zettel mit den Namen der Künstler kleben an den Türen.
Brad Galloway.
Er wünschte, die Hornisse könnte ihn jetzt sehen, könnte Zeuge sein, wie er alles ins Rollen bringt. Der Gedanke lenkt ihn für einen Moment ab. Was nicht gut ist. Er muss weiter. Erst der Umschlag, dann alles andere. Am liebsten hätte er, dass es heute gleich weitergehen würde. Aber das ist nicht der Plan.
Nervös betritt er den Gang. Roher Beton. Der Tunnel der Stars. Wer hier schon alles durchgelaufen ist!
Er öffnet den Reißverschluss seiner Jacke. Der Umschlag ist wattiert, die Oberfläche steif und glatt, sie knistert leise.
Länglich, rechteckig, von zerstörerischer Kraft.
Was könnte das sein? Plastiksprengstoff? Das würde passen. Semtex oder so was. Er will auf keinen Fall in der Nähe sein, wenn der Umschlag geöffnet wird. Denn er wird schnell geöffnet werden, allein schon wegen des roten Stempels. Urgent! – Dringend. Wie dieser Song von Foreigner aus den Achtzigern. Das war zwar etwas vor seiner Zeit, aber mit Musik kennt er sich aus. Die Melodie ist sofort in seinem Kopf.
Got fire – in your veins.
Burnin’ hot – but you don’t feel the pain.
Der Tunnel endet und vor ihm öffnet sich die Bühne. Licht pulsiert. Strahlen schneiden den Nebel in Scheiben. Vor seinen Augen explodiert ein Farbspektakel, Galloway und seine Band mittendrin, dahinter erheben sich die dicht besetzten Zuschauerränge des riesigen Amphitheaters.
Er kneift die Augen zusammen und mustert die Ränder der Bühne. Wo zum Teufel ist jetzt die Frau?
Eine Gruppe Menschen steht im Schatten eines Boxenturms; offenbar die Backstageloge für Groupies, Lakaien und Manager. Er läuft darauf zu, versucht im Streiflicht die Frau auszumachen. Der wattierte Umschlag scheint seltsam heiß zu werden zwischen seinen Fingern.
Wer sagt eigentlich, dass das Semtex erst hochgeht, wenn der Umschlag aufgerissen wird? Es könnte auch ein Zeitzünder sein. Oder ein Fernzünder …
Zuzutrauen wär’s ihm.
Er muss das Ding loswerden. Sofort.
Von links kommt eine Kamera herangeflogen, auf einem federnden Metallarm vor die Brust des Kameramanns geschnallt. Gerade noch rechtzeitig, bevor die Linse ihn erfassen kann, huscht er beiseite. Das Bild der Steadicam erscheint groß wie ein Haus auf dem Screen an der Rückwand der Bühne und zeigt Galloways Rücken vor einem Meer aus Fans.
Ein paar Schritte noch, dann ist er bei der kleinen Menschengruppe am Rand der Bühne, und plötzlich sieht er sie. Kein Zweifel, das ist die Frau auf dem Foto. Nur ihr Gesichtsausdruck ist anders, irgendwie bedrückt. Fast tut sie ihm leid. Sie wäre besser wirklich nicht hier.
Fuck. Zweifel sind das Letzte, was er jetzt gebrauchen kann. Die Hornisse hat das alles hier zu verantworten, niemand sonst. Ohne sie wäre das alles nie passiert. Also Umschlag übergeben und weg hier. Die Bühne vibriert. Die Frau steht da, wiegt mechanisch die Hüften, hat nur Augen für Galloway.
Er stupst sie an und hält ihr seinen Ausweis unter die Nase. »Hey. Ich soll ihm das geben«, brüllt er, hebt den Umschlag und deutet auf Brad Galloway.
Sie runzelt die Stirn, sagt etwas, doch durch die Ohrstöpsel versteht er nichts.
»Du triffst ihn doch gleich, in der Garderobe, oder?« Er tippt auf den roten Stempelaufdruck. »Ist dringend!«
Sie zuckt mit den Schultern, wirkt unschlüssig. Er nutzt den Moment und drückt ihr den Umschlag in die Hand. »Danke!«
Bevor sie etwas erwidern kann, dreht er sich um und lässt sie stehen. Auf der Treppe nimmt er jeweils drei Stufen auf einmal. Bloß nicht zur falschen Zeit am falschen Ort sein.
Konsterniert starrt sie auf den Umschlag in ihrer Hand. Was bitte war das gerade? Was bildet der Typ sich ein! Sie hat weiß Gott andere Themen, als auch noch den Kurier zu spielen.
Brads Stimme holt aus und hebt ab. Der Jubel von über zwanzigtausend Menschen schwillt an. Sie bekommt eine Gänsehaut. Sieht seine Hand, fest ums Mikrofon, hätte sie gerne woanders und schämt sich zugleich dafür. Seine Lippen berühren die Waben des Mikros, winzige Tröpfchen sprühen im Gegenlicht. Wie kann in einer Stimme so viel Seele sein?
Die Gänsehaut will und will nicht gehen.
Das wollte sie auch damals nicht. Sie hatte unten in der ersten Reihe gestanden. Es wäre besser gewesen, er hätte sie nicht gesehen. Es wurde ein fünf Tage langer gemeinsamer Rausch.
Geteilte Einsamkeit.
Gegen das Gefühl von Verlorensein anvögeln, und gleichzeitig war es so viel mehr gewesen. Ein kurzer Traum von Liebe. We are all broken, that’s how the light gets in. Brads Worte. Cohen, Hemingway, wer auch immer das geschrieben hatte, er musste Brad in die Seele geschaut haben.
Die Zwanzigtausend singen mit ihm. Für ihn. Wie zwanzigtausend Geliebte. Als würden sie alle ihre Erinnerung und ihre Gefühle teilen. Dabei gibt es niemanden, der so viel mit ihm teilt wie sie. Sie müsste es ihm nur sagen.
Die Waldbühne liegt Brad zu Füßen, und sie fragt sich, ob es nicht besser wäre zu gehen. Aber da ist der Umschlag. Sie schaut auf den Stempel. Urgent!
Plötzlich spürt sie seinen Blick. Er hat sie gesehen und streckt die Hand nach ihr aus, winkt, was so viel heißt wie: »Komm her zu mir!« Die Kamera wirft ihn riesengroß auf die Leinwand.
Sie schüttelt den Kopf, hält sich am Umschlag fest, will im Schatten bleiben. Er singt weiter, die Stimme dunkel und samtig, und er winkt erneut.
Bleib bloß weg. Ich kann nicht.
Die Sticks wirbeln auf dem Schlagzeug, die Musik schwillt zu einem gigantischen Finale an. Der letzte Gitarrenschlag geht im Jubel von Tausenden Kehlen unter. Schwärme von Handys leuchten auf der Tribüne.
Galloway brüllt: »Thank you! I love you all!«
So was von peinlich. Die billigste aller Liebeserklärungen. Und trotzdem funktioniert es, auch bei ihr.
Plötzlich steht er vor ihr. Die Steadicam fliegt auf sie zu. Sie wendet ihr Gesicht von der Kamera ab, drückt ihm dabei den Umschlag vor die Brust. Er lacht, packt sie, zieht sie heran, ohne dass sie sich wehren könnte, betrachtet den Umschlag in seinen Händen und runzelt die Stirn.
»Where have you been«, murmelt er, den Mund dicht an ihrem Ohr.
Sie antwortet nicht.
22 290 Menschen rufen: »Zu-ga-be!«
Er reißt den Umschlag auf, langsam, und sieht sie dabei an, als wäre der Umschlag ein Geschenk von ihr. Denkt er das wirklich? Sie sollte ihn aufklären.
Das Ratschen des Papiers geht im Lärm unter.
Warum wartet Brad nicht, bis er in der Umkleide ist?, denkt sie.
Gleich ist er offen.
Wieso eigentlich Urgent? Was kann so wichtig sein, dass er es hier auf der Bühne öffnen soll? Ein seltsames Gefühl beschleicht sie. Der Mann, der ihr vorhin den Umschlag gegeben hat, war seltsam. Die dunkle Kleidung, die Schirmmütze, der strenge Geruch von Schweiß. Aber so sind Roadies, oder?
Der Umschlag ist offen.
Brads Blick ist ein Fragezeichen.
Er fasst hinein. Zieht eine längliche, rechteckige Metalldose heraus und runzelt erneut die Stirn. Mit einer raschen Bewegung öffnet er die Dose und blickt hinein. »What the fuck …?« Mit einem Ausdruck zwischen Ekel und Verblüffung hält er ihr die Dose hin, als ob sie erklären könne, was das sein soll.
In der Aluminiumdose liegt eine kleine weiße Vogelfeder in einem Bett aus geronnenem Blut. Die Härchen sind verklebt und an manchen Stellen im dunklen Bodensatz eingetaucht, als wäre die Feder ausgeblutet und im eigenen Saft erstarrt.
Kapitel 1
Berlin-ReinickendorfSamstag, 19. Oktober02:14 Uhr
Gar nicht so lange her, denkt er, da gab es auch in Deutschland noch Todesurteile. Amtlich, mit Stempel. Getippt im Zwei-Finger-Suchsystem auf buckligen Schreibmaschinen mit Durchschlagpapier und ausgeführt im Verborgenen, von Soldaten ohne Uniform. Wenn man denkt wie ein Soldat, wird das Töten ganz normal.
Er legt die dritte leere Heparin-Spritze neben das Einmachglas auf dem kleinen Tisch.
Die Knoten hat er wie im Schlaf gebunden. Segelschein, mit fünfzehn. Was Boote hält, das hält alles.
Er holt einen Stuhl heran, setzt sich und betrachtet sein Werk.
Ein Lächeln kräuselt seine Lippen. Teufels Werk gegen Gottes Beitrag.
Er zieht das Messer aus der Scheide. Die Latexhandschuhe sitzen spack an den Fingern. Wie sich alles in der blanken Klinge spiegelt! Das Zimmer mit den vergilbten Vorhängen, das Bett mit dem Überwurf, der nach Staub und Mief riecht, die Seile, die sich zitternd spannen, und wenn er das Messer richtig hält, spiegelt sich darin sogar sein eigenes Gesicht.
Sein Lächeln wird hart, und er steht auf, tritt ans Bett heran, ignoriert das dumpfe Geheule, packt zu und schneidet. Das Textilklebeband auf dem Mund bläht sich, als wollte der Knebel herausspringen.
Das Einmachglas auf dem Tisch will gefüllt werden.
Also rein damit.
Dann klappt er den Deckel zu und schließt die Metallspange am Glas. Ihm ist, als ob das Gummi leise seufzt.
Er sollte Formaldehyd dazugießen, dann wird es sich länger halten.
Er setzt sich wieder hin, hält das Glas mit spitzen Fingern am Deckel, sodass er gut seinen Inhalt betrachten kann. Das Bett vor ihm ruckelt. Panisch rutschen die Pfosten in kleinen Schritten über den Boden.
Vor, zurück. Vor. Zurück, zurück.
Nach einer Weile wird das Bett still.
Und das im Gästehaus der Polizei.
Gott, das wird sie fuchsen!
Kapitel 2
Berlin-KreuzbergSamstag, 19. Oktober17:48 Uhr
Tom legt seinen Sohn auf den Rücken, hebt ihn an den kurzen, immer noch speckigen Beinen etwas hoch und schiebt ihm die Windel unter den Po. Es riecht nach Chlor. Die verbeulten und mit Aufklebern übersäten Stahlschränke in der engen Umkleide der Kreuzberger Welle passen eher in einen Boxclub als in das beschauliche Kiez-Schwimmbad.
Phil gluckst und strahlt ihn an, er hat sich glücklich und müde geplanscht. Der Kleine liebt Wasser; der einzige und beste Grund für Tom, mit ihm den Schwimmkurs zu besuchen. Er ist allein unter Frauen hier, was ja an sich nichts Schlimmes wäre, doch seit sich unter den Müttern herumgesprochen hat, dass er beim LKA in der Mordkommission arbeitet, können ein paar der Mütter ihre Neugier kaum bremsen.
Ob er mit diesem schrecklichen Berlinale-Fall zu tun gehabt habe? – Was? Tatsächlich? – Ach, ob er denn diesen Dr. Bruckmann vom LKA persönlich kenne? Der sei doch nach der Schießerei am Holocaust-Mahnmal geflohen … eine Schande sei das, was er da angerichtet hat. Ob die Polizei denn gar keine Ahnung habe, wo er steckt? Und warum eigentlich der Rücktritt von Bürgermeister Otto Keller, das sei doch mehr als verdächtig, oder etwa nicht?
Tom hat mit Kursbeginn auf Durchzug geschaltet und gibt abweisende Antworten. Es gibt nichts, was er sagen könnte – selbst wenn er wollte. Bruckmann ist und bleibt verschollen, und die Anschuldigungen gegen Keller sind zu diffus, um in einen Prozess zu münden. Doch Toms Schweigen führt bisher nur dazu, dass die betreffenden Mütter ihr Bemühen noch steigern, in einer Art seltsamem Wettbewerb, wer von ihnen wohl den stillen Kommissar knacken wird. Hinter einer spanischen Wand in der Eingangshalle hat er heute vor Beginn des Kurses ein Gespräch von Regina, Bozana und Claudia mitbekommen.
»Glaubt ihr, der ist wirklich verheiratet?«, fragte Regina, die älteste der drei Mütter. »Ich meine, ich seh den immer nur mit dem Jungen alleine.«
»Die Frau heißt Anne, glaube ich«, meinte Bozana, eine Polin mit auffallend guter Figur, die mit rot geschminkten Lippen ins Wasser ging und nie untertauchte.
»Ein Jammer«, seufzte Claudia.
»Muss doch nichts heißen, gibt bestimmt einen Grund, warum diese Anne nie mit dabei ist«, sagte Regina. »So ’nen Kerl … Also ich würde den nicht allein zum Schwimmkurs gehen lassen. Allein die Größe …«
»Welche Größe meinst du denn jetzt, Schätzchen?«, kicherte Bozana.
»Na, eins neunzig ist der doch mindestens.«
»Ach, die Größe.«
»Wobei«, meinte Claudia, »vielleicht sollte ihm mal jemand sagen, dass Dreitagebart nicht mehr in ist.«
»Wieso? Blonder Dreitagebart, ist doch sexy.«
»Wenn er nur nicht so still wäre.«
»Groß, blond, blaue Augen und still! Was wollt ihr denn mehr?«, echauffierte sich Bozana.
Claudia prustete spöttisch. Je mehr sie etwas wollte, desto mehr kleidete sie ihre Wünsche in Ablehnung – was alle wussten. »Der Engel vom Revier. Mehr Klischee geht nicht, oder?«
»Wenn mich Mr Klischee doch glücklich macht …«, sagte Bozana.
Bevor Tom mit anhören muss, was Bozana noch alles glücklich macht, hat er sich in die Männerumkleide verzogen, die vor und nach dem Kurs seine Fluchtburg ist. Die Momente, die er allein mit seinem Sohn hat, sind ohnehin viel zu selten, nicht zuletzt wegen seines Jobs.
Phil strampelt mit den Beinen. Tom hält eines davon fest, prustet ihm unter die Fußsohle, und in Phils kleinem Gesicht explodiert ein unbändiges Lachen, das Toms Herz erwärmt.
Gerade als Tom die Klettverschlüsse der Windel schließen will, klingelt sein Handy. Er angelt nach der Tasche, die hinter Phil liegt, beugt sich über ihn, bekommt das Handy zu fassen und spürt, wie es nass und warm an seiner Brust wird.
Oh nein, bitte nicht!
Mit der freien Hand drückt Tom rasch die Windel in Phils Schritt, aber es ist schon zu spät.
»Babylon«, seufzt Tom ins Telefon und betrachtet den Fleck auf seinem Hemd.
»Grauwein«, ahmt Peer Toms Seufzer nach.
»Haha«, erwidert Tom trocken. Grauweins spontane Witzelei ist eins, doch die Tatsache, dass der Kriminaltechniker ihn nach Dienstschluss anruft, verheißt nichts Gutes. »Ich hab frei«, knurrt Tom, klemmt das Handy zwischen Schulter und Ohr und schließt die Windel.
»Ich auch«, sagt Grauwein. »Und die Dispo übrigens auch. Weshalb Morten mich gebeten hat, dich anzurufen.«
»Großartig. Und?«
»Er will dich hier. Sofort.«
Tom presst die Lippen aufeinander. Seit Joseph Morten zum stellvertretenden Dezernatsleiter befördert worden ist, paart sich seine Stinkstiefeligkeit mit einem unangenehmen direktiven Ton. »Sag ihm, ich kann jetzt nicht.«
»Sag’s ihm selbst«, erwidert Grauwein. »Er dreht gerade am Rad.«
»Was zum Teufel ist denn los?« Tom kitzelt Phils kleinen Fuß und schneidet ihm eine Grimasse.
»Eine Leiche im Gästehaus der Polizei.«
»Wo?«, stutzt Tom. »Im Gästehaus …? Ist da nicht gerade die Forensik-Weiterbildung?«
»Genau.«
»Wie schlimm ist es?«
»Doppelschlimm«, sagt Grauwein. »Eine Riesensauerei. Dazu kommt, die Leiche liegt seit gestern hier, und keiner hat’s gemerkt.«
Kein Wunder, dass Morten am Rad dreht, denkt Tom. Ein Mord, und nebenan tagt das halbe Dezernat 11 für Tötungsdelikte, gemeinsam mit Kollegen aus den anderen Bundesländern. »Und das Opfer?«, fragt Tom. »Schon identifiziert?«
Grauwein zögert einen Moment, schließlich sagt er leise. »Das wirst du nicht glauben.«
Tom hat plötzlich das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Da ist sie wieder, die alte Falle, die seine Furcht zuschnappen lässt wie ein Fangeisen. Mit einem Mal hat er Viola vor Augen, seine kleine Schwester, die im Alter von zehn Jahren spurlos verschwunden ist. Wie oft hat er schon geglaubt, zu einem Tatort zu kommen und vor Violas Leichnam zu stehen. In seinen Albträumen sieht Vi dann nicht einen Tag älter aus als damals. »Ich komme«, sagt er heiser und legt auf.
Er hört nicht mehr, dass Grauwein ihn noch fragt, ob er nicht wissen wolle, wer das Opfer sei.
Nein, wolle er nicht, wäre Toms Antwort gewesen.
Manchmal geht die Furcht, Viola tot aufzufinden, Hand in Hand mit einem Funken Hoffnung, dann könnte alles endlich ein Ende haben.
1989
Kapitel 3
Stahnsdorf bei Berlin2. Mai 198917:48 Uhr
Oh Gott, Violas Gesicht hinter der Scheibe – vollkommen verweint! Und wie Tom mit seinen fünf Jahren neben ihr saß, ihre winzige Hand hielt, eine zornige, angestrengte Falte auf seiner glatten Stirn. Seine blauen Augen blickten verzweifelt suchend aus dem Seitenfenster.
Zwei lange Stunden.
Es zerriss Inge das Herz.
Was war sie nur für eine furchtbare Mutter?
Sie öffnete die Hintertür des Wagens. »Schatz!«
Tom presste die Lippen aufeinander, und sie nahm sein Gesicht in beide Hände. »Es tut mir leid. So, so leid.« Die zornige Falte auf Toms Stirn wich einer gewissen Erleichterung.
Inge ließ ihn los und nahm Viola auf den Arm, die ihren zarten, wuscheligen Blondschopf an ihre Wange drückte und schluchzend Luft holte. Inge wiegte sie unter Toms kritischem Blick hin und her. Der Regen wurde stärker, und Viola und sie wurden pitschnass. Inge warf einen Blick zurück zum Haus. Oben im Fenster, im ersten Stock, stand Benno und sah ihr zu. Hinter der Spiegelung in der Scheibe konnte sie sehen, wie er eine harsche Bewegung mit der Hand machte: Verschwinde da, schnell!
Hier konnte sie nicht bleiben. Wenn sie jemand sah!
»Schätzchen, wir müssen los«, murmelte sie und setzte Viola hastig neben Tom auf die Rückbank, in die selbst gebaute Sitzschale. »Mami ist gleich für euch da, ja? Habt noch ein bisschen Geduld.«
Tom nahm ganz automatisch Violas Hand. Die Kleine hielt sich an ihm fest, als gäbe es auf der Welt nichts außer seiner Hand. Sie schluchzte kurz auf, doch immerhin: Sie weinte nicht mehr.
Inge warf die Tür zu, lief um den Wagen und setzte sich hinter das Steuer der DS. Was hatte sie sich nur gedacht? Der futuristisch anmutende grüne Citroën war wie ein bunter Hund unter all den Trabis und Wartburgs auf den Straßen. Die Spitzel hatten Ohren und Augen überall. Sie hätte sich einen anderen Wagen leihen sollen, vielleicht den Trabi von Wolf und Susanne.
Sie wendete im Hof und fuhr durch das Tor auf den Feldweg. Im Rückspiegel wurde der Hof zitternd kleiner. Wenn sie jemand gesehen hatte, würde es Fragen geben. Und Fragen waren schlecht. Fragen erregten Aufmerksamkeit. Sie blickte erneut in den Rückspiegel. Ein Schlagloch ließ den Citroën schaukeln, und sie sah für einen Moment ihren Hals im Spiegel. Die Schminke verdeckte den dunkelroten Fleck unterhalb des Ohrs nur unzureichend. Sie würde nachlegen müssen, bevor sie Werner unter die Augen trat. Wenigstens hatte sie vernünftige Schminke, im Gegensatz zu den meisten anderen. Dass Werner und sie im Friedrichstadt-Palast arbeiteten, hatte weiß Gott Vorteile. An Westschminke zu kommen war einer davon. Der Citroën war ein anderer.
Wasser spritzte zu beiden Seiten aus einer Pfütze. Werner würde fragen, woher der Dreck am Wagen kam. Ihr fiel das alte Handtuch im Kofferraum ein. Das müsste reichen, um gleich in der Stadt die schlammigen Spritzer fortzuwischen.
Der Wagen holperte ein letztes Mal, dann bog sie scharf auf die Straße ein.
»Mama, wieso fährst du so schnell?«, fragte Tom.
Schnell? Inge sah auf den Tacho und erschrak. Sie hatte es nicht einmal bemerkt, so sehr war sie in Gedanken.
»Entschuldige, Schatz, du hast recht.« Sie nahm den Fuß vom Gas, und die DS wurde langsamer. Fehlte noch, dass die Polizei sie wegen überhöhter Geschwindigkeit anhielt. Auch die Meldungen der Vopo landeten am Ende bei der Stasi. Mit Ortsangabe.
»Mama?«
»Ja, Schatz?«
»Was ist das an deinem Hals?«
»Das? Ach, das ist nichts.« Im Rückspiegel sah sie, wie Tom die Stirn runzelte. Fünf Jahre und schon der reinste Lügendetektor.
Sie stellte das Radio an. RIAS. Eine lakonische, unaufgeregte Stimme verlas Nachrichten aus dem Westen. Sie hasste den Mist, den die DDR-Parteisender von sich gaben. Wenn, dann stellte sie das Radio immer auf Westfunk. Jetzt erklärte der Sprecher, dass in Ungarn offenbar gerade Grenzposten Löcher in den Zaun an der Grenze zu Österreich schnitten. Im ersten Moment überkam sie eine plötzliche Freude – nein, Hoffnung. Das war ein Dammbruch. Gut, vielleicht nur ein erster Riss, aber dabei würde es nicht bleiben. Doch dann sank ihr Mut. Das konnte nur Blödsinn sein! Eine löchrige Grenze. Das würde niemand erlauben. Wäre das wahr, dann würden sich Tausende und Abertausende aus der DDR absetzen. Sie schnaubte. Auch der Westen machte Propaganda mit Falschnachrichten. Das würde nichts an ihren Plänen ändern. Sie musste raus hier. Und Benno war ihre Fahrkarte.
Benno hatte zwei Seiten. Die, die sie magisch anzog, und die andere, manchmal etwas düstere Seite, die sie nicht weniger anziehend fand. Es machte schließlich etwas mit einem, wenn man wie er ständig Zeit unter der Erde verbrachte und Tunnel grub. Sie erinnerte sich noch genau an den Abend, an dem sie Benno Kreisler kennengelernt hatte, in einer Wirtschaft, nach einer Aufführung im Friedrichstadt-Palast. Beim dritten Bier hatte er sie angesehen, die Zigarette aus dem Mund genommen und leise gesagt: »Das ist nichts für dich hier, oder?«
»Was?«, hatte sie gelacht. »Tanzen?«
Er nahm den letzten Schluck aus seiner Bierflasche und ließ den Zigarettenstummel in den Flaschenhals fallen. Interessiert drehte er die Flasche hin und her, als würde er ein eingesperrtes Insekt betrachten. Ein letzter Rest Glut leuchtete durch das braune Glas. Als sich ihre Blicke trafen, da hatte sie gewusst, dass er sie besser verstand, als Werner es je tun würde.
Schuldbewusst sah sie in den Rückspiegel zu ihren Kindern.
Sie stellte das Radio aus und fuhr eine Weile schweigend, dann fielen ihr die Pfützen an der Potsdamer Allee ein. Tief und groß. Das könnte gehen, auch ohne Handtuch. Sie fuhr einen kleinen Umweg, lenkte den Wagen durch die Pfützen, wendete und fuhr noch mal rauschend durch die Wasserlachen. Ein Hoch auf die schlechten Straßen. Der Mangel an Asphalt hatte auch etwas Gutes.
»Was machst du, Mama?«
»Ach, ich bin heute etwas schusselig. Ich bin falsch abgebogen.«
»Ist Papa zu Hause?«
»Ich weiß nicht, Schatz«, sagte Inge. »Wart mal, ich muss kurz was schauen.«
Sie hielt am Straßenrand an, stieg aus und begutachtete die Kotflügel. Keine Dreckspritzer mehr. Gut so!
Sie stieg zurück in den Wagen, wollte gerade losfahren, doch dann drehte sie sich um und sah Tom mit ernstem Blick an. »Schatz, du musst mir etwas versprechen. Es ist ganz doll wichtig.«
»Was denn, Mama?«
Gott, wie hoch seine Stimme klang. Wie klein. Fünf Jahre! Ob er verstehen würde, was hiervon abhing?
»Ich will, dass du Papa nichts von unserem Ausflug sagst, ja? Auf gar keinen Fall.«
»Warum?«
»Weil es wichtig ist. Und wenn Papa dich fragt, sag einfach, wir haben Susanne besucht, ja?«
»Aber wir waren doch gar nicht bei Susanne.«
Himmelherrgott!, flehte sie still. »Schatz, ich weiß. Aber es ist wirklich wichtig, sonst kriegen wir Ärger.«
»Schlimmen Ärger?«, fragte Tom.
»Sehr, sehr großen Ärger. Versprichst du’s mir?«
Tom schwieg einen Moment. Dann nickte er bedächtig, auf eine kindliche Art geradezu feierlich, als wüsste er um den Ernst der Lage. Vielleicht, dachte Inge, hat er auch nur die Panik in meiner Stimme bemerkt. Wie auch immer, Toms blaue Augen waren klar wie Bergseen, und er sah sie unverwandt an. »Gut, Mama.«
Sie seufzte. Ein kurzer Moment der Erleichterung. Tom war einfach ein Seelchen.
Kapitel 4
Berlin-KreuzbergSamstag, 19. Oktober18:16 Uhr
Tom hebt Phil sanft aus dem Kindersitz. Der Kleine ist auf der Rückfahrt eingeschlafen.
»Alles okay?«, fragt Anne leise, als er mit Phil auf dem Arm die Wohnung im Erdgeschoss des Heckmannufers betritt. Wortlos lädt Tom die Tasche mit den Schwimmsachen an der Garderobe ab und bettet Phil auf das Sofa. Seine finstere Miene ist Anne Antwort genug.
»Die nächste Leiche, hm?« Anne breitet eine dünne Wolldecke mit Tiermotiven über Phil aus. Eisbären, Tiger und Füchse. »Können eure Toten nicht mal zu normalen Arbeitszeiten auftauchen?«
»Normal ist eine Erfindung der Gewerkschaften«, erwidert Tom. »Damit haben die Toten nichts am Hut.«
»Gott«, seufzt Anne. »Ich werde schon genauso zynisch wie du.« Sie gibt ihm einen Kuss und fasst mit den Fingern in seine noch feuchten Haare. »Weiß man schon, wer?«
»Interessiert’s dich wirklich?«
»Hast recht, ich will’s gar nicht wissen. Ich wollte nur …«
»… freundlich sein«, sagt Tom mit Anne im Chor. Dieser Satz ist in der letzten Zeit zum ironischen Ritual zwischen ihnen geworden. Sie haben sich eisern vorgenommen, sich wieder mehr füreinander zu interessieren. Zwischen dem Umsorgen von Phil, Toms Polizeiarbeit und Annes Job als Cutterin beim Fernsehen bleibt wenig Zeit für sie als Paar; es gibt allenfalls kurze Abende, an denen sie meist todmüde und wortkarg sind. Auch heute sieht Anne aus, als hätte sie kaum geschlafen, was vielleicht auch daran liegt, dass sie gestern Abend mit einer Freundin um die Häuser gezogen ist. Eine Art Befreiungsschlag, der nur noch selten stattfindet. »Was ist das eigentlich für ein Fleck auf deiner Brust?«, fragt sie.
Tom ist bereits auf dem Weg ins Bad im Souterrain und knöpft sein Hemd auf. »Ein kleiner Unfall«, ruft er, wäscht sich ab und zieht kurzerhand das Hemd vom Vortag an, das noch im Bad liegt.
»Ich muss los«, ruft er. »Wart nicht auf mich, ja?«
»Ich sprech mal mit den Gewerkschaften«, seufzt Anne. »Vielleicht reden die ja doch mal mit deinen Toten.«
Kurz darauf biegt Tom von der Ruppiner Chaussee auf das Gelände der Polizei Berlin in Reinickendorf, auf dem auch die Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie liegt. Er hält an der Pforte und weist sich als LKA-Ermittler aus. Ein uniformierter Beamter vergleicht das kleine biometrische Foto mit Toms Gesicht, dann inspiziert er mit neugierigen Blicken den alten dunkelblauen S-Klasse-Benz. »Schickes Ding«, murmelt er anerkennend. Seine Nase steht schief, wie nach einem schlecht verheilten Treffer bei einem Faustkampf.
»Säuft nur zu viel«, brummt Tom.
»Tun wir das nicht alle?«, grinst der Beamte.
Nicht alle, denkt Tom. Aber Polizist sein will verdaut werden, und eine Kopfschmerztablette reicht vielen nicht. Der Beamte hat begriffen, dass Tom nicht zu Scherzen aufgelegt ist, nickt ihm zu und winkt ihn durch. Der Diesel schnurrt dunkel beim Anfahren. Dass der Wagen sechsunddreißig Jahre alt ist – ebenso alt wie Tom –, merkt man dem Motor nicht an.
Puh, kichert Viola auf dem Beifahrersitz. Wenn der noch länger hier reingestarrt hätte, dann hätte er mich vielleicht sogar entdeckt.
»Das wär doch mal was«, murmelt Tom.
Der Sitz neben ihm ist leer, und doch sitzt dort seine kleine Schwester, gerade so, als wäre sie aus Fleisch und Blut; eine quietschfidele Zehnjährige mit strubbeligen blonden Locken, bekleidet mit einem etwas zu großen Schlafanzug in Altherrenmuster.
Es gab Phasen in Toms Leben, da war Viola fast ganz verschwunden. Nur um sich bei der nächsten Gelegenheit wieder in sein Leben zu schleichen. Oft wird er sie dann wochenlang nicht los, hört sie, sieht sie und fällt zurück in die Zeit, als er Vi Tag und Nacht gesucht hat.
Jetzt komm schon, sagt Vi. Ich versuch dich nur aufzumuntern. Du hast doch nicht ernsthaft gedacht, dass ich das Opfer bin, oder?
Gedacht nicht, eher gefühlt.
Tom Babylon, seufzt Vi mit sorgenvoller Miene. Wann wirst du endlich erwachsen?
Statt zu antworten, lässt Tom auch auf ihrer Seite die Scheibe herab. Der Geruch von alten Fichten weht ins Auto. Die Oktobersonne steht tief und sticht zwischen den Bäumen hindurch. Lichtflecken huschen durch das Wageninnere. Als sich der Wald teilt, taucht das rote Ziegeldach des Gästehauses der Polizei auf. Die Reifen machen ein flatterndes Geräusch auf dem Kopfsteinpflaster. Das weitläufige Gästehaus ist ein niedriger, weiß verputzter Bau mit hohem rotem Satteldach. Das Gebäude hat eine T-Form; der hintere linke Flügel verschwindet hinter einem Gerüst und wird offenbar gerade saniert. Putz und Dachschindeln sind mehr als nur in die Jahre gekommen.
Auf dem Rasen vor dem Haus parkt die für Kapitalverbrechen übliche Mischung: Leichenwagen, Notarzt, Kriminaltechnik, zwei Streifenwagen und zivile LKA-Fahrzeuge; dazu Sita Johanns’ goldfarbener Saab. Die große, schlanke Psychologin steigt gerade aus dem Wagen. Tom parkt direkt hinter ihr.
»Hey, Sita.«
»Hallo, Tom.« Ihre dunklen Augen blicken ruhig. Sita ist Halbkubanerin, ihr Teint zeugt noch vom Sommer, mit einem intensiven Bronzeton. Ihre raspelkurzen schwarzen Haare betonen ihr markantes Gesicht und die Brandnarbe, die von ihrem linken Ohr bis zur Wange verläuft. Für einen Moment meint Tom einen Hauch von Alkohol wahrzunehmen, der von Sita ausgeht. Doch sie wirkt absolut klar und nüchtern. Er ist vermutlich der einzige Mensch unter den Kollegen, der weiß, dass Sita eine seit vielen Jahren trockene Alkoholikerin ist.
»Weißt du schon irgendwas?«, fragt Tom.
Sita schüttelt den Kopf. »Nur dass Morten nervös sein wird, Grauwein seine ekelhaften Bonbons rauskramt und Frohloff grinst, als gäb’s den Tod nicht, und sich beim Nachdenken den letzten Flaum vom Kopf kratzt.«
»Familientreffen also«, sagt Tom und lächelt schief. »Spricht für den Sonderstatus der Leiche.«
»Oder den des Fundorts«, ergänzt Sita und deutet auf das Gästehaus. Das Gebäude und der umliegende Weg sind provisorisch mit Flatterband abgeriegelt. »Das Gelände ist doch so etwas wie ein Sperrgebiet. Nur Polizisten, Sanitäter oder Feuerwehrleute. Und auch die kommen nicht ohne Ausweis am Pförtner vorbei.«
»Was Morten vermutlich doppelt nervös macht«, sagt Tom. Er nimmt weiße Plastikfüßlinge aus dem Handschuhfach seines Wagens und zieht sie über seine Stiefel, dann zwängt er seine großen Hände in Latexhandschuhe. Sita tut es ihm gleich. »Hast du das von Interpol mit Bruckmann gehört?«, fragt sie.
»Nein, was denn?«
»Frohloff hat eine Meldung über I-24/7 bekommen, Bruckmann wäre in Kapstadt gesehen worden.«
»Südafrika«, murmelt Tom. »Warum ausgerechnet da?«
»Wahrscheinlich hat Bruckmann irgendeine alte ANC-Verbindung genutzt, um dort unterzutauchen.«
Tom hebt das Flatterband für Sita hoch und taucht dann nach ihr darunter durch. »Die DDR hatte Verbindung zu Nelson Mandelas Antiapartheidsbewegung?«
»Oh ja. Bis dann 89 die Mauer fiel. Hochschulausbildungen, paramilitärische Ausrüstungen, Waffen … Wer weiß, wen Bruckmann da noch von früher kennt. Er hatte es schon immer raus, die richtigen Leute zu kennen und jeden und alles zu manipulieren. Erinnerst du dich, er hat mich damals in unsere erste gemeinsame Soko geholt, damit ich dich unter Kontrolle halte.«
»Der große Puppenspieler«, sagt Tom bitter.
»Der große Narzisst«, erwidert Sita. »Hast du zufällig den Epstein-Fall in den USA verfolgt?«
»Dieser schwerreiche Kinderschänder?«
»Bruckmann erinnert mich irgendwie an ihn. Nicht nur, weil er der ›Teufel‹ war und als junger Mann über Jahre Mädchen eingesperrt, missbraucht und getötet hat, was wir ihm vermutlich nie beweisen können. Aber vor allem wegen seiner Fähigkeit, so überzeugend zu sein, dass er glaubt, mit allem durchzukommen.«
Der Kies knirscht unter ihren Schritten. Sie laufen am Rand des Weges, um keine Spuren zu verwischen.
»Vermutlich kriegen wir ihn nie«, knurrt Tom.
An der Tür des Gästehauses erwartet sie ein blasser junger Streifenpolizist mit unstetem Blick.
»KHK Babylon, meine Kollegin Johanns.« Tom hält ihm seinen Ausweis hin.
Der Polizist nickt. »Ich soll Sie reinbringen.« Seine Stimme flattert. Der Tatort hat ihn mitgenommen.
Wortlos passieren sie den Empfang und biegen nach links ab. Billige alte Holztäfelungen wechseln sich mit Tapeten aus den Siebzigern ab. Hirschgeweihe und ausgestopfte Wildtiere zieren die Wände. Das Gästehaus der Polizei ist berüchtigt für seine angestaubte Inneneinrichtung. Tom fasst in seine Jackentasche und will eine Methylphenidat-Tablette aus dem Blister drücken, entscheidet sich dann aber dagegen, auch deshalb, weil er weiß, dass er die Dinger viel zu oft nimmt, um wach und auf Spur zu bleiben. Er muss an den Beamten beim Einlass denken: Tun wir das nicht alle?
Nach einem langen Gang mit Gästezimmern kommen sie zu einer Staubschutztür aus weißem Vlies. Dahinter liegt der stillgelegte Flügel des Hauses, in dem Bauarbeiten stattfinden. Der Flur liegt im Halbdunkel, die Lampen sind demontiert, die Tapeten von den Wänden gekratzt und die Holztüren mit Beize behandelt. Der Geruch von Chemikalien und Feuchtigkeit steigt Tom in die Nase. Am Ende des Ganges dringt Licht aus einer offenen Tür.
»Immer den Scheinwerfern nach«, murmelt der Polizist. Tom strafft die Schultern und holt tief Luft. Sita ist dicht hinter ihm. Der erste Moment am Tatort ist immer der härteste. Am besten atmet man ihn weg. Er nickt Sita zu, und sie betreten das Zimmer.
Im Raum ist es gleißend hell, die Einrichtung ist unberührt. Vor einem halb geöffneten Fenster weht eine vergilbte Gardine. Kleine gelbe Plastikschilder mit schwarzen Zahlen sind im Raum verteilt. Eine alte Schirmlampe mit Troddeln ziert eine Anrichte aus dunklem Holz. Der Parkettboden ist stumpf, ein staubiger kreisrunder Teppich mit einem spießigen Muster ist etwas verrutscht und gibt ein helleres Stück Boden preis. Auf dem Teppich steht ein Stuhl, der auf das Bett ausgerichtet ist, ein antiquiertes Holzbett mit schweren Pfosten und poliertem Kopf- und Fußteil. Mittig über dem Bett prangt ein ausgestopfter Hirschkopf an der Wand. Peer Grauwein steht mit verschränkten Armen neben dem Bett und schaut einem Arzt zu, vermutlich dem bestellten Gerichtsmediziner, der sich über einen Körper beugt. Tom hört, wie Sita leise aufstöhnt, und sieht aus dem Augenwinkel, dass sie sich abwendet.
Auf dem Bett sitzt mit dem Rücken zum Kopfteil ein wachsbleicher Mann, etwa Anfang vierzig, nur mit einem aufgeknöpften Hemd bekleidet. Sein Kopf hängt schlaff zur Seite, sein Blick ist erstarrt und dabei seltsam neutral. Um seine Mundpartie ist silbernes Klebeband gewickelt, das an den Rändern in seine Haut einschneidet. Seine Arme und Beine sind gespreizt und jeweils mit straff gespannten Seilen an die Pfosten des Bettes gebunden. Um die Hüften und den Oberkörper sind weitere Seile geschlungen, die ihn in der sitzenden Haltung fixieren. Auf seine Brust ist mit einem breiten Stift etwas geschrieben worden, in schwarzen Druckbuchstaben, doch der Anfang und das Ende sind vom Hemd verdeckt. Zwischen seinen nackten Beinen hat sich ein tiefroter, fast schwarzer Fleck von der Größe eines Wagenrades auf der Matratze ausgebreitet. Dort, wo sein Glied sein sollte, ist ein dunkler Stumpf.
»Mein Gott«, stöhnt Sita.
»Ist okay. Ich mach das hier drinnen«, murmelt Tom. »Das musst du dir nicht geben.«
»Darum geht’s nicht«, erwidert Sita.
»Nicht?«
»Doch, auch … aber – erkennst du ihn nicht?«
»Du weißt, wer das ist?« Tom schaut in das fahle Gesicht des Mannes und versucht vergeblich, eine Verbindung herzustellen.
Der Arzt richtet sich auf und schaut Tom verwundert an.
Grauwein räuspert sich und tritt neben Tom. »Das ist nicht irgendwer«, setzt er mit rauer Stimme an. »Das ist –«
»Brad Galloway«, platzt es aus Sita heraus.
»Das ist Galloway?« Tom erinnert sich, den Namen oft gehört zu haben, meistens im Radio oder im Zusammenhang mit der ein oder anderen Fernsehshow, aber wenn es um Gesichter von Stars aus der Musikszene geht, dann kann er bestenfalls Mick Jagger von Lady Gaga unterscheiden – ganz im Gegensatz zu Anne.
»Irische Wurzeln, in die Staaten ausgewandert, Spätzünder. Mit dreißig entdeckt und dann ging’s sssst.« Grauweins Hand deutet steil nach oben. »Gold, Platin, Grammys, alles, was das Künstlerherz begehrt. Er müsste jetzt etwa vierzig sein. Vor ein paar Jahren war er im Gespräch für die Halbzeitshow des Superbowl, aber am Ende hat Bruno Mars das Rennen gemacht.«
Tom nickt still. Er schaut den Arzt an. »Darf ich?«, fragt er und nimmt dem Mediziner einen Kugelschreiber aus dessen Brusttasche, dann beugt er sich über Galloway und schiebt mit der Spitze des Stiftes das Hemd beiseite, sodass er die schwarze Schrift auf Galloways Brust lesen kann:
WAS ZÄHLT DAS LEBEN DEINER LIEBEN?
Kapitel 5
Berlin-ReinickendorfSamstag, 19. Oktober20:31 Uhr
»Hättest nur zu fragen brauchen«, sagt Grauwein. »Ich hab schon ein hübsches Foto von seiner Brust.«
Tom betrachtet die eng aneinandergeschriebenen Großbuchstaben. »Was ist das? Filzstift? Edding vielleicht?«
»Jedenfalls wasser- und wischfest. Mehr kann ich dir später sagen. Inhaltlich klingt’s nach Beziehungskiste, oder?«
»Hm.« Tom gibt den Kugelschreiber zurück. Er spürt plötzlich Joseph Mortens Anwesenheit in seinem Rücken, noch bevor ihr Chef sich bemerkbar macht. Es ist dieser feine Geruch von Nikotin, übertüncht von Minzkaugummi. Obwohl alle wissen, dass der Dezernatsleiter wieder raucht, versucht er es zu verbergen, vermutlich am meisten vor sich selbst. Er ist dem Tod schon einmal im Gewand von Kehlkopfkrebs von der Schippe gesprungen.
Aus dem Augenwinkel sieht Tom Grauweins zusammengekniffene Lippen, ein knappes Nicken. Der schmächtige Kriminaltechniker würde sich nie gegen Morten stellen. Grauwein hat das Wesen einer angezogenen Handbremse. Manchmal fragt sich Tom, was diese Bremse alles hält. Und was passiert, wenn sie sich eines Tages doch einmal löst.
»Schöne Scheiße«, knurrt Morten. Offenbar ist er schon informiert, um wen es sich handelt.
»Hallo, Jo«, erwidert Tom.
Grauweins Miene wird noch ein wenig finsterer. Das vertrauliche ›Jo‹ stößt ihm auf. Die meisten im Dezernat nennen Morten beim vollen Namen. ›Joseph‹ ist eine Art Synonym für die Distanz aller gegenüber ihrem vor zwei Jahren zum Chef aufgestiegenen Kollegen – zum Leidwesen von Morten, der die lange Form seines Vornamens hasst. Doch seit dem Berlinale-Fall gibt es eine neue Vertrautheit zwischen Tom und dem Dezernatsleiter, die Peer Grauwein ein Dorn im Auge ist.
»Wie lange können wir das noch unterm Deckel halten?«, fragt Morten.
Tom zuckt mit den Achseln. »Wenn sich keiner im Polizeifunk verquatscht … vielleicht bis morgen früh.«
»Der Name des Toten verlässt diesen Raum nicht, klar?« Morten schaut in die Runde. Der Gerichtsmediziner, Grauwein, Sita und Tom nicken. Neben Morten steht der junge Beamte, der auch Tom auf dem Weg zum Tatort begleitet hat. Er ist blassgrün im Gesicht und wendet den Blick ab. »Sie«, murmelt Morten und legt ihm die Hand auf die Schulter, »wie heißen Sie?«
»Biernat. Felix Biernat.«
»Haben Sie verstanden, was ich gesagt habe?«
Biernat nickt.
»Gut.« Mortens lange, sehnige Finger drücken sich in die Uniformjacke, seine dunklen Augen bohren sich in die des jungen Mannes. »Sie sind mir dafür verantwortlich, dass jeder, der den Tatort besucht – und wenn er sich auch nur auf hundert Meter nähert –, sich daran hält: Der Name des Toten wird nicht genannt. Klar?«
Biernat nickt erneut. »Klar, Chef.«
Morten lächelt verkniffen. Seine schwarzen, straff gekämmten Haare glänzen. »Dann erklären Sie das mal unseren Leuten draußen. Und notieren Sie bitte die Namen aller Anwesenden. Das sollte helfen.«
Eilig entfernt sich Biernat. Seine Schritte verhallen im Flur.
Toms Blick fällt auf den Beistelltisch. Hinter einem dunklen, kreisrunden Rand auf dem Holz steht ein gelbes Plastikschild mit der schwarzen Ziffer Acht. Ein blasser Fleck daneben, nicht größer als ein Tropfen, hat die Nummer Neun bekommen.
»Könnte eine Flasche gewesen sein«, murmelt Tom, »oder ein Glas«, und beugt sich über die Acht.
»Da hat jemand zugeschaut«, Sita deutet auf den Stuhl neben dem Beistelltisch, »während Galloway langsam verblutet ist.«
»Verblutet? Ist das die Todesursache?« Morten schaut den Gerichtsmediziner an.
»Kann sein«, erwidert der Mann, ohne aufzusehen. Konzentriert schneidet er mit einer Schere die Hemdsärmel des Toten auf. Es gehört zu den traurigsten Routinen einer Mordermittlung, dass die Leichen in der Regel noch vor Ort vollständig entkleidet werden.
»Was heißt das? Kann sein?«, blafft Morten.
»Kann auch nicht sein«, erwidert der Mediziner trocken.
Grauwein verkneift sich ein Grinsen. Gerichtsmediziner und vorschnelle Urteile sind ein Widerspruch in sich, und eigentlich weiß Morten das auch.
»Was ist mit seiner restlichen Kleidung?«, fragt Tom.
»Fehlanzeige«, meint Grauwein.
»Handy, Schlüssel, irgendwas?«
»Nur er und sein Hemd.«
»Nicht einmal Schuhe?«
»Nichts.«
»Und der Todeszeitpunkt?«, fragt Morten.
Die Scherenblätter machen beim Schneiden ein leises schleifendes Geräusch. »Rigor mortis voll ausgeprägt«, brummt der Mediziner. »Mehr kann ich noch nicht sagen.«
»Soll heißen?«
Der Mann richtet sich auf und schaut Morten mit provozierendem Gleichmut an. Seine Augen sind blaugrau, und er blinzelt irritierend oft. »Zwischen achtzehn und vierundzwanzig Stunden, grob, würde ich sagen.«
Tom betrachtet immer noch den kreisrunden Abdruck auf dem Tisch. Er wirkt beinah wie ein Stempel, scharf, mit kleinen Rillen, die sich auf der rechten Seite gut abzeichnen, auf der linken Seite dagegen sind die Rillen zugelaufen. »Peer, was, denkst du, ist das?«
»Für ‘nen Flaschenabdruck kommt es mir recht groß vor«, sagt Grauwein. »Außer unser Täter hat ’ne Magnum auf seine Tat geleert.«
Sita zieht unmerklich die Brauen zusammen. Der Tatortzynismus der männlichen Kollegen ist ihr eigentlich zuwider.
»Der dunkle Rand hier«, meint Tom, »das sieht nicht nach einer normalen Flüssigkeit aus, oder?«
»Die wäre stärker ins Holz eingesickert«, bestätigt Grauwein.
Tom nickt. Der Kriminaltechniker wird sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht festlegen, dafür arbeitet er zu genau, doch im Grunde wissen sie beide, was die Konsistenz der Spur bedeutet. Es ist vermutlich Blut.
»Okay«, sagt Morten. »Ein ermordeter Rockstar, mit abgetrenntem Glied, möglicherweise verblutet. Auf seiner Brust steht ›Was zählt das Leben deiner Lieben?‹. Womit haben wir es hier zu tun? Rache? Eifersucht? Ein psychopathischer weiblicher Groupie?«
»Stand er auf Frauen, weiß das jemand?«, fragt Tom.
»Und ob«, murmelt Grauwein. »Typ Tom Jones.«
»Das heißt?«, fragt Tom.
»Jetzt sag nicht, du kennst Tom Jones nicht.«
»Boulevard ist wirklich nicht mein Fachgebiet.«
»Meins auch nicht. Aber Tom Jones …« Grauwein öffnet den Mund, doch Sita kommt ihm zuvor. »Typ einsamer Rockstar, notorisch charmant, süchtig nach Nähe bei gleichzeitiger Bindungsunfähig –«
»Mit anderen Worten: sexsüchtig«, stellt Grauwein säuerlich fest, als würde er das Galloway persönlich verübeln.
»Das ist jetzt etwas einfach«, bremst Sita.
Peer Grauwein zuckt mit den Achseln. »Ist doch auch einfach.«
»Siehst du das bei Spuren auch so? Oder nur bei Menschen?«
Grauwein versucht sich an einem schiefen Grinsen. »Touché.«
»Reden wir jetzt über Tom Jones oder über …« Tom deutet auf Galloway. Der Gerichtsmediziner hat inzwischen das letzte Stück Hemd entfernt.
»Sowohl als auch, würde ich sagen. Das Klischee lebt«, meint Sita.
»In dem Fall ist es wohl ziemlich tot«, ergänzt Grauwein staubtrocken.
Morten blickt griesgrämig drein. »Was Personen mit Motiv angeht, also ein weites Feld.«
»Vielleicht fangen wir mit dem Tatort an«, schlägt Tom vor. »Warum ausgerechnet hier? Mit einem Rockstar, noch dazu einem Amerikaner, hat das Gästehaus herzlich wenig zu tun. Der Täter hat sich das hier ausgesucht. Er muss Galloway hierhergebracht oder -gelockt haben. Und wenn wir wissen, warum, dann kommen wir ihm oder ihr auf jeden Fall einen Schritt näher.«
»Ich leiere mal an, dass die Zugänge und die Kameras auf dem Gelände und den umliegenden Straßen gecheckt werden«, sagt Grauwein.
»Was denkt ihr, männlicher oder weiblicher Täter?« Morten sieht fragend in die Runde.
»Frauen tun so etwas nicht«, antwortet Sita. »Sagt zumindest die Statistik.«
»Und was sagt die Psychologin?«
»Das Gleiche. Frauen weiden sich nicht gerne an Gewalt. Sie töten lösungsorientierter, eher aus der Distanz, wie zum Beispiel mit einer Schusswaffe oder mit Gift, oder, wenn es unkontrolliert ist, unter emotionalem Stress. Das hier sieht nach nichts von alledem aus. Es war geplant, und der Täter hat es genossen.«
»Und das will etwas heißen«, sagt Tom. Er bückt sich und deutet auf den Boden um die Bettpfosten. Im Holz sind zahlreiche frische Kratzspuren. »Galloway muss sich in den letzten Minuten im Bett hin und her geworfen haben.«
»Das könnte auch vorher passiert sein«, widerspricht Morten.
»Nicht bei dem Muster der Blutspuren auf seinen Oberschenkeln. Er muss sich förmlich gegen den Tod gestemmt haben. Wer es schafft, dabei zuzusehen …«
Es wird still im Raum. Galloways Todeskampf ist plötzlich lebendig. Sein Entsetzen, seine Schmerzen und seine Angst hallen im Zimmer nach. Tom meint seine geweiteten Augen zu sehen, wie er gegen das Klebeband anatmet, das ihm den Mund verschließt, als ihm der Täter … Tom spürt ein unangenehmes Ziehen in der Leistengegend und schluckt die aufkommende Übelkeit hinunter. Das hier war eine brutale Hinrichtung, und was immer Galloway vielleicht getan hat, um die Wut oder Verachtung des Täters auf sich zu ziehen, das hier hat er nicht verdient.
»Was ist mit den Knoten und den Seilen«, fragt Tom und deutet auf Galloways Fesseln. »Lässt das irgendwelche Rückschlüsse zu?«
»Die Knoten sind gut und sauber gebunden«, sagt Grauwein. »Sieht nach Übung aus, ein Segler oder Kletterer vielleicht. Ist aber nicht zwingend. Und die Herkunft des Seils, das wird etwas dauern. Sieht aber nach Standard aus, nicht sonderlich vielversprechend.«
»Okay«, nickt Morten grimmig. »Die Idee, über den Tatort zu gehen, um vielleicht einen Hinweis auf den Täter zu bekommen, ist gut. Wir brauchen einen Check-up der Gäste. Frohloff sitzt drüben im anderen Flügel am Computer, der soll sich drum kümmern. Hier muss es ja Besucherprotokolle geben. Feuerwehrleute, Ausbilder, Polizisten, Seminarteilnehmer … vielleicht bekommen wir eine Übereinstimmung mit Galloways Wirkungskreis.« Morten geht ein paar Schritte aus dem Zimmer und beginnt zu telefonieren.
»Warum ist Galloway eigentlich in Berlin? Hat er hier einen Auftritt?«, fragt Tom.
»Hatte«, sagt Grauwein. »Waldbühne. War grandios.«
»Du warst da?«, fragt Sita verblüfft.
»Äh, nee. Nicole aber.« Grauwein läuft rosa an. Nicole Weihertal ist Teil des Ermittlerteams der Mordkommission, eine blitzgescheite junge Frau, die jeden Morgen mit roten Wangen und zum Pferdeschwanz gebundenen Haaren mit dem Rennrad ins Revier in der Keithstraße kommt.
»Und wo übernachtet Galloway?«
»Im Adlon«, sagt Grauwein wie aus der Pistole geschossen.
Alle wechseln Blicke.
»Also, hab ich gehört«, sagt Grauwein schnell.
»Von Nicole«, nickt Tom, ohne eine Miene zu verziehen. Der Kriminaltechniker wird noch ein wenig röter. Tom stellt sich die sportliche junge Frau und den über fünfzehn Jahre älteren Kriminaltechniker mit seinem Topfschnitt vor. Grauweins Schwärmerei ist aussichtslos, fürchtet er. Und sollte sie nicht aussichtslos sein, fürchtet er das auch. Sein Blick fällt auf Galloway, dessen bleicher und eingefallener Körper unter dem Hirschkopf ans Bett gebunden ist. »Dann also ins Adlon«, sagt Tom.
»Ich vermute mal, Galloways Manager wohnt auch dort«, sagt Morten. Er hat das Telefon noch in der Hand, als er zurück in den Raum kommt. »Ich schicke da schon mal ein paar Kollegen von der Bereitschaft hin, die sollen Galloways Suite sichern, falls es dort irgendetwas zu finden gibt …«
»Wenn nicht sowieso schon jemand vom Service das Zimmer sauber gemacht hat«, murmelt Grauwein.
»Hallo? Ja, Morten. Ich brauche sofort einen Streifenwagen beim Adlon, zwei Kollegen, die diskret die Suite von Brad Galloway sichern. Keiner geht rein, keiner raus.«
»Jo, warte mal«, sagt Tom halblaut. »Lass uns das nicht offiziell machen, du weißt, wie das mit dem Polizeifunk ist … oder jemand steckt es durch. Das dauert keine Viertelstunde, dann tauchen die ersten Reporter –«
Der Dezernatsleiter unterbricht ihn mit einer scharfen Handbewegung und drückt das Handy fester ans Ohr. »Bitte was?« Mortens Augen werden schmal. »Und warum?«, knurrt er. Die Antwort fällt anscheinend ausführlicher aus, als Morten erwartet hat. Zwischendurch hebt er die Brauen und starrt dabei durch die Gardinen ins Leere. »Nein«, sagt er schließlich. »Wenn die Kollegen oben sind, sollen sie erst mal aufnehmen, was anliegt. Die Suite bitte möglichst nicht betreten – und ja nichts anfassen, bis wir kommen.« Jo Morten beendet die Verbindung und sieht erst Tom und dann Grauwein an. »Galloways Managerin hat vor etwa fünfzehn Minuten die Polizei angerufen und um Hilfe gebeten.«
»Um Hilfe? Warum?«, fragt Tom. »Weiß sie etwa schon, was passiert ist?«
»Sie hat darauf bestanden, dass die Polizei ins Adlon kommt, zu Galloways Suite. Es gibt wohl eine Stalkerin, die sich gewaltsam Zutritt verschaffen will.«
»Stalking mache ich nicht bei einem Toten, oder? Insofern wohl eher ein durchgeknallter, ahnungsloser Fan«, meint Grauwein.
»Nicht unbedingt«, sagt Tom. »Was, wenn der Einbruch das Thema ist und nicht das Stalking? Weil der Täter zum Beispiel nach etwas sucht …«
»Stimmt auch wieder. Also dann …« Peer Grauwein räuspert sich und klappt seinen Koffer mit dem Tatortbesteck zu. Morten rührt sich nicht; nachdenklich sieht er zum Bett hinüber. Galloways blutleerer Körper leuchtet gespenstisch im harten Licht der aufgestellten Scheinwerfer.
»Das war nicht alles, oder?«, sagt Tom.
Morten schüttelt bedächtig den Kopf. »Vor zwei Minuten hat der Direktor des Adlon angerufen und erklärt, das sei alles ein Missverständnis, was denn die Polizei bei ihm wolle. Galloway würde doch eigentlich gar nicht im Adlon übernachten.«
Grauwein und Sita sehen Morten verblüfft an.
»Aber die Managerin«, sagt Tom, »ist der Meinung, das tut er, richtig? Also hat er doch offenbar eine Suite im Adlon. Was hat der Direktor denn gesagt, wo er stattdessen übernachtet?«
»Das wusste er nicht.«
Grauwein sieht skeptisch drein. »Ist da jemand bemüht, den guten Ruf seines Hotels zu schützen?«
»Möglich, aber vielleicht auch etwas zu einfach gedacht«, murmelt Tom abwesend.
Morten vergräbt die Hände tief in den Hosentaschen. Die Finger seiner Rechten tasten unwillkürlich nach der Zigarettenpackung, die sich unter dem Stoff abzeichnet. Dann bemerkt er, dass sowohl Sita als auch Grauwein ihn beobachten. Tom dagegen hat sein Handy hervorgeholt und scheint etwas zu recherchieren. »Scheiß drauf«, knurrt Morten, zieht eine Zigarette aus der Schachtel und steckt sie sich in den Mundwinkel. »Was guckt ihr so? Ihr wisst es doch eh alle.« Die Zigarette wippt ärgerlich zwischen seinen Lippen; in der Mitte hat sie einen Knick.
»Das Stue«, sagt Tom leise, mit Blick auf sein Handy.
»Was hast du gesagt?«, fragt Sita.
»Das Stue«, wiederholt Tom und steckt sein Smartphone wieder ein. »Ich würde im Stue übernachten, in der Drakestraße.«
Sita schaut Tom verständnislos an, dann plötzlich leuchten ihre Augen auf. »Aber natürlich, du hast recht. Das Stue!«
»Könnt ihr zwei uns bitte mal aufklären?« Morten schaut säuerlich in die Runde. Ein Windstoß fährt durchs Fenster und bläht die Gardinen. Wortlos schließt Grauwein den offen stehenden Fensterflügel. Seine Latexhandschuhe quietschen auf dem Metallgriff.
»Ihr kennt das Stue nicht?«, fragt Tom verblüfft. »Ich lese zwar keinen Promiklatsch, aber wenn ich ein Rockstar wäre und nach jedem Konzert ein Groupie abschleppte, dann würde ich das nicht in dem Hotel tun, vor dem die Paparazzi lauern. Ich würde mir ein zweites Hotel suchen. Luxuriös, weil ich verwöhnt bin und weil ich die Frauen beeindrucken will. Teuer, weil nur die teuren Hotels wirklich diskret sind. Sie haben einen Ruf zu verlieren. Es müsste aufregend sein, Nischen haben, ein bisschen sexy … und es müsste halbwegs in der Nähe des Hotels sein, in dem ich offiziell logiere.«
»Und rund ums Adlon kommen nur drei infrage«, ergänzt Sita. »Das Hotel de Rome – sehr teuer, sehr schick, aber auf diese etwas zu bemühte und spießige Art. Dann das Ritz-Carlton, etwas zu exponiert und zu sehr Hochhaus. Kaum Nischen, lange, gerade Flure. Eher unsexy. Und dann ist da noch das Stue …«
Grauweins kleine Augen flitzen von Sita zu Tom und zurück. »Wenn man euch so zuhört«, sagt er, »könnte man meinen, ihr habt da mal ’ne gemeinsame Nacht verbracht.«
Tom ignoriert ihn. »Wir sollten das Stue checken.«
Morten nickt. »Gut. Hört sich zwar ziemlich vage an, aber ein Anruf kann ja nicht schaden.«
»Nicht anrufen«, sagt Tom. »Wenn wir mit unserer Vermutung richtig liegen, dann sollten wir niemandem dort die Gelegenheit geben, sich auf unseren Besuch vorzubereiten.«
Morten verzieht das Gesicht. »Schön. Ihr drei fahrt zum Stue, ich nehme Frohloff mit und fahre ins Adlon. Peer, kannst du noch jemanden von der KT organisieren, der zum Adlon kommt? Mal sehen, was diese Managerin uns zu sagen hat.«
Kurz darauf steigt Tom in seinen Mercedes. Der Kies knirscht, als Sitas alter Saab 900 eine Spur an ihm vorbeizieht. Die Fichten schaukeln im Wind, und ein Schauer fegt über den Parkplatz. Tom wendet und folgt Sitas Wagen. Auf dem Beifahrersitz räuspert sich Vi. Sie versucht, eine Locke um ihren Finger zu drehen, aber ihre blonden Haare springen immer wieder zurück.
Und? Hättest du gerne?
Was?, fragt Tom
Na, eine Nacht mit dieser Sita …
Wie kommst du darauf?
Du guckst manchmal so.
Blödsinn, Vi. Und nicht jugendfrei.
Pfff. Außerdem, die würde eh viel besser zu dir passen als Anne.
Grenze, Vi. Absolute Grenze. Und total falsch.
Kapitel 6
Stahnsdorf bei Berlin3. Mai 198919:14 Uhr
Inge saß im Garten hinter dem Haus, eine Hand am Kinderwagen, in dem sie Viola schaukelte. Die Kleine schlief wie ein Engel. Tom saß beinebaumelnd am Tisch und schob lustlos das Essen auf dem Teller hin und her. Die Karotten hatte er verputzt, aber der Rosenkohl ging ihm sichtlich gegen den Strich. Aber was half’s, es musste gegessen werden, was auf den Tisch kam – die große Auswahl gab es schließlich nicht. Inge schien es, als würden die Regale im Konsum von Jahr zu Jahr leerer.
Da war das Gemüse aus dem eigenen Garten Gold wert. Sofern nicht das Grundwasser die Pflanzen vergiftete. Selbst in den kleinen See, der in einiger Entfernung hinter ihrem Grundstück lag, wurden Abwässer aus einem kleinen VEB eingeleitet. Alles ganz sauber, hieß es immer. Und: Das Waldsterben kommt aus dem Westen zu uns rüber.
»Mama«, sagte Tom. »Was macht der da?« Er zeigte zum Seeufer.
Ein Mann in einer gelben Regenjacke hielt einen Müllsack in der Hand, holte aus und warf ihn in den See, wo er mit einem Platschen auf der Wasseroberfläche aufschlug, jedoch nicht sofort unterging. Offenbar war noch einige Luft im Sack. So viel zum Thema, dachte Inge zynisch. Wenn die Staatskombinate und die VEBs mit gutem Beispiel vorangingen und ihren Müll in der Natur entsorgten, dann taten es ihnen die Genossen nach.
Der Mann griff nach einem zweiten Sack. Inge überlegte, ob sie einschreiten sollte und wie viel Ärger sie sich dabei einhandeln konnte. Sollte es jemand mit guten Verbindungen sein, konnte es sie Kopf und Kragen kosten. Werner und sie genossen zwar Privilegien, aber Werners Parteibuch war noch lange keine Garantie, dass ihnen nichts passierte.
Der Mann hielt den zweiten Müllbeutel jetzt am äußersten Ende fest und holte aus. Was war bloß in diesen Säcken? Der erste trieb noch auf dem See, war aber bereits fast ganz unter Wasser, als Inge plötzlich bemerkte, dass sich in dem Sack etwas bewegte. Er schien regelrecht zu zappeln.
Oh Gott. Das gibt’s doch nicht!
Im selben Moment schleuderte der Mann den zweiten Sack ins Wasser.
»He, Sie!«, rief Inge. »Was machen Sie da?«
Der Mann drehte sich zu ihr um. Für einen Augenblick sahen sie einander still an, über die Entfernung von etwa fünfzig Metern, doch Inge konnte sein Gesicht im Schatten der Kapuze kaum erkennen.
Was auch immer in den Säcken steckte, es brauchte Hilfe. Sie rannte los, in gerader Linie auf das Ufer zu.
»Mama!«, rief Tom.
»Bleib, wo du bist. Bin gleich wieder da«, schrie sie.
Der Mann am Ufer begann ebenfalls zu laufen und schlug sich seitlich in die Büsche des angrenzenden Waldstücks.
Inge sprang über den Gartenzaun auf das Nachbargrundstück. Sie trug Hausschlappen, die an ihren Füßen schlackerten, sodass sie kurz innehielt, sie abwarf, um auf Socken weiterzurennen. Der erste Sack auf dem See wurde jetzt ganz vom Wasser verschluckt.
Nein, nein, nein!
Noch zwanzig Meter.
Der zweite Gartenzaun. Sie flankte darüber. Das jahrelange Tanztraining machte es ihr leicht; sie war fit wie ein Turnschuh. Mit langen Sätzen erreichte sie das Ufer, lief ungebremst in den See und machte aus vollem Lauf einen Köpper. Nicht ihr bester, aber schnell genug, um ganz nah an den schwimmenden Sack heranzukommen, der noch halb über Wasser war und in dem etwas panisch strampelte. Aber wo war der andere Sack?
Sie holte Luft und tauchte unter. Riss die Augen auf, was sie einige Überwindung kostete, denn eigentlich öffnete sie nie unter Wasser die Augen. Doch das zählte jetzt nicht.
Der See war eine trübe Brühe, alles war seltsam unscharf, und sie konnte kaum zwei Meter weit sehen. Sie machte ein paar Züge mit den Armen, blickte nach links, nach rechts, nach unten. Nichts. Ihre Hände pflügten hektisch durchs Wasser, ohne dass sie etwas zu fassen bekam. Verdammt, sie hatte noch nicht einmal ein Gefühl dafür, wie weit voneinander entfernt die beiden Säcke im Wasser gelandet waren.
Prustend tauchte sie auf. Hinter ihr trieb der verbliebene Sack und drohte jetzt vollständig unterzugehen. Hastig schwamm sie zurück, griff danach und stützte ihn von unten. Das zappelnde Etwas darin sträubte sich und schlug wild nach allen Seiten aus. Inge schwamm auf das Ufer zu. Als sie wieder Grund unter den Füßen hatte, hob sie den Sack hoch. Die Plastikfolie hatte Risse bekommen, aus denen jetzt Wasser lief.