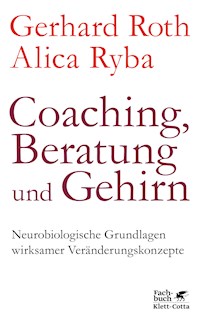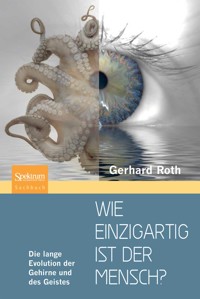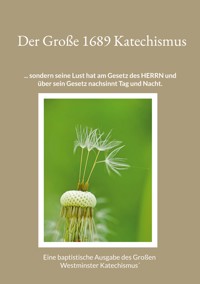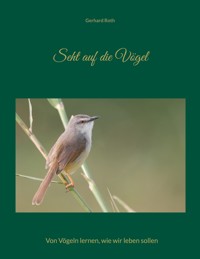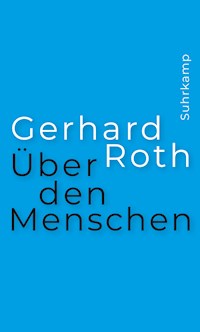16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Es ist der Morgen des 1. April, als etwas Ungeheures geschieht: Ein gelber Nebel zieht auf, der die Menschen buchstäblich in Luft auflöst. Aber nicht alle Menschen sind verschwunden, stellt Franz Lindner fest, der Erzähler dieses alle Grenzen sprengenden Romans. Er selbst hat als Patient einer Einrichtung für psychisch beeinträchtigte Künstlerinnen und Künstler die Katastrophe überlebt – wie auch die anderen Patienten, Ärzte und Besucher. So unfasslich das Ereignis ist, so konkret muss der Alltag jetzt organisiert werden. Eine Dorfgemeinschaft aus Bienenzüchtern entwickelt sich, und Franz Lindner wird ihr Chronist. Aber die neue Welt ist keine friedliche: Gewalt, Hass und Eifersucht sind nicht verschwunden, und auch die Natur scheint sich vom Menschen befreien zu wollen. Zwei Jahre begleiten wir »Die Imker« durch eine Welt, in der Traum und Wirklichkeit nicht zu unterscheiden sind. Dann macht ein weiteres unerklärliches Ereignis der Geschichte ein überraschendes Ende. Gerhard Roths »Die Imker« ist ein philosophischer Roman im Setting einer Dystopie. Er behandelt die Entstehung von Gesellschaft und das Wesen des Menschen, vor allem die Bedeutung des Unbewussten und das Rätsel des Todes. Es ist das Spätwerk eines großen Autors, der in einem parabelartigen Gedankenspiel noch einmal alle Motive seines Denkens und Schreibens versammelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 697
Ähnliche
Gerhard Roth
Die Imker
Roman
Roman
Über dieses Buch
Es ist der Morgen des 1. April, als etwas Ungeheures geschieht: Ein gelber Nebel zieht auf, der die Menschen buchstäblich in Luft auflöst. Aber nicht alle Menschen sind verschwunden, stellt Franz Lindner fest, der Erzähler dieses alle Grenzen sprengenden Romans. Er selbst hat als Patient einer Einrichtung für psychisch beeinträchtigte Künstlerinnen und Künstler die Katastrophe überlebt – wie auch die anderen Patienten, Ärzte und Besucher. So unfasslich das Ereignis ist, so konkret muss der Alltag jetzt organisiert werden. Eine Dorfgemeinschaft aus Bienenzüchtern entwickelt sich, und Franz Lindner wird ihr Chronist. Aber die neue Welt ist keine friedliche: Gewalt, Hass und Eifersucht sind nicht verschwunden, und auch die Natur scheint sich vom Menschen befreien zu wollen. Zwei Jahre begleiten wir »die Imker« durch eine Welt, in der Traum und Wirklichkeit nicht zu unterscheiden sind. Dann macht ein weiteres unerklärliches Ereignis der Geschichte ein überraschendes Ende. Gerhard Roths »Die Imker« ist ein philosophischer Roman im Setting einer Dystopie. Er behandelt die Entstehung von Gesellschaft und das Wesen des Menschen, vor allem die Bedeutung des Unbewussten und das Rätsel des Todes. Es ist das Spätwerk eines großen Autors, der in einem parabelartigen Gedankenspiel noch einmal alle Motive seines Denkens und Schreibens versammelt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Gerhard Roth, 1942 in Graz geboren und dort 2022 gestorben, lebte als freier Schriftsteller in Wien und der Südsteiermark. Zu seinem umfangreichen Werk aus Romanen, Essays und Theaterstücken gehören der siebenbändige Zyklus »Die Archive des Schweigens«, der nachfolgende Zyklus »Orkus« und eine 2021 abgeschlossene Romantrilogie über Venedig. Darüber hinaus liegen mehrere Bildbände mit seinen fotografischen Arbeiten vor. Gerhard Roth wurde mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet, darunter der Große Österreichische Staatspreis 2016. Er starb unmittelbar nach Fertigstellung seines Romans »Die Imker«, in dem er noch einmal alle Motive seines Denkens und Schreibens versammelt.
Inhalt
[Frontispiz]
[Motto]
Figurenverzeichnis
Was bisher geschah
Wirklichkeit und Wahrheit
Die »Halluzination« oder Vision, die ich beschreiben sollte
Der folgende Tag
Die ersten Apriltage
Das missglückte Bienenkunststück
Vorwort: Gedichte
Gedichte I
Ernst Haeckels mikroskopische Welt
Ausfahrt ins Ungewisse
Der düstere Tag
Pieter Bruegel der Ältere
Im Naturhistorischen Museum
Zwischenbilanz
Im Sandtrichter des Ameisenlöwen
Post-mortem-Fotografien
Warum ich schreibe
Warum ich lese
Natur und Gift
Nachtrag: Die Monate nach unserem Eintreffen im Haus von Eugen
Alltag I
Alltag II
Der Lichtstrahl
Alltag III
Das Bienengehirn
Der Steinbruch
Der Soldat
Leviathans Ende
Ich bin ein Vogel
Fotografie und Erinnerung
Reisen
Gedichte II
Die Zerstörung
Das Frühlingsbild
Kolbs Tod
Menschen
Träume
Walter und zwei chinesische Kleinwüchsige
Honigschleudern
Ein kurzer Rückblick
Tarkowski
Die Fahrt zu den Vulkanen
Das Schwerkraftbeben
Das Gebell
Nachbeben
Höhlenmalerei
Ich bin erzählbereit
Zeitenwechsel
Reise zum Berg Ararat
Aus der Kinderbibel
Neuigkeiten
Basquiat
Durchsichtige Tiere
Alltag
Religion
Der durchsichtige Mensch
Lishas Erzählung
Gedichte III
Klimawandel
Kopfgedicht
Yin und Yang
Bekannte Patienten
Rudolf
Xaver
Sepp
Johann Wagner
Konrad Igler
Die Imkerinnen
Gustav Reiter, der Vermisste
Schöpfung und Apokalypse
Der erste Flug, Venedig
Opium
»Bienen können sich in Labyrinthen zurechtfinden, in denen sie niemals zuvor gewesen sind.«
Selbstgespräch
Der unsichtbare Maulwurfsgang in der Luft
Ein Fehlstart
Ein Gebet
Hamburg
Maoris Welt
Die Pflanzenreisen
Gedichte IV
Erster Teil
»Naturgesetze«
Gedichte IV
Zweiter Teil
Gedichte IV
Dritter Teil
Das Kloster und die vier Elemente
Die Wunde und das Wunder
Gustav Reiter
Diana und Ted und die chinesischen Artisten
Lisha und die Träume
Spaziergang mit Ted und Begegnung mit dem Wahnsinn
Das begehbare Monster
Gedankenfieber
Der Totenkopffalter
Zwischenspiel
Märchen
Eine Schnecke
Die gelbe Nacht
Der Pfarrer und die Glocke
Der Blitzableitervertreter
Die Stadtmusikanten
Der Segelflieger Charwath
Der K-.u.-k.-Begräbnisredner
»Schlüsselbunt«
Eisberge am Himmel
Die Hölle
Festtagsspeisen
Der Orchideentext von R. Schall
Evolution und Wiedergeburt
Das Unentdeckte im Kopf
»Ich war es!«
Gedichte V
Im Kloster I
Die Doktoren der Normalität
Im Kloster II
Eine Geschichte der symmetrischen Zeit
In Zeitlupe: Die Entstehung eines Rätsels
Das Ornament
Zwischenbericht
Der Elefantenmensch
Edgar Allan Poe
Ein andalusischer Hund
Freaks
Ein seltsamer Traum
Die Umsiedlung
Es ist so weit
Eine Vorbemerkung
Die Geschichte der Bienen
Nachwort
Hochzeiten
Der erste April
Nachwort
Freilich ist es seltsam, die Erde nicht mehr zu bewohnen,
kaum erlernte Bräuche nicht mehr zu üben,
Rosen, und andern eigens versprechenden Dingen
nicht die Bedeutung menschlicher Zukunft zu geben;
das, was man war in unendlich ängstlichen Händen,
nicht mehr zu sein, und selbst den eigenen Namen
wegzulassen wie ein zerbrochenes Spielzeug.
Seltsam, die Wünsche nicht weiter zu wünschen. Seltsam,
alles, was sich bezog, so lose im Raume
flattern zu sehen.
Rainer Maria Rilke, Duineser Elegien
Was bisher geschah
Seit mich der Rechtsanwalt Alois Jenner, mit dem ich aufgewachsen bin, ermorden wollte, habe ich vom »Haus der Künstler« eine neue Identität erhalten. Man ließ mich, Franz Lindner, 62 Jahre alt, auf dem Papier sterben und zauberte an dessen Stelle einen Wilhelm Herman aus der Luft, der ich jetzt bin. Selbst mein Geburtsdatum stimmt nicht mehr. In der Anstalt für Art-brut-Künstler bin ich trotzdem geblieben, allerdings habe ich seither nicht den Wunsch verspürt, »ins Leben zurückzukehren«. Hier bin ich mit mir allein, was das größte aller Abenteuer ist. Ich leide nicht unter Einsamkeit, aber ich suche sie auch nicht. Wie ein Molch lebe ich hier im Dunklen – das Universum ist in mir selbst. Meine Gedanken sind Planeten, Kometen, Milchstraßen, Sternennebel, Schwarze Löcher – mit einem Wort Mystifikationen. Sicherlich bin ich nicht der erste Mensch, der die Entdeckung macht, sternengleich zu sein, im Gegenteil, die Form dieser Existenz wartet nur darauf, von Menschen erkannt und gelebt zu werden.
Wirklichkeit und Wahrheit
Bis zum Vortag war alles wie immer gewesen. Ich versuchte, eine meiner von den Ärzten sogenannten »Halluzinationen« aufzuschreiben, doch gelang mir (wie immer) nur ein Fragment. Es waren übrigens keine Visionen über eine bessere Gesellschaft, wie sie allesamt zu Mord und Totschlag geführt haben, sondern es handelte sich um seltsame Bilder und Gedanken ohne Zusammenhang – dadurch wusste ich, dass ich der Wirklichkeit meiner »Halluzinationen« nähergekommen war. Wirklichkeit. Was für ein abgedroschenes Wort. Jeder versteht etwas anderes darunter, und jeder hat recht. Auch Lügen sind ein Teil der menschlichen Wirklichkeit ebenso wie Hirngespinste – doch der allergrößte Anteil ist Fälschung, Betrug und Einbildung oder Nichtwissen und Selbsttäuschung. Die angebliche Aufdeckung eines Schwindels oder Irrtums bringt nur neue Märchen und Irrtümer ans Tageslicht – denn die »Wahrheit« kennt nicht einmal derjenige, welcher an sie glaubt und sie vertritt. Gäbe es die sogenannte Wirklichkeit, die Wahrheit wirklich, würde die Menschheit nicht existieren, weil sie unerträglich ist.
Das Haus der Künstler, wie das Gebäude in der Nervenheilanstalt bezeichnet wird, ist für mich als Schriftsteller und Patient ein Schutzgebäude. In ihm gibt es weder Wirklichkeit noch Wahrheit oder Unwahrheit.
Wahrheit, Wirklichkeit und Unwahrheit sind ausgesperrt. Übrigens haben alle angesehenen und häufig verwendeten Begriffe wie Wirklichkeit und Wahrheit ein Ablaufdatum. Ich habe gesehen, wie die Zeit entstanden und wieder verschwunden ist, wie sie wiederkam und wie sie sich auflöste.
Die »Halluzination« oder Vision, die ich beschreiben sollte
Das »Haus der Künstler« war plötzlich voll mit altem Aufziehspielzeug, das auf dem Dachboden gefunden worden war. Es ist sichtlich in der Zeit des Zweiten Weltkriegs fabriziert worden. Man zeigte es uns Patienten erst, nachdem die Bauarbeiter, die das Dach des Gebäudes renoviert hatten, gegangen waren. Als wir die Dachbodentür öffneten, vibrierten die Aufziehspielzeuge noch auf dem Fußboden. Aber bei unserem Eintreten fingen sie an zu laufen, sie blockierten einander, stolperten, stürzten um. Sie schnurrten, sie gaben Signalgeräusche von sich, sie brummten, ratterten, summten, flohen über die Stiege und überschlugen sich. Sie schienen sich in einem fort zu vermehren, sie verdrängten uns: Blechinsekten, verrücktes Militärspielzeug, geisteskrank gewordene Automobile, Fischschwärme auf Rädern und zwitschernde Robotervögel. Eine Flut von Kinderspielzeug ergoss sich in die Räume, immer mehr und mehr kam nach, und bald verhielt sich die Flut der kleinen Aufziehobjekte wie reales Wasser. Die Figuren und Gegenstände purzelten und drehten sich im Kreis, bis plötzlich Musik ertönte – woher kam sie? – und das gesamte Spielzeug stehen blieb. Das Licht erlosch, Scheinwerfer strahlten eine Bühne an. Die einzelnen Spielzeuge lagen bewegungslos herum. Kein Rädchen drehte sich, kein Licht blinkte, keine Sirene erscholl. Aus einem Lautsprecher war das Rasseln von Münzen zu hören – lauter als aus einarmigen Banditen, und Jubel brandete auf. Eine Teddybär-Dame mit Hut saß plötzlich auf einem Fauteuil. Beschädigte Roboter rollten heran: Einem fehlte die linke Hand, dem anderen der Kopf. Trotzdem erweckten sie den Eindruck, dass alles Übrige an ihnen funktionierte. Aber sogleich begann der Zerstörungsprozess. Aus der Bärin quollen Sägespäne, der Hut kollerte ihr vom Kopf, die Gliedmaßen flogen durch die Luft, die Körperspannung ließ nach, und sie wurde zu einem toten Stück Stoff. Die Roboter halfen einander, sich selbst zu zerstören, bis nur noch ein Haufen Schrauben, Gewinde, Zahnräder und Schrott auf dem Boden lag.
Der folgende Tag
Erster April.
Ich erwachte früh am Morgen. Wie verabredet wartete ich schon darauf, von meinem Neffen Eugen aus der Anstalt abgeholt zu werden. Seit dreißig Jahren beschäftigt auch er sich mit Bienen, länger als mein Vater, der Imker war und es bis zu seinem Tod auf 48 Berufsjahre brachte.
Immer wieder blickte ich aus meinem Fenster in den Laubwald. Auf Ausschnitten des Himmels, die nicht von Zweigen und Laub verdeckt waren, tauchten zu meinem Erstaunen kleine Flugzeuge auf. Üblicherweise sehe ich nur ein Blau oder Wolken, diesmal stand ein Zeppelin mit der Beschriftung »H« am Himmel, der wie ein Filmplakat aussah. Ein kleines einmotoriges Flugzeug schob sich hinter ihm langsam vorbei. Die kleinen Flugzeuge kamen mir anfangs wie schwebende Buchstaben vor. Weitere rätselhafte Erscheinungen folgten. Sie sahen jetzt aus wie Entwürfe von Flugmaschinen ohne Flügel, Ballone aber mit Antriebsmotoren. Je länger ich sie beobachtete, desto sicherer war ich, dass ich getäuscht wurde. Getäuscht von der Wirklichkeit. Getäuscht von der »Wahrheit«. Doch irgendetwas ganz im Innersten meines Herzens ließ mich erahnen, dass etwas Ungeheures vor sich ging. Was bedeutete die Spielzeugflut meiner Halluzination vom Vorabend? Was bedeuteten die Flugkörper? Einerseits erschienen sie mir selbstverständlich, andererseits hatten sie etwas Unheimliches und Unwirkliches, als flögen sie in einem Wirbelsturm, einem Hurrikan, jedoch – und das war das Verstörende – in extremer Zeitlupe. Ich schloss aus, dass die Flugkörper bemannt waren, und ich schloss aus, dass es sich um eine militärische Operation handelte, dazu bewegten sich die »Lufttrümmer«, so nannte ich sie, viel zu langsam – nein, sie schienen gleichsam in der Luft zu stehen. Aber ich schwieg lieber, denn in unserem Haus gibt es nicht wenige Wahrheiten dieser Art.
Auf der linken Seite kam jetzt eine eigelbe Wolkenformation ins Bild, der ich anfangs jedoch wenig Beachtung schenkte. Ich wollte auf die Uhr schauen, als jemand mit Fäusten gegen die Glastür des Eingangs schlug. Zu meiner Überraschung war sie noch immer verschlossen, obwohl beim Pflegepersonal eigentlich Schichtwechsel war. Ich fand den Schlüssel, und gleich darauf sah ich meinen Neffen Eugen, seinen achtzehnjährigen Sohn Walter und den Foxterrier Gazpacho, die Einlass begehrten. Sie drängten so ungestüm herein, dass ich befürchtete, es sei etwas Schreckliches geschehen. Aufgeregt, aber stumm zeigten sie hinter sich ins Freie. Dort kroch gerade ein ungeheurer gelber Nebel den Berghang hinunter. Ich verstand nicht, was geschehen war, denn kurz zuvor war der Himmel noch blau gewesen. Wie immer schwieg ich, doch schienen sie mir anzumerken, dass ich betroffen war.
Der gelbe Nebel breitete sich schneller aus, als ich erwartet hatte. Instinktiv hatte ich sofort die Tür wieder geschlossen und darauf geachtet, dass nichts davon in das Haus drang.
»Was ist das?«, rief Walter aufgeregt.
»Etwas Furchtbares«, antwortete mein Neffe hastig, und der Hund bellte, bevor er sich angsterfüllt auf den Fußboden legte.
Es war still, und ich lief, gefolgt von den dreien, in mein Zimmer, wo es bereits völlig dunkel geworden war. Vor allen Fenstern hatte sich so etwas wie eine gelbe Mauer gebildet. Es sah nicht aus wie Sandkörner aus der Sahara, vielmehr erschien es mir wie gelber Mörtel, und Furcht befiel mich, dass wir eingemauert würden. Inzwischen stellte Maori, der im Nebenzimmer wohnte und zur Tür hereinblickte, fest, dass im gesamten Gebäude der Strom ausgefallen war. Ich hatte es gar nicht bemerkt, weil ich wegen des blauen Himmels, auf dem die Flugkörper zu sehen gewesen waren, nicht daran gedacht hatte, das Licht einzuschalten.
»Was ist?«, rief Maori.
Den Spitznamen Maori hatte er von einem Zirkusdirektor bekommen, bei dem er mit seinen Tätowierungen als Schauobjekt aufgetreten war. Ich kannte den Zirkusdirektor durch Zufall: Mit hundert Jahren hatte er eine 107 Jahre alte Witwe im Altersheim geheiratet und in der Zeitung behauptet, noch potent zu sein. Doch das war nur eine seiner Lügen und Aufschneidereien gewesen.
Unsere Aufregung war zunächst nicht ansteckend. Da es ansonsten still war, schliefen die anderen Patienten einfach weiter, und Maori hatte sich ebenfalls wieder auf dem Bett ausgestreckt. Es war unter den gegebenen Umständen nicht möglich abzureisen, daher nahmen wir auf den Fauteuils im Aufenthaltsraum Platz und dachten nach. Geräusche, als ob größere oder kleinere Gegenstände vom Himmel fielen, lenkten uns immer wieder ab. Nicht nur der Strom war ausgefallen, sondern es funktionierte auch kein Smartphone mehr – das irritierte besonders meinen Neffen, der immer wieder vergeblich versuchte, seine Frau anzurufen.
Mehrmals waren Explosionen und Lärm zu hören, wie von einstürzenden Gebäuden.
»Was ist los?«, fragte der Sohn meines Neffen jedes Mal ängstlich, doch sein Vater antwortete nicht, sondern schüttelte nur den ergrauten Kopf und versuchte es etwas später neuerlich – mit demselben Ergebnis.
Im Haus befanden sich außer einem Dutzend Künstlerpatienten die Frau Doktor, die den Nachtdienst versehen hatte, ein Pfleger und ein Pflegegehilfe, die Putzfrau und eine Krankenschwester, die sich mit ihrem Mann zerstritten und ein Liebesverhältnis mit dem Oberarzt begonnen hatte. Wie sich bald herausstellte, hatte auch der Chefarzt im »Haus der Künstler« übernachtet und war erst, als ich die Haustür für meine Verwandten und den Hund geöffnet hatte, erwacht. Keiner begriff, was geschehen war. Keiner von uns konnte Kontakt zur Außenwelt aufnehmen, und keiner wagte sich hinaus ins Freie, in den breiigen gelben Nebel.
Erst als der Theologiestudent auftauchte, der die Nacht im Archiv verbracht hatte, um die kryptischen Arbeiten von August Walla zu studieren, und darüber eingeschlafen war, war auf seinen Ruf »Wir haben kein Licht!« ein kurzes, allgemeines Lachen zu vernehmen. Immer wieder wurde gefragt: »Was ist los?«
Allmählich wachten alle Patienten auf – sie waren am allerwenigsten beunruhigt. Manche lachten, manche reagierten gar nicht auf die veränderten Umstände. Sie waren mit anderen Dingen beschäftigt oder dachten an nichts. Es entstand zuerst keine Unruhe, bis irgendetwas in der Nähe des Gebäudes zu Boden krachte und explodierte. Hierauf wurde es vollständig still, das heißt, es folgten zwei oder drei kleinere Explosionen, und zwischendurch war der hastige Atem eines Brandes zu vernehmen.
Zwei oder drei Patienten waren anfangs darüber verärgert, sie regten sich auf, aber keiner zeigte Furcht – sofern ihre Empörung nicht bloß gespielt war, um nicht zu verraten, dass sie doch Angst hatten.
Gegen Mittag riss der Nebel auf, und sofort stürmte mein Neffe Eugen, gefolgt von allen Übrigen, ins Freie. Was wir zu sehen bekamen, verstörte uns. Unweit vom Eingangstor stießen wir auf einen abgestürzten und ausgebrannten Hubschrauber, in dem noch Feuer glomm. Es stank nach Treibstoff, Trümmer lagen herum, jedoch waren keine Unglücksopfer oder Lebewesen zu sehen. Noch nie hatte ich mich so geistesgestört gefühlt wie bei diesem Ereignis. Ich begriff in Wirklichkeit – das heißt, falls es überhaupt eine Wirklichkeit gab oder gibt – nichts, ich verstand nur, dass ich nichts verstand. Alles war fremd, alle Gegenstände, alle Menschen. Sie verhielten sich, als würde es keine Zukunft und keine Vergangenheit geben – nur noch Gegenwart, die auf das Unglaublichste und Abgrundtiefste anders war als alle Gegenwarten zuvor.
Gottlieb Ferra, der Theologiestudent und »Fachmann für Apokalypsen«, wie ihn der Pfleger Hans Haller bewundernd nennt, klappte im Freien auf einer Bank zusammen und begann zu weinen. Er schien mir jetzt der hilfloseste Mensch zu sein.
»Wir fahren«, schrie mein Neffe, »steigt ein!«
»Warten Sie, bis wir Nachricht von Oberarzt Dr. Brantner haben … möglicherweise ist ein Krieg ausgebrochen«, rief die Ärztin Christine Schäfer.
Unter dem großen Hügel breitete sich das ehemalige Spital für Geisteskranke aus, das zu einer Eliteuniversität umgebaut worden war, in der Studenten aus der ganzen Welt nach Wissen suchten. Die Ärztin war der Meinung, dass wir uns zuerst dort umsehen sollten. Mein Neffe nickte und zog uns in seinen VW-Bus, um augenblicklich nach Hause aufzubrechen, vor allem aus Angst, es könnte seiner Frau und deren altem Vater, der bei ihnen wohnte, »auch etwas geschehen sein«. Auf einem zerstörten Dach eines Verwaltungsgebäudes der Universität entdeckten wir ein abgestürztes kleineres Passagierflugzeug mit verbogenen Propellern. Nirgendwo ein Mensch, weder auf der Straße noch in einem der Häuser. Die Anlage machte einen bedrohlichen Eindruck. Mein Neffe Eugen hielt vor der Aula an, rief »wartet« und verschwand hinter der Eingangstür. Als er wiederkam, kämpfte er mit Tränen.
»Hier lebt niemand mehr«, sagte er nach einer Pause. »Ich habe nur Kleider in den Räumen gefunden, Gebisse, Schmuck und Brillen. Das Zeug liegt am Boden herum, als seien die Angestellten nackt geflohen … aber die Schuhe sind nicht aufgeknüpft … die Hemden nicht, die Sakkos und Westen nicht … die Menschen scheinen einfach verschwunden zu sein, als hätten sie sich in Luft aufgelöst …«
Er startete den VW-Bus und wollte, so rasch er konnte, zurück zum »Haus der Künstler« fahren. Doch bevor er die Eliteuniversität hinter sich ließ, hielt er vor der auf dem Dach über dem vierten Stock des Verwaltungsgebäudes liegenden Passagiermaschine, stieg aus und lief hinauf, um zu sehen, was mit den Fluggästen geschehen war. Er konnte es zuerst nicht glauben, aber er fand wieder nur Kleider, Schuhe, Brillen, falsche Gebisse sowie Eheringe, Schmuck – und Gepäckstücke, berichtete er uns. Was mich am meisten erschreckte, war die Selbstverständlichkeit, mit der sich alles ereignet hatte. Waren wir nur in einem winzigen Abschnitt der Erde, in dem alles aus den Fugen geriet? Die Selbstverständlichkeit, mit der es geschehen war, machte mich orientierungslos. Mein »Geisteszustand« war immer auch Schutz gewesen, nun hatte die Wirklichkeit meine spezielle Wirklichkeit, die von den Ärzten »Wahn« genannt wird, verschluckt. Es gab jetzt keinen Wahn mehr, nur noch Wirklichkeit, die »Wahn« war. Ich wollte vor Entsetzen sterben. Das Verstehen ist eine Fiktion, begriff ich. Es ist immer beschränkt, es ist immer begrenzt. Es ist eine Täuschung, nur eine Art Zurechtfindung. Doch mit einem Schlag war das Kartenhaus »Gewissheit« zusammengestürzt, und wir standen vor der Zerstörung, vor dem Nichts.
Zurückgekehrt ins »Haus der Künstler« schlief ich aus Erschöpfung sofort ein. Ich musste eine Stunde geschlafen haben, denn der Oberarzt Heinz Brantner war inzwischen von einer ersten Exkursion zurückgekehrt … gerade öffnete er die Tür zu seinem Wagen, und beim Heraussteigen hielt er eine Hand vor sein Gesicht …
»Kein Mensch«, stammelte er, während er aus Gewohnheit sein Auto abschloss und uns seinen Rücken zuwandte. »Nirgendwo. Die Geschäfte sind leer, die Straßen, die Wohnungen … meine Frau ist verschwunden, die Kinder … die Schule ist leer … überall Kleidungsstücke … Hundeleinen ohne Hunde … Ich habe keine Ahnung, was geschehen ist. Vier oder fünf Flugzeugwracks liegen in der Stadt herum und rauchen. Autos sind zusammengestoßen, gegen Mauern gefahren, aber nirgendwo Tote, nirgendwo Blut …«
Er drehte sich zur Seite, und es dauerte, bis er sich wieder gefasst hatte.
Mitten in die Stille sagte mein Neffe Eugen: »Ich muss zurückfahren, meine Frau wartet auf mich …«
Daraufhin folgte eine kurze Besprechung, während der sich erneut Nebel auf den Boden senkte, diesmal ein grauer.
Da alle nicht nur die räumliche, sondern auch die zeitliche Orientierung verloren hatten, wäre das Leben wohl in Ratlosigkeit versunken, hätte sich nicht Eugen wieder hinter das Lenkrad gesetzt und den Motor gestartet. Dem Großteil der Anwesenden war nach Flucht zumute, einem Teil der Künstlerpatienten war es gleichgültig, nur wenige wollten bleiben und abwarten. Als diese jedoch sahen, dass die meisten zur Flucht entschlossen waren, gaben sie widerstrebend nach und fügten sich.
Nur Maori riss sich kurz los und schrie: »Wir sind alle tot! Heute Nacht sind wir gestorben!«
Jeder nahm seine persönlichen Dinge mit sich – alles andere wollte man sich »unterwegs beschaffen«, da ja, wie Oberarzt Brantner berichtet hatte, die Geschäfte wie die Straßen menschenleer seien. Doch mein Neffe Eugen hatte die Absicht, mit Walter, dem Hündchen Gazpacho und mir nur noch nach Hause zu fahren. Er ließ den Übrigen eine Straßenkarte zurück, denn auch die Navigationssysteme in den Autos funktionierten nicht mehr.
Wir tauchten in die unendliche Stille, als wir den noch immer rauchenden Hubschrauber hinter uns gelassen hatten, die Allee hinunterfuhren und wieder das abgestürzte Propellerflugzeug auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes sahen. Wie war es dort hingekommen? Es musste irgendwo anders schon vorher aufgeschlagen sein.
»Dort hinten« – mein Neffe Eugen zeigte auf den Rückspiegel – »hat es die Baumkronen gestreift und zum Teil niedergemäht, und dann ist es mit dem letzten Schwung auf dem Dach liegen geblieben.«
Ich drehte mich nicht um, nur Walter tat es und rief erschrocken »Ja!«. Dann wollte er von seinem Vater wissen, was überhaupt vorgefallen sei.
»Ich weiß es nicht«, antwortete dieser.
Auf der Straße standen Autos herum, der größte Teil neben der Fahrbahn: Sie lagen auf dem Dach oder seitlich – so selbstverständlich, als gehörte es sich so. Hierauf ging es Schlag auf Schlag. Ein umgestürzter Kran versperrte die Fahrbahn, und wir mussten wenden und einen Umweg nehmen, der ebenfalls voller Hindernisse war und zuletzt von einer Ansammlung von Autos versperrt wurde, die zusammengestoßen waren und bizarre Formen angenommen hatten … Sofort fielen mir die Spielzeugautos auf dem Dachboden ein, und ich zweifelte daran, dass ich tatsächlich Zeuge der Überflutung des »Hauses der Künstler« durch Aufziehspielzeug aus dem Zweiten Weltkrieg geworden war. Vielleicht hatte ich die jetzigen Ereignisse schon vorausgesehen? Irgendetwas musste aus der Chronologie herausgebrochen und in mein Gesichtsfeld gespült worden sein, als sei ein Stück aus der Zeitmauer eingestürzt.
Die Autobahn, die wir erreicht hatten, erinnerte mich an Katastrophen, die ich nur aus dem Kino und Fernsehen kannte. Ich hatte sogar den Eindruck, dass rund um uns ein Krieg stattfand – gleichzeitig war es totenstill, abgesehen vom Motorengeräusch des VW-Busses. Eugen fuhr an den Straßenrand und hielt an.
»Ich weiß selbst nicht, was geschehen ist«, sagte er. »Ich brauche meine ganze Kraft. Schreit nicht herum – wenn ihr es nicht ertragen könnt, haltet euch die Hände vors Gesicht.«
Dann gab er sich einen Ruck und startete wieder. Der Foxterrier Gazpacho lag auf dem Boden vor der hinteren Sitzbank, Walter über ihm, ich saß auf dem Vordersitz neben Eugen. Eugen war der Einzige von uns, der einen Führerschein besaß. Wir glitten an den Autowracks vorbei, und plötzlich wusste ich, dass es keinen Gott gibt. Ich hatte mir im »Haus der Künstler« sogar angewöhnt, mit ihm zu sprechen, aber vielleicht war das eines der Symptome meines Wahns gewesen. Weshalb sollte es einen Gott geben? Ich war selbst immer nur ein Spielball gewesen, der einmal dahin, einmal dorthin gerollt war … Ich wusste, dass es Gefühle waren, die zu mir sprachen, klar denken konnte ich nicht mehr. Ich wunderte mich nur, dass ich noch lebte. Aber was bedeutete Leben noch? – Dass ich vermutlich bald nicht mehr sein würde, oder?
Plötzlich gab es kein Vorankommen mehr. Ein Tankwagen musste explodiert sein, denn das Wrack brannte noch, und die übrigen Autos, die leer waren, versperrten die Weiterfahrt.
»Raus!«, rief Eugen und bremste scharf.
Wir nahmen nichts mit. Eugen ging voran, vorbei an den leeren Fahrzeugen mit Kleidern und Schmuck, als handelte es sich um einen Gespensterumzug im Karneval. Noch immer begriff ich nichts. Da sah ich einen weißen Schmetterling, einen Kohlweißling, aber es konnte auch reflektiertes Licht von einer Windschutzscheibe gewesen sein. Wir mussten über Autowracks, Lastwagen, Traktoren, Motorräder und einen Feuerwehrwagen klettern und spürten, dass es nur noch eine bizarre, unverständliche Welt war, die uns umgab. Nichts, was wir sahen, durften wir in Beziehung setzen zu dem, was wir kannten. Ich wusste nicht einmal mehr, was wir wollten.
Auf der Gegenfahrbahn fanden wir einen Lieferwagen, der Kartoffeln geladen hatte. Eugen entfernte die Kleidungsstücke des Fahrers und seine Halskette mit goldenem Kreuz und hängte sie über den Rückspiegel einer benachbarten Mercedes-Limousine. Dann fuhren wir los. Mittlerweile wechselten meine Vorstellungen, was die Ursachen der Katastrophe betraf, ich dachte zuerst an einen medikamentös hervorgerufenen Albtraum, dann vermutete ich den Ausbruch eines Krieges und schließlich außerirdische Gewalt. Leise begann der Hund zu winseln, worauf mein Neffe ihn zuerst zu beruhigen versuchte, dann aber tadelte, worauf er still wurde. Walter fing an, vor sich hin zu weinen, aber sein Vater reagierte nicht darauf. Pausenlos arbeiteten die Kaumuskeln meines Neffen. Ein Jauchewagen war auf einem Feld umgestürzt, ein Rettungsauto gegen einen Mast auf einem Parkplatz gefahren und die Bahre herausgeschleudert worden, ohne dass ein Fahrer, ein Sanitäter oder ein Patient zu sehen gewesen wären. Später lag ein Sarg halb zersplittert auf der Fahrbahn. Zu meinem Erstaunen erkannte ich eine Hand, die in den Trümmern zu sehen war. Wie war das möglich? Waren die Toten nicht verschwunden? Wir konnten vom Grauen, das uns umgab, nur einen Bruchteil aufnehmen, es überforderte uns. Nirgendwo ein Mensch. Sinnlosigkeit übertrug sich auf uns. Es war, als würden wir in einem Riesenmixer herumgeschleudert und zerkleinert und zerdrückt werden. Von einer Baumgruppe hingen Fallschirme und Fallschirmspringeranzüge, die im Wind schlabberten. Ein Haus brannte. Ich wollte mir alles einprägen, um es irgendwann einmal abzurufen, doch die Eindrücke wechselten so rasch, dass ich alles wieder vergaß, sobald die nächsten auftauchten.
In der »Provinzhauptstadt« – wie ich dachte, da mir der Name der Stadt jetzt ausgelöscht zu sein schien – hielt Eugen es zwei Stunden später nicht mehr aus: Anstatt die Autobahn weiter nach Süden zu fahren, bog er in einen Randbezirk ein und fuhr uns durch die toten Straßen, zwischen den toten Häusern. Wir entdeckten noch immer keinen Menschen. Keinen Hund, keinen Vogel, keine Katze. Alles sah verlassen aus. Wir hielten vor einem Fleischerladen, nahmen Würste und anderes an uns und stiegen in einen BMW um, in dem noch der Zündschlüssel steckte, und erreichten nach einigen Umwegen das Landeskrankenhaus. Erst später begriff ich, weshalb es noch Würste und Fleisch gab. Keine Ampel hatte geblinkt, kein Auto hatte gehupt, kein Verkehrsgeräusch war zu hören gewesen. Eine leere Straßenbahn stand entgleist auf dem Marktplatz, dahinter ein Stau von sieben oder acht Liefer- und Personenwagen.
Eugen wollte sich nur kurz im Krankenhaus umsehen, aber Walter und ich schafften es nicht, allein im Wagen sitzen zu bleiben. Wir liefen ihm in den leeren Gängen hinterher, Gazpacho folgte uns bellend, und wir kämpften weiter gegen Tränen an. Alles sah vergessen und verloren aus. Alle Spitalszimmer waren leer. Im OP-Saal lag blaues Chirurgengewand auf dem Boden, dazwischen weiße Pantoffeln verschiedener Größen. Vom Patienten fand sich nur ein Umhang, alle Geräte waren außer Betrieb.
Als wir weiterfuhren, sah ich, dass Tränen über Eugens Wangen liefen, aber er verzog dabei nicht sein Gesicht.
Langsam erwartete auch ich nicht mehr, einen lebenden Menschen anzutreffen, obwohl ich bisher nicht daran gezweifelt hatte, dass es geschehen werde. Die einzige Hoffnung war das Unerklärliche der Ereignisse gewesen. Solange es Unerklärliches gab, war alles möglich, dachte ich. Ein leerer, eingezäunter Fußballplatz. Die Bahnlinie war von einem Zusammenstoß verwüstet, aus den Fenstern der Abteile kräuselte sich Rauch, ein Stück weiter brannte ein Waggon aus.
Als wir die rauchenden Trümmer des nächsten abgestürzten Flugzeugs entdeckten, gehörte es langsam schon zu den erwarteten Anblicken. Die Straße war mit Puzzleteilen des Flugzeugs, aufgeschlagenen Koffern, zerstörten Sitzen und zerrissenen Uniformstücken übersät. Dann wusste ich mit einem Mal, wo ich Orientierung fand: in meiner Kindheit. Wenn ich eine Atmosphäre des Unheimlichen hatte schaffen wollen, tat ich alles, was mir sonst verboten war … ich leerte die Spielzeugkiste in die Badewanne, ließ das Wasser ein oder streute Zeitungspapier aus und zündete es an – doch alles nur in Gedanken –, ich warf das Spielzeug aus dem Fenster und die Eheringe der Großeltern in den Ausguss, ich zerschmetterte das Geschirr, die Teller und Gläser auf dem Fußboden, ich schrie, ich spuckte, hilflos und einsam. Das alles fiel mir jetzt ein, als wir, plötzlich von grauem Nebel umgeben, im Schritttempo weiterfuhren. Es war der Augenblick, als Walter laut »Kamel!« schrie und wir uns umdrehten und aus dem Rückfenster blickten. Tatsächlich war es kein Plakat mit einer riesigen Zigarettenwerbung, sondern ein Lebewesen. Wir wagten es nicht, zu glauben, was wir sahen, weil wir das Tier als Zeichen der Hoffnung empfanden – aber es war tatsächlich ein Kamel. Dann erkannten wir die Umrisse eines Zirkuswagens sowie vier oder fünf weitere. Offenbar hatten die Clowns, die Artisten und die Dompteuse, die Arbeiter und Athleten versucht, aus dem Zirkuszelt, das wir am Straßenrand entdeckten, zu fliehen – waren aber nicht weit gekommen. Nur ihre Bekleidung war übrig geblieben. Es gab vier Affen und einen kleinen Elefanten. Aber weshalb sahen wir keine einheimischen Tiere – das heißt, bis auf Gazpacho? Eugen ließ uns aussteigen, er fand einen Lastwagen und verlud die Tiere mitsamt dem Kamel in den Laderaum, in dem auch ich Platz nahm.
Langsam setzte sich das schwerfällige Fahrzeug in Bewegung. Allmählich gewöhnte sich mein Blick an die Dunkelheit, und ich nahm zumindest Umrisse wahr. Der Lastwagen hatte Daunendecken transportiert, begriff ich, und die Tiere hatten sich darauf niedergelassen. Selbst die Affen verhielten sich ruhig. Es war wie eine Vision: der nackte Laderaum, halb gefüllt mit Decken, auf denen die Tiere ruhten, und ich, der ich mich noch unglücklicher fühlte als zuvor. Etwa eine Stunde lang kamen wir nur schrittweise voran. Da ich nicht sehen konnte, was draußen vor sich ging, musste ich versuchen, mir alles im Kopf auszumalen. Der Wagen bewegte sich jetzt schneller. Vermutlich hatte der Nebel nachgelassen, und die Tiere, die sich bisher ruhig verhalten hatten, fingen plötzlich an, Geräusche von sich zu geben.
Immer schon war es mein Traum gewesen, mit Tieren sprechen zu können. Als Kind hatte ich ein Buch von Hugh Lofting gelesen, »Doktor Dolittles Zirkus«, das mir jetzt einfiel. Später bekam mein Vater eine Postkarte mit einem Bild, auf dem Franz von Assisi mit einer Schar Vögel zu sehen war … Franz habe mit Tieren gesprochen, erklärte mir mein Vater eingehend und wiederholt. Er rahmte das Bild ein und hängte es in meiner Kammer auf. Es war von »Giotto« gemalt, las ich. Wie oft habe ich im Abendgebet geradezu darum gefleht, dass auch ich mit den Tieren sprechen könne. Oder hatte der Mönch auf dem Gemälde, der denselben Vornamen trug wie ich, sich das alles nur eingebildet?
Franz von Assisi begann in meinem Kopf allmählich die Stelle von Hugh Lofting einzunehmen. Das Rätselhafte an dem Heiligen zog mich immer mehr in seinen Bann, auch weil mein Vater nicht aufhörte, bewundernd über ihn zu reden … Schließlich versuchte ich es auf eigene Faust mit den Bienen. Bisweilen war mir sogar, dass ich sie verstand. Dann wiederum scheiterte ich. Trotzdem habe ich es nie aufgegeben, die Bienensprache zu erlernen – je älter ich wurde, desto intensiver quälte mich dieser Wunsch.
»Und jetzt?«, fragten die aufgeregten Affen. »Und jetzt? Und jetzt?« Sie schrien durcheinander: »Und jetzt? Und jetzt?«
Da geschah etwas mit mir, das ich nie vergessen, aber auch nie begreifen werde: Ich konnte mich plötzlich über meine Gedanken stumm mit den Tieren unterhalten. Es waren neue Fähigkeiten, die ich auf einmal besaß, aber ich wusste nicht, weshalb. Ich fragte wortlos und ohne mich anzustrengen den kleinen Elefanten, was die Affen mit »und jetzt?« meinen würden. Der Elefant war keinesfalls erstaunt über meine Frage und gab zurück: »Für den Zirkusdirektor waren wir bloß Objekte, es war ihm wichtig, dass wir gesund aussahen, stark wirkten, Neugierde weckten – wie es uns ging, scherte ihn einen Dreck.«
Die anderen Tiere kümmerten sich nicht um uns. Erst als ich mich ihnen zuwandte, reagierten sie.
Für die Affen war ich, wie sie riefen, ein »Blindgänger«. Weshalb ich wohl zusammen mit ihnen eingesperrt sei? Weil ich nichts taugte? Nur das Kamel machte Kaubewegungen und fragte sich selbst, wann es Futter gebe … Plötzlich begannen die Affen zu lärmen – soviel ich verstand, riefen sie »Feuer! Hinaus! Wir ersticken!«.
Erst eine halbe Minute später konnte ich selbst den Brandgeruch wahrnehmen und begriff, dass es draußen brennen musste. Wahrscheinlich fuhren wir gerade durch dichten Rauch, dachte ich. Plötzlich wurde das Schiebefenster zur Fahrerkabine geöffnet, und Walter rief in die Dunkelheit: »Der Wald brennt, aber die Straße ist noch frei! … Hörst du mich, Franz?« – Meinen neuen Namen Wilhelm Herman haben meine Verwandten nie benutzt.
Walter kam mir vor wie ein jugendlicher Gefängniswärter, der mich mit seinem Blick in der Dunkelheit suchte. Ich rief »Ja« zurück. Im nächsten Augenblick rüttelte es heftig, dann geriet das Fahrzeug ins Schleudern, und wir kippten zur Seite. Die Tiere waren außer sich. Die Affen schrien, der kleine Elefant zappelte auf dem Rücken, und das Kamel suchte panisch nach dem Ausgang.
Mein Kopf schmerzte. Ich war nicht ganz bei mir … benommen versuchte ich mich zurechtzufinden, aber um mich herum gab es nur tobendes Chaos, das zugleich etwas wie das Nichts war. Irgendwie kam ich auf die Beine, die Hintertür wurde geöffnet, und ich begriff, was geschehen war. Ich sah Eugen, der erschrocken »Du blutest!« ausrief, und taumelte hinaus. Rundherum brannte der Wald. Der Rauch war schwarz, außerdem herrschte noch immer grauer Nebel, der sich mit dem Rauch vermengte und immer dichter wurde. Die Tiere flohen panisch ins Freie, versuchten davonzulaufen, aber wir waren vom Feuer eingeschlossen. Ich dachte »Es geht zu Ende«, jedoch Eugen zog mich hinter sich her, und ich stolperte ihm nach. Als mir die Tiere einfielen, konzentrierte ich mich darauf, dass sie mir folgten. Ein brennender Baum, sah ich, war auf die Straße gestürzt, und weiter vorne entdeckte ich einen Möbelwagen, auf den wir zueilten. Er war zum Glück bis auf Kleiderreste, eine Zahnbrücke und Sonnenbrillen in der Fahrerkabine leer. Im Laderaum ein festgeschnürtes Klavier. Da alles in großer Eile geschah, wären wir beinahe weitergefahren, ohne dass das Schiebefenster zum Führerhaus geöffnet worden wäre. Lautstark protestierte ich.
Das Letzte, was ich sah, bevor man die Tür hinter mir ins Schloss warf, waren die Zirkustiere, die ich mit meinen Gedanken so weit gebracht hatte, dass sie in den Laderaum gesprungen waren und dort ihre Exkremente fallen ließen. Da wir keine Decken mehr hatten, streckten sie sich auf dem Boden aus, und ich beruhigte sie. Der Wald brannte lichterloh, hatte ich gesehen, und der Rauch stieg zum Himmel. Der Gestank vermischte sich mit dem der Tierexkremente. Wir fuhren jetzt zügig dahin. Ich stellte mir vor, wie der Lastwagen Feuer fing und explodierte. Ich suggerierte mir indessen, alles im Griff zu haben, und versprach dem kleinen Elefanten, mich um ihn zu kümmern. Die Affen log ich an, dass wir am Abend in Sicherheit sein würden, das Kamel hingegen umarmte ich und versuchte, es mit Liebesgefühlen zu beruhigen. Doch die Versuche schlugen fehl. Der Radau wurde so heftig, dass Eugen anhielt und mich aus dem Laderaum holte. Als ich den Kopf senkte, glaubte ich, es habe geschneit, denn der Boden war weiß und zerfurcht. Es war Kalkschlamm, wie Eugen mich gleich darauf aufklärte. Vor uns eine unasphaltierte Straße, die zu einem hohen Schornstein führte, dahinter ein Fabrikgebäude und noch weiter in der Ferne ein ausgestorbenes Dorf. Plötzlich stellte ich fest, dass die Tiere davongelaufen waren.
»Ich habe einen Umweg nehmen müssen … der Waldbrand – Unfälle auf der Autobahn«, erklärte Eugen mit unbewegtem Gesicht. Ich wechselte zu Walter in die Fahrerkabine, denn meine Stirn blutete. Der Hund Gazpacho lag wie erschlagen vor dem Beifahrersitz.
Walter rief aufgeregt: »Die Zirkustiere sind verschwunden!«
»Sie sind geflüchtet, noch bevor Franz in die Fahrerkabine gewechselt ist«, antwortete Eugen gleichgültig. Eugens Gedanken, sagte ich mir, waren mit Sicherheit bei seiner Frau und bei allem, was ich bisher gesehen hatte … Ich zwang mich, nicht weiterzudenken. Es ging jetzt eine schmale Asphaltstraße hinunter, an Einfamilienhäusern vorbei, an Kirchen und Kapellen, die wie archäologische Fundstücke aus vergangener Zeit aussahen, an Wirtshäusern und Lebensmittelgeschäften, Apotheken, Holzstapeln und Garagen. Keinen Menschen zu sehen machte mich schwermütig.
»Dort drüben steht einer!«, rief Eugen im selben Augenblick aufgeregt – doch es war nur eine Vogelscheuche.
Wir hielten im nächsten Dorf und stiegen in einen Mercedes um, den Fleischvorrat aus dem Geschäft hatten wir längst wieder verloren. Das Auto war fast neu und hatte, wie Eugen mit Hilfe des Führerscheins feststellte, den er in der Jacke auf dem Vordersitz gefunden hatte, einem 46-jährigen Arzt gehört. Eugen warf alles aus dem Wagen, nur die Tasche auf dem Rücksitz ließ er an ihrem Platz, nachdem er aus ihr ein Pflaster für meine Stirn herausgeholt hatte. Von da an verlief alles hektisch und rasant. Die Straßen waren freier geworden, Nebel und Rauch waren abgezogen, und die Sonne kam hinter den schmutzig grauen Wolken hervor. Wir schenkten den Einzelheiten keine Beachtung mehr. Als wir die Auffahrt zur Alm erreichten, sahen wir schon von unten, dass im Steinbruch kein Betrieb herrschte. Die Fahrzeuge und Maschinen standen an ihren Plätzen wie zu Arbeitsbeginn. Nichts bewegte sich, kein Fließband, kein Bagger, kein Lastwagen. Von weitem kam mir alles wie Spielzeug vor. Die restliche Fahrt über hatten wir kein Wort gesprochen. Die Almwiesen waren leer. Ein leichter Wind wirbelte Staub auf, und je näher wir Eugens und Walters Haus kamen, desto banger wurde uns. Das Gebäude lag still da. Eugen und sein Sohn sprangen heraus, der Hund hinterher, ich blieb sitzen. Ich hörte die beiden laut »Anja« und »Mama« rufen. Dann hatten sie ihr Kleid und ihren Ehering vor dem Karpfenteich gefunden, vermutete ich, denn sie fingen dort laut zu weinen an. Auf der Hausbank entdeckte ich gleich darauf das Gebiss, den Stock, den Ehering und den Trainingsanzug ihres Vaters.
Ich stieg aus und ging die wenigen Schritte hinauf zu Kucks ehemaligem Haus. Kuck war ein berühmter Comiczeichner gewesen und von Eugens Nachbarn aufgezogen worden. Nach deren Tod hatte er das nahegelegene Haus geerbt und dort an seinen neuen Geschichten gearbeitet. Als er unerwartet starb, hatte mein Neffe das kleine Gehöft am Rande des Steinbruchs von dessen Witwe gekauft, und den Sommer über hatte Anjas Vater dort gewohnt. Die Türen standen offen. Alles war frisch gereinigt und hergerichtet, als erwartete man Gäste. Doch nur ich war da.
Ich lief ums Haus zum Rand des grünfarbigen Diabas-Steinbruchs und schaute 140 Meter tief hinunter in das gleichgültige Erdinnere. Dort standen die abgestellten Lastwagen, Steinmühlen mit roten und blauen Förderbändern, Lieferwagen und Raupen herum. Es gibt nämlich eine sogenannte »Schaukanzel«, die ich früher immer wieder aufsuchte, um hinunterzusehen und mir vorzustellen, wie ich in den Abgrund stürze und dabei fliegen lerne.
Die ersten Apriltage
Wir suchten schließlich die umliegenden Bauernhöfe ab und fanden keine Menschen, nur ihre Kleidungsstücke. Auch das Vieh war spurlos verschwunden. Den ersten Vogel entdeckte ich erst am folgenden Tag – eine Taube. Eugens Nachbar hatte ein Dutzend dieser Vögel gezüchtet und mit Messingringen versehen. Es war ein kurzer Moment der Freude. Die überlebenden Tiere konnten sich vielleicht noch versteckt halten, hoffte ich. Ich versuchte stumm mit der Taube zu sprechen. »Warum lebt ihr?«, fragte sie mich.
Die nächste Überraschung war, dass ein Teil der Bienen ausgeflogen war. Jahrelang hatte sich Eugen abgemüht, dachte ich, den Bestand der Bienen trotz des Befalls durch Varroa-Milben über den Winter zu bringen, nun machte es den Eindruck, dass sich dieses Problem von selbst gelöst hatte.
Besonders aber überraschte mich der Umstand, dass es in der ersten Nacht Frösche regnete. Ich wurde wach, weil sie klatschend aufs Dach schlugen. Daher schaute ich hinaus und hörte die »Amphibien«, wie Eugen sie nannte, laut quaken, bevor sie verendeten.
Den gesamten Tag danach gingen mir tausend Frosch-Verse durch den Kopf. Ich verriet es niemandem, und es gelang mir auch nicht, die Reime zu zähmen, sie sprudelten nur so aus mir heraus:
Klappert der Frosch mit den Flossen,
glauben wir, es sind Rosen.
Ist das Froschauge starr,
heißt es, der Wein ist bald gar.
Schwimmt der Frosch über Teiches Boden,
zieht er Hosen an aus Loden.
Springt der Frosch hoch aus dem Wasser,
werden die Insekten nasser.
Öffnet der Frosch das Maul,
verwechselt man ihn mit dem Gaul.
Zeigt der Frosch seinen Darm,
wird der Betreffende arm.
Schwimmt der Frosch im Teich,
wird der Betreffende reich.
Während ich die verschiedensten Handgriffe machte, bildeten sich gegen meinen Willen ununterbrochen und rasend schnell Verse um Verse in meinem Kopf. Ich verzweifelte schon. Dann versuchte ich mit den Bienen in Gedanken zu sprechen. Ich konzentrierte mich darauf, und plötzlich waren die Verse verstummt wie Schluckauf. Als ich mich vor den Bienenkästen aufhielt, hörte ich ein einzelnes Insekt sagen, es sei die Königin, und es sei verwundert, dass ich seine Sprache verstehe.
Erst am Tag darauf trafen die übrigen Mitbewohner aus dem »Haus der Künstler« ein, die nicht mehr hatten dort bleiben wollen. Sie verteilten sich auf die umliegenden Gebäude. Da die Pfleger riesige Mengen an Medikamenten mitgebracht hatten, musste ich das Holzhaus am Rand des Steinbruchs wieder räumen, und Eugen ordnete an, dass ich in sein Haus und das ehemalige Zimmer des Schwiegervaters ziehen solle. Ich tat es, aber ich gab den Unterschlupf am Rand des Diabas-Steinbruchs in Gedanken nicht gänzlich auf. Wieder einen Tag darauf hörten wir eine Kinder- und Jugendgruppe eines SOS-Kinderdorfes laut schreiend auf unsere Häuser zulaufen. Sie hatten sich in der nahen Klamm aufgehalten und wegen des Schlechtwetters eine Höhle aufgesucht, in der sie Unterschlupf gefunden hatten, als der gelbe Nebel gekommen war. Ursprünglich hatten sie schon in der vergangenen Nacht den Rückzug antreten wollen, aber da hatte es gerade Frösche geregnet. Nun beschlossen sie, bei uns zu bleiben.
Das missglückte Bienenkunststück
In der Schwarmzeit habe ich meinen Neffen Eugen immer mit dem Bienenkunststück erfreut.
Ich fange einen Schwarm ein, beruhige und füttere ihn zwei Tage im Keller, binde mir das »Königinnen-Kästchen« – einen zündholzschachtelkleinen Behälter aus Holz – um den Hals und lasse die Bienen des Schwarms langsam auf mir Platz nehmen. Anfangs – als ich noch mit meinem Vater zusammenarbeitete – hatte ich es im Imkeranzug und mit Imkerhut gemacht, später dann – als mein Neffe Eugen mich jedes Jahr für vier Monate aus der Anstalt holte – begann ich es ohne Kopfschutz zu machen und zuletzt auch ohne T-Shirt. Das Kunststück funktioniert vor allem in der Schwarmzeit, wenn die Bienen mit der alten Königin ausziehen und sich vielleicht auf dem Ast eines Baums ganz in der Nähe niederlassen. Dort bilden sie einen großen wimmelnden Zapfen aus 10000 oder 20000 und mehr Bienen, unter denen sich die Königin befindet.
Als ich von der Schaukanzel über dem Steinbruch zurückkehrte, von der aus ich auf die von Nebeldunst förmlich zugeeist wirkende Landschaft geblickt hatte, entdeckte ich auf dem hohen Nussbaum neben dem Haus meines Neffen einen Bienenschwarm. Die Kinder und Jugendlichen aus dem SOS-Kinderdorf standen dort mit einer ihrer Betreuerinnen, die sie »Mama« nannten, und ließen sich erklären, was im Bienenuniversum gerade vor sich ging. Sie waren gerade an dem Punkt der Geschichte angelangt, wenn im Stock eine neue Königin geboren wird und vor allem die alte oder manchmal die neue mit der Hälfte des Schwarms auszieht und sich ein neues Quartier sucht. Ich holte sogleich die Leiter, die Schwarmkiste, die einen Henkel zum Halten und ein Flugloch hat, sowie einen zweiten Behälter, einen Wasserzerstäuber und einen Besen. Ja, ich wollte mich wichtigmachen. Für die alte Königin hatte ich einen Behälter in der Größe einer Zündholzschachtel bei mir, der am Deckel mit Draht vergittert war, damit sie atmen und ihr Volk sie riechen konnte. Ich trug auch die Schutzkleidung, die ich noch im Stall rasch angelegt hatte, kletterte auf die Leiter, sprühte Wasser auf die Bienen, damit sie sich enger zusammenzogen und nicht aufflogen, und schüttelte sie dann vom Ast in die Kiste, worauf ich sie noch einmal besprühte und die übrigen Insekten mit dem Besen in den anderen Behälter fegte. Sodann kletterte ich unter dem Applaus der Kinder und Jugendlichen wieder herunter und stellte die Bienen zuerst für zwei Stunden unter dem Baum ab, dann in den Keller ins Dunkle, um sie zu beruhigen. Die zwei Stunden, die sie unter dem Baum abgestellt waren, hatten die restlichen Bienen genutzt, um zurück zum Schwarm zu fliegen … Die übrigen zumindest zehntausend waren bereits der Königin gefolgt. Doch ich hatte vor, das »Bienenkunststück« zu zeigen und fütterte deshalb das Volk nachts im Keller mit Bienenhonig, um dem Schwarm die notwendige Nahrung zukommen zu lassen und ihn nicht in Unruhe zu versetzen.
Nachdem die Mitbewohner gerade aufgestanden waren, trug ich das Bienenmagazin mit dem Volk, das ich im Keller gefüttert hatte, zum Haus am Rand des Steinbruchs, wo auf halber Strecke die 46 Bienenkästen aufgestellt waren und fügte es mit einem Abstand dazu. Als Nächstes musste ich die Bienenkönigin finden. Ich hatte sie schon am Vortag auf dem Nussbaum gesehen. Schließlich nahm ich sie heraus und steckte sie in den kleinen Behälter, den ich zuvor mit einer dünnen Schnur versehen hatte, da ich ihn mir um den Hals binden musste. Übrigens trug ich jetzt den weißen Bienenmantel, nicht aber den Hut.
Ich kümmerte mich auch nicht darum, was die anderen im Augenblick machten. Immer schon will ich in Einklang mit mir selbst sein. Ich kann mich nicht verstellen, das ist der Grund, weshalb ich – wie man sagt – nicht »normal« bin. Ich lüge nur aus Angst oder um das zu schützen, woran ich glaube und was ich gerade tue. Auch, wenn ich versuche, mich zu erinnern. Andererseits falle ich leicht auf Lügen herein, da es mir fremd geblieben ist, in dieser Welt der Täuschungen zu leben. Ich bin nicht besser als die anderen, aber sie verunsichern, sie irritieren mich in meinem Befinden.
Ich legte den weißen Mantel und das T-Shirt ab und band mir, wie geplant, den kleinen Behälter mit der Bienenkönigin um den Hals. Dann öffnete ich das Magazin und wartete, bis die Insekten anfingen, sich auf mir niederzulassen. Es ist ein großartiges, ein phantastisches Gefühl, wenn sie sanft brummend ihrer Königin folgen und auf meiner nackten Haut leicht kitzelnd Platz nehmen, als kämen sie arglos auf Besuch. Natürlich sind es die Pheromone, die Geruchshormone der Bienenkönigin, die sie anziehen – der verlässlichste Mechanismus, den es gibt. Je mehr Bienen angeflogen kommen, desto beglückter fühle ich mich und desto introvertierter werde ich. Es wäre jetzt ungeschickt, würde ich mich bewegen, denn jede Hautfalte kann eine Biene irritieren, und sobald sie sich bedrängt fühlt, sticht sie. Nach dem Stich sondert das Insekt einen Duftstoff ab, der den Schwarm zum Stechen anregt. Sobald sich aber die Biene beim Stich in die Haut eines Menschen den Stachel ausgerissen hat, bewegt sich dieser noch selbständig weiter. Dadurch wird zusätzlich Gift aus der Giftblase in den Körper des vermeintlichen Widersachers gepumpt. Man kann nur versuchen, den Stachel wegzuwischen oder ein wenig herauszukratzen, andernfalls leert man die Giftblase zur Gänze in die Wunde. Da die Bienen klein sind, gelangt bei einem Stich nur sehr wenig von den giftigen Substanzen in den Menschen, aber in größerer Menge sind diese eines der tödlichsten Gifte der Tierwelt, nur vergleichbar mit denen der gefürchtetsten Schlangen. Ich habe Bienenstacheln bei meinem Neffen des Öfteren unter dem Mikroskop gesehen … ein Wunderwerk.
Plötzlich verschwinden alle Gedanken aus meinem Kopf, und ich werde zu einem Teil des Schwarms – das ist es auch, was ich beim »Bienenkunststück« erfahren will. Ein Summen umgibt mich, und da ich die Haare auf dem Kopf kurzgeschoren trage, bleiben auch keine Bienen darin hängen. Ich spüre nur die kühle Brise aus tausenden rasenden Flügelschlägen, jede Biene besitzt ja vier Flügel, die unfassbare 250 Mal in der Sekunde schlagen, also insgesamt 15000 Mal in der Minute. Ihre Augen haben übrigens eine andere Farbwahrnehmung als die der Menschen – sie sehen statt Rot Schwarz, können dafür aber ultraviolettes Licht erkennen und sich am Tag auch ohne Sonnenlicht, das heißt bei bedecktem Himmel, orientieren. Blüten sind für sie von anderer Farbe als für Menschen, vor allem sind sie deutlicher gemustert. Das Weiß, das sie erkennen, ist ein anderes als »unseres«. All das geht mir jetzt durch den Kopf, auch dass ihr Gehirn rund tausendmal kleiner ist als das menschliche. Auf eine nahezu körperlose Weise umarmt mich »der Bien«. Ich fühle seine unzähligen Beinchen – da jede Biene über vier verfügt, sind es jetzt zumindest 40000, die ich als kitzelnden Flaum empfinde. Das ist phantastisch, als berührte mich ein Geister- oder Seelenwesen. Dann spüre ich, wie ich immer kleiner und kleiner werde, bis ich die Größe einer Biene annehme und selbst zum Teil des Biens werde. Es geht mit einem Gefühl der Schwerelosigkeit und der Selbstvergessenheit einher. Und jetzt verstehe ich, was sie sprechen.
»Wer bist du?«, fragt eine Arbeitsbiene.
»Ich bin ein Mensch, der zur Biene geworden ist«, gebe ich in Gedanken zurück.
»Pass auf die Wächterinnen auf, sie stechen dich.«
Im nächsten Augenblick senkt sich eine auf den Kopf gestellte Pyramide über die Biene und verschluckt sie. Jetzt erst erkenne ich, dass es der Schnabel eines Vogels ist, der sich anschickt, auch mich zu verschlingen. Ich springe reflexartig zur Seite, aber dadurch habe ich mich bewegt und bin wieder ein menschlicher Körper geworden und so groß wie zuvor. Gleichzeitig spüre ich den ersten Bienenstich unter dem Arm, ich strecke mich durch, und während ich meine Oberarme hebe, um keine weitere Biene einzuklemmen und noch einmal gestochen zu werden, fällt mir auf, dass ich schon über und über mit Bienen bedeckt bin. Sogar auf meinem Gesicht haben sie Platz genommen, und bevor ich die Augen schließe, sehe ich aus der Ferne die Kinder, den Arzt und die Ärztin, mehrere Patienten aus der Anstalt, den Pfleger und die Krankenschwester, die mich erschrocken beobachten. Gerade als ich Stich um Stich spüre, sehe ich meinen Neffen auf mich zulaufen. Ich zeige meinen Schmerz nicht. Ich spüre, wie Eugen mir den schachtelförmigen Behälter mit der Königin vom Hals löst und ihr ein Teil der Bienen in das Magazin folgt, der übrige Schwarm mich aber weiter und weiter sticht. Noch immer bleibe ich ruhig, obwohl mich die Stiche im Gesicht und am Hals treffen, so dass ich glaube, den Schmerz nicht mehr zu ertragen. Doch widerstehe ich ihm zu meinem eigenen Erstaunen, während Eugen die Bienen mit nackten Händen von mir herunterkehrt, ohne dabei ein Wort zu sprechen. Ich stehe jetzt bewegungslos da. Die kühle Luft über meinem Kopf ist verschwunden. Dann begreife ich plötzlich, warum ich alles mit mir geschehen lasse … Ich kann nicht anders. Meine Lippen und Augen sind verschwollen, der Schmerz ist unbeschreiblich … als hätte ich keine Haut mehr.
»Komm!«, flüstert Eugen, nimmt mich bei der Hand und führt mich in sein Haus. Der Weg dorthin erscheint unendlich lang, und während ich gehe, wird er länger und länger, bis ich schließlich nur noch SCHMERZ bin … Im Haus ist es so dunkel, dass ich mich in nichts, in ein abstraktes Todesgefühl auflöse. Stimmen stellen Fragen, die ich nicht beantworte.
Eine Zeitlang lebe ich im Eis … für einen Moment nehme ich wahr, dass mir mein Neffe eine kalte Flasche Wein aus dem Keller aufgelegt hat und mich mit einem Desinfektionsspray und einer Salbe behandelt – zuletzt mit einem Hydrocortison-Präparat. Das Entfernen der Stacheln mit der Pinzette hat er längst aufgegeben, weil, wie er mir später erklärte, das gesamte Gift bereits in meinem Körper gewesen sei. Als sich Hautstellen entzündeten und anschwollen und ich Fieber bekam, verabreichte er mir Antibiotika.
Zehn Tage verharrte ich im Zwischenreich von Schmerzen, Halbschlaf und Erinnerung … Zuerst noch in einem gewaltigen Eisblock … ich sah mich von außen in ihm … er war riesig, ich sah darin aus wie eine Fliege in einem sechsstöckigen Gebäude. Mein Kopf betäubte mich mit rasenden Bildern, die ich mich später bemühte in Aufzeichnungen festzuhalten.
Vorwort: Gedichte
Wenn ich die Leere in mir überwinden will, überlasse ich es meinem Gehirn, Bilder zu entwerfen, und ich warte darauf, dass sie sich verwandeln, eines aus dem anderen … zuerst denke ich an ein Blatt, an die Taste eines Klaviers, an einen Briefbeschwerer aus Glas, das eine Blume umhüllt, an einen alten Schuh, der zu sprechen beginnt, eine Raupe, einen Schmetterling, eine Vogelfeder, ein Spielzeug, an Wolken, an eine Schere, einen Hut, bis sich die Bilder von selbst verwandeln. Langsam entstehen Buchstaben und Wörter in meinem Kopf, nein, in meinem Unbewussten, wie Oberarzt Brantner mir immer wieder erklärt, die ich dann – wie gesagt, um die Leere, die Einsamkeit, die Angst in mir zu überwinden – aufschreibe. Vor allem verbiete ich mir, den Aufzeichnungen einen Sinn zu geben. Ich kümmere mich nur um die Sprachbilder. Sie erinnern mich an die sinnentleerte Welt, das sinnentleerte Dasein, denen ich ausgesetzt bin. Ja, ich werfe die Sprache wie früher mein Spielzeug in die Badewanne, zünde Zeitungsseiten an, werfe sie weg, verbrenne sie, lasse sie aus dem vierten Stock auf die Straße fallen oder schütte sie wie die Eheringe meiner verstorbenen Großeltern in den Ausguss – dann erst bin ich bei mir selbst.
Gedichte I
Aus: »Sprachbilder«
Wolken leuchten, und der Wind spielt ein wirres Notenmosaik aus Tschaikowskys Melodien.
Auf der Suche nach Schönheit begegnest du nicht einem Menschen.
Die Dorfbewohner sind an ihren Worten erfroren.
Bienen seien die Erythrozyten der Luft, sagen die Imker.
Weingärten hingegen grünblaue Lavaströme.
Ein Regenschirm fliegt die Straße hinunter. (Gestern noch lag er zusammengefaltet am Ufer des Flusses.)
Das Muster eines Schneckenhauses durchzieht in Wellenform den Fischteich.
Tischladen voller Spielkarten.
War es ein Bussard? Eine Eidechse? Ein Sumpfkäfer?
Verrostete Flugzeuge und Autokarosserien, verrostete Fahrräder, leere, verfallene Häuser.
Eis kracht wie ein zerbrechender Menschenknochen.
Nur die Spinne schreibt das geometrische Gebet.
Angst malt Fresken in den Köpfen.
Der perlenförmige Froschlaich schmückt den Hals der Braut.
Imker rauchen Tannenzapfen und trinken.
»Tiere sind Menschen«, wiederholt der Chor der Bienen, wie im griechischen Drama.
Wer nicht lesen kann, stirbt.
Haben die Tauben Kopfschmerzen?
Leise spotten die Motten.
Der Holzbalken im Schlafzimmer sieht alles.
Die Kloake des Vergessens.
Die Gebetsmühlen des Alltags zermahlen das Märchen des Todes.
Alte Träume von alten Eseln.
Es gibt keine Jahreszeiten.
Sobald die Gedanken auf dem Kopf stehen, wird das Leben leichter.
Nur das Widersprüchliche ist wahr.
Jeden Tag lösen sich Prophezeiungen in nichts auf.
Die Stunden sind Kakteenstacheln.
Jeder nimmt sich jeden Tag das Leben.
Die Wochen sind Schaukelpferde, die Momente drehen sich wie Ringelspiele, die Jahre verschwinden im Bungee-Jumping der Zeit.
Der Leiterwagen rollt durch den Laubsturm aus Bibelseiten.
Gelbe Bleistifte auf dem Fußboden der Bäckerei.
Nirgendwo Blut.
Die Fingerabdrücke der Toten werden sichtbar.
Das Unbewusste der Erde offenbart sich im Schnee.
Nirgendwo Glück.
Alle Wolken bestehen aus Fliegen.
Der Wald verfügt über magnetische Kräfte.
Ein Elsternflügel im Moos.
Das riesige Spielzeuggeschäft – von Ameisen überflutet.
Schaufenster ohne Scheiben.
Die vom gehäuteten Hasen blutige Zeitung.
»Niemand ist schuldig!«, ruft der Konditor.
»Alle sind schuldig!«, verkündet der Landarzt, bevor er sich in Luft auflöst.
Die heilige Stille gibt das Rauschen des Wasserfalls preis.
Beim nächsten Atemzug bleiben die Uhren stehen.
Ein Apfel mit einem Gebiss.
Das Feuer strömt am Himmel.
Woher kommt der Gesang des Heuschreckenschwarms?
Pilze verstopfen die Ohren der Bäume, bis diese allmählich ertauben.
Schon bewegt sich der Erdboden, schon verlieren die Vögel alle Federn, schon kriechen Fische an Land, schon beginnen die Steine zu sprechen.
Der gelbschwarze Postautobus verrottet im Steinbruch.
In den Schultaschen verschimmeln die Liederbücher.
Am Ufer des Flusses ist ein Dampfer angeschwemmt.
Aale schwimmen in der Kombüse.
Ich verstehe die Sprache der Tiere.
Gedanken genügen, um Fragen zu stellen.
Selbst Dinge melden sich zu Wort.
Eine Fischotterin treibt auf dem Rücken im Wasser, ihr Junges, das auf ihrem Bauch liegt, liebkosend.
Krokusse wachsen auf dem Dach, Primeln auf der Brücke, Schneeglöckchen im Eisenbahnzug.
Ein Hund mit blauen Tintenpfoten.
Der Schornstein der Fabrik versinkt im Sumpf.
Wer die Welt verflucht, wird selbst zur Welt.
Das ewige Echo verstummt.
Die Verdoppelung durch den Spiegel ist Träumen im Wachsein.
Ein Unglück – bunt wie das Gefieder des Grünspechtes.
Der Überlebende stirbt vor der brennenden Volksschule.
Wer mit dem Spazierstock geht, spürt die Drehung der Erde.
Die Weintraube ist der Globus der Trinker.
Buchstaben werden zu Kieselsteinen.
Das Verzeihen verzeiht nicht das Nichtverzeihen.
Wer die Welt liebt, kann fliegen.
Rasch ist der Gelehrte ein Dummkopf.
Das All der Bienen benötigt keinen Menschen.
Was der Sterbende träumt, bleibt sein Geheimnis.
Sobald der See zugefroren ist, lachen die Käfer.
Unterwegs verwandelt sich die Torte in eine Zigarrenkiste.
Im Briefkasten wartet die Schlange.
Selbst das Kreischen der Möwen verhallt in den Ohren der Touristen.
Im leeren Kinosaal erwacht der Taschendieb.
Die Straßen sind voll lärmender Tausendfüßler.
Auf der toten Kinoleinwand zeigen sich erste Urinflecken.
Lilien und Erdbeeren übersetzen das tragische Gekeife in Zaubersprüche.
Aus dem Zapfhahn fliegt eine Amsel.
Alle Vorhänge wölben sich, wenn Seerosen nach Afrika fliegen.
Die Heldensagen der Pantoffeltiere.
Als dem Greis der Flugdrachen entgleitet, stürzt am Matterhorn ein Basstrompeter in den Tod.
Pferdemist heilt Zahnschmerzen.
»Ich habe das Wasser nie verstanden«, notiert der Schuldirektor auf dem Spaziergang und stolpert.
Schmetterlinge? In der Luft hüpfende Blumen.
Unter den Baumrinden die Skelettskizzen von Borkenkäfern.
Ein Schwein frisst Orchideen im verwilderten Glashaus.
Über dem Kopf des Kochs schwebt der Schatten des Adlers.
Die Gedankenwelt ist eine Korallenküste.
Bei Gewitter und Schneefall kräht der Hahn des Nachbarn.
Gleichgültigkeit hält alles im Gleichgewicht, selbst wenn es das Gleichgewicht verliert.
»Macht euch die Erde untertan«, sprach Jesus in der Wüste, die Pygmäen im Dschungel verstanden ihn nicht.
In den Holzsärgen werden Träume bestattet.
Alle Pflaumen weinen am Nachmittag.
Der U-Bahn-Tunnel ist gefüllt mit Tannenzapfen.
Sie fanden die Kuckucksuhr im Bestattungsinstitut.
Wer als Kind nicht lügt, scheitert.
Bäume blühen im Winter, wenn es Palmkätzchen schneit.
Der Apotheker hasst Abhörwanzen.
Ein Saxophonist geigt vom Kirchturm Flötentöne.
Der Liebhaber küsst im Trüben.
Schon wird der Igel zur Sonne.
Nur Formulare bleiben übrig.
Anstelle von Lokomotiven werden Heuwagen angekuppelt.
In den Vogeleiern nisten Flöhe.
Stirbt ein Fotograf, erwachen die Bilder, stirbt er nicht, bleichen sie aus.
»Dich hat der Mohn ausgespuckt!«
Wenn es dämmert, zeigen sich als Menschen maskierte Tiere.
Niemand ist verlassener als der Hausschuh.
Ein Kleiderhaus für Verstorbene.
Vogelfutter dient den Banken als Goldbarren.
Fossilien sind die Wertpapiere der Eisenbahner.
Als Münzen werden Trachtenhüte fabriziert.
Vermisste suchen Vermisste, bis sie selbst vermisst werden.
Reden ist Gold, Schweigen Blech.
Die Patronen in Füllfedern musizieren wie Orgelpfeifen.
Das Setzen von Kirschbäumen ist Wünschelrutengängern vorbehalten.
Am Tag sind die Geister Blätter.
Das Notizbuch löst sich im Seewasser auf.
»Schmerz« heißt ein Glied der Heuschrecke.
Nachdem der Wohnwagen aufgebrochen war, stürmte die Polizei ins Freie.
Alle Chinesen zitieren die Sprichwörter der Zitronen.
Im Beichtstuhl werden die Volksmärchen gedruckt.
Einschusslöcher in der Badewanne beweisen, dass der Täter unschuldig ist.
Jedes Haus birgt Geheimnisse, jedes Schiff, jeder Garten, jedes Automobil, jedes Kloster, jede Kaserne, jede Schule, jedes Krankenhaus, jede …
Der Kerzenleuchter aus Kupfer wird als Bierkrug verwendet.
Engel sind die Farnmuster auf vereisten Fenstern.
Dämonen der rote Rost auf Eisen.
Der Friseur tätowiert das Gehirn der Kundin.
Schon sprießen Löwenzähne aus ihrem Kopf.
»Wir müssen alle Fingernägel ziehen«, ordnet die Zahnärztin an.
Die narkotisierten Schwertlilien kommen zu sich, wenn sie das Wort »Notdurft« hören.
»Sobald du das hundertste Lebensjahr erreichst, wirst du Opernsänger«, prophezeit die Wahrsagerin dem Briefträger.
Aus dem Wachs der Bienenstöcke werden Urinale geformt.
Die Ehre des Großgrundbesitzers wurde abgeschnitten und zu Sauerkraut verarbeitet.
Das geblümte Speiseservice verdorrt, selbst das Düngen hilft nicht mehr.
Wenn ein Kind Ministrant werden will, schluckt es eine Nuss.
Am Auferstehungstag wird gebratene Katze serviert.
Wer jünger aussehen will, muss die Volksschule wiederholen.
Haufen leerer Konservendosen bedecken den Friedhof.
Die Zimmer malen sich selbst mit Schimmelflecken aus.