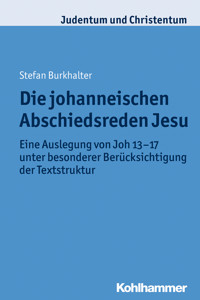
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Abschied ist ein selbstverständliches Element und Thema menschlicher Existenz. Ist der vom Evangelisten Johannes beschriebene Abschied ebenfalls ein ganz und gar menschlicher Abschied? Wer ist dieser Sich-Verabschiedende überhaupt, von dem es heißt, er habe die Seinen bis ans Ende geliebt (13,1), und was bedeutet dies alles für die Zurückbleibenden? Die vorliegende Arbeit versucht diese und ähnliche Fragen auf der Basis einer synchronen Lektüre bzw. literarisch-rhetorischen Analyse des Textes von Joh 13-17 zu beantworten. Die eruierte chiastische und konzentrische Struktur von Joh 13-17 (mit dem Zentrum 15,1-17) wird sodann inhaltlich wie auch hinsichtlich der narrativen Leserlenkung des Evangeliums interpretiert und kommentiert. Das "Annehmen" und "Bleiben" der Jünger in Jesus, was missionarischen Ertrag ermöglicht, wird so zur zentralen Aussage der Abschiedsreden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 760
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Abschied ist ein selbstverständliches Element und Thema menschlicher Existenz. Ist der vom Evangelisten Johannes beschriebene Abschied ebenfalls ein ganz und gar menschlicher Abschied? Wer ist dieser Sich-Verabschiedende überhaupt, von dem es heißt, er habe die Seinen bis ans Ende geliebt (13,1), und was bedeutet dies alles für die Zurückbleibenden? Die vorliegende Arbeit versucht diese und ähnliche Fragen auf der Basis einer synchronen Lektüre bzw. literarisch-rhetorischen Analyse des Textes von Joh 13-17 zu beantworten. Die eruierte chiastische und konzentrische Struktur von Joh 13-17 (mit dem Zentrum 15,1-17) wird sodann inhaltlich wie auch hinsichtlich der narrativen Leserlenkung des Evangeliums interpretiert und kommentiert. Das 'Annehmen' und 'Bleiben' der Jünger in Jesus, was missionarischen Ertrag ermöglicht, wird so zur zentralen Aussage der Abschiedsreden.
Dr. Stefan Burkhalter ist Pfarrer in Basel.
Judentum und Christentum
herausgegeben von Ekkehard W. Stegemann
Band 20
Stefan Burkhalter
Die johanneischen Abschiedsreden Jesu
Eine Auslegung von Joh 13-17 unter besonderer Berücksichtigung der Textstruktur
Verlag W. Kohlhammer
Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehn. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehn. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben zuströmt Kraft und Lebenssaft.
Karl Johann Philipp Spitta (1801–1859), 1833 (Evangelisch-reformiertes Gesangbuch 693,1)
Alle Rechte vorbehalten © 2014 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Reproduktionsvorlage: Andrea Siebert, Neuendettelsau Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
Print: 978-3-17-023263-1
E-Book-Formate
pdf:
epub:
978-3-17-025354-4
mobi:
978-3-17-025355-1
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Teil I: Hinführung
I. Thematik, Methodik und Aufbau der Arbeit
II. Eine erste Orientierung über Joh 13–17
1. Abgrenzung und Kontext der Texteinheit
2. Textanalyse zwischen diachroner und synchroner Betrachtungsweise – ein forschungsgeschichtlicher Überblick zu Joh 13–17: Die Krise der Literarkritik, Relecture und Réécriture
Exkurs: Narrative Exegese und die Ausweitung des exegetischen Methodenkanons
3. Wiederholung als literarische Technik: Antike Rhetorik und neuere synchrone Lesarten und ihre Gliederungsvorschläge zu Joh 13–17
4. Zwischenbemerkungen zum weiteren Vorgehen
5. Ein erstes Lesen von Joh 13–17 und erste Beobachtungen zur hier vorgeschlagenen synchronen Lesart
6. These: Konzentrische Struktur (Fünf Themenblöcke mit dem Zentrum F)
III. Joh 13–17 als literarisches Kunstwerk – Analyse der Textblöcke
1. Die Beziehungen der sich entsprechenden Themenblöcke – Kohärenz durch Analogie bzw. durch Variation
1.1 Vergleich von A und A’ (13,1–35 und 17,1–26)
1.2 Vergleich von B und B’ (13,36–38 und 16,29–33)
1.3 Vergleich von C und C’ (14,1–14 und 16,16–28)
1.4 Vergleich von D und D’ (14,15–26 und 16,4b–15)
1.5 Vergleich von E und E’ (14,27–31 und 15,18–16,4a)
2. Die sprachliche Einheit F (15,1–17) – Das formale und thematische Zentrum
IV. Zur Botschaft von Joh 13–17: Die sich entsprechenden Redeeinheiten als Kommentare zum amplifikatorischen Zentrum F (15,1–17), insbesondere zu 15,8
1. Wie sich die Verherrlichung des Vaters zunächst verwirklicht und manifestiert: Jesus als Hauptakteur in A und A’
2. Was die Verherrlichung des Vaters gefährdet: Die Rede von der Verantwortung der Jünger in B und B’
3. Der Initiant, die tragende Mitte und das Ziel von allem: Der Vater in C und C’
4. Die nachösterliche Realität und Manifestation der Herrlichkeit des Vaters in der Welt: Der Paraklet als Hauptakteur in D und D’
5. Was das Verherrlichungswerk gefährden kann: Die Welt in E und E’
V. Besonderheiten johanneischer Hermeneutik
1. Joh 13–17 als Akt der Einweihung unter Freunden
Exkurs: Joh 9,1–41
2. Teilhabe an bzw. Verähnlichung mit Gott
Teil II: Inhaltlich-kommentierende Darlegung zu Joh 13–17
Übersicht zur konzentrischen Struktur von Joh 13–17
I. Die Selbsthingabe Jesu bei der Fusswaschung als Akt der Konstitution von und als Vorbild für die Gemeinschaft – Joh 13,1–35 (Einheit A)
1. Abgrenzung, Kohäsion und Kohärenz, Gliederung
2. Die Stunde – Überschrift (13,1)
3. Die Macht des Teufels und das Zeichen der vollendeten Liebe Jesu (13,2–5)
4. Dreifaches Unverständnis des Petrus – Das Waschen der Füsse als Urgrund und Keim der Gemeinschaft (13,6–11)
5. Der Dienst des Füssewaschens als Beispiel zur Nachahmung (13,12–17)
6. Das Wissen Jesu um die Schrift und der Glaube an ihn – Überleitung zur Verratsszene (13,18–20)
7. Judas, der Verräter (13,21–30)
8. Verherrlichung, Abschied und das neue Gebot (13,31–35)
II. Der Hochmut des Petrus als innere Bedrohung für die Gemeinschaft – 13,36–38 (Einheit B)
1. Abgrenzung, Kohäsion und Kohärenz, Gliederung
2. Kein bleibender Abschied (13,36)
3. Ansage der Verleugnung des Petrus (13,37–38)
III. Der durch Jesu Zeugnis geoffenbarte Vater als Initiant, Ursprung und Ziel von allem – 14,1–14 (Einheit C)
1. Abgrenzung, Kohäsion und Kohärenz, Gliederung
2. Der Glaube an Gott, den Vater und den Sohn (14,1)
3. Der Ort/das Haus des Vaters (14,2–4)
4. Der Weg zum Vater (14,5–7)
Exkurs: Joh 14,6 als Midrasch von Ps 119
5. Das Erkennen/Sehen des Vaters (14,8–9)
6. Die Werke des Vaters (14,10–12)
7. Das Bitten des Vaters im Namen Jesu (14,13–14)
IV. Die nachösterliche Manifestation und Verwirklichung der Gemeinschaft als ein Wirken des Parakleten in den Jüngern – 14,15–26 (Einheit D)
1. Abgrenzung, Kohäsion und Kohärenz, Gliederung
2. Die Verbindung zu Jesus geht weiter: Die Sendung des Parakleten (14,15–20)
3. Die Unterscheidung zwischen Jüngern und Welt im Offenbarungswirken des Parakleten (14,21–24a)
4. Das Lehr- und Mahnamt des Parakleten (14,24b–26)
Exkurs: Die Beziehung von Vater, Sohn, Heiligem Geist und Jünger und das Buch der Weisheit 398
V. Der Fürst der Welt als äussere Bedrohung für die Gemeinschaft und die Selbsthingabe Jesu – 14,27–31 (Einheit E)
1. Abgrenzung, Kohäsion und Kohärenz, Gliederung
2. Der Friede Jesu und die Welt (14,27)
3. Abschied aus der Welt (14,28–29)
4. Der Fürst der Welt kommt! (14,30–31)
Exkurs: 14,31 – ein literarischer Bruch?
VI. Das gemeinschaftliche, fruchtbringende und den Vater verherrlichende Leben im Weinberg – 15,1–17 (Zentrum F)
1. Abgrenzung, Kohäsion und Kohärenz, Gliederung
2. Der wahre Weinstock und der Weinbauer (15,1–3)
3. Das Tun der Reben bzw. der Jünger: in Jesus bleiben! (15,4–8)
4. Das Tun der Reben bzw. der Jünger: In der Liebe bleiben! (15,9–17)
Exkurs: „Frucht“ im Johannes-Evangelium
5. Grundthesen zu Joh 15,1–17
VII. Die Bedrohungen der Welt und das Zeugnis der mit Jesus in Gemeinschaft stehenden Jünger – 15,18–16,4a (Einheit E’)
1. Abgrenzung, Kohäsion und Kohärenz, Gliederung
2. Der Hass der Welt gegenüber Jesus und seinen Jüngern (15,18–21)
3. Über die Welt (15,22–25)
4. Der Geist der Wahrheit als Beistand (15,26–27)
5. Der Ausschluss aus der Synagoge (16,1–4a)
VIII. Das nachösterliche Wirken des Parakleten gegenüber der Welt und in den Jüngern – 16,4b–15 (Einheit D’)
1. Abgrenzung, Kohäsion und Kohärenz, Gliederung
2. Die Sendung des Parakleten nach Jesu Weggang (16,4b–7)
3. Das Werk des Parakleten an der Welt: Dem Verlorenen nachgehend (16,8–11)
4. Das Werk des Parakleten in den Jüngern: In die Wahrheit leiten (16,12–15)
IX. Der Weg zur vollständigen Offenbarung des Vaters – 16,16–28 (Einheit C’)
1. Abgrenzung, Kohäsion und Kohärenz, Gliederung
2. Die „kleine Weile“ bis zu Jesu Weggehen zum Vater und die „kleine Weile“ bis zum Wiedersehen (16,16–19)
3. Die Trauer der Frau bis zum Tag der Freude und der Erfüllung (16,20–23a)
4. Das Bitten des Vaters im Namen Jesu (16,23b–24)
Exkurs: Joh 4 und Joh 16
5. Die Stunde der neuen Unmittelbarkeit zum Vater (16,25–28)
X. Die Selbstüberschätzung und Unwissenheit der Jünger als innere Bedrohung für die Gemeinschaft – 16,29–32 (Einheit B’)
1. Abgrenzung, Kohäsion und Kohärenz, Gliederung
2. Der „grosse“ Glaube der Jünger und die Ansage der Zerstreuung (16,29–32)
3. Trost (16,33)
XI. Jesu Fürbitte als Manifestation des Willens zur und Verwirklichung von Gemeinschaft – 17,1–26 (Einheit A’)
1. Abgrenzung, Kohäsion und Kohärenz, Gliederung
2. Jesu Bitte für den Weinstock (17,1–5)
2.1 Das Kommen der Stunde, Bitte um Verherrlichung (17,1)
2.1.1 Die Werke der Verherrlichung von Vater und Sohn (17,2)
2.1.2 Das Ziel: Verherrlichung des Vaters und des Sohnes durch die Glaubenden (17,3)
2.1.3 Die Werke der Verherrlichung von Vater und Sohn (17,4)
2.2 Bitte um Präexistenz-Herrlichkeit (17,5)
3. Jesu Bitte für die Reben des Weinstocks (17,6–19)
3.1 Ich habe deinen Namen offenbart und sie haben dein Wort bewahrt (17,6–8)
3.2 Die eigentliche Bitte (17,9–19)
3.2.1 Bewahre sie in deinem Namen, damit sie eins sind (17,9–13)
Exkurs: Verwendung von „Welt“ in Joh 17
3.2.2 Heilige sie in der Wahrheit (17,14–19)
Exkurs: Jesus und die Braut (Ezechiel 16)
4. Jesu Bitte für die Früchte des Weinstocks (17,20–23)
5. Jesu Bitte um bleibende Verbundenheit (17,24)
6. Das einigende Band der Liebe (17,25–26)
Teil III: Gedanken zum historischen Ort des Johannes-Evangeliums
I. Verschiedene Diskussionsbeiträge
II. Hinweise auf die Situation der johanneischen Gemeinde aufgrund der Lektüre von Joh 13–17
1. Die äussere Bedrohung der Gemeinschaft und die Antwort darauf
2. Die innere Bedrohung der Gemeinschaft und die Antwort darauf
3. Resümee
Teil IV: Ausblick
I. Ein „Profil“ des impliziten Autors: Künstler, Seelenleiter und Ehrenmann
II. Die durch das konzentrische Gefüge von Joh 13–17 implizierte Textstrategie bzw. Aussageabsicht
1. Die Bedeutung der Rahmung: Joh 13,1–35 (A) und Joh 17 (A’)
1.1 Das „Voraus“ Gottes als Ermöglichungsgrund von Leben
1.2 Plädoyer für eine Theologie der Annahme
2. Das Zentrum Joh 15,1–17 (F)
2.1 Innige Gemeinschaft und Einssein mit Gott als Ziel der Weltgeschichte
2.2 Menschliche Verantwortung: Bleiben!
2.3 Sammeln von Frucht zum ewigen Leben
Anhang
I. Übersicht zur Struktur von Joh 13–17
II. Chronologie zu Joh 12–21: „Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt!“ (Joh 1,29)
Literaturverzeichnis
Bibelstellenregister
Vorwort
Die vorliegende Arbeit wurde im Herbst 2010 von der Theologischen Fakultät der Universität Basel als Dissertationsschrift angenommen und danach für die Drucklegung geringfügig überarbeitet.
Viele haben dazu beigetragen, dass die Arbeit entstehen konnte.
Allen voran danke ich meiner Frau Christine für die Freistellung und die ungezählten Ermutigungen, die ich durch sie erfahren habe.
Dem Betreuer, Prof. Dr. Ekkehard Stegemann, schulde ich durch vielfache Anregungen und durch sein kompetentes und liebevolles Begleiten grossen Dank. Ebenso danke ich dem Zweitgutachter, Prof. Dr. Peter Wick, für die intensiven und hilfreichen Gespräche sowie sein durchgängiges Wohlwollen.
Ein herzlicher Dank geht an die Theodor Engelmann-Stiftung (Basel) und an die Elisabeth Jenny-Stiftung (Basel) für ihre finanzielle Unterstützung.
Der Theologischen Fakultät der Universtität Basel, insbesondere Prof. Dr. Alfred Bodenheimer, Prof. Dr. Albrecht Grözinger und Prof. Dr. Hanspeter Mathys bringe ich meinen Dank für die freundliche Unterstützung und das speditive Abwickeln des Promotionsverfahrens entgegen.
Ein herzlicher Dank geht auch an Herrn Jürgen Schneider und an Frau Julia Zubcic vom Kohlhammer Verlag für die Betreuung dieses Buchprojektes.
Für Kritik und Ermunterung in Wort und Schrift sowie für ihr fürbittendes Gebet bin ich der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde St. Jakob Basel dankbar, insbesondere Edgar Flückiger und dem Vereinsvorstand St. Jakob, sowie Simon Ganther und Georg Krayer von der Münstergemeinde und Hans Eberhard, meinem treuen Freund.
Bei der mühsamen Arbeit des Korrekturlesens haben Frau Franziska Bevilacqua, Herr Pfr. Patrick Moser, Herr Pfr. Johannes Huber, Herr Dr. Philipp August und vor allem Pfr. Dr. Reiner Andreas Neuschäfer grossartige Arbeit geleistet.
Meinen vier Kindern Timon, Janis, David und Rahel sei dieses Buch gewidmet. An ihnen wurde mir in dankbarer Erinnerung immer wieder vor Augen geführt, dass man „Frucht“ eben nicht machen, sondern sich nur schenken lassen kann.
Basel, im Sommer 2013
Stefan Markus Burkhalter
Teil I: Hinführung
I. Thematik, Methodik und Aufbau der Arbeit
Der hier in Betracht kommende Textabschnitt aus der Bibel handelt im Wesentlichen von einem Abschied. Dies verrät nicht nur der Titel, mit dem Joh 13–17 in der Bibelübersetzung nach Luther (1984) überschrieben ist („Jesu Abschiedsreden“), sondern auch schon der erste und damit programmatische Vers von Kapitel 13.1 Abschied ist ein selbstverständliches Element und Thema menschlicher Existenz. Kein Wunder also, dass auch Johann Wolfgang Goethe in einem seiner Sesenheimer Lieder darüber gedichtet hat: In „Willkommen und Abschied“2 (erstmals 1775) beschreibt er die aufgewühlte Stimmung und den Wechsel von Freude und Schmerz der Liebenden, der für die Situation des Abschieds bezeichnend ist. Das Gedicht endet mit den Worten:
Ich ging, du standst und sahst zur Erden
Und sahst mir nach mit nassem Blick:
Und doch, welch Glück, geliebt zu werden!
Und lieben, Götter, welch ein Glück!
Der hier nahezu poetisch vollkommen ausgedrückte Wechsel sowie die Spannung von Freude und Schmerz klingt auch in der in Joh 13–17 beschriebenen Abschiedssituation an, sodass sich insbesondere zwei Fragen aufdrängen: ist dieser vom Evangelisten Johannes beschriebene Abschied ebenfalls ein ganz und gar menschlicher Abschied? Und: wer ist dieser Sich-Verabschiedende überhaupt, von dem es heisst, er habe die Seinen bis ans Ende geliebt (13,1)? Für einen grossen Teil des Volkes scheint – nach dem Bericht des Evangelisten – festgestanden zu haben: wäre Jesus tatsächlich von Gott, wäre Jesus tatsächlich der Christus bzw. der Messias, dann würde er sich nicht verabschieden, sondern für ewig bei ihnen bleiben (vgl. 12,34). Mit dieser Argumentation drückt das Volk zweifelsohne vor allem Unmut und Unverständnis gegenüber dem Zeugnis Jesu vom Vater und dessen Liebe aus. Denn: wie kann dieser liebende Vater und sein Gesandter es nun in seiner erlösungsbedürftigen Existenz allein lassen?
Auch eine heutige Lesergemeinde steht in dieser Spannung des leiblich absenten Jesus und der Sehnsucht nach der Verwirklichung der schon vor Zeiten verheissenen ewigen Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch (vgl. Ps 89,37; Ez 37,25) und fragt sich: inwiefern kann Gott der Liebende sein, wenn er doch immer wieder so fern erscheint? Und: was bedeutet es, wenn Jesus sagt, er wolle den Seinen ganz nah, ja in ihnen sein (vgl. 14,20 u.a.)?
Im Blick auf das Selbstverständnis der Kirche stellen sich mit dem Abschied Jesu existentielle Fragen, deren Antwortmöglichkeiten im Textabschnitt angebahnt werden.
Während einzelne Sätze und Verse aus dem Abschnitt Joh 13–17 einen sehr hohen Bekanntheitsgrad im Herzen und in der Sprache christlicher Frömmigkeit gefunden haben (14,2; 15,5.13; 17,21 u.a.), gehört Joh 13–17 als gedankliches Ganzes wohl „zu den unbekanntesten und besonders schwer zugänglichen Teilen des Neuen Testaments und des Johannesevangeliums“3. Manche Ausleger reden sogar von einer offensichtlichen „Wirkungslosigkeit“4 dieses Textabschnittes – dies vor allem in Anbetracht und im Vergleich zu der immensen Wirkungsgeschichte anderer biblischer Texte (etwa der Bergpredigt). Bedenkt man die durch die Abschiedssituation in Joh 13–17 evozierte Bedeutsamkeit und Aktualität der behandelten Themen, ist solch ein Urteil allemal erstaunlich.
Wer nach einer Erklärung für diese „Fremdheit“ und „Bedeutungslosigkeit“ sucht, sieht sich alsbald mit der Klage über die komplizierten und sprachlich verschlungenen Argumentationsgänge, d.h. die meditativ-kreisende, sich oft wiederholende und „tänzelnde“ Denkweise konfrontiert und vielleicht auch mit der über die im Gegensatz zu den Synoptikern schwerer zugängliche logische Stringenz des Johannes-Evangeliums.5 Dieser in gewissen Punkten sicherlich nachvollziehbaren Einschätzung korrespondiert alsbald die Frage, ob die Jetztgestalt von Joh 13–17 auch ihre Erstgestalt war oder ob dieser Abschnitt (bzw. das ganze Evangelium) nicht einem komplizierten und vielschichtigen Entstehungsprozess ausgesetzt war.6 Nicht wenige urteilen, dass es sich bei Joh 13–17 kaum um einen in sich stimmigen Gesamtzusammenhang handeln kann, in dem ein Element aus dem anderen herauswächst, ein Gedanke zwingend in den anderen übergeht.7
Demgegenüber ist die vorliegende Arbeit der Versuch, Joh 13–17 als gedankliches Ganzes zu lesen und zu verstehen. Damit werden Beobachtungen von sogenannten Spannungen, Stilbrüchen, Wiederholungen und Leerstellen nicht vorab – wie zumeist in historisch-kritischen Fragestellungen – als Hinweise auf die Entstehungsgeschichte des Textes gelesen, sondern vielmehr wahrgenommen als Aufforderung an den Leser, diese in einem engagierten und kreativen Leseakt aufzunehmen, vermeintliche Widersprüche aufzulösen und somit die Kohärenz des Textes sinnvoll zu wahren. Dies geschieht in der Hoffnung, den vorliegenden Text und seine Strukturen selber zum Sprechen zu bringen, damit sich so der „Schleier der Unnahbarkeit“ lüfte.
Damit steht die vorliegende Untersuchung des Textes methodisch in der Tradition einer synchronen Betrachtungsweise. Das heisst genauerhin, dass der ganze Abschnitt Joh 13–17 zunächst auf textinterne Bezüge, seien sie syntaktischer, semantischer und stilistischer oder thematischer Art, zu befragen ist. Diese Vorgehensweise steht in einem direkten Zusammenhang mit dem aus der Literaturwissenschaft stammenden Ansatz der sogenannten narrativen Analyse, welcher in jüngster Zeit in den Blickpunkt neutestamentlicher Exegese gerückt ist.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























