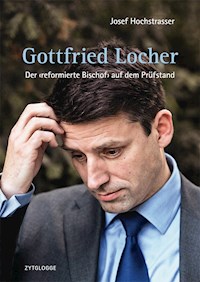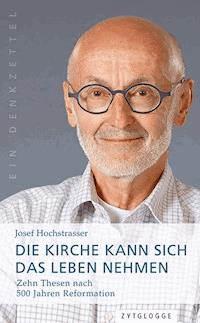
15,50 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
- Der streitbare Pfarrer Josef Hochstrasser zur Lage der Kirchen - Zehn scharf formulierte Thesen für einen lebendigen Glauben - Plädoyer für eine aktive Jesusbewegung Römisch-katholische Kirche, evangelisch-reformierte Kirche, christkatholische Kirche, unabhängige Kirchen, Lutherische Kirchen, Freikirchen, russisch-orthodoxe und weitere Ostkirchen – diese Liste liesse sich noch ewig fortsetzen. Und selbst wenn man sich auf die drei erstgenannten Konfessionen beschränkt, die auf kantonaler Ebene in der Schweiz anerkannten Landeskirchen, wüsste Jesus, würde er heute leben, mit Sicherheit nicht, welcher dieser Kirchen er sich denn zugehörig fühlen sollte. Jesus hat einen einfachen, demokratischen und damit revolutionären Glauben an eine gerechte Welt vorgelebt und kein überreguliertes Theoriegebäude im Sinn gehabt. Heute laufen den Kirchen die Mitglieder scharenweise davon. Das ist nur konsequent, stellt Pfarrer Josef Hochstrasser fest. Anlässlich von 500 Jahren Reformation geht er in zehn pointierten Thesen mit den Kirchen hart ins Gericht. Er möchte eine Debatte anzetteln, um den christlichen Glauben wieder mit Leben zu füllen und die Kirchen, so es diese in Zukunft denn noch brauchen sollte, wieder mit Menschen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 80
Ähnliche
JOSEF HOCHSTRASSER
DIE KIRCHE KANN SICH DAS LEBEN NEHMEN
Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016–2020 unterstützt.
© 2017 Zytglogge Verlag AG, Basel
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Thomas Gierl
Coverbild: Foto Jung, Sursee
Gesetzt aus: Frutiger LT Std, Garamond Premier Pro, Palatino LT Std
Gesamtherstellung: Schwabe AG, Druckerei, Muttenz/Basel
ISBN (ePUB) 978-3-7296-2166-4
ISBN (mobi) 978-3-7296-2167-1
www.zytglogge.ch
Inhalt
Warum ich dieses Buch geschrieben habe
Zur Sache: meine ‹zehn Thesen›
1. Die Kirchen predigen leere Inhalte in leeren Räumen.
2. Die Kirchen erwarten, dass die Gläubigen zu ihnen kommen.
3. Die Kirchen ignorieren den wahren Gehalt der Bibel.
4. Die Kirchen ersticken mit ihren Strukturen das Leben.
5. Die Kirchen betreiben eine Politik der Ab- und Ausgrenzung.
6. Die Kirchen verharren im Klassendenken.
7. Die Kirchen verhindern die Glaubensentfaltung.
8. Die Kirchen vernachlässigen die Jugend.
9. Die Kirchen verfügen über zu viel Reichtum.
10. Die Kirchen haben aufgehört, Menschen gewinnen zu wollen.
Langer Rede kurzer Sinn: meine ‹zehn Gebote›
Über das Buch
Über den Autor
Warum ich dieses Buch geschrieben habe
Ich mag sie beide, die katholische und die reformierte Kirche, und ich habe ihnen sehr viel zu verdanken.
Die katholische Kirche fasziniert mich noch heute. Für ein ‹Salve Regina›, gesungen von Benediktinermönchen, gehe ich weite Wege. Eine lateinische Messe? Ich habe keine Berührungsängste. Sollten Sie jetzt entsetzt feststellen: Der ist ja konservativ! Kein Problem. Mir tun sich bei einer traditionellen katholischen Messe ganze Horizonte auf. Eine mystische Erfahrung, wie sie mir als kleinem Messdiener morgens um sechs Uhr in der Kirche von Ebikon noch und noch widerfuhr. Der erstmalige Gang zur Kommunion steht stellvertretend für all die vielen katholischen Festtage, die meine Seele tief berührten – und es heute noch tun.
Lange habe ich es nicht für möglich gehalten, einst reformierter Pfarrer zu sein. Die Amtsenthebung als katholischer Priester hat den Anstoss gegeben, diesen Schritt zu prüfen. Dann habe ihn gewagt – und gewonnen. Mich endlich auf mein Gewissen berufen zu dürfen, empfand ich als unschätzbare Bereicherung. Kein Bischof mehr. Kein Pflichtzölibat. Kein Kadavergehorsam. Nicht länger mehr intellektuelle Verbiegungen vor blutleeren Dogmen. Die reformierte Kirche hat meinen Geist aus dem Gefängnis der Denkverbote befreit – und liesse mich dennoch emotional darben, träfe ich anlässlich der Gottesdienste, die ich als Stellvertreter in Steinhausen leite, nicht interessierte und herzliche Menschen.
Die beiden Kirchenerfahrungen aber glichen einem Blatt, das der Herbstwind vom Baum reisst und in der Luft herumwirbelt, wäre da nicht einer, der Kirchen und Institutionen weit übersteigt: Jesus von Nazareth. Er steht für Halt und Orientierung. In meinen Augen ist er einer der grössten Humanisten der Weltgeschichte. Es ärgert mich, dass er derart wenig Beachtung findet. Die Kirchen verehren ihn zwar. Ihre Beteuerungen sind aber nicht mehr als Lippenbekenntnisse. Kirchenobere verharmlosen die gesellschaftskritische Praxis des Nazareners oft sträflich. Mit einem ungefährlichen Jesus haben sie ihre Schafe besser im Griff. Evangelikale entschärfen ihn mit Hallelujagesängen. Zu Kirchenfernen und Atheisten dringt sein humanistisches Programm erst gar nicht mehr durch.
Es ärgert mich, was vorgebliche Nachfolger des Mannes aus Nazareth aus ihm gemacht haben. Sie haben ihn von der Erde in den Himmel weggelobt und sich selbst an seine Stelle gesetzt. Jesus musste die Eliminierung Andersdenkender legitimieren, für Herrschaft herhalten, Weltflucht gutheissen, Pate stehen für die Geringschätzung der Frau. Seine Stellvertreter verwischten die pointierten Ideen aus Nazareth bis zur Unkenntlichkeit.
Fast noch mehr aber bedaure ich, dass Jesu Impulse für eine lebenswerte Welt bei Menschen am Rande der Kirchen und erst recht bei kirchenfernen Menschen schlicht nicht mehr bekannt sind. Die Welt leidet aktuell unter Terror, krankt an Orientierungslosigkeit, Armut und einem unglaublichen Unvermögen, Beziehungen zu führen. Und was machen die Kirchen? Sie betreiben weitgehend Nabelschau. Sie beschäftigen sich mit ihren Strukturen und der Sorge um die eigene Existenz.
Da wäre aber dieser charismatische jüdische Wanderprediger mit seinen konstruktiven, ewig gültigen Impulsen, ein Mann des Friedens, einer mit tiefsinnigen psychologischen Kenntnissen, ein Kämpfer für eine gerechte Gesellschaft. Warum nur interessiert sich niemand für ihn?
Mit diesem Buch möchte ich den Kirchenleuten einen Denkzettel verpassen. Ich tue das mit ‹zehn Thesen›, an die ich ‹zehn Gebote› anschliesse. Aber ich tue dies mit Respekt vor der Kirche und in der Hoffnung auf eine engagierte öffentliche Auseinandersetzung. Genauso sehr liegt mir daran, durch alle Widerstände hindurch Kirchenferne dazu zu bewegen, sich die heilsame Lebensbewältigung eines Jesus von Nazareth anzuschauen und ihr eine Chance zu geben.
Oberentfelden, 18. Februar 2017
Zur Sache: meine ‹Zehn Thesen›
1. Die Kirchen predigen leere Inhalte in leeren Räumen.
Alles begann mit dem Sohn eines Zimmermanns aus dem unbedeutenden Dorf Nazareth in Galiläa. Jeschua war sein Name. Er war Jude, noch jung, keine dreissig. Aber er wirbelte die Gesellschaft Palästinas mächtig auf. Es ging ihm nicht bloss um Klamauk. Das Goldene Zeitalter des Friedens, von Kaiser Augustus vollmundig ausgerufen, sah er ganz anders. Nicht römische Soldatenstiefel konnten den Menschen ein würdiges Leben bescheren, glaubte der junge Jude Jesus. Er hatte eine andere Idee: Kein einziger Mensch soll über andere herrschen. Alle sind Brüder und Schwestern. Keine Macht. Für niemanden.
Doch eine solche Idee durfte nicht Schule machen, nicht in den Augen der römischen Besatzungsmacht mit Sitz in Caesarea, auch nicht für einige jüdische Glaubensbrüder des Nazareners, die am Gesetz des Mose kein Iota verändern wollten. Für seinen Glauben an einen menschenfreundlichen Gott und an eine gerechte Weltordnung bezahlte Jesus mit dem Leben. Die Römer packten ihn und machten kurzen Prozess mit ihm, wie mit so manchem, der ihrem Weltbild zu gefährlich wurde. Damit glaubten sie, den kleinen Fisch dieser jüdischen Sekte erledigt zu haben. Die Römer täuschten sich gewaltig.
Das Gerücht ging um, er lebe. Man munkelte, er habe sich mit gewissen Anhängern zum Essen getroffen …
Natürlich endete das Martyrium für Jesus tödlich. Der junge Jude starb und verweste im Grab wie jeder andere Mensch auch. Jetzt nahmen ein paar Frauen und Männer das Zepter in die Hand und schworen auf den Versuch, so zu leben wie ihr Freund Jeschua. Später gaben sie ihrem Start in eine neue Lebensvision den Namen Ostern.
Der Rest ist Geschichte: Die Jesusbewegung schlug ein. Sie war erfolgreich, lebte ein klares Profil, führte das revolutionäre Programm des verstorbenen Jesus weiter, liess sich vom Glauben an einen befreienden Gott beflügeln, verschaffte Ausgegrenzten eine Heimat. Ihre Botschaft war nicht irgendeine Theorie, sondern die Strahlkraft der Praxis. Damit punkteten sie bei suchenden Menschen. Das faszinierte und überzeugte diese.
Bald stand die noch junge Jesusbewegung vor einer ersten Zerreissprobe. Zwar kannten die Apostel Jesus noch persönlich. Doch ihr Meister war tot, und es stand eine heikle Entscheidung an: Sollten Heiden, die Christen werden wollten, erst das jüdische Gesetz annehmen, oder durften sie ohne diesen Umweg direkt Christen werden? Wer sollte wissen können, wie Jesus in dieser Frage entschieden hätte? Wer war befugt, in seinem Namen ein abschliessendes Urteil zu fällen?
In ihrer Begeisterung hatten die ersten Anhänger ihrem verehrten Jesus einen Ehrentitel verliehen. ‹Christos› nannten sie ihn, den Gesalbten, wie man im alten Israel auch die grossen Könige David und Salomon bezeichnet hatte. Sie selbst verstanden sich folglich als Christen. Das waren aber nach den Aposteln allesamt Leute, die Jesus nicht mehr persönlich kennengelernt hatten. Um wen ging es denn nun, um den historischen Jesus oder um Christus, die spätere Deutung Jesu? Gefahr war im Anzug. Der geschichtliche Jesus begann, im Nebel der Vergangenheit zu verschwinden. Innerhalb der Gemeinschaft der Gläubigen taten sich Meinungsführer hervor, erlangten Deutungshoheit. Sie lobten Jesus weg von der Erde in den Himmel hinauf. Der Weg war nun frei, sich an seine Stelle zu setzen und aus seinem Leben eine Ideologie zu schaffen. Theologen erklärten fortan, wo es dogmatisch langgeht. Päpste regierten im Namen Gottes. Das Volk mutierte zur willenlosen Manövriermasse. Erste Ketzer bezahlten ihr eigenständiges Denken mit dem Leben. Die Organisation Kirche begann, das Kapital Jesu im vatikanischen Tresor einzusperren und den Schlüssel mit Argusaugen zu bewachen.
Martin Luther wollte der römischen Machtzentrale diese Schlüsselgewalt entziehen. Jeder Christ besitze schliesslich selbst einen Schlüssel zu Jesus, glaubte der Wittenberger. Er wurde exkommuniziert. Rund 500 Jahre zuvor schon balgten sich die lateinische Kirche Roms und die orthodoxe Kirche Konstantinopels um die Frage, wo das Zentrum der Christenheit liege. In den Augen Jesu ein Skandal, sich darum zu streiten. Im 18. und 19. Jahrhundert verlor vor allem die katholische Kirche erhebliche Teile der Intellektuellen und der Arbeiterklasse. Im letzten Jahrhundert verabschiedeten sich selbstbewusste Frauen ohne Zahl von der Kirche. Aktuell erleiden beide grossen Landeskirchen einen schmerzlichen Verlust von Mitgliedern. Im Kanton Basel-Stadt leben 45% der Einwohner ohne Konfession.
Säkulare Sturmwinde rütteln am weltanschaulichen Fundament des Abendlands. Der Lack seines christlichen Etiketts blättert ab. Die Kirchen verlieren an Einfluss. Ihre Stimme ist nur mehr eine unter vielen, wenn es darum geht, Probleme der Gesellschaft zu beurteilen und zu lösen. Die Deutungshoheit der drei Schweizer Landeskirchen ist vom Tisch. Da hilft auch keine Präambel der Bundesverfassung mehr. Welcher Schweizer besingt denn noch aus tiefstem Herzen den, der da im «Morgenrot daherkommt» und «ahnt mit seiner frommen Seele Gott im hehren Vaterland»? Seit den Zeiten von Al Qaida, der Taliban und des Islamischen Staates kommt Religion gesellschaftlich vollends in Verruf. Der aufgeklärte Europäer identifiziert sie mit Rückständigkeit. Falls Religion thematisiert wird, dann negativ. Die christlichen Kirchen sind nicht kräftig genug, dem durch fanatische Islamisten produzierten Zerrbild des Islam eine positive Strahlkraft der Religion entgegenzusetzen. Doch genau dies bleibt ihnen als einziger Weg, um aus dem gesellschaftlichen Abseits herauszutreten. Die Kirchen müssen zwei Eigenschaften mobilisieren, wollen sie eine Zukunft haben: Demut und Mut.