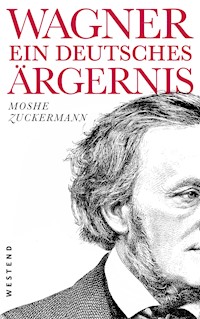16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Die Forderung nach einer freien und unabhängigen Kunst kennen wir seit dem 19. Jahrhundert. Dieses Streben nach Kunstautonomie fußt auf der Überzeugung, dass der Bereich des Ästhetischen eigenen Regeln folgt, dass Kunst frei sein muss von fremden Ansprüchen, seien diese politischer oder moralischer Natur. Heute scheint es nicht sonderlich gut um dieses Ideal bestellt: Stichworte wie ‚Cancel Culture' sowie die oft schrill geführten Debatten darüber, wer eigentlich noch etwas sagen oder zeigen darf, zeugen davon, dass die Autonomie der Kunst mehr denn je gefährdet ist. Kenntnisreich und mit stilistischer Brillanz zeichnet Moshe Zuckermann dieses Spannungsfeld nach. Er fragt nach dem Verhältnis von Kunst und Fortschritt, Politik, Elitarismus sowie kulturindustriellem Kitsch. Dabei steht nicht weniger auf dem Spiel als die Rettung der Kunstfreiheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 185
Ähnliche
Ebook Edition
Moshe Zuckermann
Die Kunst ist frei?
Eine Streitschrift für die Kunstautonomie
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-86489-879-2
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt / Main 2022
Umschlag: Buchgut, Berlin
Satz und Datenkonvertierung: Publikations Atelier, Dreieich
Inhalt
Titel
Vorwort
Kunstautonomie
Kunst und Progress
Konzeptkunst
Kunst und das Politische
»Hohe« und »niedrige« Kultur
Exkurs: Ästhetische Theorie
Kulturindustrie
Exkurs: Elitismus
Tod eines Sängers
Epilog
Orientierungspunkte
Titel
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Der Begriff der Kunstautonomie hat in den letzten Jahrzehnten seine Prominenz eingebüßt. Es will zuweilen scheinen, als hätten sich große Teile der Kunstsoziologie und -philosophie, aber auch die Kunstpraxis der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verschworen, um ihn endgültig zu desavouieren. Ich selbst habe vor etwa zwanzig Jahren von der sozialen Hintergehbarkeit des Kunstwerks gesprochen (»Kunst und Publikum. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner gesellschaftlichen Hintergehbarkeit«, 2002); schon damals ging es mir um eine beklagenswerte Diagnose des real Bestehenden, mithin um die zumindest theoretische Rettung der Kategorie der Kunstautonomie. Der vorliegende Band darf als ein neuerlicher Versuch in diesem diffizilen Unterfangen gesehen werden.
Theoretisch wissen sich meine Darlegungen dem Denken der Frankfurter Schule, allem voran dem Adornos, verschwistert. Entsprechend beginnt das Buch mit einer paradigmatischen Beleuchtung des Begriffs der Kunstautonomie, nicht zuletzt aber auch ihrer prästabilisierten Beziehung zum Fremdbestimmten. Folgerichtig befassen sich die dann folgenden Kapitel mit Problemen der Kunstimmanenz bzw. mit sozialen und kulturellen Elementen, die diese bedrohen. So setzt sich das zweite Kapitel mit den Kategorien Kunst und Progress auseinander. Gefragt wird darin, worin sich Fortschritt im Bereich der Kunst erweist, letztlich, ob es einen solchen überhaupt gibt. Dabei werden vor allem außerkünstlerische Belange ins Auge gefasst. Aber es stellt sich heraus, dass die Kunstimmanenz selbst in der Moderne einen Prozess durchlaufen hat, der prägende Auswirkungen auf die Kunstautonomie zeitigte. Dem ist das dritte Kapitel gewidmet, das sich mit Konzeptkunst, nicht zuletzt mit der Tendenz zur Selbstaufhebung von Kunst beschäftigt. Im vierten Kapitel wird Kunst und das Politische als zwei entgegengesetzte Kategorien vorgestellt, bei denen die Autonomie der Kunst die eine Seite und das Politische als das zutiefst Heteronome die andere abgeben. Zugleich aber wird auch die dichotome Gegenüberstellung beider Seiten relativiert. Fußend auf der bis dahin umrissenen Problematik der Kunstautonomie nimmt sich das fünfte Kapitel die Auseinandersetzung mit den Kategorien »hohe« und »niedrige« Kultur vor, wobei die Erörterung sich vor allem auf die sozial-kulturellen Entstehungszusammenhänge der normativen Wertungshierarchie konzentriert. Auch hier müssen die traditionellen Koordinaten dialektisch gefasst werden, denn die Moderne hat sie gründlich erschüttert und umdefiniert. Ein Exkurs über Adornos Ästhetische Theorie ist diesem Kapitel einverleibt. Im zentralen sechsten Kapitel des Bandes wird sodann Kulturindustrie als heteronomer Gegensatz par excellence der Kunstautonomie erörtert. Die sich dabei zunächst an Adornos Überlegungen zu dieser Kategorie orientierende Auffassung geht im zweiten Teil des Kapitels über diese hinaus und stellt eine mögliche Verbindung zu Strukturformen des Faschismus, mithin zur Wirkmächtigkeit des autoritären Charakters her. Ein Exkurs über Elitismus ist in dieses Kapitel integriert. Ein Fallbeispiel der in der populärkulturellen Sphäre wirkenden Mechanismen des autoritären Charakters wird im siebten Kapitel – Tod eines Sängers – anhand der Rezeption des Todes des israelischen Sängers Arik Einstein ideologiekritisch untersucht, dabei die sozialen und ethnischen Faktoren, die den Rezeptionsvorgang durchwirkten, anvisiert. Ein Epilog, der einen kurzen streifenden Blick auf den Begriff des Kitschs zum Inhalt hat, beschließt den Band.
Die in diesem Buch vorgelegten Erörterungen des Spannungsverhältnisses zwischen der Autonomie von Kunst und den diese Autonomie bedrohenden außerkünstlerischen Elementen erhebt nicht den Anspruch, dieses Grundproblem von Kunst im Kontext zu lösen. Fraglich, ob es sich überhaupt lösen lässt. Unannehmbar ist die völlige Verwerfung des Autonomiepostulats. Naiv die Vorstellung, dass das Postulat bereits den Autonomieerhalt und die Abwehr fremdbestimmter Einflüsse garantiere. Eher ist anzunehmen, dass es sich um eine Aporie handelt – ein im Wesen unlösbares Problem, das aber gerade in seinem Sosein den Kampf der Kunst um ihr Bestehen in »feindseligen« gesellschaftlichen und historischen Zusammenhängen immer wieder belebt, somit die eigentümliche Sonderstellung der Kunst in der Kultur zum Tragen bringt.
Moshe Zuckermann
April 2022
Kunstautonomie
Der Begriff der Kunstautonomie ist von gewisser Ambivalenz. Er verweist auf die Selbständigkeit der Kunst im Verhältnis zu dem, was außerhalb ihr liegt, muss aber zugleich in Kauf nehmen, das besagtes »außerhalb« stets auch ein (aktiver) Bestandteil der Kunst selber ist. Das gilt freilich für jegliche Autonomie als solche. Man kann ja nur im Verhältnis zu dem, wovon man sich unterscheidet, autonom sein; und das, wovon man sich unterscheidet, muss folglich begrifflicher Bestandteil dessen sein, was für autonom erachtet wird. Wozu denn sonst der Unterscheidungsakt und die Behauptung der Autonomie? Gleichwohl scheint dies den Anhängern des Begriffs der Kunstautonomie nicht genug zu sein. Sie insistieren auf die Rigorosität des Autonomiepostulats im spezifischen Fall der Kunst, wohingegen die Gegner des Begriffs bestrebt sind, seine Unhaltbarkeit nachzuweisen. Die im besagten dialektischen Verhältnis gründende Ambivalenz ist beiden Seiten unerträglich, weshalb sie auf ihre jeweiligen Grundannahmen bestehen, wohlwissend, dass diese – über die Problematik der Kunstautonomie hinaus – den Begriff der Kunst bestimmen.
Worum geht es hier? Im Allgemeinen – um die für die Erhaltung großer menschlicher Kollektive notwendigen Systeme, um die Strukturen, Institutionen und Apparaturen, die diese Kollektive und deren schiere Existenz garantieren. Und da Kunst ein historisches Erzeugnis menschlicher Kollektive ist, kann man sich nicht vorstellen, dass sie gegen die wesentlichen Einflüsse besagter Institutionen und Strukturen auf Entstehung, Inhalte und Ansprüche der Kunst immun sein könnte. Es geht primär um die Systeme der Religion, der Politik und der Wirtschaft, um die Gestalt der gesellschaftlichen Ordnung und deren Ausrichtung, welche entsprechend den Stand der Kunst in ihr entscheidend bestimmen. Die seit Urzeiten bestehende Einbettung der Kunst im religiösen Kult haben Forscher und Denker bereits im 19. Jahrhundert dargelegt. Man denke bloß an Nietzsches Erörterung der antiken dionysischen Kulte und die von ihm hervorgehobene Verschwisterung und gemeinsame Entwicklung der »absoluten Musik« und der »absoluten Mystik«. Nicht von ungefähr sah auch Walter Benjamin den »Kultwert« als Ausgangspunkt der über Jahrhunderte verlaufenden Entfaltung der Kunst zum »Ausstellungswert«. Im Grunde kann man sich die hervorragenden Manifestationen der christlichen europäischen Kunst in den Bereichen der Malerei, der Bildhauerei, der Musik, der Literatur und der Architektur ohne den entscheidenden institutionellen, inhaltlich normativen und ideologischen Einfluss der Religion auf sie gar nicht vorstellen. Dies hatte weitgehende politische und wirtschaftliche Auswirkungen – nicht nur, weil die christliche Kirche ab einem bestimmten Zeitpunkt im Mittelalter eine dominante politische und wirtschaftliche Macht darzustellen begann, eine Macht, die mit außerkirchlichen Mächten um den politisch-ideologischen und ökonomischen Vorrang der Herrschaft konkurrierte; auch nicht im allgemeinen Sinne, dass wirtschaftliche Macht seit jeher nicht zuletzt das Primat innehatte, die Koordinaten des gängigen Schönheitsdiskurses samt seiner künstlerischen Darstellungen zu bestimmen; sondern darüber hinaus auch im zweckgebundenen Sinne, demzufolge die wirtschaftlich-politisch Herrschenden in der Festlegung der ästhetischen Maßstäbe und der Adoption der Künste als deren kulturellen Medien ein ausgesprochenes Attribut ihrer exklusiven Distinktion von den (unkultivierten) Volkmassen sahen, das, was späterhin das kulturelle Kapital genannt werden wird, welches sozialen Status und verwertbare Macht in den Sphären Politik und Wirtschaft verleiht. Ein deutliches Echo dieser uralten Verbindung zwischen Kulturgütern und sozial-ökonomischer Macht findet sich noch im 19. Jahrhundert in der deutschen bürgerlichen Klassenparole »Besitz und Bildung«, mit der sich das Bürgertum sowohl vom traditionellen Adel, den es stürzen und beerben wollte, als auch von den Volksmassen, die es mit eigenen politischen und ökonomischen Bestrebungen bedrohte, zu unterscheiden trachtete. Der von der Aristokratie und dem infolge der industriellen Revolution aufsteigenden Bürgertum Britanniens zur eigenen Kennzeichnung verwendete Ausdruck »educated classes« widerspiegelt das gleiche Klassenphänomen. Letztendlich, so die tiefe Einsicht Norbert Elias’, lässt sich die fortwährende Verfeinerung der höfischen Kultur seit dem ausgehenden Mittelalter als Zivilisationsprozess mit prononciertem politischen Ziel deuten. Die höfische Kultur begann die kulturelle Verfeinerung, die sich für Elias in der »Triebregulierung« manifestierte (»Sublimierung« bei Freud), als herrschaftliche Tugend zu identifizieren – Zurückhaltung im Sinne von kühler Selbstbeherrschung wurde als notwendige Voraussetzung für Weitsicht, rationale Planung operativer Schritte und zweckgerichteter Manipulation von Gegnern erkannt, zugleich aber auch als Basis der Pflege guten (kulturellen) Geschmacks, erlesener Genussfähigkeit und verfeinerten ästhetischen Distinktionsvermögens.
Dies Wenige möge ausreichen, um zu indizieren, dass Kunst schon immer notwendig in außerkünstlerischen Kontexten eingebettet war. Das ist auch nicht zu bestreiten. Worauf basiert also das Postulat der Kunstautonomie? Warum weigert man sich zu akzeptieren, was anscheinend nicht infrage gestellt werden kann? Die Antwort darauf berührt gewisse Grundannahmen über das Wesen der Kunst. Akzeptiert man diese Grundannahmen nicht, ist es sinnlos, das Postulat der Kunstautonomie (was immer sie auch sei) überhaupt noch weiter zu erörtern.
Erstens: Im Gegensatz zur Ausrichtung der Welt auf die zunehmende Unterordnung von immer mehr Lebensbereichen unter das hermetische Diktat der instrumentellen Vernunft, mithin unter ein Zweckdenken, das von raffgieriger Profitmache und Kapitalakkumulation, von Macht und machtmotiviertem Einfluss angetrieben ist, begreift sich die Raison d’être der Kunst in der Verwirklichung ihres Selbstzwecks. Die Frage »Warum Kunst?« beantwortet sich mit der dezidierten Antwort »Um der Kunst willen« und nicht, um ein anderes, außerkünstlerisches Ziel zu verfolgen. »L’art pour l’art« deklarierte das französische Denken im 19. Jahrhundert, die Autonomie der Kunst definierend und ihren Geltungsbereich begrenzend (ehe es dieses Diktum selbst zur Ideologie verkommen ließ). So besehen, manifestiert sich der Zweck der Kunst – und darin eine wichtige Dimension ihres Wesens – in ihrer kategorischen Weigerung, sich fremdbestimmten Zwecken unterzuordnen, heteronomen Zielen, die ihre Autonomie zwangsläufig verraten.
Zweitens: Das Postulat der Kunstautonomie drückt sich nicht nur im ideal-utopischen Selbstverständnis der Kunst aus, sondern nicht minder auch in ihrer Praxis (zumindest in ihren großen Momenten, in denen es ihr gelingt, ihre ästhetischen Potentiale und erhabenen Versprechungen zu verwirklichen). Die spezifische Materialanordnung – die Komposition – ist ihr nicht nur als Technik, Methode oder Prozedur zu eigen, sondern vor allem als das, was ihr Wesen als schöpferischen Akt ausmacht, der einem eigenen System von Regeln, Gesetzen, Forderungen und Ansprüchen folgt, einem System, dessen Realisierung einzig der ihm eigenen inneren Logik gehorchen möchte. Das Fehlen von »Nutzen« im künstlerischen Erzeugnis verleiht dem (praktischen) schöpferischen Akt seinen Wert, mithin seine auratische Einzigartigkeit, die sich mit nichts anderem tauschen lässt. Denn es kann nicht getauscht werden, was sich im Selbstzweck und der diesen Selbstzweck generierenden Logik manifestiert.
Drittens: Die Verbindung der Definition der Kunstautonomie als Verweigerung außerkünstlerischer Einflüsse auf sie einerseits und als bedingungslose Unterwerfung unter die Diktatlogik der den Kunstakt konstituierenden Materialanordnung andererseits ist es, die der modernen Auffassung der Kunstautonomie als Hort eines utopisch-emanzipativen Horizonts zugrunde liegt. Diese emanzipative Dimension ist nicht als eine ihrer selbst bewussten Deklaration der Kunst zu verstehen, sondern sie ergibt sich aus ihrem schieren Stand als Gegenentwurf zur repressiven Lebensrealität, welche primär in den strukturellen Auswirkungen der instrumentellen Vernunft und entfremdeter Lebenspraxen (im Hinblick auf die freiheitliche Selbstbestimmung des Individuums) gründet. Dieser Stand der Kunst als Gegenentwurf erhält eine Art indirekter Bestätigung seitens ihrer Adressaten (Leser, Hörer, Zuschauer); darin vor allem lässt sich die emanzipative Dimension des Kunsterlebnisses erkennen. Denn im Kunsterlebnis des Rezipienten, mehr als in anderen gängigen Erlebnissen des Daseins, verkehrt sich das Verhältnis von Subjekt und Objekt.
Auszugehen ist dabei vom modernen Begriff des auf die Beherrschung des Objekts ausgerichteten Herrschaftssubjekts. Zum einen manifestiert sich die Herrschaft auf der kognitiv-perzeptuellen Ebene: Das Subjekt erfasst das Objekt kraft seiner Vernunft, konzeptualisiert, katalogisiert und subsumiert es einer Ordnung der Dinge, wie sie sich dem Subjekt anhand der sie arrangierenden Vernunftkategorien und seines sinnlichen sowie begrifflich-abstrakten Auffassungsvermögens darstellt. Das Geflecht der Vernunftkategorien, welches das Subjekt über die objektive Realität ausbreitet, um sie zu erfassen, verleiht ihm die Souveränität als Herrschaftssubjekt, als Herr dessen, was er seinen Bedürfnissen unterordnet. Zum anderen weist die Kategorie des Herrschaftssubjekts einen historisch-praktischen Aspekt auf: Die europäische Aufklärungsbewegung, die den vernunftbegabten Menschen ins Zentrum des Daseins gerückt hat, sah ihn nicht nur als Herrn seines Handelns und Schicksals an (wenn er sich nur als fähig erweist, sich des ihm zur Verfügung stehenden Vernunftpotentials zu bedienen, um seine Ziele zu planen und durchzuführen), sondern begriff ihn auch als Subjekt der Geschichte, mithin als Herrn der Zukunft des gesamten menschlichen Kollektivs. In dieser Kapazität erscheint das geschichtliche Herrschaftssubjekt als Herr eines jeglichen Objekts, das er sich unterzuordnen vermag – sei es die Natur, andere Menschen, gesellschaftliche und politische Gebilde oder den menschlichen Geist. Die Dialektik der Aufklärung bewundert das Vernunftvermögen des Menschen, erkennt in ihm aber auch ein immanentes repressives Element, welches sie scharf kritisiert. Den Konnex zwischen dem kognitiven Auffassungsvermögen und der physischen Herrschaft (samt der sich von diesem Konnex ableitenden repressiven Verhältnisse zwischen Subjekt und Objekt) indiziert im Deutschen die Nähe von »begreifen« und »greifen« wie im Englischen »to grasp« und »to catch«.
Im künstlerisch-ästhetischen Erlebnis ändert sich das Subjekt-Objekt-Verhältnis von Grund auf: Nicht das Subjekt beherrscht das Objekt, sondern das Objekt bemächtigt sich des Subjekts, und zwar als ein bewusster Willensakt des Subjekts – das menschliche Subjekt gibt sich dem Kunstobjekt hin und ist bereit, sich seiner Wirkungsmacht, gleichsam der »Autorität« seiner ästhetischen und geistigen Forderungen unterzuordnen. Was bei Immanuel Kant »interesseloses Wohlgefallen« genannt wird, fasst dies pointiert zusammen: Das Subjekt ist gefordert, sich jeglichen fremdbestimmten »Interesses« zu entledigen, das dem Akt der Hingabe ans Kunstwerk und dem Sichversenken in ihm als notwendige Bedingung für die Aufnahme von Inhalt und Schönheit des Werks hinderlich zu sein vermag. Die Selbstvergessenheit des Subjekts, welches seine perzeptuellen und intellektuellen Energien ganz auf den Kontakt mit dem Werk und der es konstituierenden inneren Logik richtet, bedeutet eine wesentliche Schwächung des das Herrschaftssubjekt antreibenden Repressiven. Und da der Akt der Hingabe sich freiwillig zuträgt, birgt er in sich auch etwas von jenem utopischen Gegenentwurf eines Erlebens, das auf dem intensiven Hinhorchen auf das Objekt und dem Bestreben einer immanenten Berührung mit ihm basiert und nicht mehr auf dem repressiven Impuls, es zu beherrschen. In Sprachgebilden wie »das Lied bewegt mich«, »der Tanz begeistert mich«, »die Musik erregt mich« oder »der Film stimmt mich traurig« hat sich diese eigentümliche Verkehrung des Subjekt-Objekt-Verhältnisses erhalten; in jedem dieser Sprachgebilde bewirkt das Kunstobjekt etwas im rezipierenden Subjekt – das Subjekt ist bar jeglicher Ambition, das Kunstobjekt zu beherrschen, im Gegenteil, es möchte einzig, dass das Objekt sich ihm gegenüber aktiviere, sich seiner bemächtige. Der Rezipient will nichts an dem von ihm betrachteten Rembrandt-Gemälde oder an der Beethoven-Sinfonie, die er hört, ändern. Wohl wahr, die Adressaten des Kunstwerks sind gefordert, das, was sie in der Hingabe ans Werk aufnehmen, zu dekodieren und zu deuten, aber der Deutungsakt vollzieht sich gemäß der inneren kompositorischen Logik des Werks und nicht heteronom. Die Autonomie des Werks erhält sich entsprechend auch dann, wenn es von den Rezipienten dekodiert und angeeignet wird.
Es erhebt sich also erneut die Frage: Wenn die Einbettung des Kunstwerks in außerkünstlerischen – sozialen, politischen und ökonomischen – Zusammenhängen nicht bezweifelt werden kann, die Kunst aber ihrerseits unentwegt auf das Postulat ihrer Autonomie insistiert, wie lassen sich diese widerstrebenden Momente miteinander vereinbaren? Kann man überhaupt von Kunstautonomie sprechen, wenn man bedenkt, dass die fremdbestimmte Wirkung besagter Zusammenhänge der Grundbedingung von Kunst immanent, mithin wesentlich unabdingbar ist? Kann man andererseits tatsächlich behaupten wollen, dass Kunst letztlich nichts sei als nur ein von vielen Anhängseln der großen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Systeme, welches sich letztlich ganz der diese Systeme antreibenden heteronomen Logik unterordne? Eine ernst zu nehmende Antwort auf diese Fragen weiß sich einem gewissen dialektischen »Kompromiss« verpflichtet, demzufolge von einer absoluten Autonomie der Kunst im Hinblick auf die heteronomen Kontexte ihrer Entstehung und Seins, ihrer Wirkung und Rezeption keine Rede sein kann; was aber nicht besagt, dass die Kunst trotz aller sie fremdbestimmt bedrohenden Kraftfelder nicht auch zugleich ein ausgeprägtes Moment der Autonomie bewahrt. Adorno, der den warenförmigen Tausch im Spätkapitalismus als krasseste Manifestation der zwischen den Menschen herrschenden Entfremdung (und der Heteronomie ihres gesellschaftlichen Daseins) ansah, hat dies in aphoristischer Dichte formuliert, als er davon sprach, dass das Kunstwerk zwar immer schon Ware, aber nie nur Ware gewesen sei.
In ihren außerkünstlerischen Zusammenhängen zeichnet sich Kunst in der Tat durch einen Doppelcharakter aus. Zum einen fungiert Kunst, die in der Gesellschaft entsteht und sich auf diese bezieht, in jeder Hinsicht als soziale Institution – sie befindet sich nicht außerhalb der Gesellschaft, auch nicht außerhalb der Geschichte. Insofern sie nun aber diese Grundtatsache »verleugnet«, was durchaus ihrem künstlichen Wesen entspricht (»künstlich« leitet sich im Deutschen ja von »Kunst« ab, wie »artificial« von »art« im Englischen), wenn sie also als Schein erscheint, als täuschende Illusion, »betrügt« Kunst in Bezug auf das gesellschaftlich real Existierende, was ihr im Hinblick auf das Dasein des Menschen zwangsläufig eine ideologische Dimension verleiht. Andererseits erweist sich die Einzigartigkeit von Kunst, mithin ihre besondere Macht gerade in jener Dimension, die sie unter einem anderen Aspekt ideologisch werden lässt: Ihr Künstliches ermöglicht es ihr, kraft der Wirkmacht der Phantasie und der Vorstellungskraft die Grenzen des konkret Bestehenden zu überschreiten, soziale Konventionen zu unterwandern, gängige perzeptuelle Normen bewusst zu irritieren und so einen (scheinbar akzeptierten) Gegenentwurf zum Bestehenden, eine utopische Antithese zu repressiven Strukturen der Realität zu schaffen, eine Sphäre der Freiheit, deren Durchbrechung des konkret Gegebenen und allgemein Akzeptierten ihr Autonomes ausmacht. Der Begriff »Schein« indiziert diese widersprüchliche Doppelbedeutung: Der Ausdruck »schöner Schein« enthält ein pejoratives Element des Trügerischen und ideologisch Irreführenden. »Vorschein« – ein Begriff, dessen sich Ernst Bloch in der Fundierung der Stellung von Kunst innerhalb seiner Emanzipationsphilosophie bediente – verweist hingegen auf das in der Kunst sich manifestierende utopische Moment einer gleichsam kurz aufscheinenden Zukunftsbotschaft, die in sich das Potential eines gesellschaftlich befreiten Daseins des Menschen und die ihn zu dessen Erkämpfung antreibende Hoffnung birgt.
So besehen, besteht beispielsweise kein Widerspruch zwischen der Stellung Goyas als Hofmaler, der sich verpflichtet sah, die repräsentativen Portraits der königlichen Familie und des spanischen Hofadels zu malen, und der ästhetischen Autonomie, die er sich zum Ziel gesetzt und im Werk verwirklicht hat. Ein kurzer Blick auf das Kollektivportrait der »Familie Karls IV.« von 1801 reicht hin, um zu verstehen, was ein zeitgenössischer Kritiker damit meinte, der König und seine Frau sähen aus »wie ein Bäcker und seine Gemahlin nach einem Lotteriegewinn«; umso erstaunlicher, dass die Auftraggeber selbst offenbar mit dem Resultat des Repräsentationsaktes zufrieden waren. Man mag daraus folgern, dass eine immanente Reaktion auf das autonome Kunstwerk und eine heteronome Bezugnahme auf ebendiese Dimension sich nicht zwangsläufig gegenseitig ausschließen. So lässt sich etwa die Entwicklung der klassischen Sinfonie von Haydn über Mozart bis Beethoven verfolgen und entdecken, dass eine allmähliche Metamorphose in der Form des dritten Satzes dieses musikalischen Genres stattgefunden hat: von der Menuett-Form in einem beträchtlichen Teil der Sinfonien Haydns zur Scherzo-Form in Beethovens Sinfonien. Eine angemessene immanente Analyse dieser Entwicklung würde eine Erörterung der Funktion, die das Menuett bzw. das Scherzo in der Gesamtform des Werks erfüllt, erfordern, wobei die formalen Veränderungen der Gesamtform zu eruieren wären, mithin die des sinfonischen Genres insgesamt. Eine kontextuell-heteronome Erklärung der Entwicklung der sinfonischen Form könnte sich hingegen auf die historische Dimension der Metamorphose einlassen und feststellen, dass sie in einer Zeit gravierender politischer und sozialer Umbrüche stattgefunden habe – im Zeitalter der Französischen Revolution. In seiner Stellung als Hofkomponist beim Fürsten Esterházy steckte Haydn noch mit einem Bein im feudal-aristokratischen Zeitalter; Beethoven hingegen, erklärter Anhänger der Französischen Revolution und ihrer Aufklärungsideale, war bereits den Prinzipien der heranwachsenden bürgerlichen Gesellschaft verhaftet. Und weil das Menuett seinen historischen Ursprung in der Sphäre von Hof und Adel hatte, die ihm seinen kulturellen Stand als ausgesprochen aristokratischen Tanz verlieh, verwundert es nicht, dass Beethoven ihn aus dem Bereich der Sinfonie »vertrieb« – parallel zum Niedergang des Ancien Régimes und der revolutionären Vertreibung des Adels von der Geschichtsbühne. Eine musikologische Erklärung dieser Art basiert auf der Annahme, dass außerkünstlerische Faktoren einen entscheidenden Einfluss auf formale Veränderungen im Rahmen der Entwicklung von Kunstgenres ausgeübt haben. Vermag dies das Postulat der Kunstautonomie wesentlich zu erschüttern? Ja und nein. Ja – weil die (halb)-bewusste Erwägung, die Veränderung herbeizuführen, in der Tat von einer dem Kunstwerk äußerlichen Entwicklung herrührt, und zwar umso mehr, als die Gewalt, die jene geschichtliche Entwicklung generierte, der Veränderung im künstlerischen Bereich eine Dimension von Notwendigkeit verlieh. Nein – weil die Materialanordnung (des Scherzos) letztlich nicht aktiv beeinflusst ist von der Absage an die alternative Form (des Menuetts). In jedem Fall bereichert zwar das Wissen um die historische Metamorphose, die der dritte Satz der klassischen Sinfonie durchlaufen hat, das Verständnis der Formentwicklung der Sinfonie bei Beethoven und seinen Nachfolgern, aber auf keinen Fall bildet es eine notwendige Bedingung für die Rezeption des Werks und die Verinnerlichung seiner ästhetischen Werte.