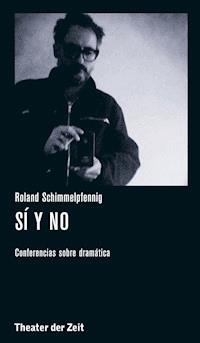18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Ein schneller, sehnsüchtiger Trip durch unsere chaotische Gegenwart Berlin, Görlitzer Park: Im Landwehrkanal treibt eine tote junge Frau im weißen Brautkleid. Woher kommt sie? Wie heißt sie? Der suspendierte Drogenermittler Tommy sucht im Berlin der Clubs und kriminellen Clans nach der Geschichte der Frau. Auf seiner Odyssee durch die Stadt begegnet er Überlebenskünstlern und Kämpfern, Verlorenen und Gestrandeten aus aller Welt: vom japanischen Tattoo-Meister bis zur indischen Feuerspuckerin. Hellwach und todmüde, zwischen Traum und Wirklichkeit taucht Tommy immer tiefer in die Berliner Unterwelt und in die eigene Vergangenheit ein. Ein ebenso harter wie gefühlvoller Roman, der von der Zerbrechlichkeit des Lebens und unserer Sehnsucht nach Gemeinschaft erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 196
Ähnliche
Roland Schimmelpfennig
Die Linie zwischen Tag und Nacht
Roman
Roman
FISCHER E-Books
Sie trieb in ihrem weißen Brautkleid auf dem grünen Wasser des Kanals, die junge Frau trieb auf dem Rücken, und sie hatte Rosen im Haar. Sie sah in den Himmel.
Es war ein kalter Tag im Frühling, und trotzdem tanzte die ganze Stadt.
Erster Mai, Berlin, Techno.
Zwei Helikopter kreisten über dem Görlitzer Park, aber die beiden Helikopter flogen viel zu dicht beieinander, was, wenn sie sich berührten, was, wenn sie vom Himmel in die tanzende Menge stürzten?
Vielleicht waren es aber auch gar nicht zwei Helikopter, die da oben über uns kreisten, vielleicht war es nur ein Helikopter, es bestand die Möglichkeit, dass ich doppelt sah, denn ich war seit mehr als vierundzwanzig Stunden wach.
Neben mir am Kanal tanzten eine kolumbianische Zeichnerin und ein kroatischer Dachdecker und eine portugiesische Kellnerin und ein syrischer Informatiker und ein indisches Mädchen mit schwarzblau geschminkten Augen, das Feuer spucken konnte, und ein sehr großer und sehr dünner, bärtiger Russe, der sich als Mystiker bezeichnete. Ich kannte nur den Russen, Ivan.
Alle waren hellwach und gleichzeitig todmüde, und alle teilten miteinander, was sie hatten: Kokain, MDMA, Ketamin, Speed, Bier und Wodka.
Die Sonne war eine silberne Scheibe, und ich frage mich, wie das sein konnte, es war, als habe sich der Mond in den Tag verirrt.
Ich sah die junge Frau in dem Brautkleid, die auf dem Wasser trieb, und ich dachte, alles ist richtig, und alles ist falsch. In einem Baum drehte sich eine Disco-Kugel.
Früher einmal hatte ich selbst da oben gesessen, in dem Helikopter am Himmel über der Stadt, über dem Park, über dem Kanal, und ich weiß, was man von da oben mit der Kamera sieht: alles und nichts. Du siehst nichts außer einer Masse von Leuten, die sich mitten am Tag am Rand des Kanals zu elektronischer Musik bewegt, aber die Musik kannst du da oben in dem kreisenden Helikopter nicht hören, weil der Motorenlärm viel zu laut ist.
Die junge Frau in dem Brautkleid trieb auf dem Rücken den Kanal entlang und sah in den Himmel.
Dann setzte sich ein Vogel auf ihre Brust und pickte an ihr herum, aber außer mir schien niemand das Mädchen und den Vogel zu sehen. All die Raver am Ufer und auf der schmalen, übervollen Brücke über dem Kanal tanzten weiter, als sei alles wie immer.
Berlin hat mehr Brücken als Venedig, hatte Csaba einmal gesagt, und Gianni hatte die Augen verdreht.
– Was soll das schon sein, die Unendlichkeit?, sagte der kroatische Dachdecker zu dem russischen Mystiker, nichts ist unendlich, das weiß jedes Kind, und dabei ging ein weißes Pulver herum.
Hallo Helikopter.
Hallo Venedig.
– Alles hat einen Anfang und ein Ende, sagte der Kroate.
– Wenn alles einen Anfang und ein Ende hat, dann gibt es keine Unendlichkeit, sagte der syrische Informatiker. Aber die Unendlichkeit gibt es. Sie ist eine Reihe von Zahlen.
– Die Unendlichkeit ist ein Kreis, sagte der Mystiker.
– Die Unendlichkeit ist eine Linie, sagte die Portugiesin.
– Sieht denn keiner den Vogel?, sagte ich, und das indische Mädchen fragte, was für ein Vogel, welcher Vogel?, und dann wechselte die kolumbianische Zeichnerin das Thema, kennt jemand die Geschichte von dem Vogel und der Schlange?, nein, sagte der Syrer, aber kennt jemand die Geschichte von der Biene und dem Wal?, und dabei saß der Vogel weiter auf der Brust des Mädchens in dem Brautkleid. Das indische Mädchen mit den blauschwarz geschminkten Augen nahm meine Hände.
Ruft jemand die Polizei?, wollte ich sagen, ruft denn niemand die Polizei, und dann dachte ich, die Polizei ist hier doch überall, ich bin doch selbst Polizist, aber ich war kein Polizist mehr.
Ich war dreiundzwanzig Jahre lang Polizist gewesen, aber jetzt war ich kein Polizist mehr, ich wartete auf meinen Prozess.
Ist jemand hier ein Rettungsschwimmer?, dachte ich.
– Spring nicht, sagte die indische Feuerspuckerin, die ich erst ein paar Stunden vorher in der Morgendämmerung unter der Eisenbahnbrücke am Holzmarkt kennengelernt hatte, spring nicht, und dabei hielt sie mich weiter an den Händen.
Ich zog meine Sachen aus und sprang in den Kanal.
Das Wasser war eiskalt.
Die junge Frau sah in den Himmel und blinzelte nicht ein einziges Mal, als ich sie aus dem Wasser zog.
Sie war tot.
Ihr Brautkleid verrutschte, und ich sah ein Tattoo auf ihrer linken Schulter, eine Kornblume.
Die Musik hatte nicht aufgehört, die Discokugel in dem Baum drehte sich immer weiter, alles tanzte, die tote Frau in dem Brautkleid lag jetzt im Gras neben dem Kanal, der Helikopter stand tosend genau über uns, und die Sirene eines Krankenwagens drang durch die Musik und kam immer näher.
– Lass uns gehen, sagte das indische Mädchen, das mit meinen Sachen am Ufer gewartet hatte. Ich bringe dich nach Hause.
Für einen Moment dachte ich, dass das indische Mädchen vielleicht kein indisches Mädchen war, sondern ein indischer Junge oder beides gleichzeitig.
– Wie heißt du?, fragte ich.
Ich stolperte, und ich fing an zu zittern, ich zitterte am ganzen Körper, und dann küssten wir uns, endlos lange, irgendwo auf der Straße auf dem langen Weg von Kreuzberg in den Wedding.
Sonnenstrahlen fielen durch die großen Fenster der alten Werkstatt. Draußen hörte ich einen Zug vorbeifahren. Ich konnte mich nicht erinnern, wie ich nach Hause gekommen war. Das indische Mädchen war nicht da.
Ich war allein.
Ich hatte nichts an.
Ich war nicht allein.
Am Fußende des Betts, auf dem ich aufgewacht war, saß reglos ein grauhaariger Mann mit grau-weißen Bartstoppeln und tiefen Falten im Gesicht.
Der Mann sah mich mit traurigen Augen an.
In der Ecke des Zimmers lag eine Schlange in einem Sonnenfleck auf den alten Holzdielen.
Es fuhr wieder ein Zug draußen an den Fenstern vorbei, aber diesmal schien der Zug rückwärts zu fahren, der Mann mit den traurigen Augen am Fußende des Betts verschwand wie das Geräusch des Zuges, und dann war er wieder da und sah mich weiter wortlos an.
– Wie sind Sie hier hereingekommen? Wer sind Sie?, fragte ich.
Der Mann sagte lange nichts.
– Die Tür war offen, sagte er dann.
– Wer sind Sie?, fragte ich noch einmal.
– Jemand hat eine junge Frau aus einem Kanal gezogen, die junge Frau trug ein Brautkleid.
Wieder fuhr ein Zug draußen vorbei, und diesmal fuhr der Zug gleichzeitig vorwärts und rückwärts.
– Und dann liegt das tote Mädchen neben dem Kanal im Gras, die blasse Sonne scheint kalt vom Himmel herab, überall tanzen Leute, und die Leute hören nicht auf zu tanzen, obwohl da eine tote junge Frau liegt. Wer soll das verstehen? Das kann man nicht verstehen.
Der grauhaarige Mann trug einen dunklen dreiteiligen Anzug. Er breitete für einen Moment die Arme aus, als ob er tanzen würde.
– Vielleicht denken die Leute, die Frau schläft. Vielleicht sehen sie sie nicht einmal. Die Polizei kommt. Ein Krankenwagen kommt. Niemand weiß, wer die junge Frau ist. Niemand vermisst sie. Kein Mensch. Keiner weiß, wie sie heißt. Und wenn niemand herausfindet, wie sie heißt, liegt sie am Ende in einem Grab ohne Namen. Und das wäre doch das Traurigste, was man sich vorstellen kann. Das wäre doch das Traurigste, was es gibt, nicht wahr?
Ich versuchte, mich zuzudecken, aber ich konnte mich nicht bewegen. Die Schlange lag weiter bewegungslos in dem Sonnenfleck, aber vielleicht war die Schlange auch nur mein Gürtel, und für einen Moment dachte ich, der Mann am Fußende des Betts sei ich selbst, aber der Mann war fünfundzwanzig oder dreißig Jahre älter als ich, er war etwa siebzig. Er sah aus wie ein Geschäftsmann, vielleicht irgendwo aus dem Süd-Osten, vielleicht aus der Türkei, vielleicht aus Armenien, vielleicht aus Syrien, vielleicht aus dem Iran oder dem Irak.
Der Mann schwieg. Er schwieg lange.
– Sie haben das Mädchen aus dem Wasser geholt. Das Mädchen hat seinen Namen verloren. Ich würde gerne dem Mädchen seinen Namen zurückgeben. Ich möchte, dass sie wieder einen Namen hat. Jeder hat doch einen Namen. Sie können mir vielleicht helfen, sagte der traurige Mann dann.
– Ich weiß nicht, wer sie ist. Ich kannte sie nicht, sagte ich.
– Ja, sagte der Mann.
– Ich bin nicht mehr bei der Polizei. Auf mich warten sechs bis zehn Jahre Gefängnis.
– Ja, sagte der Mann wieder. Ich weiß. Ich weiß.
Und Sie reden mit Gespenstern.
– Ich mag keine Gespenster.
– Aber Sie reden mit ihnen, und Sie sind barfuß und halbnackt von Kreuzberg bis in den Wedding gelaufen.
Es wurde dunkel draußen, als ich das nächste Mal aufwachte.
Der traurige Mann am Fußende des Bettes war nicht mehr da.
Das indische Mädchen war nicht da.
Die Schlange auf dem Holzfußboden war mein Gürtel.
Neben meinen Sachen lag eine Pistole. Es war meine eigene Dienstwaffe, eine SIG Sauer P6, aber diese Waffe hatte man mir bei meiner Festnahme vor über einem Jahr abgenommen, sie konnte nicht hier sein. Ich machte die Augen zu, und dann machte ich die Augen wieder auf, und die Waffe war nicht mehr da.
Ich stand auf, trank zwei Gläser kaltes Wasser und duschte in einer gefliesten Ecke der ehemaligen Tischler-Werkstatt für mehr als zwanzig Minuten. Ich trocknete mich mit einem Handtuch ab, das noch aus dem Besitz meines Vater stammte, und zog mir etwas an. Ich machte das Radio an und presste eine Zitrone aus. Ich erkannte die Stimme der Moderatorin. Ich mochte, wie sie sprach. Die Moderatorin sprach so, als ob wir uns schon lange kennen würden. Sie sprach so, als ob wir keine Fremden wären. Sie sprach so, als ob wir Freunde sein könnten.
Ich stand mit zitternden Händen allein in der alten Werkstatt und hörte der Stimme aus dem Radio zu. Ich hätte Hunger haben müssen, denn ich hatte seit zwei oder drei Tagen nichts mehr gegessen, aber ich hatte keinen Hunger.
Ich trank das Glas mit dem Zitronensaft in einem Zug aus.
Etwas später zitterten meine Hände nicht mehr. Auf der Bahntrasse draußen vor den hohen Fenstern der Werkstatt fuhren die Züge vorbei. Manchmal waren es S-Bahnen, und manchmal waren es Fernzüge.
Die alte Werkstatt in der Gerichtstraße, in der ich lebte, war früher einmal die Werkstatt meines Vaters gewesen. Er hatte sie von seinem Vater geerbt. Wie mein Großvater war auch mein Vater Tischler. Er starb, als ich neunzehn war, da war meine Mutter bereits seit vielen Jahren tot. Sie war gestorben, als ich noch ein Kind war. Nach dem Tod meines Vaters erbte ich die Werkstatt und zog dort ein, aber ich wurde nicht Tischler. Ich ging zur Polizei.
Als ich die Werkstatt verließ, fiel mein Blick auf einen kleinen, schmalen Zettel an der schweren Eisentür, den dort einmal ein Kind hingeklebt hatte, das war die Tochter der vietnamesischen Obst- und Gemüsehändler von der gegenüberliegenden Straßenseite gewesen. Sie hieß Vinh. Das schmale Papier, das Vinh an die Tür geklebt hatte, war einer dieser kleinen Papierstreifen, die man in chinesischen Glückskeksen findet.
»Unvergessliche Augenblicke werden Deine Reise verschönern.«
Das stand auf dem schmalen Zettel, und daneben hatte das kleine Mädchen einen winzigen Hasen gemalt. Dass es ein Hase war, wussten nur ich und Vinh. Vinh studierte inzwischen dank eines Stipendiums Mathematik in Harvard. Sie war hochbegabt.
Als Vinh noch ein Kind war und hinter der Kasse in dem kleinen Laden ihrer Eltern stand, hatte sie mir manchmal chinesische Glückskekse geschenkt, und mit sechs oder sieben hatte sie mich adoptiert, wie sie sich ausdrückte.
– Du hast keine Eltern mehr. Ich werde dich adoptieren, und später werden wir heiraten.
Katrin, meine damalige Freundin, mochte das Kind nicht. Sie mochten sich beide nicht.
Ich hatte seit einem Jahr so gut wie nichts von Vinh gehört.
»Unforgettable moments will enlighten your journey.«
Der Papierstreifen hing seit Jahren dort an der Tür, ich sah ihn jeden Tag, aber ich hatte lange nicht mehr gelesen, was darauf stand.
Ich lief die Treppen hinunter und überquerte in der Abenddämmerung den alten Industriehof.
Auf der Bahntrasse hoch über mir fuhr ein weiterer Zug durch die Stadt.
Vinhs Mutter stand drüben auf der anderen Seite der Gerichtstraße vor ihrem kleinen Laden. Als sie mich sah, winkte sie mir aufgeregt zu. Sie rief etwas, aber ich verstand nicht, was sie sagte, weil gerade ein Auto vorbeifuhr. Ich winkte einfach zurück und lief weiter zur S-Bahnstation Wedding. Am Abendhimmel über der Stadt türmten sich ein paar dunkle Wolken. Es wehte ein warmer Wind. Es sah nach Regen aus, aber noch war es ein schöner Abend. Nach einem kalten Frühling kam endlich der Sommer.
Die Polizisten mit den Maschinenpistolen und den Kevlar-Westen vor dem Eingang wussten, wer ich war. Ich war einmal einer der besten Polizisten der Stadt gewesen, Drogenermittler, mehrfach ausgezeichnet. Dann hatte man mich suspendiert. Verdacht auf Verrat von Dienstgeheimnissen. Verdacht auf Bestechlichkeit, Vorteilsannahme, Vorteilsgewährung, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Betäubungsmittelmissbrauch. Behinderung der Justiz. Drogenhandel. Die Beweise gegen mich waren erdrückend, trotzdem wartete ich seit über einem Jahr darauf, dass die Staatsanwältin Anklage gegen mich erhob.
Früher hätten die Polizisten vor dem Eingang der Gerichtsmedizin mir anerkennend zugenickt, vielleicht hätten sie mir etwas zugerufen, vielleicht hätten sie mich mit Handschlag begrüßt, aber jetzt sahen sie einfach durch mich durch, als ich das große alte Gebäude betrat.
Ich war durchsichtig. Ich war ein Gespenst.
Ich lief die Treppe herunter in den Keller, ging den breiten unterirdischen Flur der Pathologie entlang und öffnete eine schwere Tür.
Die junge Frau aus dem Kanal lag in dem kalten Licht der Leuchtstoffröhren auf einem Tisch aus silbernem Metall. Sie trug ihr weißes Brautkleid nicht mehr.
Neben dem Tisch aus Metall stand eine blonde Frau in einem blauen Kittel.
– Raus, sagte die Frau in dem Kittel unaufgeregt. Geh einfach raus.
Dann zog sie ein weißes Tuch bis zu den Schultern der toten jungen Frau auf dem Tisch.
Katrin und ich kannten uns seit über zwanzig Jahren.
Es gab Fotos von uns beiden aus einem anderen Leben. Es gab Fotos von uns zusammen in Venedig.
Es gab Fotos von uns beiden in Lissabon.
Es gab Fotos von uns auf Motorrädern in Marokko.
Wir waren auf den Fotos Anfang dreißig. Wir hatten unendlich viel Kraft.
Es gab Fotos von uns auf Bali. Wir hatten zusammen Wellenreiten gelernt.
Es gab Fotos von uns an einem strahlend hellen Tag im Schnee der französischen Alpen. Wir waren zusammen tauchen vor der Küste Indiens. Wir waren zusammen Fallschirm gesprungen. Es gab keine Sportart, in der Katrin nicht besser war als ich. Ich erinnerte mich an den Widerschein eines Feuers am Strand in ihrem Gesicht und an den sanften Wind in ihren Haaren.
Wir gingen täglich laufen. Wir hatten guten Sex, wir nahmen keine Drogen, wir tranken wenig Alkohol, wir ernährten uns gesund, wir waren jung, wir verdienten beide genug Geld, wir waren perfekt, und wir hatten versucht, eine Beziehung zu führen wie Millionen von anderen perfekten Leuten auch. Wir waren ein Musterpaar, und wir waren ein Abziehbild, die blonde Frau aus Dahlem und der Junge aus dem Wedding, die Rechtsmedizinerin und der Polizist. Sie mochte meine Wohnung in den Industriehöfen in der Gerichtstraße hinter den Bahngleisen nicht, die mein Vater noch als Werkstatt benutzt hatte, und ich mochte nicht ihre Wohnung in der Auguststraße, die ihr ihre Eltern gekauft hatten, auch als Anlage für »später«.
Sie wollte irgendwann Kinder, ich sagte, ich sei mir nicht sicher, aber in Wahrheit wollte ich keine, obwohl ich mir vielleicht auch wirklich nicht sicher war, und dann lief mir der Junge vor das Auto, und alles ergab von einem Tag auf den anderen keinen Sinn mehr.
– Hey, sagte ich.
– Hey, sagte Katrin, und danach sagten wir beide nichts mehr. Wir waren zwölf Jahre lang zusammen gewesen. Sie blieb hinter dem Obduktionstisch stehen.
– Wer ist sie?, fragte ich.
– Keine Ahnung.
– Und wo kommt sie her?
Schulterzucken.
– Ist sie ertrunken?
– Nein, sagte Katrin. Sie ist nicht ertrunken.
Katrin sah mich an.
– Sie ist verbrannt. Sie ist geschmolzen.
Die tote junge Frau auf dem Metalltisch hatte langes Haar, dunkelbraun, fast schwarz.
Ihre Augen waren jetzt geschlossen.
Sie trug noch etwas dunkelroten Lippenstift und einen Rest von blauem Lidschatten. Sie war wunderschön.
Die junge Frau war geschmolzen, das bedeutete unter Drogenermittlern und Medizinern, sie hatte eine Überdosis MDMA oder Ecstasy genommen, Methylendioxy-N-methylamphetamin, und dann war ihre Körpertemperatur gestiegen und hatte nicht mehr aufgehört zu steigen. Sie musste angefangen haben zu frieren und zu schwitzen, sie hatte wahrscheinlich Schaum gespuckt und Krämpfe gehabt, und dann hatte das Fieber schließlich zweiundvierzig Grad erreicht, das Eiweiß in ihrem Körper begann zu verklumpen, und in der Folge hatten ihre Organe versagt, und währenddessen hatte sie vielleicht noch Feen und Hexen und Gespenster gesehen, vielleicht hatte sie gar nicht begriffen, dass sie schon auf der Reise auf die andere Seite war.
Die junge Frau sah aus, als sei sie einfach gerade dort auf dem Metalltisch eingeschlafen, aber so hatte sie nicht ausgesehen, als sie starb. Da hatte sie sich in Krämpfen gewunden und gekotzt. Vielleicht hatte sie sich in die Hosen gemacht, wahrscheinlich. Niemand hatte einen Arzt für sie gerufen, wobei ein Arzt ohnehin nichts mehr für sie hätte tun können. Jemand hatte sie sterben lassen, und dann hatte er sich um sie gekümmert, als wäre sie seine Braut. Als sie tot war, musste sie jemand gewaschen haben, es hatte ihr jemand das Brautkleid angezogen und ihre Lippen geschminkt und blauen Lidschatten aufgetragen. Es hatte ihr jemand im Tod Blumen ins Haar gesteckt und sie dann ganz sacht auf das Wasser gelegt und den Kanal hinuntertreiben lassen. Ihr Brautkleid hatte sie auf dem Wasser getragen.
Auf ihrer linken Schulter trug die tote junge Frau ein Tattoo, eine Blume mit verlaufenden Farben.
Es war eine Kornblume, deren Stiel sich unter ihrem Schulterblatt verlor. Das Tattoo sah aus, als hätte es jemand nicht in die Haut gestochen, sondern mit Tusche gemalt. Es sah aus, als wäre das Blau der Blüte im Wasser des Kanals verlaufen.
– Wie lange war sie im Wasser?
– Keine zehn Minuten.
– Wie alt ist sie?
– Ich schätze sie auf Anfang bis Mitte Zwanzig, sagte Katrin. Dann fragte sie nach einer Pause: Was machst du hier?
– Ich habe sie aus dem Kanal gezogen. Ich dachte, du kannst mir vielleicht sagen, wer sie ist. Sie hat keinen Namen.
Katrin hob für einen kurzen Moment die linke Hand, so als ob sie etwas abwehren wollte, als ob sie nicht wollte, dass etwas in ihr Leben bricht, das sie nicht beherrschen konnte.
Diese Geste hatte ich in all den Jahren nie bei ihr gesehen.
– Vielleicht solltest du dir mal ihren Rücken ansehen, sagte sie dann.
Auf den Rücken der Toten war ein Feld voller Blüten tätowiert.
Es wuchsen Korn- und Mohnblumen auf den Anhöhen ihrer Schulterblätter, ein schmaler Flusslauf schlängelte sich ihre Wirbelsäule entlang durch hohes Gras und Schilf, da waren Trauerweiden an einem grünblauen Weiher, auf dem Seerosen blühten, ihr ganzer Rücken war ein Blütenmeer, es sah aus wie getuscht und verlaufen. Das war keine einfache Tätowierung. Das war ein in die Haut gestochenes Aquarell. Ein solches Tattoo hatte ich noch nie gesehen.
– Sie hat Blutergüsse am ganzen Körper. Aber vor allem sind da Narben, sagte Katrin. Unter dem Tattoo sind überall Narben.
– Was für Narben?, fragte ich.
Sie zuckte mit den Schultern.
– Alte Risse. Schnitte. Verbrennungen. Alles. Dazu kommen alte Knochenbrüche, seit ein paar Jahren verheilt. Beine, Arme, Rippen, Schlüsselbein.
– Ein Unfall?
– Vielleicht.
Katrin sah traurig aus, aber sie versuchte, es nicht zu zeigen. Sie versuchte zu lächeln, so wie sie es immer getan hatte.
– Ciao, Tommy, sagte Katrin, als ich ging. Sie strich eine Haarsträhne hinter ihr Ohr. Sie versuchte zu lächeln, weil sie es einfach schon ihr ganzes Leben lang nicht aushielt, nicht zu lächeln, selbst wenn es nichts zu lächeln gab.
– Pass auf dich auf.
Es gab Fotos von uns zusammen beim Marathon in New York. Es gab Fotos von uns zusammen auf einem Vulkan auf Hawaii.
Ich lief den langen Korridor unten im Keller der Gerichtsmedizin zurück, stieg aus der Unterwelt der Pathologie hinauf in das Reich der Lebenden und verließ das alte Gebäude. Draußen war es inzwischen dunkel. Die Straßen waren nass, es hatte in der Zwischenzeit kurz geregnet, aber es war immer noch überraschend warm.
Ich dachte an die junge Frau auf dem Metalltisch, die ich in den Armen gehalten hatte, als ich sie aus dem Wasser gezogen hatte.
Ich dachte an Katrin und ihr Lächeln, das ich irgendwann nicht mehr ertragen hatte.
Ich lief durch die Stadt, und ich war nüchtern und klar. Manchmal, eher selten gab es sie, diese Abende, an denen ich nüchtern und klar war, die Abende, an denen ich sicher einen Schritt vor den anderen setzen konnte, obwohl in meinem Leben alles zerbrochen war. Das waren die Abende, an denen ich mich an alles erinnern konnte, an denen ich für eine Stunde oder zwei die Kraft hatte, im Kopf all die Scherben vor mir auszubreiten und anzusehen, als wäre es nicht mein Leben, das da vor mir lag, sondern einfach irgendein Fall. Es gab nicht viele Abende davon, und sie endeten niemals gut, denn irgendwann fing ich an, mich an den ausgebreiteten Scherben vor mir zu schneiden, immer.
Ich kam an einem italienischen Lokal vorbei, in dem ich früher oft mit Csaba gewesen war. Vor der Tür stand ein Kellner und rauchte. Gianni. Gianni war ein Freund von Csaba. Gianni und ich waren selbst eine Zeitlang so etwas wie Freunde gewesen. Gianni war früher einmal heroinabhängig gewesen, aber er hatte die Sucht überlebt. Jetzt kiffte und kokste er nur noch, abgesehen vom Alkohol.
– Komm rein, hier ist sonst keiner, sagte Gianni. Wir haben den ganzen Laden für uns allein, komm rein, oder musst Du irgendwo hin?
Das Lokal war leer, ich war der einzige Gast. Ich sagte Gianni, dass ich nichts trinken wolle außer etwas Wasser, aber Gianni stellte eine Flasche Grappa und zwei Gläser vor uns auf den Tisch. Wir tranken jeder ein Glas, und danach tranken wir noch eines und dann noch eines.
Hallo Grappa.
Hallo Erinnerung.
Hallo Csaba.
Es war ein Noteinsatz gewesen.
An der Grenze zwischen Kreuzberg und Neukölln war eine Polizeistreife ein paar Straßenzüge weit einem Wagen hinterhergefahren. Der Wagen war nicht weiter auffällig, aber die Polizisten fragten routinemäßig das Kennzeichen ab. Der Halter des Wagens war ein nicht besonders wichtiger Informant des Drogendezernats, und gleichzeitig verkaufte er Kokain und Speed. Die Zentrale nahm Kontakt mit uns von der Drogenfahndung auf, und die Streifenpolizisten bekamen per Funk die Anweisung, den Wagen nicht anzuhalten und nicht weiterzuverfolgen, um den Kontakt nicht zu beschädigen, aber da war es schon zu spät.
Mitten auf der Fahrbahn bremste der Wagen plötzlich scharf, setzte zurück und rammte den Streifenwagen hinter ihm. Zwei mit Pistolen bewaffnete Männer stiegen aus dem Wagen und eröffneten das Feuer. Die Polizisten schossen zurück.
Ich raste den Kottbusser Damm herunter. Ich weiß nicht mehr, warum ich allein in dem Wagen fuhr. Ich hätte gar nicht allein fahren dürfen.
Es war dunkel, es regnete, ich fuhr einen zivilen Streifenwagen mit Blaulicht und Sirene, und trotzdem lief mir der Junge vor das Auto. Ich war so schnell, ich sah den Jungen erst, als er plötzlich auf der Fahrbahn stand. Der Junge sah mich für den Bruchteil einer Sekunde mit fassungslosen Augen an, da lebte er noch, und dann flog er über die Motorhaube.
Ich brachte den Wagen zum Stehen und sprang aus dem Auto. Der Junge lag zuckend auf der Straße, ich rannte zu ihm, und wenige Atemzüge später war der Junge tot.