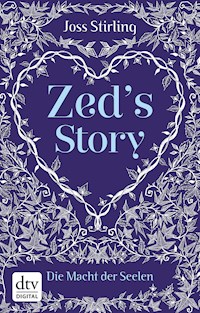12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Die Macht der Seelen führt sie zusammen Drei mitreißende, übersinnliche Romantasy-Bände, in denen die attraktiven Benedict-Brüder ihre große Liebe finden, jetzt in einem E-Book In der Welt der Savants, Menschen mit übernatürlicher Gabe, hat jeder einen Seelenspiegel, die Liebe seines Lebens. Doch ihn zu finden, ist nicht immer leicht. - Sky und Zed - ist das Hass auf den ersten Blick? Aber Bad Boy Zed geht der zierlichen, scheuen Sky nicht mehr aus dem Kopf, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Zed kann mit Sky durch seine Gedanken sprechen … - Yves und Phoenix - Phoenix wird von einem grausamen Savant in London gefangen gehalten und muss für ihn stehlen. Als sie Yves beklauen soll, erkennt er in ihr seinen Seelenspiegel - und setzt sofort alles daran, sie zu befreien .. - Crystal und Xavier - Crystal fühlt sich verkehrt in der Welt der Savants. Sie hat keine besondere Begabung und glaubt auch nicht daran, dass sie jemals ihren Seelenspiegel finden wird. Doch dann tritt Xav Benedict in ihr Leben und stellt alles auf den Kopf …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1286
Ähnliche
Joss Stirling
Die Macht der Seelen
Finding SkySaving PhoenixCalling Crystal
Aus dem Englischen von Michaela Kolodziejcok
Die Macht der Seelen
Finding Sky
Für Lucy und Emily
Kapitel 1
Das Auto fuhr davon und ließ das kleine Mädchen auf dem Parkplatz zurück. Es trug ein dünnes Baumwollhemdchen und Shorts. Zitternd vor Kälte setzte es sich hin und schlang seine Arme um die Beine, der Wind fuhr in sein helles blondes Haar, das so blass war wie eine Pusteblume.
Du hältst die Klappe, Missgeburt, oder wir kommen zurück und machen dich fertig, hatten sie zu ihr gesagt.
Sie wollte nicht, dass sie zurückkamen. So viel wusste sie, auch wenn sie sich weder an ihren eigenen Namen erinnern konnte noch daran, wo sie wohnte.
Eine Familie ging auf dem Weg zu ihrem parkenden Auto an ihr vorbei, die Mutter trug ein Kopftuch und hatte ein Baby auf dem Arm, der Vater hielt ein Kleinkind an der Hand. Das Mädchen starrte auf den abgewetzten Rasen und zählte die Gänseblümchen. Wie das wohl ist?, fragte sie sich. Im Arm getragen zu werden? Es war so lange her, dass jemand liebevoll zu ihr gewesen war, dass es ihr schwerfiel hinzusehen. Sie konnte den Goldschimmer sehen, der die Familie umstrahlte – die Farbe der Liebe. Aber sie traute dieser Farbe nicht, sie brachte nur Schmerzen.
Dann hatte die Frau sie entdeckt. Das Mädchen zog ihre Knie bis ans Kinn, versuchte sich so klein zu machen, dass niemand sie bemerkte. Aber es war zwecklos. Die Frau sagte etwas zu ihrem Mann, drückte ihm das Baby in den Arm, kam näher, setzte sich neben das Mädchen in die Hocke. »Hast du dich verlaufen, Kleines?«
Du hältst die Klappe oder wir machen dich fertig.
Das Mädchen schüttelte den Kopf.
»Sind Mummy und Daddy da reingegangen?« Die Frau runzelte die Stirn; die sie umgebenden Farben nahmen eine zornige Rottönung an.
Das Mädchen wusste nicht, ob es nicken sollte. Mummy und Daddy waren fortgegangen, aber schon vor langer Zeit.
Sie hatten sie nie aus dem Krankenhaus abgeholt, sondern waren zusammen im Feuer geblieben. Das Mädchen beschloss, nichts zu sagen. Die Farben der Frau loderten in tiefem Purpur.
Das Mädchen zuckte zusammen: Sie hatte die Frau verärgert. Diejenigen, die gerade weggefahren waren, hatten also die Wahrheit gesagt. Sie war böse. Sie machte allen immer nur Kummer. Das Mädchen legte ihren Kopf auf die Knie. Wenn sie einfach so tat, als ob es sie gar nicht gäbe, wäre die Frau vielleicht wieder zufrieden und würde weggehen. Manchmal klappte das.
»Armes, kleines Ding«, seufzte die Frau und erhob sich. »Jamal, würdest du bitte noch mal reingehen und Bescheid sagen, dass hier draußen ein verirrtes Kind sitzt? Ich bleibe bei ihr.«
Das Mädchen hörte, wie der Mann beruhigend auf das kleine Kind einsprach, und dann ihre Schritte, als sie zusammen zum Restaurant zurückgingen.
»Hab keine Angst. Deine Familie sucht dich bestimmt schon.« Die Frau setzte sich neben sie und drückte Nummer fünf und sechs der abgezählten Gänseblümchen platt.
Das Mädchen fing an, heftig zu zittern, und schüttelte den Kopf. Sie wollte nicht, dass sie nach ihr suchten – jetzt nicht, niemals.
»Alles okay. Wirklich. Ich weiß, du hast Angst, aber du wirst im Nu wieder bei deiner Familie sein.«
Sie wimmerte und schlug sich schnell eine Hand vor den Mund. Ich darf keinen Laut von mir geben, ich darf kein Theater machen. Ich bin böse. Böse.
Aber sie war es gar nicht, die so viel Lärm machte. Sie war nicht schuld. Jetzt schwirrten viele Leute um sie herum. Polizisten in gelben Westen, die so aussahen wie die, die an jenem Tag vor ihrem Haus gestanden hatten. Stimmen, die zu ihr sprachen. Nach ihrem Namen fragten.
Aber der war ein Geheimnis – und sie hatte die Antwort auf die Frage schon vor langer Zeit vergessen.
Kapitel 2
Ich erwachte aus meinem altbekannten Albtraum, als das Auto anhielt und der Motor verstummte. Meinen Kopf hatte ich auf das Kissen gepresst und war noch benommen vom Schlaf, sodass es eine Weile dauerte, bis ich wieder wusste, wo ich war. Nicht an jener Autobahnraststätte, sondern in Colorado bei meinen Eltern. Beim Weiterziehen. Beim Umziehen.
»Und, was sagst du?« Simon, wie Dad lieber genannt wurde, stieg aus dem klapprigen Ford aus, den er in Denver gekauft hatte, und zeigte mit einer theatralischen Geste auf das Haus. Sein grau gesträhnter, brauner Zopf löste sich aus dem Haargummi, so schwungvoll war die Begeisterung, mit der er uns unser neues Heim präsentierte. Spitzdach, Schindelwände und schmutzige Fenster – es sah nicht sonderlich einladend aus. Halb erwartete ich, dass die Adams Family zur Eingangstür hinausschwanken würde. Ich setzte mich aufrecht hin und rieb mir die Augen, um die bohrende Angst zu vertreiben, die nach einem solchen Traum stets bei mir nachwirkte.
»Oh, Liebling, es ist wunderschön!« Sally, meine Mutter, ließ sich durch nichts so schnell entmutigen – Simon nannte sie immer scherzhaft einen Terrier auf der Jagd nach dem Glück: Wenn sie ein Zipfelchen davon zu fassen kriegte, schlug sie ihre Zähne hinein und ließ einfach nicht mehr los. Sally stieg aus dem Auto aus. Ich folgte ihr ziemlich schwerfällig, wobei ich nicht wusste, ob das am Jetlag oder an meinem Traum lag. Die Worte, die mir beim Anblick des Hauses in den Kopf schossen, waren »düster«, »Bruchbude« und »runtergekommen«, Sallys Vokabular unterschied sich von meinem gewaltig. »Ich glaube, das wird ganz toll. Seht euch doch nur mal diese Fensterläden an – das müssen noch die originalen sein. Und diese Veranda! Ich habe mich schon immer auf genau so einer Veranda im Schaukelstuhl sitzen und den Sonnenuntergang genießen sehen.« Ihre braunen Augen strahlten vor Vorfreude und ihre weichen Locken wippten bei jeder Stufe, die sie hinaufstieg.
Ich war nun schon seit meinem zehnten Lebensjahr bei ihnen und hatte mich mittlerweile damit abgefunden, dass meine Eltern beide eine Schraube locker hatten. Sie lebten in ihrer eigenen kleinen Fantasiewelt, in der alte Bruchbuden »malerisch« und Schimmelbefall »stimmungsvoll« waren. Im Gegensatz zu Sally sah ich mich immer in einem ultramodernen Haus auf einem Stuhl sitzen, der kein Paradies für Holzwürmer war, und in einem Schlafzimmer, an dessen Fensterscheiben die Eisblumen nicht innen wuchsen.
Aber mal abgesehen von dem Haus: Die Berge dahinter waren atemberaubend, imposant hoch ragten sie in den klaren Herbsthimmel hinein, ein Hauch von Weiß auf den Gipfeln. Wie eine zu Stein gewordene Flutwelle am Horizont, die gerade noch rechtzeitig erstarrt war, bevor sie über uns zusammenschlug. Die felsigen Hänge schimmerten rosa im späten Nachmittagslicht und dort, wo sich lange Schatten auf die Schneefelder legten, zeigten sie sich schieferblau. Die waldbestandenen Seiten waren bereits vom Herbstgold der Espen durchwirkt, die sich leuchtend gegen die dunklen Douglas-Tannen abzeichneten. Ich konnte eine Seilbahn erkennen und die kahl geschlagenen Schneisen der steilen Skipisten.
Das mussten die High Rockys sein, von denen ich gelesen hatte, nachdem mir meine Eltern eröffneten, wir würden von Richmond-Upon-Thames, England, nach Colorado in den USA, genauer gesagt in eine kleine Stadt namens Wrickenridge ziehen. Ihnen war dort ein einjähriges Stipendium als Artists-in-Residence in einem neuen Künstlerhaus angeboten worden. Ein ortsansässiger Multimillionär und Bewunderer ihrer Arbeiten hatte es sich in den Kopf gesetzt, dass der Skiort westlich von Denver dringend eine Kulturspritze benötigte – und meine Eltern, Sally und Simon, sollten nun die Injektionslösung sein.
Als mir meine Eltern die ›frohe‹ Botschaft überbrachten, sah ich mir die Website der Stadt an und erfuhr, dass Wrickenridge für seine jährlich fallende Schneehöhe von 750cm bekannt war und mehr auch nicht. Dort wäre also Skifahren angesagt – allerdings hatten wir uns die Klassenfahrten in die Alpen nie leisten können und so würde ich meinen Altersgenossen dort Lichtjahre hinterherhinken. Ich malte mir bereits aus, wie ich mich am ersten schneereichen Wochenende am Babyhang bis auf die Knochen blamierte, während die anderen die schwarzen Pisten hinunterbretterten.
Aber meine Eltern waren begeistert von der Vorstellung, inmitten der Rockies zu malen, und ich brachte es nicht übers Herz, ihnen ihr großes Abenteuer zu vermiesen. Ich tat so, als hätte ich überhaupt kein Problem damit, dass ich die Oberstufe in Richmond, auf die alle meine Freunde gingen, verpasste und mich stattdessen an der Wrickenridge High einschrieb. Seit meiner Adoption vor sechs Jahren hatte ich mir einen Platz in der Gemeinde im Südwesten Londons erkämpft; ich hatte Todesangst und Sprachlosigkeit besiegt, hatte meine Schüchternheit überwunden und mir einen Freundeskreis aufgebaut, in dem ich mich gemocht fühlte. Ich hatte die befremdlichen Seiten meiner Persönlichkeit tief in mir vergraben – beispielsweise diese Sache mit den Farben, von der ich geträumt hatte. Ich achtete nicht mehr auf die Aura der Leute, so wie ich es als Kind getan hatte, und ignorierte es, wenn ich es einmal nicht unter Kontrolle hatte. Ich hatte mich normal gemacht – na ja, soweit das möglich war. Jetzt wurde ich ins kalte Wasser geworfen. Ich hatte haufenweise amerikanische Highschool-Filme gesehen und war ziemlich verunsichert, was meine neue Schule anging. Bestimmt hatten gewöhnliche amerikanische Teenager doch auch ab und zu mal Pickel und trugen bescheuerte Klamotten, oder? Sollten sich die amerikanischen Filme bewahrheiten, würde ich niemals dort hinpassen.
»Okay.« Simon wischte mit den Händen über seine Oberschenkel, die in einer verblichenen Jeans steckten, eine Angewohnheit, aufgrund derer jedes Kleidungsstück, das er besaß, mit Ölfarbe beschmiert war. Sally sah dagegen ziemlich schick aus mit einer neuen Hose und einem Blazer, Klamotten, die sie sich extra für die Reise gekauft hatte. Ich lag mit meinem leicht verknautschten Levis-Look irgendwo in der Mitte zwischen den beiden. »Lasst uns mal reingehen. Mr Rodenheim sagte, drinnen waren schon die Handwerker zugange. Er hat versprochen, dass sie sich so bald wie möglich die Fassade vorknöpfen.«
Darum sah’s hier also aus wie auf einer Müllkippe.
Simon öffnete die Haustür. Sie quietschte, fiel aber nicht aus den Angeln, was ich als kleinen Triumph für uns verbuchte. Die Handwerker waren ganz offensichtlich eben erst gegangen – und hatten uns ihre Malerplanen und Leitern, Farbeimer und halb fertigen Wände als Begrüßungsdekoration dagelassen. Ich sah mir die Räume im ersten Stock an und entdeckte ein türkisfarben gestrichenes Zimmer mit einem Doppelbett und Ausblick auf die Berggipfel. Das musste unbedingt mir gehören. Vielleicht war’s hier doch nicht so übel.
Mit dem Fingernagel kratzte ich Farbreste von dem alten Spiegel über der Kommode. Das blasse, ernste Mädchen, das mir aus dem Spiegel entgegenblickte, tat dasselbe und starrte mich aus dunkelblauen Augen an. Sie sah in dem schummrigen Licht gespenstisch aus; das blonde Haar fiel ihr in ungebändigten Locken ums ovale Gesicht. Sie wirkte zerbrechlich. Einsam. Eine Gefangene im Raum hinter dem Spiegel; eine Alice, die es niemals wieder in die echte Welt zurückschaffen würde.
Ich erschauerte. Der Traum verfolgte mich noch immer, zog mich zurück in die Vergangenheit. Ich musste dringend aufhören damit. Alle – Lehrer, Freunde – hatten mir gesagt, dass ich dazu neigte, in melancholische Tagträumereien abzudriften. Aber sie verstanden nicht, dass ich mich, wie soll ich sagen, dem Leben irgendwie nicht gewachsen fühlte. Ich war mir selbst ein Rätsel – ein Bündel von bruchstückhaften Erinnerungen und unerforschten dunklen Abgründen. In meinem Kopf verbargen sich jede Menge Geheimnisse, aber die Karte, die mich zu ihnen führen konnte, war mir abhandengekommen.
Ich nahm meine Hände vom kalten Spiegelglas, drehte mich um und ging die Treppe nach unten. Meine Eltern standen in der Küche, eng aneinandergeschmiegt wie immer. Sie führten die Art von Beziehung, die so innig war, dass ich mich oft fragte, wie sie darin noch Platz für mich gefunden hatten.
Sally umschlang Simons Taille und legte ihren Kopf an seine Schulter. »Nicht übel. Erinnerst du dich noch an unsere erste Bude am Earls Court, Liebling?«
»Ja. Die Wände waren grau und alles rappelte, sobald die U-Bahn unter dem Haus entlangfuhr.« Er küsste ihr Haar. »Das hier ist ein Palast.«
Sally streckte die Hand nach mir aus, um mich in diesen Augenblick mit einzubeziehen. Ich hatte mich in den letzten paar Jahren darauf getrimmt, ihren liebevollen Gesten nicht zu misstrauen, und so nahm ich ihre Hand. Sally drückte leicht meine Knöchel und erkannte damit stillschweigend an, wie viel Überwindung es mich kostete, nicht vor ihnen zurückzuscheuen. »Ich bin so aufgeregt. Das ist fast so gut wie Heiligabend.«
Sie hatte schon immer eine Schwäche für Bescherungen gehabt.
Ich lächelte. »Darauf wäre ich echt nie gekommen.«
»Jemand zu Hause?« Es klopfte kurz an die Verandatür und schon kam eine ältere Dame hereinmarschiert. Sie hatte schwarzes, mit Weiß durchwirktes Haar, dunkle Haut und an ihren Ohrläppchen baumelten riesengroße dreieckige Ohrringe, die fast bis zum Kragen ihrer mit goldenem Stoff gefütterten Jacke hinunterreichten. Schwer beladen mit einer Auflaufform, warf sie mit einem gekonnten Fußtritt die Tür hinter sich zu.
»Da sind Sie ja. Ich habe Sie ankommen sehen. Willkommen in Wrickenridge!«
Sally und Simon tauschten leicht belustigte Blicke aus, als die Frau wie selbstverständlich die Auflaufform auf den Tisch in der Diele stellte.
»Ich bin May Hoffman, Ihre Nachbarin von gegenüber. Und Sie sind die Brights aus England.«
Wie es aussah, brauchte Mrs Hoffman keinen Gesprächspartner, um eine Unterhaltung zu führen. Ihr Temperament war geradezu beängstigend; ich ertappte mich bei dem Wunsch, mich wie eine Schildkröte in den Schutz meines Panzers zurückzuziehen.
»Ihre Tochter sieht aber keinem von Ihnen beiden besonders ähnlich, was?« Mrs Hoffman rückte einen Farbeimer beiseite. »Ich habe Sie vorfahren sehen. Wussten Sie, dass Ihr Auto Öl verliert? Das wollen Sie bestimmt reparieren lassen. Kingsley von der Werkstatt wird sich das umgehend ansehen, wenn Sie sagen, dass Sie auf meine Empfehlung kommen. Er verlangt sehr faire Preise, allerdings müssen Sie aufpassen, dass er Ihnen den Bringservice nicht in Rechnung stellt – der sollte nämlich inbegriffen sein.«
Simon sah mich mit entschuldigender Miene an. »Das ist ausgesprochen freundlich von Ihnen, Mrs Hoffman.«
Sie machte eine wegwerfende Handbewegung. »Wir legen hier großen Wert auf gute Nachbarschaft. Das müssen wir – warten Sie nur ab, bis der Winter kommt, dann werden Sie’s verstehen.«
Sie richtete ihre Aufmerksamkeit auf mich; ihre Augen waren hellwach. »Und du? Hast du dich in der elften Klasse der Highschool angemeldet?«
»Ja, äh, Mrs Hoffman«, murmelte ich.
»Das Halbjahr hat vor zwei Tagen begonnen, aber ich vermute, das weißt du. Mein Enkel ist ebenfalls in der Oberstufe. Ich werde ihm sagen, dass er ein Auge auf dich haben soll.«
Mich überkam die albtraumhafte Vision einer männlichen Ausgabe von Mrs Hoffman, die mich durch die Schule schleuste. »Ich bin mir sicher, das wird nicht …«
Sie schnitt mir das Wort ab, indem sie auf die Auflaufform zeigte. »Ich dachte mir, Sie würden es zu schätzen wissen, Ihre neue Küche mit etwas Hausmannskost einzuweihen.« Sie schnupperte. »Wie ich sehe, hat Mr Rodenheim das Haus endlich renovieren lassen. Wurde auch Zeit. Ich habe ihm immer gesagt, dass dieses Haus ein Schandfleck für die Nachbarschaft ist. Na ja, Sie ruhen sich jetzt erst mal aus, hören Sie, und wir sprechen uns wieder, wenn Sie sich ein bisschen eingelebt haben.«
Sie war weg, bevor wir die Möglichkeit hatten, uns bei ihr zu bedanken.
»O-kay«, sagte Simon. »Das war ziemlich interessant.«
»Bitte, lass das Ölleck gleich morgen reparieren«, sagte Sally in gespieltem Flehen und verschränkte die Hände vor der Brust. »Ich möchte auf keinen Fall in der Nähe sein, wenn sie herausfindet, dass du ihrem Rat nicht gefolgt bist – und sie kommt garantiert bald wieder.«
»Wie ein Schnupfen«, stimmte er zu.
»Sie ist schon … ziemlich amerikanisch, oder?«, sagte ich zaghaft.
Wir prusteten laut los – das Haus hätten wir auf keine andere Weise besser einweihen können.
An diesem Abend packte ich meinen Koffer aus und räumte die Sachen in die alte Kommode, die ich mit Sallys Hilfe mit Schrankpapier ausgekleidet hatte; sie roch noch immer muffig und die Schubladen klemmten, aber mir gefiel der blass-weiße Lasuranstrich. Distressed Look, nannte Sally diesen Stil und erklärte, dass die Kommode absichtlich so hergerichtet worden war, dass sie möglichst abgerissen und alt aussah. Vermutlich gefiel mir dieser Look deshalb so gut, weil ich das Gefühl kannte, lädiert zu sein.
Ich dachte über Mrs Hoffman und diese seltsame Stadt nach, in die wir gezogen waren. Alles fühlte sich hier so anders an – fremd. Sogar die Luft, die bedingt durch die Höhenlage nie auszureichen schien, sodass ich die ganze Zeit unterschwellige Kopfschmerzen hatte. Draußen vor meinem Fenster, umrahmt von den Ästen eines dicht am Haus stehenden Apfelbaumes, hob sich der dunkle Schattenriss der Berge gegen den fast schwarzen, bewölkten Nachthimmel ab. Die Gipfel saßen über die Stadt zu Gericht, mahnten uns Menschen, wie unbedeutend und vergänglich wir doch waren.
Ich brauchte ziemlich lange, bis ich ausgesucht hatte, was ich an meinem ersten Schultag anziehen würde. Ich entschied mich für eine Jeans und ein T-Shirt von Gap, unscheinbare Klamotten, in denen ich aus der Masse der anderen Schüler nicht hervorstechen würde. Nach weiterem Überlegen kramte ich dann aber einen weiten Pulli hervor mit dem Union Jack in Gold vorne drauf. Ich sollte einfach akzeptieren, wer ich war.
Das war etwas, was Simon und Sally mir beigebracht hatten. Sie wussten, wie schwierig es für mich war, mich an meine Vergangenheit zu erinnern, und drängten mich nie. Sie sagten stets, die Erinnerung käme zurück, sobald ich dazu bereit wäre. Ihnen genügte es vollkommen, wer ich momentan war; ich brauchte mich für meine Defizite nicht zu entschuldigen. Doch das änderte nichts daran, dass ich eine Heidenangst vor dem Unbekannten hatte, das mich morgen erwartete.
Ich kam mir ein klein bisschen feige vor, als ich Sallys Angebot, dass sie mich zur Anmeldung in die Schule begleiten könne, dankbar annahm. Wrickenridge High lag ungefähr eine Meile bergab von unserem Haus entfernt, in der Nähe der Interstate 70 – die Hauptstraße, die die Stadt mit den anderen Skiorten in der Gegend verband. Das Gebäude zeugte vom Stolz der Erbauer auf seine Bestimmung: Der Name war oberhalb der ausladenden Flügeltüren ins Mauerwerk gemeißelt, die Außenanlagen machten einen gepflegten Eindruck. Im Eingangsbereich hing ein Schwarzes Brett neben dem anderen, alle übervoll mit Zetteln, auf denen jede Menge Aktivitäten angeboten wurden, die den Schülern zur mehr oder weniger freiwilligen Teilnahme offenstanden. Ich dachte an das Oberstufenzentrum, das ich in England besucht hätte. Hinter einem Einkaufscenter versteckt, bestehend aus Sechzigerjahrebauten und Raumcontainern, war es ein eher unpersönlicher Ort, den man einfach aufsuchte, ohne sich zugehörig zu fühlen. Allmählich schwante mir, dass dazugehören ein wichtiger Aspekt des Lebens in Wrickenridge war. Ich war mir nicht sicher, wie ich das fand. Vermutlich wäre es okay, wenn ich es schaffte, mich in meiner neuen Schule anzupassen, und richtig übel, wenn ich es vermasselte.
Sally wusste, dass ich Muffensausen hatte, aber sie tat so, als würde ich die erfolgreichste Schülerin aller Zeiten werden.
»Sieh mal, die haben hier auch eine Kunst-AG«, sagte sie fröhlich. »Du könntest ja mal Töpfern ausprobieren.«
»Ich bin ’ne Niete in solchen Sachen.«
Sie schnalzte kurz mit der Zunge, denn sie wusste, dass ich recht hatte. »Dann Musik. Wie ich sehe, haben sie hier auch ein Orchester. Oh, sieh doch mal – Cheerleading! Das könnte doch ganz lustig sein!«
»Aber sicher.«
»Du würdest echt süß aussehen in so einem Röckchen.«
»Ich bin dafür aber ungefähr dreißig Zentimeter zu kurz geraten«, sagte ich mit Blick auf die ellenlangen Beine der Mädchen, die das Plakat des Cheerleading-Teams zierten.
»Eine Venus im Handtaschenformat, das bist du. Deine Figur hätte ich gern.«
»Sally, hör auf, so peinlich zu sein.« Warum machte ich mir überhaupt die Mühe, mit ihr zu streiten? Ich hatte nicht die Absicht, Cheerleader zu werden, auch dann nicht, wenn meine Größe kein Hindernis darstellen würde.
»Basketball«, fuhr Sally fort.
Ich verdrehte die Augen.
»Tanz.«
Jetzt war’s nur noch ein Witz.
»Mathe-Club.«
»Du müsstest mich schon bewusstlos schlagen, bevor ich da hingehe«, murmelte ich und brachte sie damit zum Lachen.
Sie drückte kurz meine Hand. »Du wirst schon das Passende finden. Denk dran, du bist was Besonderes.«
Wir stießen die Tür zum Büro auf. Der Empfangsangestellte stand hinter dem Tresen, seine Brille hing ihm an einer Kette um den Hals; sie hüpfte auf seinem pinkfarbenen Pulli auf und ab, als er die Briefe in die Postfächer der Lehrer sortierte. Gleichzeitig nippte er an einem Coffee-to-go-Becher.
»Ah, du musst das neue Mädchen aus England sein! Herein, herein!« Er winkte uns näher heran und schüttelte Sally die Hand. »Mrs Bright, ich bin Joe Delaney. Wären Sie bitte so freundlich, ein paar Formulare für mich zu unterschreiben? Und du bist Sky, richtig?«
Ich nickte.
»Die Schüler nennen mich alle Mr Joe. Ich habe ein Begrüßungspaket für dich.« Er drückte es mir in die Hand. Ich sah, dass mir bereits ein elektronisch lesbarer Schulpass mit Foto ausgestellt worden war. Es war das gleiche Bild wie das auf meinem Ausweis, auf dem ich guckte wie ein Kaninchen im Scheinwerferlicht. Na super. Ich hängte mir das Band um den Hals und stopfte die Ausweiskarte unter meinen Pulli, wo sie niemand sehen würde.
Mr Joe lehnte sich vertraulich nach vorne und schickte eine Wolke seines blumigen Parfüms in meine Richtung. »Ich vermute, du kennst dich noch nicht aus damit, wie es bei uns hier so läuft?«
»Nein, noch nicht«, sagte ich.
Er verbrachte die nächsten zehn Minuten damit, mir geduldig zu erklären, welche Kurse ich belegen konnte und welche Noten ich für meinen Abschluss bräuchte.
»Wir haben für dich einen Stundenplan zusammengestellt, der auf den Angaben beruht, die du in deinem Anmeldeformular gemacht hast. Aber denk dran – da ist nichts in Stein gemeißelt. Wenn du Kurse wechseln möchtest, gib mir einfach Bescheid.« Er warf einen prüfenden Blick auf seine Armbanduhr. »Du hast die Registrierung versäumt, also bringe ich dich am besten zu deinem ersten Kurs.«
Sally gab mir einen Kuss und wünschte mir viel Glück. Von jetzt an war ich auf mich allein gestellt.
Mr Joe zog angesichts einer Gruppe trödelnder Schüler, die am Zuspätkommerbuch herumlungerten, die Stirn in Falten und trieb sie, wie ein Schäferhund eine Herde widerspenstiger Schafe, auseinander, bevor er mich zu dem Geschichtstrakt führte. »Sky, das ist ein hübscher Name.«
Ich wollte ihm nicht erzählen, dass Sally, Simon und ich ihn gemeinsam ausgesucht hatten, als ich vor erst sechs Jahren adoptiert worden war. Davor, als man mich gefunden hatte, war ich nicht in der Lage gewesen zu sagen, wie ich heiße, und nachdem ich jahrelang kein Wort gesprochen hatte, war ich von den Sozialarbeitern einfach Janet genannt worden. ›Einfach-Janet‹, witzelte einer meiner Pflegebrüder immer. Aus diesem Grund hatte ich den Namen umso mehr gehasst. Ein neuer Name hatte mir bei meinem Neuanfang mit den Brights helfen sollen; Janet war mein Zweitname geworden.
»Meinen Eltern hat er gefallen.« Und ich war damals noch zu jung gewesen, um absehen zu können, wie peinlich er gelegentlich in Kombination mit meinem Nachnamen sein würde.
»Er ist niedlich, fantasievoll.«
»Ähm, ja.« Mein Herz wummerte, meine Hände waren feucht. Ich würde das hier nicht vermasseln. Ich würde das hier nicht vermasseln.
Mr Joe öffnete die Tür.
»Mr Ozawa, hier ist die neue Schülerin.«
Der japanischstämmige Lehrer schaute von seinem Laptop auf, an dem er gerade Notizen auf dem digitalen Whiteboard bearbeitet hatte. Zwanzig Köpfe drehten sich in meine Richtung.
Mr Ozawa blickte über den Rand der halbmondförmigen Gläser seiner Lesebrille, eine Strähne seines glatten schwarzen Haares verdeckte ein Auge. Für einen älteren Typen war er recht gut aussehend. »Sky Bright?«
Ein Kichern ging durch die Klasse, aber ich konnte schließlich nichts dafür, dass mich meine Eltern damals bei der Wahl des Namens nicht gewarnt hatten. Wie immer hatten ihnen nur schillernd originelle Bilder vor Augen gestanden und nicht meine zukünftigen Höllenqualen in der Schule.
»Ja, Sir.«
»Ich übernehme, Mr Joe.«
Mr Joe gab mir auf der Türschwelle einen aufmunternden Stups und marschierte davon. »Und toitoitoi, Sky.«
Am liebsten hätte ich mich unter dem nächstbesten Tisch verkrochen.
Mr Ozawa klickte eine neue Präsentation mit dem Titel ›Der amerikanische Bürgerkrieg‹ an. »Du kannst dich hinsetzen, wo du magst.«
Ich konnte nur einen freien Platz ausmachen, neben einem Mädchen mit karamellfarbener Haut und Fingernägeln in Rot, Weiß und Blau. Ihre Haare waren umwerfend – eine Mähne kastanienbrauner Dreadlocks, die ihr bis über die Schultern fiel. Mit einem neutralen Lächeln ließ ich mich auf den Stuhl neben sie gleiten. Sie nickte und tickte mit ihren Krallen auf den Tisch, während Mr Ozawa Arbeitsblätter verteilte. Als er sich kurz wegdrehte, hielt sie mir ihre Hand hin. Sie streifte meine mehr, als dass sie sie schüttelte.
»Tina Monterey.«
»Sky Bright.«
»Ja, das hab ich mitgekriegt.«
Mr Ozawa klatschte in die Hände. »Okay Leute, ihr seid also die Glücklichen, die mehr über das Amerika im neunzehnten Jahrhundert erfahren wollen. Na ja, nach zehn Jahren Unterricht in der Mittelstufe gebe ich mich keinen Illusionen mehr hin und gehe davon aus, dass während der Ferien euer gesamtes Wissen aus euren Gehirnen getilgt worden ist. Also, dann fangen wir mal ganz einfach an. Wer kann mir sagen, wann der Bürgerkrieg begann? Und ganz recht, ich möchte auch gern den Monat wissen.«
Seine Augen wanderten suchend über die Klasse hinweg und alle zogen versiert die Köpfe ein. Schließlich blieb sein Blick an mir haften.
Mist.
»Miss Bright?«
Alles, was ich je an Wissen zur Geschichte Amerikas besessen hatte, verschwand wie bei ›Der Unsichtbare‹, wo der Mann Stück für Stück seinen Anzug auszog, bis nichts als Leere blieb. »Ähm, hier gab es einen Bürgerkrieg?«
Die Klasse stöhnte.
Das hieß dann wohl, dass ich das wirklich hätte wissen müssen.
Ich war froh, dass Tina mich unbeleckte Britin in der Pause nicht einfach im Regen stehen ließ, trotz der armseligen Vorstellung, die ich abgeliefert hatte. Sie bot sich an, mir die Schule zu zeigen. Vieles, was ich sagte, brachte sie zum Lachen – aber nicht etwa, weil ich witzig, sondern weil ich so britisch war, wie sie sagte.
»Dein Akzent ist toll. Du klingst wie diese Schauspielerin, du weißt schon, die aus den Piratenfilmen.«
Klinge ich wirklich so affektiert?, fragte ich mich. Eigentlich hatte ich immer geglaubt, ich wäre dafür zu londonerisch.
»Bist du etwa mit der Queen verwandt?«, scherzte Tina.
»Ja, sie ist meine Großcousine zweiten Grades«, erwiderte ich ernst.
Tinas Augen wurden groß. »Du machst Witze!«
»Eigentlich … ja, ich mach Witze.«
Sie lachte und schlug sich mit ihrem Hefter gegen die Stirn. »Für einen kurzen Moment hab ich’s dir echt abgekauft. Ich hatte schon Angst, ich müsste jetzt vor dir knicksen.«
»Tu dir keinen Zwang an.«
Wir holten uns mittags etwas zu essen aus der Mensa und trugen unsere Tabletts in den Speisesaal. Eine Wand bestand aus einer Glasfront, die auf den matschigen Sportplatz und den Wald dahinter blickte. Die Sonne war hervorgekommen und brachte die weiß bekrönten Gipfel zum Glitzern. Ein paar Schüler aßen deshalb draußen, in Grüppchen, die sich nach ihren Klamotten unterschieden. An dieser Highschool gab es vier Jahrgänge in den Altersstufen von vierzehn bis achtzehn. Ich war in der Elften, der sogenannten Mittelstufe, ein Jahr unter der Abschlussklasse.
Mit einer Dose Mineralwasser in der Hand zeigte ich auf die Grüppchen. »Also, Tina, wer ist wer?«
Sie lachte. »Weißt du, Sky, manchmal glaube ich, wir sind Opfer unserer eigenen Stereotype, denn wir passen uns an, auch wenn ich es nicht gern zugebe. Wenn man versucht, anders zu sein, landet man in einer Gruppe von Rebellen, die dann doch wieder alle das Gleiche machen. So ist das eben in der Highschool.«
Gruppe klang gut – ein Ort, wo man untertauchen konnte. »Da, wo ich herkomme, ist es genauso. Lass mich raten, sind das da drüben die Sportler?« Solche Typen hatten in allen Highschool-Filmen mitgespielt, die ich gesehen hatte, angefangen bei ›Grease‹ bis ›High School Musical‹ und waren leicht zu erkennen an ihren Trikots, die sie zum Mittagstraining trugen.
»Ja, die Sportfanatiker. Die meisten sind ganz okay – bedauerlicherweise gibt’s darunter keine richtig fitten Typen mit Waschbrettbäuchen, nur verschwitzte Teenager. Hier wird vor allem Baseball gespielt, Basketball, Hockey, Mädchenfußball und Football.«
»American Football – das ist so ähnlich wie Rugby, oder? Außer dass sie einen Haufen Schutzkleidung tragen.«
»Ach echt?« Sie zuckte die Achseln. Ich vermutete, dass sie selbst keine große Sportskanone war. »Und was spielst du?«
»Ich bin ’ne ganz gute Läuferin und hab früher ein bisschen Tennis gespielt, aber das war’s dann auch.«
»Das klingt okay. Sportler können so langweilig sein. Sie denken immer nur an das eine – allerdings hat das nichts mit Mädchen zu tun.«
Drei Typen gingen an uns vorbei. Sie waren in eine Diskussion über Megabytes vertieft und machten dabei so ernste Mienen, als führten sie Friedensverhandlungen im Nahen Osten. Einer von ihnen spielte mit einem Schlüsselring, an dem ein Memorystick hing.
»Und das sind die Geeks – die Intelligenzbestien, die jedem unter die Nase reiben müssen, dass sie’s draufhaben. Ähnlich wie die Nerds, aber mit mehr Technologie.«
Ich lachte.
»Na ja, es gibt noch ein paar andere schlaue Köpfe, aber die tragen es nicht so zur Schau. Die klüngeln nicht so wie die Geeks und Nerds.«
»Aha. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwo reinpasse.«
»Ich auch nicht: Ich bin nicht dumm, aber ich hab nicht das Zeug zur Eliteuni. Dann gibt’s noch die Künstlertypen – die Musiker und Theaterleute. Die sind mehr mein Ding, weil ich Malerei und Design liebe.«
»Dann solltest du meine Eltern kennenlernen.«
Sie tickte mit den Nägeln einen kleinen Trommelwirbel an ihre Getränkedose. »Gehörst du etwa zu der Familie? Das Künstlerpaar, das bei Mr Rodenheim ausstellen wird?«
»Ja.«
»Cool. Ich würde deine Eltern gern kennenlernen.«
Eine Gruppe von Jungen schlurfte vorbei, mit tief im Schritt hängenden Hosen, die aussahen, als würden sie ihnen jeden Moment vom Hintern rutschen.
»Und das hier sind ein paar unserer Skaterboys«, schnaubte Tina abfällig. »Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Nicht zu vergessen, es gibt noch die Bad Boys; du wirst sie allerdings nie hier bei uns Losern sehen, dafür sind sie nämlich viel zu cool. Wahrscheinlich hängen sie zusammen mit ihren Groupies auf dem Parkplatz rum und vergleichen, keine Ahnung, ihre Vergaser oder so. Aber nur, wenn sie ausnahmsweise mal nicht suspendiert sind. Wen habe ich vergessen? Es gibt noch ein paar Außenseiter, die in keine Schublade passen.« Sie zeigte auf eine kleine Gruppe in der Nähe der Essensausgabe. »Und dann haben wir natürlich noch unsere Skifahrerfraktion, ganz typisch für die Rockys. Meiner Ansicht nach sind das die Coolsten.« Sie musste meinen besorgten Gesichtsausdruck gesehen haben, weil sie hastig hinzufügte: »Du kannst aber mehreren Gruppen angehören – Skifahren und Baseball spielen, man kann in der Theater-AG sein und trotzdem Spitzennoten haben. Niemand muss sich nur auf eins festlegen.«
»Außer die Außenseiter.« Ich warf einen Blick zu den Schülern, auf die sie gezeigt hatte. Es war nicht wirklich eine Gruppe, eher eine Ansammlung schräger Vögel, die ansonsten niemanden hatten, zu dem sie sich setzen konnten. Ein Mädchen brabbelte leise vor sich hin – zumindest konnte ich nichts erkennen, was darauf hindeutete, dass sie gerade die Freisprechanlage ihres Handys benutzte. Ich spürte, wie mich plötzlich Panik überkam, dass ich irgendwann zu ihnen gehören könnte, falls Tina mich satthätte. Ich hatte seit jeher das Gefühl gehabt, irgendwie anders zu sein; es war nur ein schmaler Grat zwischen mir und den Sonderlingen.
»Ja, lass dich nicht von ihnen stören. Die gibt’s an jeder Schule.« Sie zog den Foliendeckel von ihrem Joghurt. »Also, wie war deine alte Schule so? Hogwarts? Stinkreiche Kids in schwarzen Gewändern?«
»Ähm, nein.« Ich verschluckte mich fast vor Lachen. Hätte Tina miterlebt, wie die zweitausend Schüler meiner Gesamtschule in ihrer 45-minütigen Mittagspause versuchten, in der proppevollen Mensa etwas Essbares zu ergattern, hätte sie weniger an Hogwarts als eher an einen Zoo denken müssen.
»Da war es mehr so wie hier.«
»Super. Dann wirst du dich ja bald ganz wie zu Hause fühlen.«
Bevor Sally und Simon mich adoptierten, war ich immer wieder irgendwo neu dazugekommen. Damals war ich von Heim zu Heim gereicht worden wie ein Wanderpokal, den niemand haben wollte. Und jetzt war ich also mal wieder die Fremde. Ich hatte das Gefühl, dass mir das jeder auf den ersten Blick ansah, wenn ich mit dem Übersichtsplan in der Hand durch die Flure tapste, ohne den leisesten Schimmer, wie die Dinge an dieser Schule funktionierten. Aber wahrscheinlich bildete ich mir das bloß ein und die anderen Schüler bemerkten mich noch nicht mal. Klassenräume und Lehrer wurden zu Orientierungspunkten und Tina war der sprichwörtliche Felsen, an den ich mich festklammerte, wenn es mich hin und wieder in ihre Nähe verschlug. Allerdings versuchte ich das geschickt zu überspielen, denn sie sollte nicht aus Angst, dass ich ihr zu sehr auf die Pelle rücken könnte, vor einer Freundschaft mit mir zurückschrecken. Ich brachte viele Stunden zu, ohne mit jemandem zu sprechen, und musste mich dazu zwingen, meine Schüchternheit zu überwinden und mit meinen Mitschülern zu reden. Dennoch hatte ich den Eindruck, dass ich zu spät gekommen war; die Schüler der Wrickenridge High hatten bereits viel Zeit gehabt, ihre Cliquen zu bilden und sich kennenzulernen. Ich jedoch stand außerhalb des Kreises und schaute von draußen hinein.
Als sich der Schultag dem Ende zuneigte, fragte ich mich, ob mich denn bis in alle Ewigkeit dieses Gefühl verfolgen würde, dass mein Leben ein klein wenig unscharf war, wie die verwaschenen Bilder eines raubkopierten Filmes. Entmutigt und auch ein bisschen deprimiert trottete ich zum Hauptausgang, um mich auf den Heimweg zu machen. Als ich mir einen Weg durch die aus dem Gebäude strömenden Schülermassen bahnte, erhaschte ich einen Blick auf die Bad Boys, von denen Tina beim Mittagessen gesprochen hatte. Sie standen in einem Fleckchen Sonne auf dem Parkplatz zusammen und sahen tatsächlich so aus, als ob sie schon einiges auf dem Kerbholz hätten. Es waren fünf Jungen, die alle lässig an ihren Motorrädern lehnten: zwei Afroamerikaner, zwei Weiße und ein dunkelhaariger Latino. Man hätte den Typen jederzeit und überall auf den Kopf zusagen können, dass sie Ärger machen würden. Für die Bildungswelt und ihre Vertreter – wir, die braven Schüler, die pflichteifrig erst nach Unterrichtsende aus dem Gebäude marschierten – hatten sie nur ein höhnisches Grinsen übrig. Die meisten Schüler machten einen großen Bogen um sie, wie Schiffe, die den gefährlichen Küstenabschnitt mieden; der Rest beäugte sie neidisch, hörte den Ruf der Sirene und war verlockt, sich zu nähern.
Ein Teil von mir wünschte, ich könnte das auch – so selbstsicher dastehen und dem Rest der Welt den Stinkefinger zeigen, weil alle so verdammt uncool waren. Wenn ich doch bloß endlos lange Beine hätte, schlagfertig wäre und eine Erscheinung, nach der sich die Leute die Köpfe verdrehten. Männlich zu sein war ebenfalls hilfreich: Ich könnte niemals diesen ultralässigen Look so rüberbringen, Daumen in die Gürtelschlaufen gehängt, mit den Stiefelspitzen den Straßenstaub wegkickend. War das ihr natürliches Verhalten oder eine kalkulierte Pose? Übten sie vor dem Spiegel? Ich verwarf diesen Gedanken schnell wieder – so etwas würden nur Loser wie ich machen; ihre Coolness war sicher angeboren, in ihnen herrschte Eiszeit. Der Latino-Typ faszinierte mich besonders – seine Augen waren hinter einer Sonnenbrille verborgen, während er am Sitz seines Motorrads lehnte, ein König mit seinen Rittern. Er hatte sicher nicht mit dem Gefühl zu kämpfen, unzulänglich zu sein.
Ich schaute zu, wie er seine Maschine bestieg und den Motor auf Touren brachte wie ein Krieger, der ein monsterähnliches Schlachtross anspornte. Er verabschiedete sich von seinen Kumpels, dann schoss er vom Parkplatz und die umherstehenden Schülergrüppchen stoben auseinander. Ich hätte viel dafür gegeben, nach einem langen Schultag hinten auf diesem Motorrad sitzen zu können und von meinem Ritter nach Hause kutschiert zu werden. Oder noch besser: die Fahrerin zu sein, die einsame Superheldin, die in ihrer hautengen Ledermontur gegen das Unrecht kämpfte und alle Männer schwachmachte.
Ein selbstironisches Lachen ertönte und würgte meine Gedanken ab. Hör dir doch nur mal selbst zu! Ich schalt mich für meine überbordende Fantasie. Krieger und Monster – Superhelden? Ich hatte wohl zu viele Manga-Comics gelesen. Diese Jungs spielten in einer ganz anderen Liga als ich. Ich war noch nicht mal ein Pünktchen auf ihrem Radar. Ich sollte dankbar sein, dass niemand in meinen Kopf hineingucken und sehen konnte, wie überspannt ich war. Manchmal hatte ich eine ziemlich verzerrte Wahrnehmung der Realität und driftete in Tagträumereien ab, die meinen Blick trübten. Ich war einfach nur die gute alte Sky; sie waren Götter: So war die Welt nun mal.
Kapitel 3
In den folgenden Tagen lernte ich die Schule besser kennen, füllte ganz allmählich die blinden Flecken auf meiner Übersichtskarte und fand Schritt für Schritt heraus, wie man hier alles so handhabte. Als ich erst mal den Unterrichtsstoff, der mir fehlte, nachgelernt hatte, stellte ich fest, dass ich mit allen Kursen gut klarkam, auch wenn ein paar Lehrmethoden ungewohnt waren. Es ging wesentlich förmlicher zu als in England – die Schüler durften die Lehrer nicht beim Vornamen nennen und alle saßen separat in langen Reihen hintereinander statt in Paaren –, aber alles in allem hatte ich mich gut eingefunden. Und so wiegte ich mich in vermeintlicher Sicherheit und war vollkommen unvorbereitet auf den Schock, den meine erste Sportstunde für mich bereithielt.
Mrs Green, unsere heimtückische Sportlehrerin, bereitete uns Mittwochmorgen eine kleine Überraschung. Es sollte ein Gesetz geben, das Lehrern so etwas verbietet. Wir hätten wenigstens die Chance kriegen müssen, uns eine Krankschreibung besorgen zu können.
»Ladys, wie ihr wisst, haben wir sechs unserer besten Cheerleader ans College verloren, darum bin ich auf der Suche nach neuen Talenten.«
Ich war nicht die Einzige, die dastand wie vom Donner gerührt.
»Na kommt, das ist jetzt keine angemessene Reaktion! Unser Team braucht eure Unterstützung. Wir können nicht zulassen, dass Aspen lauter singt und besser tanzt als wir, richtig?«
Yes we can, sang ich leise den Obama-Refrain.
Sie betätigte eine Fernbedienung und der Taylor-Swift-Song »You belong with me« dröhnte aus den Lautsprechern.
»Sheena, du weißt, wie’s geht. Zeig den anderen Mädchen die Schritte des ersten Teils.«
Eine hochaufgeschossene, honigblonde Gazelle schritt anmutig nach vorne und begann eine Choreografie vorzutanzen, die für mich höllisch kompliziert aussah.
Seht ihr, ganz einfach«, erklärte Mrs Green. »Jetzt bitte alle aufstellen.« Ich schlich mich in die letzte Reihe. »Du da, die Neue. Ich kann dich nicht sehen.« Ganz genau: Das war der Plan gewesen. »Komm nach vorne. Und jetzt, eins, zwei, drei und kick.«
Okay, ich war kein ganz hoffnungsloser Fall. Selbst mir gelang es, in etwa Sheenas Bewegungen nachzumachen. Trotzdem kam das Unterrichtsende nur quälend langsam näher.
»Jetzt werden wir das Ganze ein bisschen aufpeppen«, verkündete Mrs Green. Na, wenigstens eine hatte hier ihren Spaß. »Holt die Pompoms!«
Auf keinen Fall. Ich würde nicht mit diesen albernen Dingern herumfuchteln. Hinter Mrs Green konnte ich ein paar Jungs aus meiner Klasse sehen. Sie waren von ihrem Trainingslauf zurück und beobachteten uns durch die Fenster der Turnhallencafeteria. Hämisch grinsend. Na toll.
Mrs Green bemerkte, dass sich die Aufmerksamkeit der ersten Reihe auf etwas richtete, was hinter ihrem Rücken geschah, und so bekam sie mit, dass wir Publikum hatten. Lautlos wie ein Ninja-Krieger schlich sie sich an unsere Zuschauer heran und schleifte sie, ehe sie wussten, wie ihnen geschah, in die Halle.
»Wir an der Wrickenridge High sind für Chancengleichheit.« Mit einem schadenfrohen Grinsen drückte sie ihnen Pompoms in die Hand. »Aufstellen, Jungs.«
Jetzt waren wir es, die lachten, als sich die Jungs mit hochroten Gesichtern notgedrungen bei uns einreihten. Mrs Green stand vorne und bewertete unser Können – oder Nichtkönnen. »Hmm, das reicht nicht, das reicht nicht. Ich glaube, wir müssen ein paar Würfe üben. Neil …« Sie wählte einen breitschultrigen Jungen mit kahl rasiertem Schädel aus. »Du hast doch letztes Jahr zum Squad gehört, du weißt, was zu tun ist.«
Werfen klang nicht schlecht. Pompoms rumzuschmeißen war besser, als mit ihnen zu wedeln.
Mrs Green tippte drei weiteren Jungs auf die Schulter. »Meine Herren, ich möchte gern, dass ihr vier nach vorne kommt. Verschränkt eure Arme ineinander zu einer Art Korb – ja, genau so. Und jetzt brauchen wir das zierlichste Mädchen.«
Nein, ausgeschlossen. Ich duckte mich hinter Tina, die, ihre Hand mit dem Pompom in die Hüfte gestemmt, netterweise versuchte, mir etwas mehr Deckung zu geben.
»Wo ist sie denn hin, das Mädchen aus England? Sie war doch eben noch hier.«
Sheena machte mir und meinem tollen Plan einen Strich durch die Rechnung. »Sie steht hinter Tina, Ma’am.«
»Komm her, meine Liebe. Also, es ist ganz einfach. Setz dich auf ihre verschränkten Arme, dann werfen sie dich hoch in die Luft und fangen dich wieder auf. Tina und Sheena, holt mal eine Matte, nur für alle Fälle.« Offenbar machte ich Augen, so groß wie Untertassen, denn Mrs Green tätschelte mir die Wange. »Keine Bange, du brauchst nichts weiter zu machen, als deine Arme und Füße zu strecken und so zu gucken, als ob du Spaß hättest.«
Ich beäugte die Jungen misstrauisch; sie sahen mich genau an, vermutlich das allererste Mal überhaupt, und schätzten, wie viel Gewicht ich auf die Waage brachte. Dann fasste Neil anscheinend einen Entschluss, denn er zuckte die Achseln und sagte: »Ja, das kriegen wir hin.«
»Auf drei!«, bellte die Lehrerin.
Sie packten mich und schwupps, sauste ich auch schon hoch in die Luft. Mein Kreischen war vermutlich noch in England zu hören gewesen. Jedenfalls stürmte daraufhin der Basketballtrainer mit den restlichen Jungen herein. Vermutlich dachten sie, es würde gerade ein brutaler Mord geschehen.
Mrs Green würde mich wohl doch nicht für das Squad auswählen.
Ich stand noch immer unter Schock, als ich mit Tina beim Mittagessen saß, und rührte kaum einen Bissen an. Mein Magen hatte sich noch nicht wieder von meinem Höhenflug erholt.
»Bei diesem Wurf geht’s ganz schön weit nach oben, was?« Tina schnipste gegen meinen Arm, um mich aus meiner Starre zu lösen.
»Oh. Mein. Gott.«
»Für so ein kleines Persönchen kannst du echt ganz schön viel Krach machen.«
»Das würdest du auch, wenn eine sadistische Lehrerin beschließen würde, dich zu foltern.«
Tina schüttelte ihre Mähne. »Das wird nicht passieren – bin zu groß dafür.« Sie fand das auch noch lustig. »Und, Sky, was hast du mit dem Rest deiner Pause vor?«
Wieder etwas gefasster, kramte ich eine Broschüre aus meinem Begrüßungspaket und legte sie zwischen uns hin. »Ich dachte, ich seh mir mal die Orchesterprobe an. Willst du mitkommen?«
Sie schob die Broschüre mit einem gequälten Lachen beiseite. »Tut mir leid, das musst du allein machen. Sie lassen mich nicht mal in die Nähe des Musiksaals. Scheiben splittern, sobald ich auch nur den Mund zum Singen öffne. Welches Instrument spielst du denn?«
»Verschiedene«, sagte ich.
»Ich will alle Einzelheiten hören, Schwester.« Sie winkte mit dem gekrümmten Finger, um mir die Worte zu entlocken.
»Klavier, Gitarre und Saxofon.«
»Mr Keneally wird vor Freude tot umfallen, wenn er das hört. Eine Ein-Frau-Band! Singst du auch?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Puh! Und ich hatte schon gedacht, ich müsste dich jetzt dafür hassen, dass du so widerlich talentiert bist.« Sie stellte ihr Tablett auf dem Geschirrtrolley ab. »Zu den Musikräumen geht’s da lang. Ich zeig dir den Weg.«
Ich hatte Fotos auf der Website der Schule gesehen, aber die Musikabteilung war noch viel besser ausgestattet, als ich gehofft hatte. Im Hauptsaal stand ein glänzender schwarzer Flügel und ich konnte es kaum erwarten, darauf zu spielen. Als ich eintrat, waren überall Schüler, ein paar zupften an ihren Gitarren herum, einige Mädchen übten Tonleitern auf der Flöte. Ein großer, dunkelhaariger Junge mit einer John-Lennon-Brille wechselte mit ernster Miene das Blatt seiner Klarinette. Ich schaute mich nach einem Sitzplatz um, der etwas abseits lag und doch eine gute Sicht auf den Flügel bot. Ganz am anderen Ende des Raums war neben einem Mädchen ein Platz frei. Ich hielt darauf zu, doch ihre Freundin pflanzte sich dort hin, bevor ich es konnte.
»Tut mir leid, aber hier ist besetzt«, sagte das Mädchen, als es sah, dass ich wie angewurzelt stehen blieb.
»Ach ja, richtig. Okay.«
Ich hockte mich auf die Kante eines Tisches, wartete ab und vermied es, irgendjemanden anzusehen.
»Hey, du bist Sky, richtig?« Ein Junge mit kahl rasiertem Kopf und kaffeebrauner Haut schüttelte umständlich meine Hand. Er bewegte sich mit der luftigen Anmut der Langgliedrigen. Wäre er in einer meiner erdachten Comic-Geschichten vorgekommen, dann hätte er Elasto-Mann oder so geheißen.
Hör jetzt auf und konzentrier dich, Sky.
»Ähm, hi. Du kennst mich?«
»Ja. Ich bin Nelson. Du hast meine Grandma kennengelernt. Sie hat mir gesagt, dass ich mich um dich kümmern soll. Und, sind alle nett zu dir?«
Okay – er war also überhaupt nicht wie Mrs Hoffman, dafür war er viel zu cool. »Ja, alle waren bisher sehr freundlich.«
Er grinste, als er meinen Akzent hörte, setzte sich neben mich und legte die Füße auf den Stuhl, der vor ihm stand. »Sehr gut. Ich glaube, du wirst dich hier ganz schnell einfinden.«
Was er sagte, war genau das, was ich in diesem Moment hören wollte, da mir gerade die ersten Zweifel gekommen waren. Ich beschloss, dass ich Nelson mochte.
Die Tür flog krachend auf. Und hereinkam Mr Keneally, ein kräftiger Mann mit dem rotblonden Haarschopf eines Kelten und einem Stapel Noten in der Hand. Ich wusste sofort, welche Rolle er in meinem Kopf-Comic spielen würde: der Master of Music, Rächer aller Misstöne. Und ganz sicher kein geeigneter Kandidat für eng anliegende Klamotten.
»Meine werten Damen und Herren«, setzte er an, ohne stehen zu bleiben. »Wie jedes Jahr nähern wir uns Weihnachten mit beängstigender Geschwindigkeit und haben ein großes Konzertprogramm in Planung. Und Sie sollten dann in der Lage sein, die ganze Palette Ihres Könnens zu präsentieren.« Ich konnte deutlich seine persönliche Erkennungsmelodie heraushören: jede Menge Trommeln und enorm viel aufgebaute Spannung, eine auf Touren gebrachte Version der Ouvertüre ›1812‹.
»Orchesterprobe findet mittwochs statt, die Jazzband ist am Freitag dran. Und all die aufstrebenden Rockstars unter Ihnen, die im Musiksaal proben wollen, sollen mich zuerst fragen kommen. Aber was halte ich mich damit überhaupt auf – Sie wissen, wie’s läuft.« Er knallte den Notenstapel auf den Tisch. »Nur Sie vermutlich nicht.« Der Master of Music durchdrang mich mit seinem Röntgenblick.
Wie ich es hasste, die Neue zu sein.
»Ich find mich schnell zurecht, Sir.«
»Das ist gut. Name?«
Mit zunehmendem Groll gegen den absonderlichen Namensgeschmack meiner Eltern nannte ich meinen Namen und erntete das übliche Kichern von all denen, die ihn bisher noch nicht gehört hatten.
Mr Keneally runzelte die Stirn. »Welches Instrument spielen Sie, Miss Bright?«
»Ein bisschen Klavier. Ähm, und Gitarre und Tenorsaxofon.«
Mr Keneally federte auf seinen Ballen auf und ab; er erinnerte mich an einen Schwimmer kurz vor dem Sprung ins Wasser. »Ist ›ein bisschen‹ der britische Ausdruck für ›sehr gut‹?«
»Ähm …«
»Jazz, Klassik oder Rock?«
»Äh, Jazz, glaube ich.« Mir war alles recht, solange es die Noten dazu gab.
»Jazz, glauben Sie? Sie scheinen sich da nicht so sicher zu sein, Miss Bright. Musik, das ist nicht: mal so, mal so; Musik, das ist: leben oder sterben!«
Seine kleine Rede wurde von einem Zuspätkommer unterbrochen. Der Latino-Biker schlenderte in den Raum hinein. Die Hände in den Hosentaschen, marschierte er mit seinen ellenlangen Beinen zum Fenster hinüber und setzte sich neben den Klarinettisten aufs Sims. Ich war mehr als überrascht, dass der Biker überhaupt an irgendwelchen Schulaktivitäten teilnahm; ich hatte geglaubt, er würde über solchen Dingen stehen. Oder war er vielleicht auch nur gekommen, um sich über uns lustig zu machen? Er lehnte am Fensterbrett auf die gleiche Weise wie an seinem Motorradsitz, mit lässig überkreuzten Füßen und einem amüsierten Gesichtsausdruck, so als hätte er das alles schon mal gehört. Und als wäre es ihm völlig egal.
Alles, woran ich denken konnte, war, dass man Typen wie ihn in Richmond vergebens suchte. Dabei war es gar nicht mal sein werbeplakatreifes Aussehen, sondern eher diese rohe Energie, die in ihm steckte, diese aufgestaute Wut, wie bei einem im Käfig gefangenen Tiger. Ich konnte meinen Blick nicht von ihm losreißen. Und ich war nicht die Einzige, der es so erging. Die Atmosphäre im Raum hatte sich spürbar verändert. Die Mädchen setzten sich alle ein klein bisschen aufrechter hin, die Jungen wurden nervös – und das alles, weil dieses gottähnliche Geschöpf geruht hatte, sich zu uns Normalsterblichen zu begeben. Oder war er der Wolf unter den Schafen?
»Mr Benedict, wie liebenswürdig von Ihnen, dass Sie sich uns anschließen«, sagte Mr Keneally mit einer vor Sarkasmus triefenden Stimme. Seine gute Laune von eben war verflogen. Eine kleine Szene stand mir plötzlich vor Augen: Der Master of Music steht dem widerwärtigen Wolfman im Duell gegenüber, bewaffnet mit einer Sprühdose voll Noten. »Wir sind alle hocherfreut, dass es Ihnen gelungen ist, sich von Ihren zweifellos weit wichtigeren Angelegenheiten loszureißen, um gemeinsam mit uns zu musizieren, auch wenn Ihr Auftritt hier etwas verspätet ist.«
Der Junge zuckte ohne ein Anzeichen von Reue mit einer Augenbraue. Er nahm zwei Trommelstöcke in die Hand und drehte sie zwischen seinen Fingern. »Bin ich zu spät?« Seine Stimme klang dunkel, genau so, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Der Klarinettist stieß ihn mutig in die Seite, um ihn zur Ordnung zu rufen.
Mr Keneally fühlte sich eindeutig provoziert. »Ja, Sie sind zu spät. Ich glaube, es ist Brauch an dieser Schule, dass man sich bei Lehrern entschuldigt, wenn man nach ihnen zum Unterricht erscheint.«
Die Trommelstöcke hörten auf zu wirbeln, der Junge starrte ihn für einen Moment mit arrogantem Blick an, so wie ein junger Lord einen Bauern mustert, der es gewagt hat, Einwände zu erheben. Schließlich sagte er: »Tut mir leid.«
Alle im Raum schienen erleichtert aufzuatmen, weil es diesmal nicht zum Eklat gekommen war.
»Tut’s Ihnen nicht – aber ich will’s dabei bewenden lassen. Seien Sie gewarnt, Mr Benedict: Sie mögen Talent haben, aber ich bin nicht an Primadonnen interessiert, die ihre Musikerkollegen respektlos behandeln. Und Sie, Miss Bright, sind Sie denn wenigstens ein Teamplayer?« Mr Keneally wandte sich mir zu und zerstörte damit alle meine Hoffnungen, dass er mich vergessen hatte. »Oder vertreten Sie die gleiche Haltung wie unser Mr Zed Benedict?«
Eine sehr unfaire Frage. Hier tobte eine Schlacht zwischen zwei Giganten und ich stand genau zwischen den Fronten. Ich hatte noch kein Wort mit Wolfman gewechselt und wurde bereits aufgefordert, Kritik an ihm zu üben. Seine Erscheinung flößte sogar extrem selbstbewussten Mädchen leise Ehrfurcht ein. Mein Selbstwertgefühl war sowieso schon im Keller, und so empfand ich blanke Panik.
»Ich … ich weiß nicht. Aber ich war auch zu spät.«
Wolfman streifte mich mit einem Blick und maß mir dann ungefähr so viel Bedeutung zu wie einem Schlammspritzer auf seinen Superboots.
»Dann wollen wir doch mal sehen, was Sie auf dem Kasten haben. Die Jazzband, bitte. Mr Hoffman, Sie spielen das Saxofon, Yves Benedict Klarinette. Vielleicht können Sie Ihren Bruder ja dazu veranlassen, uns am Schlagzeug zu entzücken?«
»Natürlich, Mr Keneally«, erwiderte die John-Lennon-Brille und schoss dem Biker einen finsteren Blick zu. »Zed, komm hier rüber.«
Sein Bruder? Wow, wie war das denn bitte passiert? Schon möglich, dass sie sich ein klitzekleines bisschen ähnlich sahen, aber was ihr Auftreten anging, kamen sie von verschiedenen Planeten.
»Miss Bright kann meinen Platz am Klavier einnehmen.« Mr Keneally strich zärtlich über den Flügel.
Ich wollte wirklich nicht vor allen spielen.
»Ähm, Mr Keneally, mir wäre es lieber …«
»Setzen.«
Ich setzte mich und stellte die Höhe des Hockers auf meine Größe ein. Wenigstens kannte ich das Stück.
»Lass dich vom Professor nicht einschüchtern«, murmelte Nelson und tätschelte mir kurz die Schulter. »So macht er das mit jedem – er stellt die Nerven auf die Probe, sagt er immer.«
Ich spürte, dass ich mit meinen bereits am Ende war, während ich darauf wartete, dass alle ihre Plätze eingenommen hatten.
»Okay, dann wollen wir mal hören«, sagte Mr Keneally, der im Publikum saß und zuschaute.
Schon mit der ersten Berührung wusste ich, dass der Flügel ein echtes Schätzchen war – perfekt gestimmt, kraftvoll und mit einer großen Klangbreite. Nichts wirkte auf mich so entspannend, wie am Klavier zu sitzen, es schuf eine Barriere zwischen mir und den anderen Leuten im Raum. In die Noten einzutauchen milderte mein Lampenfieber und ich fing an, Spaß zu haben. Ich lebte für die Musik auf die gleiche Weise, wie meine Eltern für die Kunst lebten. Es ging mir nicht um den Auftritt – eigentlich spielte ich lieber in einem leeren Raum –, für mich ging es darum, Teil der Komposition zu werden, die Noten zu spielen und ihnen den Zauber zu entlocken. Wenn ich mit anderen zusammenspielte, waren sie für mich nicht Menschen mit ihren jeweiligen Charaktereigenschaften, sondern Töne: Nelson, geschmeidig und locker; Yves, der Klarinettist, poetisch, schlau und manchmal witzig; Zed – tja, Zed war der Herzschlag, der die Melodie vorantrieb. Mir kam es so vor, als begreife er die Musik auf ähnliche Weise wie ich, sein Gespür für Stimmungs- und Tempiwechsel war nahezu perfekt.
»Sehr gut, nein, hervorragend!«, rief Mr Keneally, als wir zu Ende gespielt hatten. »Ich fürchte, ich bin gerade aus der Jazzband rausflogen.« Er zwinkerte mir zu.
»Du warst genial!«, sagte Nelson leise, als er hinter mir vorbeiging.
Danach wandte sich Mr Keneally der Organisation der Chor- und Orchesterproben zu, aber es wurde niemand anderes nach vorn gerufen, um zu spielen. Ich wollte meinen sicheren Platz im Schutz des Flügels nicht aufgeben und so blieb ich, wo ich war, starrte auf das Spiegelbild meiner Hände im offenen Flügeldeckel und glitt mit den Fingern über die Tasten, ohne sie anzuschlagen. Ich spürte eine leichte Berührung an der Schulter. Die Schüler verließen gerade den Raum, doch Nelson und der Klarinettist waren hinter mich getreten. Zed stand ein Stück abseits und machte noch immer ein Gesicht, als wäre er lieber ganz woanders.
Nelson zeigte auf den Klarinettisten. »Sky, das ist Yves.«
»Hallo. Du spielst echt gut.« Yves lächelte und schob seine Brille auf dem Nasenrücken zurecht.
»Danke.«
»Der Idiot da ist mein Bruder Zed.« Er machte eine vage Handbewegung in Richtung des finster dreinblickenden Bikers.
»Komm jetzt, Yves«, brummte Zed.
Yves ignorierte ihn. »Kümmer dich einfach nicht um ihn. Er ist mit jedem so.«
Nelson lachte und drehte sich weg.
»Seid ihr Zwillinge?« Sie entsprachen dem gleichen Typ, mit dem gleichen goldbraunen Teint, aber Yves hatte ein rundes Gesicht und sein schwarzes, glänzendes Haar war glatt. Er sah aus wie ein junger Clark Kent. Zed hatte markante Gesichtszüge, eine kräftige Nase, große Augen mit langen Wimpern und einen dichten Lockenschopf; seine Sorte fand sich eher bei den verrufenen Bad Boys als bei den netten Langweilern. Ein gefallener Held, eine tragische Figur, die zur dunklen Seite übergetreten war wie Anakin Skywalker …
Bleib bei der Sache, Sky.
Yves schüttelte den Kopf. »Bloß nicht! Ich bin ein Jahr älter als er. Ich bin in der Oberstufe. Er ist das Küken der Familie.«
Noch nie hatte ich jemanden gesehen, zu dem diese Beschreibung so wenig passen wollte. Meine Hochachtung für Yves stieg gewaltig, da er sich durch seinen Bruder ganz offensichtlich nicht einschüchtern ließ.
»Oh Mann, danke, Bruderherz. Das wollte sie jetzt ganz bestimmt wissen.« Zed verschränkte die Arme und tappte ungeduldig mit dem Fuß auf den Boden.
»Wir sehen uns bei der Bandprobe.« Yves zog Zed mit sich.
»Ja, klar«, murmelte ich und sah den zwei Brüdern hinterher. »Ich wette, ihr könnt’s kaum erwarten.« Ich summte passend zu ihrem Abgang eine kleine ironische Melodie und stellte mir vor, wie sie sich Seite an Seite in den Himmel aufschwangen und dem Blickfeld von uns Normalsterblichen entschwanden.
Kapitel 4
An diesem Nachmittag brachte mich Tina mit dem Auto nach Hause, weil sie, wie sie sagte, sehen wollte, wo ich wohnte. Ich glaube, eigentlich war sie nur darauf aus, meine Eltern kennenzulernen. Ihr fahrbarer Untersatz verfügte nur über zwei Sitze vorne, denn Fahrgast- und Kofferraum hatte ihr Bruder, der Klempner war, als Staufläche für sein Werkzeug gebraucht. Man konnte noch immer die Worte Monterey – Sanitär, Heizung, Installation auf der Seite lesen.
»Er hat ihn mir geschenkt, als er sich einen Truck gekauft hat«, erklärte sie vergnügt und hupte dabei, um eine Gruppe von Teenagern auseinanderzuscheuchen. »Er ist mindestens noch einen Monat lang offiziell mein Lieblingsbruder.«
»Wie viele Brüder hast du denn?«
»Zwei. Mehr als genug. Und du?«
»Ich hab keine Geschwister.«
Sie plapperte wie ein Wasserfall, während wir uns durch die Stadt fädelten. Ihre Familie klang toll – ein bisschen chaotisch, aber sehr innig. Kein Wunder also, dass sie solch ein unerschütterliches Selbstbewusstsein hatte.
Sie trat das Gaspedal durch und wir schossen den Hügel hinauf.
»Ich habe bei der Orchesterprobe Zed und Yves Benedict kennengelernt«, sagte ich ganz beiläufig und versuchte den Umstand zu ignorieren, dass ich wie ein Astronaut beim Take-off in meinen Sitz gepresst wurde.
»Ist Zed nicht umwerfend!« Sie schmatzte begeistert mit den Lippen und umkurvte knapp eine Katze, die es gewagt hatte, vor ihr die Straße zu überqueren.
»Ja, vermutlich.«
»Da gibt’s nichts zu vermuten. Dieses Gesicht, dieser Körper – was könnte sich ein Mädchen mehr wünschen?«
Jemanden, der sie beachtet?, dachte ich.
»Aber er lässt immer den Megacoolen raushängen – das treibt die Lehrer in den Wahnsinn. Zwei seiner Brüder waren genauso, aber es heißt, er sei der Schlimmste von allen. Ist letztes Jahr fast von der Schule geflogen wegen respektlosen Verhaltens gegenüber einem Lehrer. Allerdings hat keiner von uns Mr Lomas gemocht. Wie sich dann herausstellte, hatte er dafür ein paar von uns zu sehr gemocht, falls du verstehst, was ich meine. Er wurde am Ende des Halbjahres gefeuert.«
»Igitt.«
»Ja, na ja. Es sind sieben Söhne in der Familie. Drei leben immer noch daheim, in einem Haus oberhalb der Stadt, gleich neben der Seilbahnstation. Die älteren Brüder leben in Denver.«
»Seilbahn?«
»Ja, ihr Dad bedient während der Saison die Seilbahn. Ihre Mom ist Skilehrerin. Die Benedict-Jungs gelten als die Könige der Pisten.«
»Es gibt sieben von ihrer Sorte?«
Tina hupte einen Fußgänger an und scheuchte ihn mit wedelnden Händen auf die andere Straßenseite. »Die Benedicts sind einem System gefolgt: Trace, Uriel, Victor, Will, Xavier, Yves und Zed. Vermutlich, damit sie sich’s besser merken können.«
»Komische Namen.«
»Komische Familie, aber sehr cool.«
Als wir ankamen, packten Sally und Simon gerade ihre Malutensilien aus. Es war nicht zu übersehen, wie sie sich freuten, dass ich schon so bald eine Freundin mit nach Hause gebracht hatte. Sie machten sich wegen meiner Schüchternheit sogar noch mehr Sorgen als ich.
»Tut mir leid, aber wir können dir nichts weiter als Kekse aus dem Supermarkt anbieten«, sagte meine Mutter und wühlte raschelnd in einer Lebensmittelkiste auf dem Küchentresen. Als ob sie eine von den Müttern wäre, die selbst backten!
»Und da hatte ich auf einen standesgemäßen englischen Afternoon-Tea gehofft«, sagte Tina augenzwinkernd. »Sie wissen schon, mit diesen winzig kleinen Häppchen mit Gurkenscheiben und so kleinen Kuchendingern, die man mit Marmelade und Rahm isst.«
»Du meinst Scones«, sagte Simon. »Tina, Sky hat uns erzählt, du interessierst dich für Kunst? Was hast du denn so über das neue Künstlerhaus gehört?«
»Ich habe das Gebäude gesehen – hammermäßig! Mr Rodenheim hat sich mit dem Haus richtig ins Zeug gelegt.« Tina erhaschte einen Blick auf ein Skizzenbuch, das Sally gerade auspackte. Mit beeindruckter Miene betrachtete sie die Entwürfe etwas eingehender. »Die sind klasse. Kohle?«
Sally legte sich ihren Schal um die Schultern. »Ja, ich benutze gern Kohle für meine Skizzen.«
»Werden Sie auch Unterricht geben?«
»So war es vereinbart«, sagte Sally und warf Simon einen erfreuten Blick zu.
»Da würde ich gern dran teilnehmen, Mrs Bright.«
»Natürlich, Tina. Und bitte nenn mich Sally.«
»Sally und Simon«, fügte Dad hinzu.
»Okay.« Tina legte das Skizzenbuch hin und vergrub die Hände in ihren Hosentaschen. »Und hat Sky die künstlerischen Gene von Ihnen geerbt?«
»Äh, nein.« Sally lächelte mich leicht verlegen an. So war es immer, wenn Leute nachfragten. Wir hatten vereinbart, dass wir niemals vorgeben würden, etwas anderes zu sein als das, was wir waren.
»Ich bin adoptiert, Tina«, erklärte ich. »Mein Leben war etwas kompliziert, bevor ich zu ihnen kam.«
Im Klartext hieß das: ›komplett verpfuscht‹. Mit sechs Jahren war ich an einer Autobahnraststätte ausgesetzt worden; meine leiblichen Eltern hatte man nie ausfindig machen können. Ich war traumatisiert gewesen und noch nicht mal in der Lage, mich an meinen eigenen Namen zu erinnern. In den darauffolgenden vier Jahren hatte ich ausschließlich über Musik kommuniziert. Keine Zeit, an die ich gern zurückdachte. Tief in meinem Inneren war das quälende Gefühl geblieben, dass mich eines Tages irgendjemand zurückfordern würde, so wie einen bei einer Reise verloren gegangenen Koffer. Ich wollte nicht, dass man mich ausfindig machte.
»Oh, tut mir leid – das war ja wohl ein Fettnäpfchen. Aber deine Eltern sind genial.«
»Schon okay.«
Sie nahm ihre Tasche. »Cool. Ich muss los. Wir sehen uns morgen.« Mit einem vergnügten Winken verschwand sie.
»Ich mag deine Tina«, erklärte Sally und nahm mich in den Arm.
»Und sie findet, ihr seid genial.«