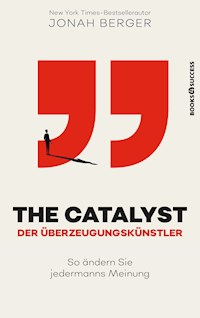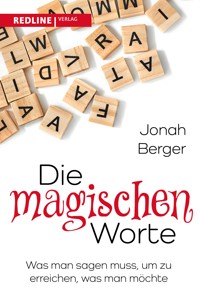
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Auf die richtigen Worte kommt es an Die Wahl der passenden Worte ist immer entscheidend – ob bei der Kindererziehung, der Motivation des Teams, dem Aufbau starker Beziehungen oder beim Überzeugen von Kunden. Umso mehr, da bestimmte Wörter mehr Wirkungskraft als andere haben. Welche das sind, wie man sie richtig einsetzt und Sprache im Allgemeinen effektiver nutzt, erklärt der Marketingexperte und Bestsellerautor Jonah Berger. Er beschreibt die sechs Arten von magischen Wörtern – unter anderem solche, die Vertrauen vermitteln oder Emotionen nutzen. Berger zeigt mit vielen Beispielen, wie schon kleine Veränderungen in der Kommunikation viel bewirken können: man dank der richtigen Sprache beispielsweise auf ein zweites Date eingeladen wird oder mittels spezieller Präpositionen seine Chancen auf ein Jobangebot erhöht. Für alle, die mit der richtigen Wortwahl ihre Wirkung steigern und andere zielsicher überzeugen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Ähnliche
Jonah Berger
Die magischen Worte
Jonah Berger
Die magischen Worte
Was man sagen muss, um zu erreichen, was man möchte
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
1. Auflage 2023
© 2023 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,
Türkenstraße 89
D-80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
© der Originalausgabe 2023 by Jonah Berger
Die englische Originalausgabe erschien 2023 bei Harper Business, einem Imprint von HarperCollins Verlag LLC, unter dem Titel Magic Words.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Nikolas Bertheau
Redaktion: Christiane Otto
Umschlaggestaltung: Marc Fischer
Umschlagabbildung: Serhii Khanas/ Shutterstock
Satz: Satzwerk Huber, Germering
eBook by tool-e-byte
ISBN Print 978-3-86881-933-5
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96267-509-7
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96267-510-3
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.redline-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
INHALT
Einführung
1 Tun oder Sein
2 Zuversicht vermitteln
3 Die richtigen Fragen stellen
4 Konkretes Verhalten wirksam einsetzen
5 Die Rolle der Gefühle
6 Ähnlichkeiten (und Unterschiede) nutzen
7 Was Sprache verrät
Epilog
Anhang: Leitfaden für die Nutzung und Anwendung computerlinguistischer Tools
Danksagung
Über den Autor
Anmerkungen
EINFÜHRUNG
Kurz nach seinem ersten Geburtstag begann unser Sohn Jasper, »please« – bitte – zu sagen. Oder es zumindest zu versuchen. Er konnte das L noch nicht aussprechen, und so klang es mehr wie »peas« – Erbsen –, aber das war nahe genug dran, um uns zu zeigen, was er sagen wollte.
Dass er das Wort verwendete, war für sich genommen nicht allzu überraschend. Mit sechs Monaten können die meisten Kinder elementare Laute unterscheiden, und mit etwa einem Jahr sprechen sie in der Regel ein bis drei Wörter.
Interessant war jedoch die Art und Weise, wie er es verwendete.
Er sagte etwas, was er wollte, wie zum Beispiel »up«, »yo« (für yogurt) oder »brow ber« (für brown bear) und wartete dann auf den Effekt. Wenn er bekam, was er wollte, ließ er es damit bewenden. Dann sagte er weiter nichts mehr. Wenn er das Gewünschte jedoch nicht sofort bekam und ihm schien, als hätten wir gerade nicht die Absicht, alles stehen und liegen zu lassen, um ihm das Gewünschte zu bringen, schaute er uns in die Augen, nickte mit dem Kopf und sagte »peas«.
Mit der Zeit nahm Jaspers Wortschatz zu. Er begann, über seine Lieblingstiere zu reden (»dido« für dinosaurs), Dinge, die er sich wünschte (»wee« für Dias), und Zahlen. Er ergänzte »peas« sogar um das Wort »yeah«, um zu zeigen, dass er es ernst meinte, zum Beispiel »Yo, peas, yeah« für Yes, I’d like yogurt ... I mean it in Erwachsenenenglisch.
Aber »peas« war besonders. Denn »peas« war das erste Mal, dass ihm bewusst wurde, dass Wörter etwas bewirken können. Dass sie eine Handlung auslösen können. Dass er, wenn er etwas wollte und es nicht bekam, durch Hinzusetzen des Wortes »peas« erreichen konnte, dass er es doch bekam. Oder zumindest mit größerer Wahrscheinlichkeit.
Jasper hatte sein erstes magisches Wort entdeckt.
Bei fast allem, was wir tun, sind auch Worte beteiligt. Wir verwenden Worte, um zu kommunizieren, uns auszudrücken und die Nähe zu geliebten Menschen zu pflegen. Führungskräfte nutzen Worte, um ihrer Führungsaufgabe gerecht zu werden, Verkäufer nutzen sie, um Käufer zu gewinnen, und Eltern könnten ohne sie nicht ihre Elternrolle ausfüllen. Lehrer unterrichten mit Worten, Politiker bedienen sich ihrer und Ärzte klären Patienten mit Worten auf. Selbst unsere unausgesprochenen Gedanken setzen Sprache voraus.
Schätzungen zufolge verwenden wir täglich rund 16 000 Wörter.1 Wir verfassen E-Mails, bereiten Präsentationen vor und sprechen mit Freunden, Kollegen und Kunden. Wir entwerfen auf Datingplattformen unser Onlineprofil, führen Zaungespräche mit Nachbarn und tauschen uns mit unseren Partnern aus, wie unser Tag verlief.
Aber wie viel Zeit wir auch mit Sprache verbringen – nur selten machen wir uns bewusst, was genau wir sagen. Vielleicht machen wir uns Gedanken über die Ideen, die wir zum Ausdruck bringen wollen, aber wir beschäftigen uns weniger mit den konkreten Worten, die wir dafür verwenden. Und warum sollten wir auch? Die einzelnen Begriffe scheinen häufig austauschbar.
Nehmen Sie den drittletzten der Sätze, die Sie gerade gelesen haben. Statt von den »konkreten Worten« hätten wir auch von den »speziellen Worten« oder von den »besonderen« oder »individuellen« »Wörtern«, »Begriffen«, »Ausdrücken« oder »Formulierungen« sprechen können. Obwohl es natürlich wichtig ist, dass wir unseren Standpunkt deutlich machen, erscheinen die dafür verwendeten Wörter oft unbedeutend. Es sind zufällige Wendungen von Phrasen oder was immer uns gerade in den Sinn kommt.
Aber wie sich zeigen wird, liegen wir mit unserer Intuition häufig daneben. Weit daneben.
Das Wort, das die Welt veränderte
In den 1940er-Jahren genügte ein Wort, um die Welt zu verändern. Wann immer sich ein Desaster ereignete oder ein Übeltäter das Leben, wie wir es kennen, zu zerstören drohte, sagte Billy Batson, der Junge aus dem Comicheft, »Shazam!« und verwandelte sich in einen Superhelden mit außergewöhnlichen Kräften und blitzschneller Reaktionsgeschwindigkeit.
Solche magischen Formeln hat es immer schon gegeben. Von »Abrakadabra!« über »Hokuspokus!« und »Sesam, öffne dich!« bis zu »Expecto patronum!« verwenden Magier, Zauberer und Helden aller Arten seit jeher Sprache zur Heraufbeschwörung mystischer Kräfte. Strategisch eingesetzt, können bestimmte Worte Zaubersprüchen gleich schier Unglaubliches bewirken. Wer sie zu hören bekommt, kann sich ihnen unmöglich entziehen.
Das gehört klar ins Reich der Märchen, nicht wahr? Nicht unbedingt.
Ende der 1970er-Jahre wandten sich Forschende der Harvard Universität an Personen, die in der Bibliothek der City University of New York gerade einen Kopierer bedienten, und baten sie um einen Gefallen.2
Die Stadt New York ist für ihre lebendige Kultur, ihr leckeres Essen und die vielfältige Herkunft ihrer Menschen bekannt. Aber Freundlichkeit? Nicht so sehr. Die New Yorker sind dafür bekannt, dass sie schnell sprechen, hart arbeiten und immer in Eile sind. Sie dazu zu bewegen, sich Umstände zu machen, um einer unbekannten Person zu helfen, würde mit Sicherheit nicht einfach sein, um es gelinde auszudrücken.
Die Forschenden interessierte, wie sich Menschen zu etwas überreden ließen. Einer aus dem Team wartete in der Bibliothek an einem Tisch so lange, bis jemand an den Kopierer herantrat, um sich Kopien zu machen. In dem Augenblick, in dem er die Vorlage auf das Glas legte, mischte sich der Mitarbeiter aus dem Forschungsteam ein. Er ging zu der Person am Kopierer, unterbrach sie in ihrer Tätigkeit und bat darum, sich vordrängeln zu dürfen.
Die Forschenden probierten dabei verschiedene Ansätze aus. In einigen Fällen fragten sie ganz direkt: »Entschuldigung, ich habe nur fünf Seiten. Dürfte ich mal eben den Kopierer benutzen?« In anderen Fällen fügten sie noch ein »denn« an: »Entschuldigung, ich habe nur fünf Seiten. Dürfte ich mal eben den Kopierer benutzen? Denn ich bin in Eile!«
Beide Ansätze waren fast identisch. In beiden Fällen folgte auf die höfliche Einleitung »Entschuldigung« die Frage, ob man kurz mal an den Kopierer dürfe und dass es nur fünf Seiten seien. Die Zumutung war ebenfalls in beiden Fällen dieselbe: Die andere Person musste ihre begonnene Tätigkeit unterbrechen, ihre Vorlage vom Kopierer nehmen und Däumchen drehen, solange jemand anderes sich vordrängelte.
Aber so ähnlich die Ansätze waren, so verschieden war der Effekt. Das zusätzliche Wort »denn« erhöhte den Anteil der Personen, die dem Ansinnen stattgaben, um mehr als 50 Prozent.
Eine Steigerung der Überredungskraft um 50 Prozent durch ein einziges Wort ist gewaltig. Geradezu astronomisch. Aber um fair zu sein: Man könnte argumentieren, dass sich die beiden Ansätze durch mehr als nur ein Wort unterschieden. Schließlich kam zu dem Wörtchen »denn« auch noch der Grund für das Ansinnen hinzu (die Person war in Eile).
Vielleicht war es ja gar nicht das Wort »denn«, von dem die Überredungskraft ausging, sondern die Tatsache, dass zugleich ein überzeugender Grund genannt wurde. Der Mitarbeiter des Forscherteams sagte, wer wäre in Eile, und weil die andere Person es nicht eilig hatte, willigte sie ein, weil sie höflich sein oder helfen wollte.
Aber das war nicht der Grund. Die Forschenden testeten nämlich noch einen weiteren Ansatz. Einer dritten Gruppe von Testpersonen nannten sie keinen triftigen Grund, sondern beließen es bei einer Floskel: »Entschuldige, ich habe nur fünf Seiten. Dürfte ich mal eben den Kopierer benutzen? Denn ich muss das hier kopieren.«
Diesmal enthielt der angegebene Grund keine neue Information. Denn mit der Frage, ob die Person mal eben den Kopierer nutzen dürfe, war schon klar, dass sie Kopien benötigte. Das eine Wort »denn« hätte also eigentlich keine große Rolle spielen dürfen. Wenn der triftige Grund ausschlaggebend für die gesteigerte Überredungskraft war, hätte es wenig bringen dürfen zu sagen, dass man den Kopierer benötige, um Kopien zu machen. Ein offensichtlich bedeutungsloser Grund hätte womöglich sogar die Überredungskraft und damit die Bereitschaft der anderen Person, der Bitte stattzugeben, verringert.
Aber es kam anders. Anstatt die Überredungskraft zu reduzieren, steigerte die Angabe eines bedeutungslosen Grundes sie – ganz so, als hätte es sich um einen triftigen Grund gehandelt. Nicht der Grund als solcher war für die Überredungskraft verantwortlich, sondern das Wort, das als Einleitung diente: »denn«.
Das Kopiererexperiment ist nur ein Beispiel für die Macht magischer Worte. Indem wir sagen, dass wir etwas »empfehlen«, anstatt lediglich, dass es uns »gefällt«, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der Adressat unseren Vorschlag aufgreift, um 32 Prozent. In den Vereinigten Staaten erhöht sich bei Männern, die in ihren Onlinedating-Profilen das Wörtchen whom (anstelle von who) verwenden, die Wahrscheinlichkeit, ein Date zu bekommen, um 31 Prozent. Der ausgiebigere Gebrauch von Präpositionen im Bewerbungsschreiben erhöht die Wahrscheinlichkeit, einen Job zu bekommen, um 24 Prozent. Und für ein Produkt, in dessen Produktbeschreibung is not anstelle von isn’t verwendet wird, sind die Menschen bereit, 3 US-Dollar mehr zu bezahlen. Die in Earnings Calls verwendete Sprache hat Einfluss auf den Preis der Unternehmensaktie und die von CEOs verwendete Sprache wirkt sich auf Investitionsrenditen aus.
Woher wissen wir das alles? Aus der modernen Sprachwissenschaft. Technische Fortschritte im Bereich von maschinellem Lernen, Computerlinguistik und Natural Language Processing (NLP), kombiniert mit der Digitalisierung von allem und jedem, von Briefen bis zu Gesprächen, haben unsere Fähigkeiten, Sprache zu analysieren, revolutioniert und uns beispiellose Erkenntnisgewinne gebracht.
Der Zufall brachte mich dazu, mich mit der automatischen Textanalyse zu befassen. Anfang des Jahrtausends befand ich mich in meinem ersten Jahr als Professor an der Wharton School, wo uns die Frage interessierte, warum bestimmte Themen das Interesse der Menschen wecken und andere nicht: Warum sprachen sie über bestimmte Dinge und nicht über andere? Wir hatten Tausende von New-York-Times-Artikeln gesammelt, von Aufmachern über Weltnachrichten bis zu Sport- und Lifestyle-Themen. Viele Artikel waren höchst interessant zu lesen, aber nur ein kleiner Teil von ihnen schaffte es auf die Liste der von Lesern am häufigsten (per E-Mail an Freunde) weiterempfohlenen Beiträge. Und wir wollten wissen, warum das so war.
Dazu mussten wir verschiedene Gründe messen, weshalb Inhalte viral gehen konnten. Möglicherweise erhielten Artikel auf der Frontseite der New York Times mehr Aufmerksamkeit. Also maßen wir das. Vielleicht wurden bestimmte Rubriken oder bestimmte Autoren von mehr Menschen gelesen als andere. Also maßen wir auch das.
Besonders interessierte uns die Frage, ob es auch am Schreibstil liegen könnte, dass Artikel häufiger geteilt wurden. Um das herauszufinden, mussten wir jedoch eine Möglichkeit finden, die Merkmale des Schreibstils zu messen: wie viele Gefühle ein Artikel weckte oder wie viel verwertbare Informationen er enthielt. Wir begannen damit, dass wir Forschungsassistenten anwarben. Interessierte Studierende schickten mir E-Mails, in denen sie fragten, ob es für sie in der Forschung etwas zu tun gäbe. Und hier bot sich nun eine Möglichkeit, wie sie sich einbringen konnten, indem sie Artikel lasen und sie danach bewerteten, welche Emotionen sie hervorriefen.
Dieser Ansatz funktionierte erstaunlich gut – zumindest anfänglich. Unsere Assistenten codierten einige wenige Artikel und schließlich einige Dutzende.
Als es aber in die Tausende ging, funktionierte die Methode schon nicht mehr so gut. Es kostete die Studierenden Zeit, einen Artikel zu lesen, und die Lektüre von zehn, hundert oder tausend Artikeln kostete sie zehn-, hundert- oder tausendmal so viel Zeit.
Wir warben eine kleine Armee von Assistenten an, aber selbst so ging die Arbeit nur schleppend voran. Und je mehr Menschen wir anheuerten, desto weniger konnten wir sicher sein, dass die Ergebnisse »aus einem Guss« waren. Ein bestimmter Artikel konnte einem Assistenten emotionaler vorkommen als einem anderen, und wir hatten Sorge, dass sich diese Unschärfe negativ auf unserer Ergebnisse auswirken würde.
Wir benötigten eine objektive Methode, die zudem skalierbar war – eine schlüssige Vorgehensweise, wie wir bestimmte Merkmale von Tausenden Artikeln messen konnten, ohne dass unsere Assistenten unter der Last der Arbeit zusammenbrachen.
Ich sprach darüber mit einigen Kollegen und jemand empfahl mir Linguistic Inquiry and Word Count. Das Programm war sagenhaft einfach. Man brauchte es lediglich mit einem Textblock (wie beispielsweise einem Zeitungsartikel) zu füttern, woraufhin es Statistiken unterschiedlichster Art ausspuckte. Auf der Grundlage der Zahl der gefühlsbezogenen Wörter eines Artikels stellte es fest, ob dieser mehr oder weniger auf Gefühle fokussiert war.
Im Unterschied zu unseren Assistenten wurde das Programm niemals müde. Und es war absolut konsequent. Es codierte die Dinge stets auf ein und dieselbe Weise.
Linguistic Inquiry and Word Count oder LIWC (wie englisch Luke ausgesprochen) wurde mein bevorzugtes Forschungstool.*
Erkenntnisse aus Worten
Mittlerweile sind Hunderte neuer Tools und Ansätze entwickelt worden: Methoden für das Zählen bestimmter Begriffe, für die Ermittlung der zentralen Themen eines Dokuments und die Gewinnung von Erkenntnissen aus den Worten.
Und wie das Mikroskop die Biologie revolutionierte und das Teleskop die Astronomie auf den Kopf stellte, so haben die Werkzeuge der Computerlinguistik die Sozialwissenschaften umgekrempelt und Einblicke in alle Arten von menschlichen Verhaltensweisen ermöglicht. Wir analysierten Kundenservicetelefonate, um festzustellen, welche Worte zur Kundenzufriedenheit beitragen. Wir zerlegten Gespräche, um zu verstehen, warum manche besser verlaufen als andere, und durchforsteten Onlineartikel, um Schreibstile zu identifizieren, die das Interesse der Leser mehr fesseln als andere. Wir haben Tausende von Filmdrehbüchern untersucht, um herauszufinden, warum manche zu Blockbustern werden. Wir haben Zehntausende akademischer Arbeiten studiert, um zu verstehen, was wirkungsvolle Sprache ist, und Millionen von Onlinerezensionen analysiert, um zu lernen, wie sich Sprache auf die Mundpropaganda auswirkt.
Wir analysierten die Kommunikation zwischen Arzt und Patient, um herauszufinden, welche Art der Ansprache am ehesten dazu geeignet ist, Patienten dazu anzuhalten, ihre Medikationspläne einzuhalten. Wir sezierten Bewährungsanhörungen, um festzustellen, was eine überzeugende Entschuldigung ist, und untersuchten Gerichtsplädoyers, um herauszufinden, womit sich Prozesse gewinnen lassen. Wir haben die Skripte von Tausenden von TV-Shows durchforstet, um zu erkennen, was eine gute Story ist, und über eine Million Songtexte analysiert, um die Merkmale eines Hits zu identifizieren.
Das alles bot mir Gelegenheit, zu erkennen, welche Macht in unseren Worten liegt. Ja, was wir sagen, ist wichtig. Aber manche Worte entfalten eine stärkere Wirkung als andere. Die richtigen Worte, im richtigen Augenblick gesprochen, können Einstellungen verändern, Zuhörer mitreißen und Menschen dazu bringen, sich so oder anders zu verhalten.
Welche also sind diese magischen Worte und wie können wir uns ihrer bemächtigen?
Dieses Buch offenbart die verborgene Wissenschaft von der Art und Weise, wie Sprache funktioniert und wie wir sie effektiver einsetzen können: um andere zu überzeugen, Beziehungen zu vertiefen und privat und beruflich erfolgreicher zu sein.
Wir werden insbesondere über sechs Typen von magischen Worten sprechen: Worte, die (1) uns in unserem Tun oder Sein ansprechen, (2) von Zuversicht und Selbstüberzeugtheit zeugen, (3) die richtigen Fragen stellen, (4) konkret oder abstrakt sind, (5) Gefühle ansprechen und (6) mit Ähnlichkeit und Verschiedenheit operieren.
Tun oder Sein
Worte lassen durchblicken, wer das Sagen hat, wer schuld ist und was es bedeutet, sich an einer bestimmten Handlung zu beteiligen. Kleine Veränderungen in den Worten, die wir verwenden, können folglich große Auswirkungen haben. Entdecken Sie, warum Substantive besser als Verben geeignet sind, andere zu einem bestimmten Verhalten zu überreden, wie wir mit der richtigen Art, Nein zu sagen, unsere Ziele besser erreichen und wie der Wechsel eines einzigen Wortes in der Frage, die wir uns stellen, wenn wir nicht weiterkommen, unsere Kreativität steigert. Erkennen Sie, warum das Sprechen über uns selbst in der dritten Person Ängste abbauen und uns zu besseren Gesprächspartnern machen kann und warum die Verwendung eines Anredepronomens in manchen Interaktionen nützt und in anderen schadet. Lernen Sie, wie Worte Aktivität und Empathie fördern und darauf Einfluss haben können, ob Menschen sich ethisch verhalten, von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen oder sich mit ihren Partnern zanken.
Zuversicht vermitteln
Worte vermitteln nicht nur Fakten und Meinungen, sondern auch, wie sicher wir uns dieser Fakten und Meinungen sind, wovon wiederum abhängt, wie wir wahrgenommen werden und welchen Einfluss wir haben. Lernen Sie, wie ein Vertriebsleiter, der sich von den falschen Worten trennte, auf einmal Traumergebnisse einfuhr und welche Sprachstile den Menschen ein glaubwürdigeres und verbindlicheres Auftreten ermöglichen. Entdecken Sie, warum die Menschen selbstüberzeugte Finanzberater bevorzugen, selbst wenn diese mit ihren Prognosen häufiger falschliegen, und warum eine Restaurantempfehlung überzeugender wirkt, wenn sie in der Gegenwarts- und nicht in der Vergangenheitsform abgefasst ist. Und während Gewissheit manchmal von Nutzen ist, werde ich Ihnen zeigen, wann eine ungewisse Sprache effektiver ist, warum geäußerte Zweifel zu einem kontroversen Thema die andere Seite zum Zuhören ermuntern kann und warum einen das Eingeständnis der Schwächen der eigenen Argumentation unter Umständen glaubwürdiger erscheinen lässt.
Die richtigen Fragen stellen
In diesem Kapitel erfahren Sie etwas über die Wissenschaft des Fragenstellens: warum andere Sie für intelligenter halten, wenn Sie sie um Rat fragen, und warum Partnersuchende mit größerer Wahrscheinlichkeit ein zweites Date bekommen, wenn sie mehr Fragen stellen; wie Sie schwierige Fragen umschiffen und anderen unangenehme Informationen schmackhaft machen können; wie ein verheiratetes Paar eine narrensichere Methode zur Vertiefung sozialer Beziehungen entdeckte und warum wir anderen zeigen können, dass sie uns wichtig sind, indem wir die richtigen Fragen stellen.
Konkretes Verhalten wirksam einsetzen
Dieses Kapitel illustriert die Macht der konkreten Ausdrucksweise: welche Worte deutlich machen, dass wir zuhören, und warum die Kundenzufriedenheit steigt, wenn wir sagen, dass wir ein Problem »beheben« und nicht »lösen«; warum Wissen ein Fluch sein kann und warum es den Umsatz fördert, wenn wir von einem »grauen T-Shirt« statt lediglich von einem »Oberteil« reden. Und damit Sie nicht denken, dass eine konkrete Sprache immer und überall besser ist, werde ich Ihnen zeigen, wann es besser ist, abstrakter zu formulieren: warum eine abstrakte Sprache Macht und Führungsstärke signalisiert und Start-ups hilft, mehr Geld einzuwerben.
Die Rolle der Gefühle
Das fünfte Kapitel ergründet, warum eine emotionale Sprache mehr Einsatzbereitschaft weckt und wie wir davon in allen Lebensbereichen profitieren können. Entdecken Sie, wie ein 22-jähriger Praktikant ein Podcast-Imperium errichtete, indem er verstand, was eine gute Geschichte ausmacht; warum positive Dinge noch positiver erscheinen, wenn sich negative Dinge zu ihnen gesellen, und warum eine emotionale Sprache in einigen Produktkategorien umsatzsteigernd wirkt und in anderen nicht. Sie werden lernen, wie Sie die Aufmerksamkeit von Menschen selbst für Themen wachhalten, die nicht sonderlich interessant zu sein scheinen, und warum die Menschen häufig weniger aufmerksam zuhören, nachdem wir Ihnen ein Gefühl des Stolzes oder des Glücks vermittelt haben. Wenn Sie dieses Kapitel gelesen haben, werden Sie wissen, wie Sie emotionale Sprache nutzen, wann Sie sie einsetzen und wie Sie mit Ihren Präsentationen, Geschichten und Informationen jedes Publikum fesseln können.
Ähnlichkeiten (und Unterschiede) nutzen
Dieses Kapitel führt Sie in die Sprache der Ähnlichkeit ein: was sprachliche Ähnlichkeit bedeutet und warum sie hilft, alles Mögliche zu erklären – von der Frage, wer befördert wird oder wer sich anfreundet, bis zu der Frage, wer entlassen wird oder wer zu einem zweiten Date geht. Entdecken Sie, warum Songs, die vom typischen Muster abweichen, am Ende populärer sind und wie die künstliche Intelligenz hinter Siri und Alexa genutzt wird, um zu quantifizieren, wie rasch sich Geschichten verbreiten und wie viel Boden sie gewinnen. Am Ende des Kapitels werden Sie wissen, wie Sie den Sprachstil anderer aufgreifen, wann Sie eine Sprache verwenden sollten, die der Sprache anderer ähnelt oder sich von ihr unterscheidet, und wie Sie Ihre Ideen so präsentieren, dass sie leichter zu verstehen sind und mit höherer Wahrscheinlichkeit eine positive Reaktion hervorrufen.
Was Sprache verrät
Die ersten sechs Kapitel handelten von der Wirkung der Sprache: wie Sie sie einsetzen können, um glücklicher, gesünder und erfolgreicher zu sein. Im letzten Kapitel werde ich Ihnen einiges von dem zeigen, was Sprache verrät. Erfahren Sie, wie Forschende feststellten, ob ein Theaterstück von Shakespeare stammte, ohne es je gelesen zu haben, und wie Sie anhand der in einem Kreditantrag verwendeten Worte vorhersagen können, bei wem ein Kreditausfall droht (Tipp: Seien Sie vorsichtig mit Extrovertierten). Sie werden außerdem entdecken, was Sprache allgemeiner über die Gesellschaft verrät; wie die Analyse einer Viertelmillion Lieder die uralte Frage beantwortete, ob Musik frauenfeindlich ist (oder ob sich die Situation mit der Zeit verbessert hat), und wie Aufzeichnungen von Körperkameras die subtilen Vorurteile belegten, die in der Art und Weise zum Ausdruck kommen, wie Polizisten zu Schwarzen und zu Weißen sprechen. Nach der Lektüre dieses Kapitels werden Sie die Welt um sich herum anhand der verwendeten Sprache besser decodieren können: was Sprache über andere Menschen und ihre Motive verrät und wie Sprache gesellschaftliche Stereotype und Vorurteile widerspiegelt.
Jedes Kapitel fokussiert sich auf einen bestimmten Typ magischer Worte und wie er sich nutzen lässt. Manche Erkenntnisse betreffen den Austausch eines einzelnen Wortes durch ein anderes; andere sind komplexer und hängen stärker vom Kontext ab.
Der Schwerpunkt des Buches liegt auf der effektiveren Verwendung von Sprache. Wenn Sie sich für die Tools interessieren, mit denen wir diese Erkenntnisse gewonnen haben, empfehle ich Ihnen den Leitfaden im Anhang. Er zählt einige der wichtigsten Herangehensweisen auf und beschreibt, wie diverse Unternehmen, Organisationen und Branchen sie einsetzen können und eingesetzt haben.
Ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht: Wir sind alle Schreiber. Wir verfassen vielleicht keine Bücher oder Nachrichtenartikel und nennen uns auch nicht alle Autoren oder Journalisten, aber wir schreiben. Wir schreiben E-Mails an Kollegen und Texte für Freunde. Wir verfassen Berichte für Vorgesetzte und entwerfen Präsentationsfolien für Kunden.
Wir alle sind zugleich auch Redner. Wir treten vielleicht nicht auf Bühnen vor Tausenden von Zuhörern auf, aber wir sprechen zu anderen Menschen. Vielleicht halten wir in unserem Unternehmen eine Präsentation oder wir plaudern während eines Dates. Wir bitten potenzielle Geldgeber um eine Spende oder bitten die Kinder, ihre Zimmer aufzuräumen.
Aber um bessere Schreiber und Redner zu werden – und mit Absicht und Sorgfalt zu kommunizieren –, müssen wir wissen, welche Worte die richtigen sind. Es ist hart, Menschen dazu zu bewegen, uns zuzuhören und uns ihre Aufmerksamkeit zu schenken, und es ist hart, sie zu überreden, das zu tun, was wir uns von ihnen wünschen. Es ist hart, andere zu motivieren, Kreativität zu fördern und soziale Kontakte zu knüpfen.
Aber die richtigen Worte können helfen.
Häufig heißt es, bestimmte Menschen hätten eine besondere Sprachbegabung. Sie besitzen Überzeugungskraft und Charisma und es scheint, als wüssten sie immer die richtigen Worte zu finden. Aber heißt das zugleich, dass wir übrigen, die ohne diese Begabung geboren wurden, schlicht Pech gehabt haben?
Nicht wirklich.
Denn man muss nicht als großartiger Schreiber oder Redner geboren worden sein. Sie können sich diese Fähigkeiten auch aneignen. Worte haben eine erstaunliche Wirkungskraft, und indem wir verstehen, wann, warum und wie sie funktionieren, können wir mit ihrer Hilfe auch selbst mehr Einfluss gewinnen.
Ganz gleich, ob Sie Sprache effektiver einsetzen oder lediglich verstehen wollen, wie sie funktioniert – dieses Buch wird Ihnen zeigen, wie es geht.
_________
* Wenn Sie sich für LIWC interessieren, empfehle ich Ihnen James W. Pennebakers exzellentes Buch The Secret Life of Pronouns – What Our Words Say About Us.
1 Tun oder Sein
Nicht weit von den umtriebigen Risikokapitalunternehmen, die das Silicon Valley bevölkern, liegt in einer unauffälligen Seitenstraße eine der besten Vorschulen der Vereinigten Staaten. Die Bing Nursery School ist der Traum jedes Kindes. Jeder Gruppenraum verfügt über eine Freifläche von einem halben Hektar mit Hügeln und Senken, Brücken, Sandplätzen, Hühner- und Kaninchenställen. Die großen, lichtdurchfluteten Räume sind reichlich ausgestattet mit Kunstzubehör, Bausteinen und anderen kreativitätsanregenden Materialien. Sogar das Gebäude selbst ist auf die Kinder abgestimmt – mit Fenstern, die bis auf die Höhe der kleinsten von ihnen hinunterreichen.
Entsprechend umkämpft sind die verfügbaren Plätze. Auf einige Hundert von ihnen kommen Tausende von besorgten Eltern, die alles tun, um es auf die Wartelisten zu schaffen. Andere versuchen, die Zulassungsbeauftragten vom Genie ihres Kindes zu überzeugen, indem sie auf seine frühe musikalische Begabung hinweisen oder darauf, dass es schon in mehreren Sprachen zählen kann.
Aber die Vorschule interessiert sich nicht für außergewöhnliche Kinder. Sie zieht im Gegenteil gemischte Kindergruppen vor, die die Gesamtgesellschaft widerspiegeln. Denn Bing ist nicht nur eine Vorschule, sondern ein Labor.
Anfang der 1960er-Jahre wollte die Stanford University eine neue Laborschule einrichten. Die Universitätsangehörigen benötigten eine Kinderbetreuung, und die fortgeschrittenen Studenten der Erziehungswissenschaften und der Psychologie benötigten praktische Lernerfahrungen. Also errichtete Stanford mit Mitteln der National Science Foundation eine moderne Forschungseinrichtung. Neben den einladenden Räumen innerhalb und außerhalb des Gebäudes, die Bing zu einem vorbildlichen Kindergarten machen, machen Einwegspiegel in den Gruppenräumen und separate Beobachtungsräume die Einrichtung für die Forschenden zu einem idealen Ort, um die Entwicklung der Kinder zu beobachten.
Seither wurden an der Bing Nursery School Hunderte von Studien durchgeführt. Bing war beispielsweise der Schauplatz des sogenannten Marshmallow-Tests, der die Fähigkeit der Kinder untersuchte, Belohnungen hinauszuschieben (den vor ihnen liegenden Marshmallow vorerst nicht zu essen, um später einen zweiten zu bekommen). Und Untersuchungen zur intrinsischen Motivation offenbarten, dass es kontraproduktiv war, Kinder für eine Tätigkeit zu belohnen, die ihnen ohnehin Spaß bereitete, senkte es doch ihre Bereitschaft, sich später erneut damit zu befassen.
In jüngerer Zeit untersuchte eine Gruppe von Wissenschaftlern an der Bing Nursery School, wie es möglich war, die Bereitschaft der Kinder, einander zu helfen, zu steigern.3 Dass Hilfsbereitschaft ein Wert ist, steht außer Frage. Eltern bitten ihre Kinder, beim Abwasch zu helfen, Lehrer bitten die Kinder, beim Aufräumen des Spielzeugs mitzuhelfen, und Kinder bitten einander, sich auf der Schaukel anzuschubsen.
Aber wie jeder bezeugen kann, der schon einmal versucht hat, Kinder dazu zu überreden, etwas zu tun, hat diese Hilfsbereitschaft ihre Grenzen. Ähnlich Klienten, Kollegen und Kunden sind auch Kinder nicht immer daran interessiert, das zu tun, was wir uns von ihnen wünschen. Lieber würden sie mit Lego-Steinen spielen, auf dem Sofa herumspringen oder aus allen Schuhen im Flurschrank die Schnürsenkel herausziehen.
Um zu verstehen, wie sich Kinder und andere vielleicht überreden lassen, etwas Bestimmtes zu tun, baten die Wissenschaftler eine Gruppe Vier- und Fünfjähriger, etwas zu tun, was Kinder besonders ungern tun: beim Aufräumen zu helfen. Bausteine mussten vom Boden aufgesammelt und in eine Box gelegt, Spielzeug weggeräumt und ein umgekippter Becher mit Kreidestiften wieder aufgerichtet und gefüllt werden. Um die Überredungsaufgabe noch schwerer zu machen, warteten die Wissenschaftler, bis die Kinder bereits mit etwas anderem beschäftigt waren – mit dem Spielzeug spielten oder mit den Kreidestiften malten –, bevor sie ihre Bitte formulierten. Die Kinder waren also besonders wenig daran interessiert, sich helfend zu beteiligen.
Einige der Kinder wurden einfach nur um Hilfe gebeten. Sie wurden daran erinnert, dass Helfen gut ist und dass es vieles bedeuten kann: Dinge vom Boden aufzuheben oder immer dann mit anzupacken, wenn andere in Not sind.
Bei einer weiteren Gruppe von Kindern aber unternahmen die Wissenschaftler einen interessanten Versuch. Die Kinder erhielten fast dieselbe Ansprache. Auch sie handelte davon, wie man anderen hilft und welche verschiedenen Formen der Hilfe es gibt. Aber ein Detail war anders. Sie baten die Kinder nicht zu »helfen«, sondern sie baten sie, »Helfer« zu sein.
Dieser Unterschied erscheint vernachlässigbar – so klein, dass Sie ihn vielleicht gar nicht bemerkt hätten. Und in vielerlei Hinsicht ist er es auch. Beide Bitten beziehen sich auf die gleiche Tätigkeit (Dinge aufheben) und in beiden kommt das Wort »Hilfe« in der einen oder anderen Form vor. Der Unterschied besteht sogar nur aus einem Buchstaben (»Helfer« statt »helfen«).
Aber so klein die Veränderung auch gewesen war, so groß waren die Folgen. Verglichen mit der einfachen Bitte an die Kinder, »zu helfen«, steigerte die Bitte, »ein Helfer zu sein«, die Hilfsbereitschaft der Kinder um fast ein Drittel.
Warum? Warum hatte ein Buchstabe eine so große Wirkung?
Die Antwort hat, wie sich zeigt, mit dem Unterschied zwischen einem Verb und einem Substantiv zu tun.
Aktionen in Identitäten verwandeln
Stellen Sie sich vor, ich würde Ihnen von zwei Menschen berichten, Rebecca und Fred. Rebecca geht joggen, und Fred ist ein Jogger. Wer, würden Sie denken, joggt mit mehr Leidenschaft?
Menschen lassen sich auf unterschiedliche Art beschreiben. Peter ist alt, und Scott ist jung. Susan ist eine Frau, und Tom ist ein Mann. Charlie liebt Baseball, Kristen ist ein Linksliberaler und Mike isst viel Schokolade. Jessica ist ein Morgenmensch, Danny mag Hunde und Jill ist Kaffeetrinkerin. Von demografischen Merkmalen wie Alter und Geschlecht bis zu Meinungen, Eigenheiten und Vorlieben geben Beschreibungen wie diese einen Eindruck davon, wer jemand ist und was er mag.
Es gibt jedoch viele Möglichkeiten, ein und dasselbe zu sagen. Wer politisch eher links eingestellt ist, könnte beispielsweise als »links« oder als »ein Linker« beschrieben werden. Von jemandem, der Hunde mag, könnten wir sagen, dass er »Hunde liebt« oder dass er »ein Hundeliebhaber« ist. Diese Unterschiede mögen klein erscheinen, aber die zweite Variante beschreibt jeweils eine Kategorie. Wenn wir jemanden als »links« beschreiben, suggerieren wir damit, dass er linke Überzeugungen teilt. Indem wir ihn jedoch als »einen Linken« bezeichnen, deuten wir an, dass er einer bestimmten Gruppe zuzurechnen ist. Er ist Mitglied einer konkreten Gruppe von Menschen.
Kategorienetiketten implizieren häufig einen Grad von Beständigkeit oder Stabilität. Anstatt zu sagen, was jemand tat oder tut, fühlt oder fühlte, verweisen solche Etiketten auf eine tiefere Essenz: darauf, wer jemand ist. Unabhängig von Zeit oder Situation ist dieser Mensch von diesem Typ. Und er wird das immer bleiben.
Wenn wir sagen, dass jemand links ist, deuten wir damit an, dass er gegenwärtig linke Überzeugungen vertritt. Indem wir aber jemanden als einen Linken bezeichnen, suggerieren wir, dass es sich um etwas Dauerhafteres handelt. Wenn wir von jemandem sagen, dass er Hunde liebt, meinen wir damit, dass er gegenwärtig solche Gefühle hat. Indem wir ihn jedoch als Hundenarr bezeichnen, stellen wir ihn als einen bestimmten Typ von Menschen dar, der er für immer bleiben wird. Dinge, die sich als vorübergehende Zustände sehen ließen (»Sally hat das Geschirr nicht weggeräumt«), erscheinen häufig beständiger oder fundamentaler, wenn wir sie mit einem Kategorienetikett belegen (»Sally ist eine Chaotin«). Zu verlieren, ist schlecht. Aber ein Verlierer zu sein, ist noch schlechter.
In der Tat hielten Beobachter, denen erzählt wurde, dass eine gewisse Rosalie »eine Karottenesserin« wäre, diese Eigenschaft für stabiler als andere Beobachter, denen gesagt wurde, dass Rosalie »viele Karotten isst«. Sie dachten, dass Rosalie mehr Karotten aß, als sie jünger war, dass sie vermutlich auch in Zukunft mehr Karotten essen wird und dass sie das auch dann tun wird, falls andere versuchen, sie davon abzubringen. Unabhängig vom Zeitpunkt und unabhängig davon, ob es auf Widerstand traf – dieses Verhalten würde andauern.4
Die Suggestivkraft von Etiketten kann so groß sein, dass häufig versucht wird, Etiketten von dem Verhalten, das sie beschreiben, zu trennen. Ein Anwalt könnte im Bemühen um ein mildes Urteil für seinen Mandanten sagen: »Er ist kein Verbrecher; er hat nur eine schlechte Entscheidung getroffen.« Und ein Sportbegeisterter könnte sagen: »Ich schaue mir gelegentlich Spiele an, aber ich bin kein Fan.«
In all diesen Fällen verwenden die Etiketten eine bestimmte grammatikalische Form: Substantive. Die Eigenschaft »links« ist ein Adjektiv, aber die Kategorie »ein Liberaler« ist ein Substantiv. In der Aussage »joggt häufig« ist »joggt« ein Verb, aber wenn wir sagen, dass jemand »ein Jogger« ist, wird aus dem Tun (Verb) ein Sein (Substantiv).
In einer Vielzahl von Bereichen stellen Forschende fest, dass der Übergang vom Tun zum Sein Auswirkungen darauf haben kann, wie jemand wahrgenommen wird.5 Als Beobachter beispielsweise hörten, dass jemand ein Kaffeetrinker ist (und nicht, dass er viel Kaffee trinkt), oder dass er ein Computermensch ist (und nicht, dass er häufig den Computer nutzt), schlossen sie daraus, dass diese Personen eine stärkere Affinität zum Kaffee (beziehungsweise zum Computer) haben und diese Affinität mit größerer Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft beibehalten und selbst dann an ihr festhalten würden, wenn andere um sie herum sie nicht teilten.
Der Wechsel von einer verbbasierten Beschreibung (»trinkt Kaffee«) zu einer substantivischen (»ist Kaffeetrinker«) erzeugte den Eindruck, dass die Eigenheiten und Vorlieben dieser Person stärker in seiner Veranlagung wurzelten und folglich stärker und stabiler waren – dass sie untrennbar zu ihr gehörten und nicht nur einer vorübergehenden Laune entsprachen.
Dass der Wechsel vom Tun zum Sein Einfluss darauf hat, wie jemand wahrgenommen wird, hat eine Reihe nützlicher Anwendungen. Wer sich beispielsweise in seinem Lebenslauf als »harter Arbeiter« statt als »hart arbeitend« beschreibt, wird damit in der Regel einen günstigeren Eindruck erzeugen. Und wenn wir unsere Kollegen als »Innovatoren« und nicht als »innovativ« beschreiben, hat auch das positive Auswirkungen darauf, wie sie wahrgenommen werden.
Aber die Effekte reichen noch weiter, denn es lassen sich so nicht nur Wahrnehmungen beeinflussen, sondern auch Verhaltensweisen. Indem wir ein Verhalten als Möglichkeit darstellen, sich eine ersehnte Identität zuzulegen, können wir damit, dass wir den Fokus vom Tun auf das Sein verlagern, andere dazu verleiten, ihr Verhalten zu verändern.
Jeder möchte sich selbst positiv sehen: als intelligent, kompetent, attraktiv und wirksam. Einer sieht sich vielleicht gern als sportlich, ein anderer als geübten Rätselrater und ein Dritter als jemanden, der es versteht, jederzeit aus dem, was sich zufällig gerade im Kühlschrank befindet, ein köstliches Mahl zuzubereiten, aber im Allgemeinen wollen wir uns alle in einem positiven Licht sehen. Folglich versuchen wir uns so zu verhalten, wie es mit unserem (positiven) Selbstbild im Einklang steht. Möchten Sie sich sportlich fühlen? Dann tun Sie gut daran, von Zeit zu Zeit eine Runde zu joggen. Legen Sie Wert auf Status und darauf, sich als vermögend wahrzunehmen? Dann kaufen Sie sich doch dieses schicke Auto oder unternehmen jene exotische Reise. Indem wir uns passend zu unserem Selbstbild verhalten, signalisieren wir uns selbst gegenüber, dass wir in der Tat der Mensch sind, der wir sein wollen.
Aber hier wird es interessant, denn wenn jemand ein bestimmtes Bild von sich hat, das er bestätigen will, können wir ihn damit, dass wir bestimmte Verhaltensweisen als Möglichkeiten darstellen, dieses Bild zu bestätigen, dazu verleiten, sich entsprechend zu verhalten. Und hier kommt nun die Bing Nursery School ins Spiel.
Wenn wir andere um Hilfe bitten, tun wir das häufig mit Verben: »Kannst du mir helfen, die Bauklötze aufzuräumen?«, oder: »Kannst du mir beim Abwasch helfen?« In beiden Fällen formulieren wir unsere Bitte mithilfe des Verbs »helfen«. Wir können aber anstelle des Verbs auch ein Substantiv verwenden, um unsere Bitte zu formulieren. Anstatt um Hilfe beim Aufräumen der Bauklötze zu bitten, könnten wir sagen: »Könntest du ein Helfer sein und die Bauklötze aufräumen?« Mit dieser kleinen Änderung verwandeln wir die ursprüngliche Aktion (das Helfen) in etwas Tiefgreifenderes. Aus der simplen Einmalaktion des Helfens wird eine Chance: die Chance, Anspruch auf die ersehnte Identität als Helfer erheben zu können.
Was manchen Eltern vielleicht schwerfällt zu glauben: Die meisten Kinder möchten sich selbst als Helfer sehen. Vielleicht können sie nicht den Müll entsorgen oder ein Essen kochen, aber ein Helfer zu sein, der seinen Beitrag zur Gruppe leistet, ist eine positive Identität, die ihnen erstrebenswert erscheint. Indem wir also aus dem Verb ein Substantiv machen, können wir das, was sonst nur eine Aktion (helfen) wäre, in eine Chance verwandeln, sich eine positive Identität (ein Helfer zu sein) zuzulegen. Jetzt wird aus dem Aufräumen der Bauklötze eine Gelegenheit, mein wahres Ich zu zeigen und mir selbst und vielleicht auch anderen zu beweisen, dass ich ein guter Mensch und ein Mitglied dieser erstrebenswerten Gruppe bin.
Helfen? Ist immer gut. Aber die Chance zu bekommen, sich als einen Helfer zu sehen – eine Identität, die ich mir nur zu gerne zulegen würde? Dafür lohnt es sogar, die Wachskreiden niederzulegen und beim Aufräumen mit anzupacken. Und genau das taten die Kinder der Bing Nursery School.
Die Wirkung der Verwandlung von Verben in Substantive geht über Kinder und Aufräumen hinaus. Im Jahr 2008 beispielsweise nutzten Forschende dasselbe Prinzip, um die Wahlbeteiligung zu steigern. Wahlen sind ein zentrales Element funktionierender Demokratien und eine Chance, Einfluss darauf zu nehmen, wie ein Land regiert wird. Dennoch machen viele Menschen nicht von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Wie Helfen ist auch zur Wahl zu gehen etwas, von dem die Menschen wissen, dass sie es tun sollten, auch wenn sie sich nicht immer daran halten. Sie sind zu beschäftigt, vergessen es oder interessieren sich schlicht nicht genug für die Kandidaten, um sich die Mühe zu machen, wählen zu gehen.
Forschende fragten sich, ob die Sprache hier helfen könnte. Statt die Menschen aufzufordern, wählen zu gehen, wählten sie einen leicht veränderten Ansatz: Sie sprachen darüber, ein Wähler zu sein. Auch dieser Unterschied – der Austausch eines Buchstabens von »wählen« zu »Wähler« – scheint winzig zu sein. Aber der Trick funktionierte. Er steigerte die Wahlbeteiligung um mehr als 15 Prozent.6
Die Verwandlung einer Verhaltensweise – wählen – in eine Gelegenheit, sich eine positive Identität – Wähler – zuzulegen, verleitete mehr Menschen dazu, diese Verhaltensweise zu zeigen. Indem aus dem bloßen Akt des Wählens die Chance wurde, etwas Positives über sich selbst zum Ausdruck zu bringen, fühlten sich mehr Menschen bemüßigt, diesen Weg zu gehen.
Möchten Sie, dass jemand zuhört? Bitten Sie ihn, ein Zuhörer zu sein. Möchten Sie, dass jemand die Leitung übernimmt? Bitten Sie ihn, der Leiter zu sein. Möchten Sie, dass jemand härter arbeitet? Ermutigen Sie ihn, ein Spitzenleister zu sein.*
Dieselbe Idee kann sogar genutzt werden, um Menschen zu ermutigen, negative Verhaltensweisen zu vermeiden. Unehrlichkeit ist teuer. Fehlverhalten am Arbeitsplatz beispielsweise kostet US-Unternehmen jährlich mehr als 50 Milliarden US-Dollar.
Aber obwohl Menschen häufig ermutigt werden, sich moralisch zu verhalten oder das Richtige zu tun, kann eine Sprache der Identität noch effektiver sein. In der Tat stellt die Forschung fest, dass sich das Betrugsverhalten um mehr als die Hälfte reduziert, wenn die Aufforderung nicht lautet: »Betrüge nicht!«, sondern: »Sei kein Betrüger!«7 Die Versuchspersonen betrogen seltener, wenn sie mit ihrem Betrugsverhalten signalisiert hätten, dass sie ein nicht erstrebenswertes Bild von sich selbst hatten.
Möchten Sie, dass die Menschen ihren Müll nicht überall liegen lassen? Sagen Sie nicht: »Verschmutzen Sie bitte nicht die Umwelt«, sondern: »Seien Sie bitte kein Umweltverschmutzer.« Versuchen Sie, Kinder dazu zu bringen, dass sie die Wahrheit erzählen? Dann erreichen Sie mehr, wenn Sie nicht sagen: »Lüge nicht!«, sondern: »Sei kein Lügner!«
Diese Ideen funktionieren sogar uns selbst gegenüber. Möchten Sie sich angewöhnen, häufiger Sport zu treiben oder zu joggen? Indem Sie anderen erzählen, dass Sie »ein Jogger« sind, und nicht, dass Sie »joggen«, erscheint das Joggen wie ein stabiler, konstanter Teil von Ihnen, und das wiederum vergrößert die Wahrscheinlichkeit, dass Sie am Ball bleiben.
Den Fokus vom Tun auf das Sein zu verlagern, ist nur ein Beispiel für die Anwendung einer größeren Sprachkategorie – der Sprache des Tuns und Seins.
Hier sind vier weitere Anwendungen: (1) auf die richtige Art »nein« sagen, (2) kreativer werden, (3) mit sich selbst sprechen und (4) wissen, wann es besser ist, in der zweiten Person zu sprechen.
_________
*