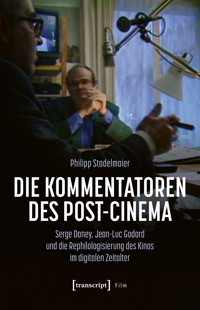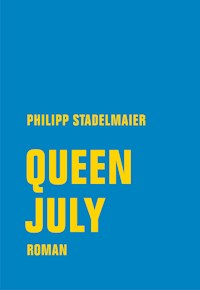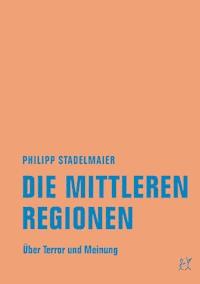
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
"Die mittleren Regionen" ist ein aufrüttelnder Essay, entstanden unmittelbar in der Folge des Anschlags auf die Redaktion von Charlie Hebdo, der am 7. Januar 2015 in Paris stattfand. In Form eines Tagebuchs nimmt Philipp Stadelmaier eine polemische Dekonstruktion der Konzepte "Meinung" bzw. "Meinungsfreiheit", "Karikatur" und "Terror" vor. Dabei zeichnet er - ausgehend von Pasolinis Motivsuche für seine Verfilmung des Matthäusevangeliums in Palästina, einem Seminar bei Hélène Cixous, Mails von Freunden und Artikeln in deutschen und französischen Medien - die Metapsychologie (und die pathologischen Züge) der Figur der Meinung nach. Dieser wird mit den "mittleren Regionen" ein unstabiles, geografisch-geschichtliches Gefüge gegenübergestellt, das essenziell von einem Mangel an Sicherheit, "Meinung" und "Identität" bestimmt wird. In einem Nachsatz zu diesem Tagebuch überprüft Stadelmaier nach den Anschlägen vom 13. November 2015 die Gültigkeit seiner zu Jahresbeginn entwickelten Thesen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Philipp Stadelmaier
Die mittleren Regionen
Über Terror und Meinung
He entered. Pure chaos surrounded him.
»Pasolini« von Abel Ferrara (2014)
Paris, 7. Januar 2015, 11:48 h
Terrorisiert.
23:57 h
»La rançon de la gloire«gesehen, heute gestartet, im Cinémades Cinéastes. Vier Leute im Publikum. Benoît Poelvoorde wird aus dem Gefängnis entlassen und hat die Idee, die Leiche von Charles Chaplin zu klauen, um mit dem Lösegeld seinem muslimischen Freund (Roschdy Zem) zu helfen und die Krankenhausrechnung für dessen Frau zu bezahlen. Was kann man heute noch mit der Leiche von Chaplin anfangen, mit Chaplins Humanismus, mit dem Geist von Chaplins Humanismus? Was kriegt man heute noch für einen Chaplin?
Idiotischer Wunsch, dass alle an diesem Abend ins Kino gehen sollten, um diesen Film zu sehen; um sich zu fragen, was man heute noch mit Chaplin und seiner Leiche anfangen kann oder auch nicht; mit dem, was von Chaplin übrig bleibt – in diesen wunderbaren Einstellungen von Xavier Beauvois, die stets zwei Bereiche zusammenhalten und den Abstand zwischen ihnen öffnen: zwischen dem Bereich des Sakralen und dem des Profanen, zwischen Chaplins Geist und seinem schweren Körper, zwischen der Musik von Michel Legrand und dem flapsigen Dialog von Poelvoorde bleibt die Frage, wer sich von Chaplin heute angeschaut fühlt. Dass es jener Blick Chaplins auf sein Publikum ist, das er nie sehen kann, das ein abwesendes und noch zu kommendes ist, das also stets riskiert, ihn schon nicht mehr oder noch nicht zu sehen, und also ein – noch – blindes Publikum ist, wissen wir seit dem Ende von »City Lights« (und seit der Kritik von Serge Daney zu »Limelight«*), wo das vorher blinde Mädchen am Ende des Films Charlot zum ersten Mal sieht. Also ist es Chaplin selbst, der stets riskiert, an seinem Platz zu fehlen, »sein« Publikum nicht zu sehen oder von diesem (abwesenden) nicht gesehen werden zu können: eine Leiche zu sein.
Jenseits des Ruhms von Chaplin, jenseits dessen, was diese Filme je einspielen werden oder was man für sie ausgibt, ist Chaplin unbezahlbar, gibt es immer noch einen Rest, eine Reserve an Chaplin, die nicht bezahlt und nicht ausgelöst werden kann. Etwas, was von diesen Filmen ewig »gegeben« werden wird, wie ein ewiges Geschenk, sodass es nie genug geben kann, die es annehmen, und nie genug, die den Film sehen. Denn der immense Ruhm von Chaplins Filmen hat seinen Preis: Er ist nie groß genug, denn er ist unbezahlbar. Sein Preis ist die schiere Undankbarkeit: Man raubt noch Chaplins Leiche, und man kann ihm nicht mal für ein Lösegeld dankbar sein, das nicht bezahlt werden wird. Aber so wird aufgedeckt, was die Filme hätten geben sollen und niemals genug geben können: ein letzter, toter Rest von Chaplin, für den das Lösegeld unbezahlbar bleibt, der nie wirklich gegeben oder zurückgegeben werden kann zwischen den Filmen und ihren Zuschauern. Als könnten die Filme, für diesen Rest, noch immer nicht richtig gesehen werden. Aber nur so gibt es diese Reserve an Chaplin, diese Reserve an einem unbedingten Humanismus, für den noch ein toter Chaplin und noch ein (fast) leerer Saal verantwortet werden können, wie an diesem Abend im Cinéma des Cinéastes.
* Erschienen in den Cahiers du Cinéma No. 297, Februar 1979.
9. Januar, 22:59 h
Erneut terrorisiert: diesmal in einem jüdischen Supermarkt. In ihrem eingespielten Hass unendliche Trostlosigkeit der Ereignisse, ebenso wie die trostlosen Reaktionen, ebenso eingespielt.
Man kann die Menschen einfach nicht genug lieben. Man müsste heute diese Reserve anzapfen, die »unsichtbar« bleibt wie der Rest an einem Chaplin-Film, aber sich nie erschöpfen lässt und mit keinem Lösegeld je ausgelöst werden kann. Man müsste Chaplins/Beauvois’ Reserve anzapfen, die immer da ist, die nie erschöpft werden kann, um mit den Leichen jener anderen Komiker, der Karikaturisten von Charlie Hebdo, alle Muslime und Juden dieser Welt ebenso zu lieben und nie genug lieben zu können wie den Muslim im Film und seine Frau (noch unter dem Risiko ihres Raubs, denn das Lieben war nicht unbedingt die Sache dieser Karikaturisten, und wenn, dann nur in Form eben der Karikatur). Alle Muslime, die immer schon ebenso wenig »Muslime« sind wie der »Muslim« im Film und seine Frau, also immer auch schon »Juden« und ebenso wenig »Juden« wie Juden; wie jene, die heute in dem jüdischen koscheren Supermarkt gestorben sind; wie jene über 2.000 vorwiegend muslimische Menschen, die von Boko Haram am 7. in Nigeria ermordet wurden.
Man kann sie nie genug lieben, wie auch, als Juden oder Muslime, und das zeigt, dass diese Reserve wirklich unerschöpflich ist, dass sie niemals mit einem dieser Worte oder einer Gruppe oder Religion oder Kultur oder was auch immer an ein Ende kommt, dass sie immer darüber hinausliebt.
16. Januar, 3:01 h
Zu spät angefangen zu schreiben, zu spät angefangen, dem Wust am Gespreche und Geschreibe noch eins draufzusetzen, das längst überall zirkuliert. Es ist spät.
3:04 h
Wie unter diesen Umständen die Lust zum Schreiben finden? Man nehme den Text von Emmanuel Burdeau zu Avi Mograbis »Z32«** Erschienen in Cahiers du CinémaNo. 639, November 2008, Spécial: Festival d’Automne 2008. . Wie die Freude an etwas finden, die perverse Freude, über etwas zu schreiben, was keine machen sollte? Die Freude etwa, als politisch engagierter Filmemacher einen Film zu machen, weil man die Gelegenheit hat, ein Kriegsverbrechen aufzudecken – weil also Menschen für diesen Film gestorben sind, weil jemand sterben, sich opfern musste, damit man nun schreiben oder filmen kann? Man muss also diese Lust in Szene setzen und gleichzeitig dafür sorgen, dass dieses Spektakel sich selbst ironisiert, dass es eine Clownsnummer wird, ein wenig lächerlich. Es muss die Lust geben, sich selbst zu karikieren in dieser Situation, um sich klarzumachen, dass man sich nun äußert, mit Überzeugungen, Meinungen, mit allem, was wichtig und bedeutend scheint und nun gesagt werden muss, in aller Differenziertheit oder wüsten Polemik, dass man nun seiner Lust freien Lauf lässt – und dazu aber, ironischerweise, Menschen sterben mussten. Die Szene der Lust, des politischen Statements, muss eine Clownsszene werden; muss zumindest auch die Lust in Szene setzen, sich selbst zu verspotten in seiner Lust. Alles andere scheint hypokritisch. Wie sich betroffen geben, ohne deutlich zu machen, dass noch in dieser Betroffenheit eine Lust steckt, eine Lust am Spektakel der Betroffenheit, ohne deutlich zu machen, dass Betroffenheit immer auch ein Spektakel und also ironisch sein muss? Mit anderen Worten, nahe an der Karikatur? Und zwar um so mehr, weil für dieses Spektakel Menschen sterben mussten, Unschuldige? Wie also sollte man nicht zeigen, wie sehr man selbst längst eine Karikatur geworden ist?
Die meisten lehnen den Tod von Karikaturisten ab. Nun verdanken sie eben diesem ihre Betroffenheit und die Lust an deren Darstellung, lehnen es aber ab, Karikaturisten dieses Spektakels zu werden. Was sie vielleicht gerade um so mehr in Karikaturen, ihre Reaktion in eine Clownsnummer verwandelt: Sie lehnen es ab, das Spektakel, das sie geben, zu überspitzen, als ein zutiefst unmoralisches – und sei es eines der besten Absichten, der Betroffenheit, der Trauer. Tod der Karikaturisten, zum zweiten Mal. Aber wenn Charlie Hebdo nicht tot ist, wie die Attentäter auf ihrer Flucht über den Boulevard Beaumarchais schrien, wenn die Karikatur sofort zu neuem Leben erwacht wie Kenny in »South Park« (»Sie haben Kenny getötet. – Ihr Schweine!«, aber in der nächsten Episode ist Kenny wieder dabei), dann, weil dieser Witz, in der Betroffenheit den Witz nicht zu sehen und die Karikatur nicht anzuerkennen, selbst noch ein Witz und eine Karikatur ist und man damit schlicht und ergreifend dieser nicht mehr entweichen kann.
Was gegen den Terror schreiben lässt – gibt es einen größeren Scherz? –, ist der Terror. Der Terror, der über Leichen geht. Genauso wie alle anderen. Ich. Hier.
Hier also haben wir nun die Gelegenheit zu kommentieren, zu schreiben, das, was wir wollen und möchten, das, was einige von uns als »Recht auf freie Meinungsäußerung« bezeichnen. Hier haben wir die Gelegenheit, unserer Lust auf Aufklärung, Beruhigung, Skandal, Rassismus, Beschwichtigung, auf Information, auf Trauer, auf Betroffenheit freien Lauf zu lassen. Hier bietet sich die Gelegenheit, einen politisch, historisch, religiös, soziologisch, psychoanalytisch, philosophisch (usw.) relevanten Kommentar von uns zu geben. Welche Freude. Aber das doch nur, weil Menschen sterben mussten.
Ein Skandal.
Ein Skandal, der skandalöserweise nicht gesehen wird, weil er möglicherweise aufdecken würde, dass die Terroristen mit den Verfechtern der »öffentlichen Meinung« und der »Meinungsfreiheit« unter einer Decke stecken. Was, im Übrigen, eine Karikatur wäre, ein Witz. Der Skandal, nur schreiben zu können, weil wir wie die Terroristen über Leichen gehen, wäre genau der Skandal, von dem wir uns skandalisieren lassen müssten. Die meisten sehen ihn natürlich nicht und würden auf diesen Vorwurf moralisch reagieren. »I think to scandalize is a right, to be scandalized is a pleasure, and those who refuse to be scandalized are moralists«: Skandalisieren ist ein Recht, Skandalisiert-Werden eine Freude, wer den Skandal ablehnt, ist ein Moralist, sagt Pasolini in Abel Ferraras »Pasolini«, der Anfang des Jahres gestartet ist, eine Woche vor dem Beauvois; eine weitere Hommage an den Tod eines großen Cineasten (Ferrara zeigt den letzten Tag im Leben Pasolinis, der mit seiner Ermordung am Strand von Ostia endet; Beauvois das Schicksal der Leiche Chaplins). Eine weitere Frage nach dem Gebrauch seines Todes, seiner Leiche, seines Restes. Für jede Reserve an Humanismus bei Beauvois/Chaplin eine Reserve Skandal bei Ferrara/Pasolini.
Die Menschen zu lieben, ist eine Freude. Skandalisiert zu werden, ist eine Freude. Mograbi hat Freude bei seinem Unterfangen, einen Film über einen israelischen Soldaten zu machen, der Unschuldige getötet hat – denn wie sollte er sonst diesen Film machen? Und er lässt sich von dieser Freude skandalisieren. Er lässt sich von ihr skandalisieren, indem er sie zelebriert (das Orchester in seinem Wohnzimmer, die Lieder, wie einem Hollywood-Musical!) und sie im gleichen Zug in eine Clownsnummer verwandelt.
Es sind nur die Moralisten, die diese Freude am Skandal und den Skandal selbst ablehnen. Wie man weiß, sind es die Moralisten, die sich gut in Karikaturen machen. Charlie Hebdo ist also garantiert nicht tot. Nicht unbedingt, weil die Zeitung nun in Millionenauflage erscheint. Sondern weil es ab sofort so viele – schreibende, moralisierende, skandalophobe – Karikaturen wie noch nie gibt. Nur gibt es nur noch sehr wenige, um über sie zu lachen. Denn diejenigen, die sie zeichnen, wurden gerade dezimiert.
Also wiederholen wir es, bevor es aufhört uns zu skandalisieren: Es ist ein Skandal, dass wir, hier, jetzt, die Überlebenden dieser Angriffe, also wir, die wir Karikaturen sind, hier schreiben und schreibend unserer Lust freien Lauf lassen – denn dafür mussten Menschen sterben. Karikaturisten. Es sei denn, einige von jenen hätten überlebt. Man sollte schleunigst Kontakt mit ihnen aufnehmen. Jetzt, hier. Um diesen Skandal mit etwas Lust aufzunehmen; mit der Lust, seine »Meinungen« wie und als ein Clown herauszuschreien.
12:33 h
Skandalisieren lassen: Aushalten, dass dieses ganze Geschreibe und die Lust daran ein Skandal ist. Aushalten, dass man eine Karikatur ist, um darin vielleicht ein wenig Karikaturist zu werden. Moralisch reagieren: Versuchen, sich diesen Skandal vom Hals zu halten. Minimales Programm für den Moment.
21:18 h
Jemand, also nicht jemand, sondern eine Karikatur, zweifelsohne jemand, der mindestens er selbst und seine Karikatur ist – hat uns nach den Anschlägen gesagt, dies sei ein Angriff auf die »Meinungsfreiheit« gewesen. Er hat damit so ziemlich genau das ausgesprochen, was die Terroristen zuvor nicht gesagt, aber zweifelsohne gemeint hatten. Diese Karikatur hat, mit anderen Worten, die Meinung wieder eingesetzt, in ihr Recht gesetzt. Da töten Terroristen einige Karikaturisten, gemeint ist also: ein Angriff auf die Meinungsfreiheit. Die Vertreter der Meinungsfreiheit als Advokaten, Interpreten, Übersetzer des Terrors. Ein Witz.
Also: Die Meinung meint, dass die Meinungsfreiheit angegriffen wurde. Wer fortan meint, wer fortan noch und wieder meinen kann, nachdem klar wurde, was die Terroristen meinten, nachdem deren Meinung endlich übersetzt und zugänglich gemacht wurde – wer fortan »meint«, der meint, dass die Meinungsfreiheit angegriffen wurde. Sagt diese Karikatur der Meinung, die nun im Namen der Meinungsfreiheit auftritt und dabei das von den Terroristen Gemeinte, die Meinung der Terroristen vertritt. Eine Karikatur, die es um so mehr ist, als dass sie todernst ist (karikierte Figuren sind meistens ernst; seltene Ausnahme sind die Karikaturisten von Charlie Hebdo, die in einer Karikatur von Romain Dutreix vor Lachen nicht mehr können, während ihnen eine Wahrsagerin die Zukunft vorhersagt: ein Anschlag, ein großer Trauermarsch mit der politischen Elite, nationale Trauer, selbst der Papst bete für sie, etc.)*, als dass sie ihr eigenes Ausmaß als Karikatur nicht versteht, aber über den Leichen von toten Karikaturisten das Recht auf Karikatur ausruft, als dass sie ein Spektakel an Betroffenheit darbietet und dabei die »Meinung« von »Terroristen« vertritt!
* Die Zeichnung trägt den Titel: »La diseuse de bon aventure de Romain Dutreix« und wird am 7. April als Hommage an Charlie Hebdo in der französischen Comiczeitschrift Fluide Glaciale erscheinen (Stand Februar 2015). Vorab zu finden etwa hier: https://twitter.com/louiswitter/status/554997785326809089, zuletzt abgerufen am 9. Februar 2015.
22:20 h
Halten wir für einen Moment inne, werden wir für einen Moment ernst. Wie schreiben, ohne selbst in diesen chaotischen Strudel verwickelt zu werden? Ohne etwa dem Eindruck in die Hände zu spielen, wir wollten hier einem Gesetz der Identität folgen, also auf einer Seite »uns«, auf einer anderen die »Terroristen« und auf wieder einer anderen »den Islam« verorten? Um dann, noch schlimmer, Identitäten zwischen diesen Identitäten herzustellen (der Islam ist oder ist nicht der Terrorismus, etc.)? Um darin dem Anderen die Ähnlichkeit abzusprechen, die zwischen uns immer anders Anderen besteht? Wie nicht der Hysterie der Meinung und der Identität folgen, die schreiend mal sich selbst, schreiend mal das, was andere gemeint haben oder hätten meinen können, kundtut – hysterisch, weil sie nicht aufhören kann, sich in das zu vermischen, was »sie« nicht ist, »sie« nicht gemeint und mit »ihr« nichts gemein hat, und sich dennoch ständig abgrenzen muss? Wie also nicht dieser Meinung folgen, die dem ganzen Gemeine immer noch eines draufsetzen muss, dieser Meinung, die von Meinungsfreiheit redet und dabei nicht anders kann, als alles niederzuschreien, was sich ihr in den Weg stellt? Wie?
Wir sind eine Karikatur, die dringend Kontakt zu einem überlebenden Karikaturisten herstellen sollte, eine schreibende Karikatur, die dringend einen Karikaturisten braucht, der sie findet, sieht, schreibt – karikiert. Wir sollten Kontakt aufnehmen. Und dieser Karikaturist könnte uns vielleicht den Skandal zeigen, dass es keine Meinungsfreiheit gibt und dass es eine Karikatur war, welche dazu aufrief, sich »jetzt erst recht« zu äußern, das heißt, nie mehr aufhören zu meinen, gegen alle anderen und alle anderen Meinungen. Lassen wir uns davon skandalisieren: Es gibt keine freie Meinung, keine Meinungsfreiheit, die nicht – was für eine Karikatur – nur sich selbst sprechen hören will und keine andere. Es wäre also, dieser Karikatur nachzufolgen, sodass die Attentäter uns dazu gezwungen haben, mit vorgehaltener Waffe, unsere Meinung kundzutun. Zunächst natürlich ihre eigene: ein Angriff auf die Meinungsfreiheit, die wir zu beobachten meinten. Und in dem wir diesen übersetzten, haben wir die Meinung in diesem Moment wieder hergestellt, inklusive ihrer Bedrohung. Nun, da die Meinung bedroht ist, muss sie geäußert werden, ansonsten ist sie tot; immer, wenn sie nicht geäußert wird, ist sie tot. Sie, die, wie wir meinten, mit ihrem mörderischen Akt einen Angriff auf die Meinungsfreiheit meinten, werden die Inauguratoren der öffentlichen Meinung, so, wie sie nun vertreten, verteidigt und verhandelt wird. Und diese kennt, man kann es sich vorstellen, kein Erbarmen. Die Meinung, frei, aber unfrei in ihrem Äußerungszwang, muss geäußert werden.
Ein Witz, eine Karikatur. Aber Karikaturisten wurden getötet, und man sieht, was das anrichtet. Die Karikaturen laufen frei herum und verkünden in einem Zug den Tod und das Schweigen ihrer Meister und das Gesetz der Meinung: Schweig und du bist tot, schweig und du wurdest getötet, für uns, für die öffentliche Meinung – bleibst du tot. Ein Karikaturist könnte darüber lachen, selbst und gerade ein schweigender, toter. (Hoffen wir, sie melden sich jetzt, hier, bald zurück …)
23:37 h
Aber halten wir noch einen Moment inne, um vielleicht gleich das Lachen zu hören. Vielleicht hilft Schweigen, als sei es nicht schon längst zu spät dafür, als hätten sie uns dafür nicht schon längst für tot erklärt, für ebenso tot wie lachende Tote, wie das Lachen von Toten. Hören wir Hélène Cixous, am Samstag nach dem Anschlag, bei ihrem Seminar im Maison Heinrich Heine. »Ça parle, ça parle de façon incontrôlée. Des infos occupent le silence.«Ihr Rat?»Ne pas vouloir dire. Garder le silence.« – Die Stille ist besetzt, das ist es, was so ein Anschlag vermag. Die Terroristen zwingen zum Schweigen, schlimm genug. Aber die öffentliche Meinung tötet noch das Schweigen, also das Einzige, in dem noch das Lachen selbst, der Spott über alles »Sagen-Wollen« oder »Meinen« möglich ist, der Spott über all diese Karikaturen, die nun, nach dem Tod der Karikaturisten, frei herumlaufen, unkarikiert und ernst. Nach dem Massaker wird noch die Stille zum Verstummen gebracht, ausgelöscht. Rache der Karikaturen an den Karikaturisten. Aber noch dann hat man die Möglichkeit, die Stille zu »bewahren« (garder), sie in sich aufzubewahren, in sich wegzuschließen und einzuschließen wie in einer Krypta, wie eine Reserve an Stille und Schweigen, in der das Lachen über all das ertönt, was versucht, sie zu besetzen.
Sagen Sie das heute jemandem, sagen Sie jemandem: »Ich schweige«, und man wird Ihnen vorhalten, Sie würden die Anschläge gutheißen, und Sie dabei mundtot, also tot machen. Für ihn werden Sie, allen Ernstes, so gut wie tot sein, und er wird nicht zögern, das mit der Äußerung seiner Meinung zu unterstreichen.
Sagt eine Karikatur (»Ich schweige …«) zu einer anderen (»Sie sind tot …«) …
17. Januar, 12:33 h
»Das ist ein Angriff auf die Meinungsfreiheit.«