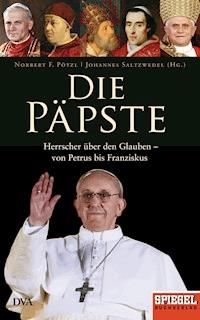
Die Päpste E-Book
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DVA
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Die Geschichte der Päpste - von Petrus bis Franziskus
Der neue Papst heißt Franziskus. Den ehemaligen Erzbischof von Buenos Aires erwarten große Aufgaben, steckt die katholische Kirche doch in einer ihrer größten Krisen seit langem. Wie sich der neue Stellvertreter Christi auf Erden in die Reihe seiner Vorgänger einfügt und welches Erbe insbesondere Benedikt XVI. ihm hinterlassen hat, erkundet das vorliegende Buch.
SPIEGEL-Autoren und Kirchenhistoriker beleuchten darin die 2000-jährige Geschichte des Papsttums und porträtieren die großen Persönlichkeiten unter den Stellvertretern Christi: korrupte Machtmenschen wie die Borgia-Päpste, weitblickende Reformer wie Gregor XIII. und weltweit respektierte Würdenträger wie Johannes Paul II. Dabei wird deutlich, dass die Geschichte der Päpste neben der Verkündung der Glaubenslehren oft auch von Intrigen, Prunksucht und eiskalter Machtpolitik geprägt war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Ähnliche
Norbert F. Pötzl | Johannes Saltzwedel (Hg.)
DIE PÄPSTE
Herrscher über den Glauben –von Petrus bis Franziskus
Kian Badrnejad, Dieter Bednarz, Georg Bönisch, Fiona Ehlers, Angelika Franz, Friedrich Wilhelm Graf, Annette Großbongardt, Hans Hoyng, Nils Klawitter, Uwe Klußmann, Ulrike Knöfel, Gunther Latsch, Romain Leick, Martin Mosebach, Bettina Musall, Dietmar Pieper, Jan Puhl, Hans-Jürgen Schlamp, Eva-Maria Schnurr, Mathias Schreiber, Alexander Smoltczyk, Michael Sontheimer, Gerhard Spörl, Katharina Stegelmann, Hans-Ulrich Stoldt, Frank Thadeusz
Deutsche Verlags-Anstalt
Einige Texte dieses Buches sind erstmals im Heft »Die Päpste. Absolute Herrscher im Namen Gottes« (Heft 4/2012) aus der Reihe SPIEGEL GESCHICHTE erschienen und wurdenfür diese Ausgabe aktualisiert.
1. AuflageCopyright © 2013 Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH und SPIEGEL-Verlag, HamburgAlle Rechte vorbehaltenTypografie und Satz: DVA/Brigitte MüllerGesetzt aus der GoudyISBN 978-3-641-09718-9
www.dva.de
Inhalt
Vorwort
TEIL I NACHFOLGER DES APOSTELS
Die Monarchen Gottes
»Im Strom der Tradition«
TEIL II BISCHOFSAMT UND KIRCHENHOHEIT
Die Schlüsselgewalt
Spuren im Mauerwinkel
Der tatkräftige Zauderer
Beschützer aus dem Norden
Herrschaft der Huren
Feingeist mit Machtdrang
TEIL III KAMPF UM DIE WELTHERRSCHAFT
Gekreuzte Schwerter
Barfuß im Schnee
Heiliger Krieg
Babylon an der Rhône
Weiße Pracht
Macht oder Recht
Arsenal frommen Wissens
»Inkarnation des Teufels«
TEIL IV GLAUBENSPRACHT GEGEN WISSENSMACHT
Woge des Wandels
Gottes Bauherr
»Geistige Verknechtung«
Unter bösen Sternen
Baustelle des Apostels
Trikolore über der Engelsburg
An Gottes Stelle
Winzige Weltmacht
TEIL V AUFTRAG AUS DEM HIMMEL
Die Stunde des Joschka Ratzinger
»Mit brennender Sorge«
Unheilige Dreifaltigkeit
Der Menschenfischer
Public Viewing im Vatikan
Fels mit Zukunft
Satans Rauch und Gottes Wahrheit
Schnee im August
ANHANG
Chronik 64 bis 2013
Buchhinweise
Autorenverzeichnis
Dank
Personenregister
Vorwort
Gebannt schaute die Welt, schauten vor allem die 1,2 Milliarden Katholiken im März 2013 nach Rom: Wer wird nach dem als Sensation empfundenen Rücktritt des deutschen Papstes Benedikt XVI. neues Kirchenoberhaupt? Als dann, auch per Livestream in Online-Medien, über der Sixtinischen Kapelle des Vatikans weiße Rauchwölkchen anzeigten, dass ein neuer Papst gewählt war, wurde sofort kommentiert und analysiert, was von diesem Jorge Mario Bergoglio aus Buenos Aires erwartet wird. Selbst auf eher kirchenferne Menschen übten die Ereignisse eine bewegende Faszination aus. Zwei Beiträge am Ende dieses Buches greifen denn auch diese aktuellen Vorgänge auf; sie resümieren das Pontifikat Joseph Ratzingers und porträtieren dessen Nachfolger.
Wer sich für Rekorde begeistert, konnte schon immer über die Institution Vatikan staunen: Zwei Jahrtausende Tradition, ein Staatsgebiet von weniger als einem halben Quadratkilometer, auf dem sich kostbarste Kunstschätze und eine der ältesten Bibliotheken der Welt befinden – das sind nur ein paar der zahllosen Eigentümlichkeiten, die das Papsttum zu bieten hat. Geht es dann freilich um Roms Hauptanspruch, die hartnäckig verteidigte Lehrhoheit in christlichen Glaubensfragen, teilen sich rasch die Meinungen. Und blickt man darüber hinaus auf die weltliche Geschichte päpstlicher Macht, öffnet sich ein immenses Panorama, das von schier übermenschlicher Glorie bis hin zum Grauen von Intrige, Mord und Kriegsgewalt reicht.
Wer waren, was sind die Päpste? Männlich, ledig und meist nicht mehr jung, so könnte die erste respektlos-äußerliche Typenskizze lauten. Als geistliche Oberhäupter eines Großteils der Christen genießen sie Verehrung; überdies sind sie weltliche Souveräne, wenn auch mit sprichwörtlich geringer Militärmacht. Doch wie präzise Würden und Titel auch immer benannt werden mögen, wie akribisch sich Rollen, Rechte und Rituale aufzählen lassen: Verständlich werden all die verwirrend vielfältigen Merkmale – samt der sie umgebenden ausgeklügelten Hierarchie – erst durch den Blick in die Geschichte.
Aus der Funktion des römischen Bischofs zielstrebig an die Spitze der Kirche vorgerückt, wurden die Päpste als religiöse Führer zur festen politischen Größe; weder Reformation noch Revolutionen, weder Familienklüngel, Feldzüge, Finanzskandale noch zahllose theologische Zwistigkeiten konnten das oberste Hirtenamt je zum Erliegen bringen. Die heute von etlichen Beobachtern diagnostizierte Wiederkehr des Religiösen hat sich auch für den Vatikan überraschend positiv ausgewirkt: Was die römische Kurie und ihr feierlich gewähltes Oberhaupt der Welt mitteilen, wird bei aller fortdauernden Kritik bis weit in andere Konfessionen, ja weit über das Christentum hinaus mit Achtung gehört.
Worauf stützt sich der älteste funktionierende Gottesstaat der Welt? Was half ihm zu überleben? Welche Zukunftsaussichten hat das Papsttum? Offiziöse Antworten darauf gibt gleich im vorderen Teil dieses Buches der wohl berufenste Kenner: Kardinal Walter Brandmüller, 84, gilt seit langem als Chefhistoriker des Vatikans. Für den frommen Gelehrten, der im Palazzo della Canonica direkt neben dem Petersdom wohnt, besteht kein Zweifel, dass der römische Primat »im genetischen Code des Christentums enthalten« ist.
Viele innerhalb der zunehmend bunten christlichen Welt sehen das freilich anders. Kein Wunder, dass Friedrich Wilhelm Graf, einer der scharfsinnigsten protestantischen Kirchenhistoriker Deutschlands, gerade am Beispiel des Unfehlbarkeitsdogmas von 1870 die Tücken solcher Festlegungen und damit der päpstlichen Macht überhaupt zu demonstrieren weiß. Überzeitliche Autorität wahren und dennoch für aktuelle Nöte offen bleiben möchte Rom. So hat sich sein Weg durch die Epochen windungsreich und nur selten vorbildlich, dafür ungemein fesselnd gestaltet. Hohe Diplomatie und menschlich-allzumenschliche Begierden, kaltes Machtkalkül, Kompromissnot und Parteienhader, doch immer wieder auch raffinierte Schachzüge und glanzvolle mäzenatische Taten: Das Schicksal der Päpste bietet alles, was Weltgeschichte von jeher spannend gemacht hat.
In möglichst vielen Aspekten versucht dieses Buch das dauerhaft aktuelle Phänomen zu zeigen. Am Schluss stellt sich unausweichlich die Frage, ob und wie das Papsttum die Kraft und die Zähigkeit in Ewigkeit bewahren kann. Der Romancier Martin Mosebach, der trotz seines katholischen Bekenntnisses durchaus nicht einfach kirchengläubig ist, sieht die Einrichtung eines Stellvertreteramtes für den christlichen Erlöser historisch vor allem als verblüffendes Überbleibsel des römischen Kaiserstaates. Über die Zeiten hinweg verkörpert das Papsttum so für ihn Welteinheitsmacht schlechthin, während seine Inhaber zugleich spirituell als »menschliche Ikone« und »Herrscher über das Reich des Noch-Nicht« an die Erlösungsbedürftigkeit im Diesseits gemahnen.
Ob Sie als Leser solch ein Bedürfnis spüren oder nicht: Die Bedeutung des Papsttums, seinen Anteil am Lauf des menschlichen Schicksals wird keiner leugnen, der Geschichte ernst nimmt. So haben wir versucht, in den Beiträgen Einfühlung und Distanz, Kritik, Information und Analyse möglichst gleichwertig zu Wort kommen zu lassen. Denn ein Urteil über das seltsame Faktum der Monarchen Gottes wird sich am Ende doch jeder für sich bilden müssen. Dazu möchte dieses Buch beitragen.
Hamburg, Frühjahr 2013
Norbert F. Pötzl
Johannes Saltzwedel
TEIL I NACHFOLGER DES APOSTELS
Die Monarchen Gottes
Was heißt es, ein Papst zu sein? Bewegende Porträts, aber auch Schmähungen und Karikaturen zeigen, wie eine Institution aus der Defensive zur Weltmarke wurde und sich hielt – oft gegen alle Erwartung.
Von Johannes Saltzwedel
Keiner kann ihm ausweichen, diesem Blick. Prüfend, erfahren, durchdringend, misstrauisch und doch auch ein wenig verständnisvoll schaut der ältere Herr die Betrachter an.
Gewiss, hier posiert ein Regent, das zeigen schon thronartiger Sessel, schimmernder Atlasstoff und feine, blütenweiße Spitze. Aber die Pracht umhüllt einen Charakter, dessen Energie von der wenig virilen Tracht mit dem schürzenähnlichen Vorderteil schwer zu bändigen scheint. Ein Porträt der Gegensätze: machtbewusst und milde, geborgen wie auch exponiert, stolz, aber seltsam wehrlos, in überindividuellem Faltenwurf und dennoch einmalig erscheint die Gestalt – wie nur ein Papst es sein kann.
Bloß ein paar Sitzungen soll Diego Velázquez 1650 gebraucht haben, um das Bildnis des 75-jährigen Innozenz X. zu malen. Seit 1644 saß der Jurist aus dem römischen Adelshaus der Doria Pamphili auf dem Stuhl Petri.
Kein großer Mann, eher das Gegenteil: Von der Schwägerin ausgenutzt, durch Frankreichs Kardinal Jules Mazarin drangsaliert, glücklos im Westfälischen Frieden, machte Innozenz eine denkbar unerfreuliche Figur. Er war berüchtigt für Wutausbrüche, seit seinem Vernichtungsfeldzug gegen ein kleines Fürstentum bei vielen Landsleuten regelrecht verhasst. Aber zeigt das Bild nicht trotz alledem ein Wesen, für das gewöhnliche Maßstäbe wenig gelten?
Papst Innozenz X.
(Gemälde von Diego Velázquez, 1650)
ALINARI /ART RESOURCE, NY IMAGE /ADP
So ist es anscheinend mit Päpsten: Wie irdisch, ja zuweilen kläglich sie auch handeln, ihr unvergleichlicher Posten als Stellvertreter Christi entrückt sie ins Überwirkliche. Sakramente und Segen, Kirchenlehre und Ritus betreuen sie nur wie oberste Verwalter, doch eben als letzte Instanz; im Stil können sie sich stärker voneinander unterscheiden als Orchesterdirigenten. Die Monarchen Gottes gebieten kaum über irdische Gewaltmittel, dennoch brauchen sie sich nicht einmal den Regeln für Könige oder Kaiser zu unterwerfen. Und obgleich viele Jahrhunderte das Amt in ein dichtes Geflecht aus Tradition und Routine eingesponnen haben, lässt es die Persönlichkeit derer, die es ausüben, meist umso schärfer hervortreten. Papst sein, das ist ein Paradox.
Schon der übliche Wechsel des Namens enthebt den Träger des Fischerrings seinem bisherigen Lebenslauf. Den Anfang machte 533 ein Mercurius, der als Bischof von Rom nicht mehr nach einem antiken Gott, sondern lieber Johannes II. heißen wollte. Seit dem 10. Jahrhundert taten es ihm die meisten nach; als letzter bisher blieb Marcellus II. (1555) bei seinem Taufnamen. Seit langem gilt die Verkündung des neuen Namens als kürzeste Regierungserklärung der Welt: Ausdrücklich vereinigte so 1978 Albino Luciani alias Johannes Paul I. seine beiden recht gegensätzlichen Vorgänger. Als Karol Wojtyla ihm keine fünf Wochen später mit demselben Namen folgte, gab er ein starkes Signal der Kontinuität. Papst Benedikt XVI. beschwor sicherheitshalber gleich 15 Vorläufer im Amt, obendrein den wichtigsten frühmittelalterlichen Ordensgründer herauf und gab sich damit eine Aura von Frömmigkeit und Führungsstärke.
Gegen den allmählich zusammengeschmolzenen Fundus an Papstnamen hebt sich grell ab, was in frühen Zeiten möglich war: Dioskur, Siricius, Konon, Anterus, Lando, ja der schwer altpersisch klingende Hormisdas stehen in den Annalen, auch ein Miltiades, Namensvetter des legendären Siegers von Marathon. Als Staatsreligion des römischen Kaiserreiches zeigte sich das Christentum zunächst eben weit stärker griechisch geprägt, als die spätere lateinische Überformung es heute erkennbar macht.
Solch weniger bekannte Facetten hat die Papstgeschichte reichlich zu bieten. Es ließe sich geradezu ein Quiz veranstalten mit Fragen wie:
▶ Ist jemand mehrfach auf den Stuhl Petri gelangt? Sogar zwei: Bonifaz VII. kam 974 durch den Clan der Crescentier auf den Thron und amtierte dann wieder 984 bis 985; Benedikt IX., ein Graf von Tusculum, der mit etwa 15 Jahren Papst geworden war, wurde 1044 verjagt und von einem Silvester III. verdrängt, konnte zurückkehren, ließ sich dann mit Geld abfinden, war zweieinhalb Jahre später aber wieder Kirchenoberhaupt.
▶ Seit wann residiert der Papst im Vatikan, neben dem Petersdom? Dauerhaft erst seit Mitte des 15. Jahrhunderts; zuvor war San Giovanni im Lateran das angestammte bischöfliche Zentrum Roms.
▶ Sind vor Benedikt XVI. Päpste zurückgetreten? Mehrere, und nicht nur Gegenpäpste: 537 gab Silverius auf oströmischen Druck hin drei Wochen vor seinem Tod das Amt auf; Johannes von Velletri, 1059 als Benedikt X. inthronisiert, konnte sich kein Jahr halten, wurde obendrein exkommuniziert, starb aber erst nach 1073; Coelestin V. trat Ende 1294 zurück und starb 1296; Gregor XII. endlich, schon 1409 abgesetzt, erklärte 1415 auch offiziell seinen Rücktritt.
Im Ringen um die geistliche Führung der Christenheit ist es bis in die Neuzeit kaum weniger ruppig zugegangen als zwischen weltlichen Dynastien. Obwohl es nominell keinen Amtserben geben kann, berichtet auch die Historie des Papsttums von Sippenfehden und Verwandtenmord. Dass der Heilige Vater dennoch, all den vielen Schauergeschichten über Usurpation, Ämterkauf und -verkauf (Simonie), Vetternwirtschaft und Komplotte zum Trotz, seit 1500 Jahren seine Weltgröße behauptet, könnte ein frommer Chronist als Wunder hinstellen.
Doch der Erfolg hat irdische Gründe, nüchtern säkulare, ganz ohne Parade von Helden oder Heiligen. Auf eine Formel gebracht: Immer hat das Zwitterdasein spiritueller und profaner Amtsgewalt dem Papsttum die nötige Chance gelassen; oft genug brauchten sich die Inhaber des Stuhles Petri nur dem zu fügen, was man ohnehin von ihnen erwartete, damit sie als würdige Regenten durchgingen. Papsttum, das ist die windungsreiche Erfolgsgeschichte eines Images, das zur festen Größe im kollektiven Unbewussten der halben Menschheit geworden ist, einer institutionellen Marke, die bis heute ihre Konkurrenten überflügelt.
Denkbar bescheiden fing es an. Da sieht man rechts neben einer Gedenknische einen bartlosen Mann in Tunika und Sandalen stehen, geschmückt mit dem bischöflichen Pallium, in den Händen eine Schriftrolle. Die Figur unter Girlanden, eine Wandmalerei in der römischen Praetextatus-Katakombe, ist als »Liberius« bezeichnet; entstanden sein mag dieses früheste bekannte Bild eines Papstes relativ bald nach dessen Tod im Jahr 366. Wohl ein Sonderfall: Ähnliche Porträts, meist Stifterdarstellungen am Rand von Apsismosaiken, sind erst seit etwa 500 bekannt, zunächst nur aus Rom.
Auch nachdem das Christentum, anfangs eine belächelte Erlösungssekte, den bis heute verblüffenden Durchbruch zur Staatsreligion des Reiches geschafft hatte, konnte also von päpstlicher Regentenpracht noch lange kaum die Rede sein. Mochten Kaiser ihr Konterfei zur Propaganda nutzen – für die Nachfolger Petri galt bildliche Individualität sehr wenig. Als im 8. Jahrhundert ein Künstler inmitten anderer Apostel und Heiligen den längst legendären Retter Roms vor den Hunnen, Leo I., darstellte, ließ er äußerlichen Prunk weitgehend fort, betonte dagegen in byzantinisch eindringlichem Andachtsstil die Augen.
Erst Hadrian I. (772–795) wagte es einmal, sein Porträt auf Münzen prägen zu lassen – vermutlich um anderen weltlichen Hoheitsansprüchen, zum Beispiel aus Byzanz, entgegenzutreten. Ein entscheidender Image-Coup glückte dann seinem Nachfolger Leo III. Auf zwei Mosaikbildern im Speisesaal des Lateranpalastes ließ er darstellen, wie aus seiner Sicht die Macht auf Erden verteilt war: Links gab Christus an Petrus die Schlüssel des Himmels und an Kaiser Konstantin das Feldzeichen irdischer Macht; rechts reichte Petrus das bischöfliche Pallium an Leo und eine Standarte an den mächtigen Frankenkönig Karl. Symbolisch rückten damit Papst und künftiger Kaiser auf gleiche Ebene.
Noch immer knien auf diesem Bild unter Petrus zwei eher schlichte Gestalten, in ihrer Würde vorwiegend durch edle Gewänder und einen quadratischen Heiligenschein (für Lebende) bezeichnet. Doch einmal auf der politischen Bühne präsent – auch als Herren des karolingisch verbrieften Kirchenstaates –, fingen die Päpste an, ihre Ebenbürtigkeit zum Regenten auch äußerlich darzustellen. Purpurmantel und hohe Kopfbedeckung, die später den alten Namen Tiara bekam, hoben vom 10. Jahrhundert an den geistlichen Oberhirten hervor. Buchminiaturen, Mosaiken, Skulpturen und Fresken hielten immer häufiger Schlüsselmomente seines Wirkens fest.
Porträt des Liberius in der Praetextatus-Katakombe
in Rom (bald nach 366)
PONTIFICIA COMMISSIONE DI ARCHEOLOGIA SACRA
Die Selbstsicherheit, mit der Rom weltlichen Großen begegnete, wurde im Investiturstreit mit dem Kaiser endgültig zum Politikum. Jedes Detail hatte seine Tücken, erst recht in der Bildsymbolik: Wer kniet vor wem und wie demütig? Wem wenden Christus oder Maria sich zu? Pochten säkulare Rechtsbücher wie der weitverbreitete »Sachsenspiegel« auf Gleichrangigkeit und Unabhängigkeit der »zwei Schwerter«, so ließ das päpstliche Lager, juristisch und propagandistisch ebenso versiert, keinen Zweifel am Vorrang des Heiligen Vaters.
Wie tief die Konfrontation beider Machtsphären die Gemüter verstörte, zeigen schlaglichtartig einige zornbebende Verse Walthers von der Vogelweide, wohl aus den Jahren 1212 oder 1213. Mit dem »hellemor«, dem schwarzen Teufel aus der Hölle, sei Papst Innozenz III. im Bunde, ja Gottes »hirte ist z’einem wolve im worden under sinen Schafen«. Erst habe er den Welfen Otto IV., dann den Staufer Friedrich II. protegiert, alles nur, um Aufruhr zu säen, um des eigenen Vorteils willen. »Ahi wie kristenliche nu der babest lachet«, spottete der vielerprobte Liedermacher zornig. Die Kirche fülle ihre Truhen mit Ablassgeld, Roms Priester könnten dank der Kreuzzugsabgaben Hühner und Wein schmausen, während das deutsche Glaubensvolk darbe. Das Herz drehe sich einem um, ansehen zu müssen, wie »der babest selbe dort den ungelouben meret«. Solche Wendungen bewegten sich hart am Rand eines Ketzerverfahrens – immerhin hatte derselbe Innozenz 1204 die Plünderung der christlichen Metropole Konstantinopel mitverschuldet und 1209 zum grausamen Feldzug gegen die südfranzösische Sekte der Albigenser aufgerufen.
Dem fatalen Widerspruch von weltlicher Handlungsmacht und geistlichem Auftrag sollte das Papsttum fortan nicht mehr entkommen. Natürlich gab es Rom-Kritik schon seit Jahrhunderten; nun aber wendeten sich oft ganze Herrscherhäuser ab. In der gewaltigen Jenseitsvision seiner »Göttlichen Komödie« ließ Dante Alighieri bald nach 1300 gleich mehrere Päpste in der Hölle büßen; der machtversessene Nikolaus III. zum Beispiel steckt als Simonist (Ämter-Schacherer) kopfüber in einem Felsloch und wird an den Füßen geröstet.
Den nächsten Prestigeverlust erlitt das kirchliche Regiment, als zwischen 1378 und 1415 /17 zwei, schließlich sogar drei Päpste amtierten, deren jeder unter Europas Fürsten Anhänger fand. Brauchte es da noch mehr Beweise, dass die Kirche kein Garant des Seelenheils, sondern vorwiegend ein Pfründen- und Sündenpfuhl war? Vielleicht half nur noch Widerstand. Zu diesem Schluss jedenfalls gelangte nach 1517 ein Augustinermönch und Theologieprofessor namens Martin Luther, als seine biblisch fundierte Kritik an Praktiken wie dem Ablasswesen – dem als Bescheinigung käuflichen Erlass von Sündenstrafen, mittlerweile zum einträglichen Gewerbe ausgeartet – kein Gehör fand.
Bis 1520 plädierte er dafür, der Papst solle auf jeden Hofstaat, ja sogar seine priesterlichen Privilegien verzichten und in der Nachfolge Christi vorbildlich arm leben. Nach dem Bann aus Rom aber begann Luther zu kontern, die Kurie halte die Kirche in »babylonischer Gefangenschaft«. In Rom regiere »ein Erzkirchendieb und Kirchenräuber der Schlüssel, aller Güter, beide der Kirchen und der weltlichen Herrn«, polterte der Deutsche. Das Oberhaupt der westlichen Christenheit sei »ein Mörder der Könige und Hetzer zu allerlei Blutvergießen, ein Hurenwirt über alle Hurenwirte und aller Unzucht, auch die nicht zu nennen ist, ein Widerchrist, ein Mensch der Sünden und Kind des Verderbens, ein rechter Bärwolf«.
Selbst den Teufel und den Antichristen sah der Reformator im Papst verkörpert – Schmähbilder, die protestantische Künstler sogleich begeistert aufgriffen. Vom »Papstesel« bis zum apokalyptischen Ungeheuer mit Tiara zog etwa der phantasievolle Lucas Cranach d. Ä. alle Register der Karikatur. Die Angriffe, durch den jungen Buchdruck massenwirksam verbreitet, konnte der Katholizismus kaum in gleicher Münze heimzahlen; die allbekannten Insignien von Papst- und Mönchtum aber eigneten sich vortrefflich zum visuellen Spott.
Auf Pressefehden um sein Image ging die stolze römische Kurie so gut wie nicht ein. Wenigstens traten die Päpste nun etwas bescheidener auf: Seit dem faktischen Scheitern spiritueller Großmachtansprüche und dem Einzug des Humanismus zeigten sich die Stellvertreter Christi nicht mehr ostentativ in Triumphpose.
So ließ sich Julius II., der immerhin Truppen geführt und 1506 den Grundstein zum neuen Petersdom gelegt hatte, vom Malerstar Raffael als weiser, besorgter Altvater des Glaubens darstellen. Auch sein Nachfolger Leo X. beauftragte Raffael zu einem Porträt ähnlichen Typs. Während Nordeuropa bis um 1650 immer wieder von blutigen Fehden mit konfessionellem Hintergrund erschüttert wurde, setzten die Päpste vorwiegend auf Festigung dessen, was sicher bleiben sollte: Territorial im Kirchenstaat, geistig in Bibliothek, Archiv und Geschichtsschreibung, äußerlich durch nützliche, möglichst pompöse Bauten und Kunstwerke. Denn so eifrig das Papsttum mit dem Konzil von Trient oder dem neuen, geistkämpferischen Jesuitenorden einzuholen versuchte, was glaubenspolitisch verspielt war – intellektuell sah sich die Kirche der Barockzeit aus ihrer bisherigen Führungsrolle verdrängt.
Neuen Wissenschaftszweigen wie der philologischen Textkritik, experimenteller Naturforschung und erst recht dem Selbstbewusstsein aufgeklärter Vernunft hatte Rom wenig entgegenzusetzen. Da lag es nahe, zumindest das Feld der großen Emotion imagepolitisch zu besetzen. Repräsentant dieser letzten Aufwallung ins Erhaben-Monumentale wurde der geniale neapolitanische Künstler Gian Lorenzo Bernini (1598–1680).
Denkmal Urbans VIII.
(Marmorskulptur von Gian Lorenzo Bernini, um 1640)
GETTY IMAGES
Ein erstes Zeichen setzte er im Petersdom mit dem riesigen und doch verspielten Altarbaldachin, für dessen bronzene Korkenziehersäulen unter anderem – zum Entsetzen von Altertumsfreunden – Deckenverkleidung des antiken Pantheons eingeschmolzen worden sein soll. Bernini war es auch, der Jahrzehnte später die beiden wuchtigen, perspektivisch trickreich konstruierten Säulenkolonnaden vor die Fassade stellte, ein gebautes Umarmungssymbol für den weiterhin allumfassenden Seelsorge- und Lehranspruch des Katholizismus. Höhepunkt von Berninis skulpturaler Rhetorik aber wurde das Gedenkporträt seines großen Gönners, Urbans VIII.
Die pompöse Marmorfigur, 1640 im Auftrag der Stadt Rom vollendet, zeigt einen segenspendenden, tiarabekrönten Wundermann in dekorativ wallenden Gewändern. Wie souverän Faltenwurf, Spitze und Stickereien aus dem Marmor gemeißelt sind, verblasst vor dem Gesamteindruck: Überirdisch beseelt, fordert diese Gestalt Ehrerbietung von den Betrachtern; sie brauchen nichts mehr zu deuten, schon gar nicht in furchtsamem Respekt zu erstarren, sondern sollen ganz unmittelbar majestätische Huld empfinden.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























