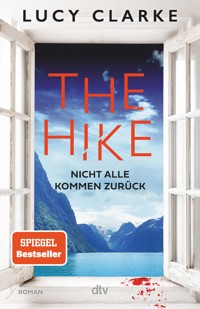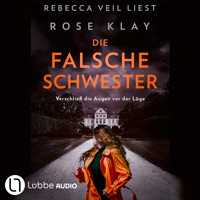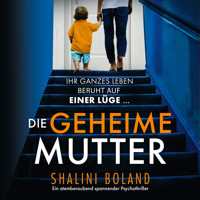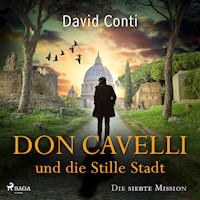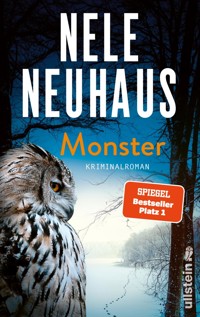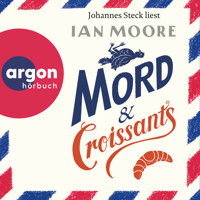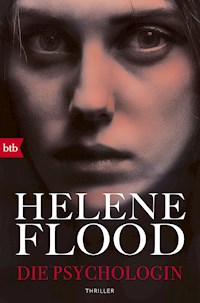
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Die 30-jährige Psychologin Sara behandelt Jugendliche mit familiären Problemen. Sie und ihr chronisch überarbeiteter Mann Sigurd sind vor kurzem in ein Haus mit Blick über Oslo gezogen, dort befindet sich auch Saras Praxis. Als Sigurd zu einer Übernachtung bei Freunden aufbricht, ist das letzte, was sie von ihm hört, eine Nachricht auf ihrer Mailbox, dass er gut angekommen sei. Doch noch am selben Abend ruft Sigurds Freund an und teilt ihr mit: Er war nie dort. Hat Sigurd gelogen? Was ist geschehen? Plötzlich fühlt sich Sara in dem großen Haus mit seinen vielen noch unfertigen Zimmern unwohl. Als die Polizei erscheint und sie befragt, beginnt sie zu ahnen, dass der Schlüssel zu Sigurds Verschwinden in ihrer Erinnerung liegt.
Je näher sie der Wahrheit kommt, desto schwerer fällt es Sara, die Kontrolle über ihr Leben zu behalten. Verliert sie, die gelernt hat, die Emotionen anderer Personen zu deuten, ihre so wichtige Intuition?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Ähnliche
Zum Buch
Die 30-jährige Psychologin Sara behandelt Jugendliche mit familiären Problemen. Sie und ihr chronisch überarbeiteter Mann Sigurd sind vor kurzem in ein Haus mit Blick über Oslo gezogen, dort befindet sich auch Saras Praxis. Als Sigurd zu einer Übernachtung bei Freunden aufbricht, ist das Letzte, was sie von ihm hört, eine Nachricht auf ihrer Mailbox, dass er gut angekommen sei. Doch noch am selben Abend ruft Sigurds Freund an und teilt ihr mit: Er war nie dort. Hat Sigurd gelogen? Was ist geschehen? Plötzlich fühlt sich Sara in dem großen Haus mit seinen vielen noch unrenovierten Zimmern unwohl. Als die Polizei erscheint und sie befragt, beginnt sie zu ahnen, dass der Schlüssel zu Sigurds Verschwinden in ihrer Erinnerung liegt.
Je näher sie der Wahrheit kommt, desto schwerer fällt es Sara, die Kontrolle über ihr Leben zu behalten. Verliert sie, die gelernt hat, die Emotionen anderer Personen zu deuten, ihre so wichtige Intuition?
Zur Autorin
Helene Flood ist Psychologin und lebt mit ihrer Familie in Oslo. Ihr erster Roman wurde bereits vor Erscheinen in Norwegen in 28 Länder verkauft. Er stand monatelang auf der Bestsellerliste, eine Verfilmung ist geplant.
Helene Flood
Die Psychologin
Thriller
Aus dem Norwegischen von Ursel Allenstein
Die norwegische Ausgabe erschien 2019 unter dem Titel »Therapeuten« bei Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS, Oslo.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2019 by Helene Flood
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022 by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Published in Agreement with Oslo Literary Agency
Covergestaltung: Semper Smile nach einem Entwurf von © Harvey Macaulay/Imperiet.dk for Grønningen 1, Denmark unter Verwendung eines Motivs von © Alexander Krivitskiy: Unsplash
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-26395-9${ebookVersion}www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Freitag, 6. März: Die Nachricht
Es war noch dunkel, als er ging. Ich wurde wach, als er sich über mich beugte und mich auf die Stirn küsste.
Ich gehe jetzt, flüsterte er.
Im Halbschlaf drehte ich mich um. Er trug seine Jacke und einen Rucksack über der Schulter.
Gehst du?, murmelte ich.
Schlaf einfach weiter, sagte er.
Ich hörte seine Schritte auf der Treppe, döste aber wieder ein, noch bevor die Tür hinter ihm ins Schloss fiel.
Als ich wieder aufwache, liege ich allein im Bett. Durch einen Spalt zwischen Rollo und Fensterbank fällt ein milder Sonnenstrahl auf mein Auge und weckt mich. Es ist halb acht. Keine schlechte Zeit, um aufzustehen.
Ich schlurfe barfüßig ins Bad, trotze den Holzsplittern auf dem Boden im Flur und den nassen Holzpaletten, die auf dem Lehmboden im Bad liegen. Dort drinnen haben wir keine Deckenlampe, aber Sigurd hat eine Arbeitslampe aufgestellt, als er die Fliesen abklopfte, und die steht immer noch da, beunruhigend dauerhaft. Zum Glück ist es jetzt hell genug, sodass ich die Lampe nicht brauche. Sie ist effektiv, wie Arbeitslampen im Allgemeinen, mit einem harten, weißen Licht, in dem ich mich so entblößt fühle wie früher in der Sportumkleide der Schule. Ich drehe das Wasser in der Dusche auf, damit es sich aufwärmt, während ich mich ausziehe. Der Boiler müsste ausgetauscht werden, aber Sigurd duscht immer nur kurz, und ich muss mir heute nicht die Haare waschen, sodass es reichen wird.
Die Duschkabine ist aus Plastik. Auch sie sollte nur eine vorübergehende Lösung darstellen. Sigurd hat eine Duschnische für uns gezeichnet, mit einer Mauer und einer Glastür und kleinen blaugesprenkelten und weißen Kacheln. Von allen halbfertigen Räumen im Haus wird der Stillstand im Bad am deutlichsten. Die alten Fliesen sind weg, die neuen noch nicht verlegt. Wir haben keine Lampen, keine ordentliche Gardine. Wir laufen auf den Paletten, um den Boden nicht zu beschädigen, das Wasser kommt aus einem Loch in der Wand, und dann diese provisorische Duschkabine, ein uraltes Überbleibsel von Sigurds Großvater. Eine Zeitlang konnte ich das Haus sehen, wie es einmal werden würde, wenn ich diese verlassene Baustelle betrat: die blau gesprenkelten Kacheln, die glatten Mauern, die eingelassenen Lampen; ich spürte die warmen Bodenfliesen unter meinen Füßen und das warme Wasser, das in perfekten Mengen aus dem modernen Duschkopf mit den verschiedenen Einstellmöglichkeiten floss. Jetzt sehe ich lediglich die ganze Zeit, die das alles noch in Anspruch nehmen wird. Während ich die Hand hineinhalte und spüre, wie die Temperatur im Strahl langsam steigt, wird mir plötzlich bewusst, dass ich nicht mehr daran glaube, dieses Haus jemals in einem fertigen Zustand zu sehen.
Unter dem warmen Wasser werde ich wach. Hier drinnen ist es kalt. Im Schlafzimmer lässt es sich ertragen, im Bad ist es eiskalt. Der Winter war lang, und ich habe jeden Morgen nackt auf der Stelle getrippelt und die Hand unter den Duschstrahl gehalten. Jetzt geht es immerhin langsam auf das Frühjahr zu. Die Dusche tut mir gut, sie prasselt auf meine kalte Gänsehaut, und ich sammle das Wasser in meinen Händen und tauche das Gesicht hinein, spüre, wie es mich endgültig aus der Nacht herauszieht, wie der Tag übernimmt.
Freitag. Drei Patienten, mein übliches Freitagsgrüppchen. Erst Vera, dann Christoffer, und am Ende Trygve. Es ist unklug, Trygve am Freitag als Letzten einzuplanen, aber wenn die Stunde vorbei ist, lasse ich mich jede Woche aufs Neue dazu verleiten. Ich sammle noch eine Handvoll Wasser, tauche das Gesicht hinein und reibe mir die Wangen. Sigurd wird mit seinen Freunden bis Sonntag im Norefjell bleiben. Ich bin das ganze Wochenende allein.
Ich gehe wieder ins Schlafzimmer, um mich anzuziehen, möchte mich keine Sekunde länger als nötig in dem kalten Bad aufhalten. Unsere Bettdecken liegen zerknäult auf dem Bett. Sie riechen muffig nach Schlaf, meine jedenfalls, seine vermutlich auch. Ich habe nicht auf die Uhr gesehen, als er sich verabschiedete, vielleicht ist es schon mehrere Stunden her. Wir haben keinen Schrank, aber Sigurd hat eine Metallstange zwischen dem Kaminschacht und der Wand montiert, wo wir Kleider, Hemden und Jacken aufgehängt haben. Seine wild durcheinander, meine ordentlich aufgereiht und nach Farben sortiert. Ich betrachte seine Sachen, es sieht nicht so aus, als würde etwas fehlen, aber er wollte ja auch direkt in die Berge fahren. Der Rucksack, der auf dem Boden stand, ist weg, und jetzt erinnere ich mich wieder, dass er ihn über der Schulter trug, als er aufbrach. Ich will eine Bluse und eine Hose anziehen, mich ordentlich und neutral für den Tag kleiden, und während ich eine weiche, taubenblaue Bluse auswähle, denke ich, dass ich schon in ein paar Stunden wieder hier hinaufkommen und meine Sportklamotten holen kann, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, oder eine Jogginghose und ein weißes T-Shirt anziehen, wenn nicht. Nur erst die drei Patienten.
Drei Patienten sind eigentlich zu wenig. Ich sollte jeden Tag vier haben, idealerweise auch einen oder zwei Tage in der Woche mit fünf Patienten. Das hatte ich mir ausgerechnet, als ich mich selbständig machte. In einer eigenen Praxis fällt weniger Papierkram an, hatte ich zu Sigurd gesagt, als wir in der Küche unserer alten Wohnung am Torshovparken Pläne schmiedeten und unser Budget in eine Exceltabelle einpflegten, vier Patienten am Tag schaffe ich gut, wahrscheinlich sogar fünf. An den meisten Tagen fünf. Oder wenigstens an einem Tag in der Woche, aber ein bisschen zusätzliches Geld würde ja auch nicht schaden. Wir lachten.
»Du sollst dich aber auch nicht zu Tode schuften«, sagte Sigurd.
»Das musst du gerade sagen«, erwiderte ich.
Er hatte sich zur selben Zeit selbständig gemacht, trug seine eigenen Kalkulationen in dieselbe Exceltabelle ein. Mindestens acht Kunden gleichzeitig, besser noch zehn. Und bei den anderen Partnern aushelfen, wenn sie es brauchten, jede Stunde zählte.
»Das werden einige Überstunden«, sagten wir zueinander, »aber wir verdienen damit, Geld für die Gemeinschaftskasse.«
Jetzt habe ich mehrere Tage mit drei Patienten und nur ausnahmsweise fünf an einem Tag. Wie kam es dazu? Es war schwieriger als erwartet, Patienten zu finden, und die Jugendlichen sagen oft ab, aber das ist nur die halbe Wahrheit.
Ich knöpfe meine Bluse bis oben zu, ganz anständig. Eine wichtige Sache hatte ich nicht in meiner Rechnung bedacht, damals in der Küche in Torshov, mit dem Licht von Sigurds alter Schreibtischlampe über dem PC und den Blättern, die wir vollkritzelten. Den menschlichen Faktor. Auch ich, die so gern allein ist, habe ein Bedürfnis nach anderen Menschen. Ich hatte meine Kollegen von der Liste gestrichen und nicht damit gerechnet, dass ich mich einsam fühlen würde. Dass ich dadurch in Passivität verfallen würde. Hätte mir jemand vor einem Jahr erzählt, wie schwer es mir fiele, ein bisschen Werbung zu machen, um zusätzliche Patienten zu gewinnen, wie sehr mir davor grauen würde, ich hätte ihm nicht geglaubt.
Für mich ist das Frühstück die beste Mahlzeit des Tages. Ich sitze an unserer Kücheninsel mit der Zeitung, einer Scheibe Brot und einer Tasse Kaffee. Ich esse am liebsten allein. Sigurd geht immer früh zur Arbeit, kippt im Stehen an der Arbeitsplatte einen Kaffee herunter. Ich nehme mir gerne Zeit. Lese die Kommentare in der Aftenposten, die Filmkritiken. Beginne den Tag kontemplativ.
Er hat seine Tasse nicht weggeräumt. Da steht sie, neben der Spüle. Die Küchenausstattung gehört zu den wenigen halbwegs fertigen Dingen im Haus, und die Arbeitsplatte ist so glatt, dass ich von meinem Sitzplatz den Halbkreis aus Kaffee unter seiner Tasse sehen kann. Natürlich. Vielleicht ist es eine weibliche Fähigkeit, einen Kaffeering unter einer Tasse zu erkennen, Krümel unter dem Toaster, Wassertropfen neben der Spüle. Sigurd möchte es schön haben, plant den Umbau des Hauses bis ins letzte Detail, erstellt sorgfältig ausgearbeitete Zeichnungen und beeindruckende Präsentationen mit Grafiken, doch an den kleineren Aufgaben scheitert er. Die Tasse in die Spüle zu räumen. Die Arbeitsfläche abzuwischen. Abends den Laptop wegzupacken. Es sind nur Kleinigkeiten, warum nörgle ich daran herum, warum rege ich mich auf? Andererseits – warum kann er nicht einfach die drei Sekunden aufbringen, die es dauern würde?
Weiter komme ich nicht mit meinen Gedanken, als ich zum Haken an der Wand hinübersehe, an dem normalerweise Sigurds Rollenköcher hängt. Er benutzt ihn, um Zeichnungen ins Büro zu transportieren und wieder zurück, ein graues Rohr aus Hartplastik mit einem schwarzen Trageband an jedem Ende, das immer am selben Haken hängt, wenn er es mit nach Hause bringt. Ich runzle die Stirn, während ich den leeren Haken betrachte. Wollte er nicht direkt zu Thomas fahren, um die Jungs aufzugabeln? Hatte er das nicht explizit gesagt? Und hing der Köcher nicht gestern Abend noch an der Wand?
Mir ist es schon immer schwergefallen, gegenüber Ungereimtheiten gleichgültig zu bleiben. Ich sehe, wie es anderen Menschen gelingt, und ich beneide sie: Eigentlich wollte er doch nicht noch mal im Büro vorbeifahren, tja, vielleicht habe ich ihn missverstanden. Eigentlich wollte er direkt zu Thomas fahren, aber vielleicht habe ich mich auch verhört, vielleicht musste er spontan noch schnell etwas in der Arbeit erledigen. Vielleicht hatte er den Zeichenköcher doch im Büro gelassen, und wenn ich glaube, ich hätte ihn gestern dort hängen sehen, war es in Wirklichkeit vorgestern. So hat man es bestimmt leichter. Diejenigen, die ein schlechtes Gedächtnis haben, scheinen weniger misstrauisch zu sein, weniger zänkisch. Um noch einmal das aktuelle Beispiel zu nehmen: Ich erinnere mich, ganz ohne Zweifel, wie wir gestern darüber sprachen, als ich mich aus unserer provisorischen Sitzecke erhob und in diese offene Küche hier ging, um den letzten Rest Tee wegzukippen und den Teebeutel in den Müll zu werfen und die Tasse in die Maschine zu räumen; wie ich mich vielleicht einen Meter von der Kücheninsel entfernt wegdrehte, an der ich jetzt sitze, und Sigurd fragte, wann fahrt ihr denn morgen? Und ich habe Sigurd so klar vor Augen, als würde ich ein Foto von ihm sehen, eins mit hervorragender Auflösung, Milliarden von Megapixeln, auf dem jede Hautunreinheit zum Vorschein kommt, ich sehe den abgewetzten Pullover und die löchrige Hose, die er abends so oft trägt, sehe, wie er sich mit einer Hand durch die wirren Locken fuhr und mich mit schmalen, müden Augen ansah, als hätte ich ihn geweckt, und sagte:
»Äh … Ich fahre früh los. Will versuchen, um halb sieben bei Thomas zu sein.«
Und ich fragte: »Halb sieben?«
Und er antwortete: »Ja. Dann sind wir schon morgens da und haben noch den ganzen Tag.«
Dann nahm er vielleicht versehentlich den Zeichenköcher mit. Dann wollte er vielleicht doch ein wenig im Ferienhaus arbeiten. Dann überlegte er es sich vielleicht anders und fuhr spontan im Büro vorbei.
Mein Gedächtnis ist zu detailliert. Ich erinnere mich viel zu genau daran, wie er aussah, als wir darüber sprachen, dass er den beigen Pullover mit dem schwarzen Kragen trug, der so schlecht geschnitten ist und aussieht, als hätte ihn seine Mutter für ihn gekauft, und so war es auch, sie hatte ihn gekauft, bevor er mich kennenlernte, das behauptete er jedenfalls hoch und heilig, als ich es wagte, ihn darauf hinzuweisen, wie grässlich ich dieses Kleidungsstück finde. Das ist ein vollkommen unwesentliches Detail, nichts, woran ich mich erinnern müsste. Und genauso wenig muss ich mich daran erinnern, dass ich »okay« antwortete und mich umdrehte, und dass er, als ich meine Teekanne wegräumte und zum Sofa hinübersah, schon seinen Laptop auf dem Schoß hatte und auf den Bildschirm blinzelte, die Augenbrauen hochgezogen, den Mund halbgeöffnet, und dass ich den Impuls unterdrückte, ihm zu sagen, er bräuchte mehr Licht, du machst dir die Augen kaputt, und nimm den Laptop vom Schoß, das mindert deine Spermienqualität, und irgendwann brauchen wir vielleicht eine Topqualität, und sitz nicht mit gebeugtem Nacken da, davon bekommst du Rückenschmerzen, und dass ich stattdessen nur sagte:
»Ich gehe hoch und lege mich hin. Gute Nacht.«
All das ist unwesentlich. Man muss das, was etwas bedeutet, von allem anderen trennen können, mehr nicht. Wenn man sich an alles erinnert, fällt es einem schwerer, zum Wesentlichen zu gelangen, zu dem, woran man sich erinnern muss.
Vom Badezimmerfenster aus kann ich sehen, wie die erste Patientin des Tages den Weg zu meiner Praxis über der Garage zurücklegt. Vera hat den Kopf leicht nach vorn geneigt, das verleiht ihr diesen charakteristischen Gang, den man so leicht wiedererkennt, den Gang einer Jugendlichen, die noch nicht ganz in ihren erwachsenen Körper hineingefunden hat. Wenn man sie fragen würde, wäre sie der Meinung, sie wäre erwachsen genug. Ich atme tief in den Bauch und folge ihr mit dem Blick, während sie die Tür zur Praxis öffnet und hineingeht. Nur drei Patienten, dann habe ich Wochenende. Ich fühle mich erschöpft, obwohl ich gerade erst aufgestanden bin.
Ich putze mir die Zähne und balanciere auf einer der Paletten, die Sigurd von einer Baustelle mitgebracht und auf den Badezimmerboden gelegt hat. Das Waschbecken stammt noch von Opa Torp, genau wie die Duschkabine, was bedeutet, dass sie vor 1970 eingebaut wurde und seither nichts mehr daran geändert wurde, was der alte Torp nicht selbst durchgeführt hat. Der Wasserhahn hat zwei Knäufe, einen für warmes Wasser und einen für kaltes, und wenn ich sie betrachte, sehe ich vor meinem inneren Auge, wie die krummen, gichtgeplagten Hände von Sigurds Großvater daran drehen. Er glaubte nicht an irdischen Besitz. Er wünschte sich, die Kommunisten würden Norwegen einnehmen. Es muss ihn enttäuscht haben, dass sie es nicht mehr vor seinem Tod schafften, denn er hatte seit den Fünfzigerjahren darauf gewartet. Als er schließlich in seiner »Kommandozentrale« auf dem Dachboden seinen letzten Atemzug tat, hatte seine politische Überzeugung unerschütterlich sowohl den Fall der Sowjetunion als auch Chinas Aufstieg als globale Wirtschaftsmacht überstanden, aber es musste den alten Fuchs dennoch entmutigt haben, dass sich seine Gesundheit im selben Tempo verschlechterte, in dem auch die letzten kommunistischen Staaten vor den kapitalistischen Ideen kapitulierten. Seine Glanzzeit hatte er während des Kalten Krieges und erzählte seinen Gästen – im Großen und Ganzen Sigurds Mutter oder Sigurd und mir – gern stolz, dass der norwegische Geheimdienst in den Siebzigerjahren eine Akte über ihn angelegt hatte. Doch im vergangenen Jahr starb er also, und jetzt sind die Souvenirs in diesem Haus alles, was von ihm geblieben ist: die alten Öfen und Wasserhähne und die Kommandozentrale, die bislang unverändert bestehen geblieben ist. Darin viele Regalmeter Lektüre wie die Mitgliedszeitschriften der Kommunistischen Partei und der AKP(m-l), Weltkarten voller Pinnnadeln, um strategisch wichtige Ziele zu markieren, und der alte, rostige Revolver, der angeblich noch aus der Zeit der Russischen Revolution stammte, und den er in den Siebzigerjahren angeschafft hatte, um sich zu verteidigen, oder um dem Geheimdienst einen Grund zu geben, ihm weiter in die Karten zu schauen.
Der Tod des alten Torp gab Sigurd und mir die Möglichkeit, einen Wohntraum zu erfüllen. In den Fünfzigerjahren war Nordberg ein Viertel wie jedes andere, doch mit den Jahren stiegen die Preise, und 2014 war es für ein junges, hoffnungsfrohes Paar wie uns geradezu unmöglich, genug Eigenkapital anzusparen, um sich an einem Ort wie diesem niederzulassen. Wenn wir zur U-Bahn liefen, nachdem wir den alten Torp besucht hatten, konnten wir seufzend schwärmen: diese Aussicht, und so nah am Wald, und nur eine kurze U-Bahn-Fahrt von der Stadt entfernt, und man kann den See von hier aus sehen! Mehr gab es nicht zu sagen. Wir konnten uns höchstens ein Reihenhaus im Vorort ohne eine Nähe zu oder eine Aussicht auf irgendetwas leisten. Doch zwei Tage, nachdem der alte Mann gefunden und für tot erklärt und vom Bestatter abgeholt worden war, rief Sigurds Mutter an und fragte: »Hört mal. Wäre Opas Haus im Kongleveien nicht genau das Richtige für euch?«
Margrethe, Sigurds Mutter, war Einzelkind und wohnt in einem modernen Haus in Røa. Sigurds Bruder Harald lebt in San Diego und hat keinen Bedarf an einem Haus in Oslo. Außerdem hatte Harald das Ferienhaus von Sigurds verstorbenem Vater in Krokskogen geerbt und versprochen, es nicht zu verkaufen, ehe die Mutter zu alt war, um dort die Ferien zu verbringen, und er würde eines Tages auch Margrethes Haus erben. Und so fiel das Haus des alten Torp an uns.
Ein unangenehmes Detail an seinem Tod besteht darin, dass wir ihn erst nach drei Wochen fanden. Er tat seinen letzten Atemzug in seiner Kommandozentrale auf dem Dachboden, direkt über dem Schlafzimmer, das Sigurd und ich jetzt teilen, während er mit seinem Mokka in der Thermoskanne über einer Karte brütete, auf der Deutschland noch geteilt war. Vermutlich starb er an einem Herzstillstand. Das war nicht weiter erstaunlich, immerhin war er fast neunzig Jahre alt. Er war kein besonders sozialer Mensch gewesen, nur seine engsten Familienangehörigen besuchten ihn. Margrethe unternahm gerade eine ihrer zweimonatigen Reisen in wärmere Gefilde, als es passierte, und Sigurd und ich hatten versprochen, den Großvater einmal in der Woche zu besuchen und nach dem Rechten zu sehen. Doch wir hatten viel zu tun mit unserer Arbeit und unserem eigenen Leben und übersprangen die eine oder andere Woche, und als wir mit zweiwöchiger Verspätung ankamen, spürten wir die Stille bereits, als Sigurd den Schlüssel im Schloss umdrehte.
»Opa?«, rief Sigurd.
Ich erinnere mich, wie wir uns mit einem etwas schuldgeplagten Lächeln ansahen, weil wir den alten Kommunisten so lange allein gelassen hatten, und wenn ich mich im Nachhinein an Sigurds Lächeln erinnere, erkenne ich die Anspannung darin, als hätte man die Mundwinkel mit Sicherheitsnadeln befestigt, damit sie oben blieben. Ich bin versucht zu sagen, dass wir es schon in dem Moment wussten, doch das wäre zu dramatisch. Aber vielleicht ließ uns das schlechte Gewissen schneller ahnen, dass etwas nicht stimmte. Opa?
Ich war es, die ihn fand. Er lag mit dem Gesicht auf der Karte. Seine Haut war grau und geädert, trocken wie Leder und genauso leblos, von fleckigen Blutergüssen übersät, weil er so lange gelegen hatte. Diesen Anblick würde ich gerne ausradieren. Die gelben Nägel, die aussahen, als würden sie jeden Moment abfallen. Die Knochen im Nacken, die kurz davor waren, durch die dünne Pergamenthaut hervorzubrechen. Der beißende Gestank von verwesendem Fleisch. Seither habe ich die Kommandozentrale kaum mehr betreten. Vielleicht hatte uns Margrethe das Haus auch überlassen, weil all das eine zu große Belastung war.
Wir wollten es sofort renovieren, wollten den alten Mann von den Wänden kratzen, wollten das Haus von ihm befreien und zu unserem eigenen machen. Sigurd zeichnete drauflos, ich kalkulierte unser Budget. Durch unsere neuerlangte finanzielle Freiheit hatten wir andere Möglichkeiten. Einige frühere Kommilitonen von Sigurd wollten ein eigenes Architekturbüro eröffnen und fragten ihn, ob er Teilhaber werden wollte. Wir mussten keinen Immobilienkredit aufnehmen, und der Verkauf unserer alten Wohnung finanzierte die Summe, die er brauchte, um sich in das Büro einzukaufen. Ich war mit meinem Job in der Jugendpsychiatrie unzufrieden. Jetzt hatten wir genug Platz, um eine Praxis einzurichten. Das Haus war für uns der Beginn von etwas Neuem. Vier Tage, bevor wir umzogen, heirateten wir im Osloer Rathaus. Anschließend aßen wir in Halvorsens Konditorei mit meiner Schwester und Sigurds beiden besten Freunden und deren Freundinnen Sahneschnittchen. Die Hochzeit änderte nichts, wir waren nach wie vor wir selbst, aber wir wollten alles offiziell absichern. An unserem ersten Abend im Haus schliefen wir im Wohnzimmer auf der Luftmatratze. Wir stießen mit Prosecco an und sagten einander: Jetzt fängt es an.
Doch wie sich herausstellte, war es nicht so leicht wie gedacht, den alten Torp zu vertreiben. Die Renovierung dauerte länger als vorgesehen. Der Beginn unserer Selbständigkeit auch. Vor allem Sigurd machte Überstunden, und bei unserem Plan vom Umbau war in erster Linie er gefragt; seine Expertise, sein handwerkliches Geschick. Wir hatten übereifrig und voller Unternehmungsgeist angefangen. Hatten die Tapeten abgerissen, die Fliesen im Bad abgeklopft. Und wir hatten auch einiges geschafft, eine neue Küche eingebaut und für mich über der Garage die Praxis eingerichtet. Doch dann nahm unser Eifer ab. Sigurd hatte mehr Kunden, längere Tage. Er saß über seinen Zeichentisch gebeugt. Der Winter kam, es wurde kälter und dunkler, und uns ging die Energie aus. Wenn wir mit unserer eigenen Arbeit fertig waren, hatten wir keine Kraft mehr, zu streichen oder in den Baumarkt zu fahren, um nach Duschköpfen oder Wasserhähnen zu schauen, oder nach Fliesen oder Farben, wir rührten keine Spachtelmasse an und rissen keine weiteren Tapeten ab, sondern sanken auf das alte Sofa, das wir aus Torshov mitgebracht hatten, und sahen fern. Oft kam Sigurd erst spät am Abend zurück, mit gebeugtem Nacken, den Zeichenköcher von der Schulter baumelnd.
Nur bis zum Sommer, sagten wir. Die Sommerferien nutzen wir für das Haus. Bis dahin sind es noch drei Monate, und es erschreckt mich selbst, dass ich den Glauben schon jetzt verloren habe. Es wird anders kommen. Im Sommer werden wir sagen, nur bis zum Herbst, und dann wird es kalt, und uns erwartet ein weiterer langer Winter, in dem ich mit Füßen, die steif und taub sind wie gefrorene Keulen, über die Paletten im Bad trippele.
In meiner Praxis über der Garage habe ich das kleinste Wartezimmer, das man sich vorstellen kann, mit einem Schuhregal, einem Holzstuhl, einem winzigen Tisch mit Zeitschriften und schließlich der Tür, die zu meinem Behandlungsraum führt. Vera sitzt auf dem Holzstuhl. Sie hat eine Zeitschrift auf dem Schoß liegen, aber ich habe den Verdacht, dass sie gar nicht liest. Als ich hereinkomme, sieht sie auf.
»Hallo Frau Doktor«, sagt sie.
Sie sieht immer wach und frischfrisiert aus.
»Hallo«, sage ich. »Warten Sie noch einen Moment, dann werde ich … Ich hole Sie gleich.«
»Ja, natürlich«, sagt sie bereitwillig, mit einer hochgezogenen Augenbraue, diesem Ausdruck, den ich am häufigsten bei ihr sehe, diesem kleinen Hauch von Ironie, den sie fast all ihren Äußerungen verleiht.
Ich gehe in meinen Behandlungsraum und schließe die Tür hinter mir, damit Veras Blick mir nicht bis hinein folgen und sich alles ausmalen kann, was ich mache.
Den Raum hat Sigurd gut gelöst. Er ist nicht groß, und wegen der Dachschräge kommt es darauf an, den wenigen Platz optimal auszunutzen. Auf der einen Schmalseite, die auf die Einfahrt hinausgeht, hat er die Außenwand entfernt und alles komplett verglast. Dort stehen meine Sessel, zwei schöne Arne-Jacobsen-Modelle, mit einem kleinen Tisch in der Mitte. Wenn meine Patienten und ich dort sitzen, befinden wir uns am hellsten Ort im ganzen Raum. Im Dach über uns hat Sigurd ein schräges Fenster eingebaut, sodass auch dort Licht hereinfällt, und ein paar einfache Deckenleuchten machen die Ecke freundlich und gemütlich, egal ob draußen Herbststürme toben oder frostiger Winter herrscht. Vor der anderen Schmalseite, die an das Wartezimmer grenzt, hat er meinen kleinen weißen Schreibtisch platziert. Außerdem hat er an der Wand rechts und links von der Tür Regalborde aufgehängt, die bis unter den Dachfirst reichen, sodass ich genug Raum für meine Bücher und Ordner habe. Die Schmalseite und der Boden sind aus hellem, freundlichem Holz, die anderen Wände sind weiß gestrichen, und alles ist modern und freundlich. Dort, wo die Dachschräge an den Längsseiten in den Boden übergeht, habe ich ein paar Pflanzen hingestellt, und obwohl es wirklich schwierig ist, sie am Leben zu erhalten, weil es hier drinnen kalt wird, sobald ich den Heizstrahler ausschalte, sorgen sie für eine heimelige Stimmung. Hier kannst du durchatmen, sagt das Zimmer. Hier kannst du sein, wie du bist. Nichts von dem, was du hier sagst, wird verurteilt oder weitererzählt oder lächerlich gemacht werden. Genau das, was ich wollte, eine einladende Praxis. Und ich habe sie auch bekommen. Das muss ich Sigurd lassen.
Doch jetzt wartet Vera dort draußen auf mich, und mein Hals wird von einer lähmenden Müdigkeit zugeschnürt. Ich habe keine Lust, sie hereinzubitten. Ich setze mich an den Schreibtisch und schalte den Computer ein. Ich werde mir meine Notizen zur letzten Sitzung in ihrer Akte ansehen, obwohl ich es streng genommen nicht bräuchte, ich erinnere mich, worüber wir letztes Mal gesprochen haben. Ich schinde lediglich Zeit, will den Augenblick hinauszögern, wenn ich hinausgehen und sie holen muss. Warum das so ist, weiß ich nicht, und ich möchte auch nicht darüber nachdenken. Ein Therapeut hegt Empathie für seine Patienten, und ich für Vera, aber ich muss mir eingestehen, dass die Sitzungen mit ihr mühsam sind.
Konflikte mit den Eltern, steht in meinen Notizen vom letzten Mal, Konflikte mit dem Freund. Vera hat Probleme mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Sie kam kurz nach Weihnachten wegen einer depressiven Verstimmung zu mir. Sie ist überdurchschnittlich intelligent, vielleicht sogar hochbegabt, und von allem gelangweilt. Ich bin alles so leid, sagte Vera in unserer ersten Sitzung, als sie mir erzählen sollte, warum sie zu mir kam, alles erscheint mir bedeutungslos. Wie sich herausstellte, ist ihr Freund ein verheirateter Mann. Ihre Eltern sind Forscher, sie versuchen, ein mathematisches Theorem zu beweisen, das nur eine Handvoll Menschen auf der Welt annähernd begreifen, sie arbeiten andauernd und sind häufig verreist. Ihre Geschwister sind erwachsen und längst von zu Hause ausgezogen, und Vera, die achtzehn Jahre alt ist und sich erwachsener fühlt, als sie ist, meint, ihre Familie sei schon vollständig gewesen, als sie kam. Die Eltern wollten kein weiteres Kind. Sie war ein Unfall.
Das sagt natürlich einiges. Es gibt viel Schmerz in Veras Leben. Aber es ist zäh, an diesen Themen zu arbeiten.
Ich lese meine Mails, ziehe die Zeit in die Länge, bevor ich sie hereinlasse. Nur Werbung, nichts Persönliches. Für einen Moment bekomme ich Lust, Sigurd anzurufen, aber das wäre dumm, wir haben erst fünf vor neun, wahrscheinlich ist er immer noch mit seinen Jungs im Auto unterwegs. Ich atme ein. Nur noch drei Patienten, dann ist Wochenende. Den ganzen Abend allein. Am Sonntag bin ich bei meiner Schwester zum Mittagessen eingeladen, ansonsten habe ich keine Pläne. Höchstens zum Sport gehen.
»Sind Sie bereit, Frau Doktor?«, fragt sie, als ich herauskomme, um sie aufzurufen.
Die Sache mit dem Doktor hat sie sich bei unserer zweiten Sitzung ausgedacht. Sie fragte mich nach dem Unterschied zwischen einem Psychologen und einem Psychiater, und ich erklärte, ich sei Psychologin und nicht Ärztin, sei darin ausgebildet, den Menschen als Ganzes zu betrachten und nicht nur in seiner Pathologie, aber sie versteifte sich nur auf Ersteres und sagte: Sie sind also gar kein richtiger Doktor? Irritierenderweise quälte mich das und brachte einen Minderwertigkeitskomplex zum Vorschein, den ich gar nicht von mir kannte, denn ich antwortete ein wenig defensiv, ich wüsste mindestens so viel wie ein Arzt über all das, was in den Köpfen der Menschen vor sich gehe, und sie lachte und sagte, ist schon in Ordnung, ich nenne Sie Frau Doktor. Seither spüre ich immer ein stechendes Unbehagen, wenn sie es sagt, ein kribbelndes Gefühl tief im Hals, weil ich zu viel von mir offenbart habe. Hin und wieder frage ich mich, ob ihr bewusst ist, dass es mich quält, ob es eine passive Aggression ihrerseits ist, aber sie wirkt eigentlich aufrichtig, nichts weiter als scherzhaft.
Ich lasse sie vor mir in den Raum. Vera ist etwas mehr als mittelgroß, dünn, mit geraden Hüften. Ihre Hände sind ein wenig groß, sie hängen wie Pendel an ihr herab, und ich betrachte sie und frage mich, wie immer, wenn ich andere Frauen sehe: Ist sie hübsch?
Ja, auf eine normale Weise. Jung. Aber gleichzeitig hat sie etwas Drolliges an sich, das kleine, runde Gesicht, der lange Körper.
»Tja«, sagt sie, als sie sich setzt, »ich habe mich schon wieder mit meinen Eltern gestritten. Und mit Lars.«
»Dann erzählen Sie mal«, sage ich und setze mich auf dem Stuhl zurecht.
Die Morgensonne fällt durch das kleine Fenster im Dach, während sie berichtet, und erleuchtet ihr Haar, sodass es an eine Glorie erinnert, diese hunderte von krausen Härchen, die sich aus ihrer sonst so glatten Frisur herausgemogelt haben. Alle jungen Frauen haben diese unbezwingbaren Haare, denke ich. Ich selbst habe auch massenhaft davon, mehr als Vera.
Das Muster hinter dem, was sie mir erzählt, ist offensichtlich. Vera fühlt sich von ihren Eltern abgewiesen, die mit so vielen wichtigen Sachen beschäftigt sind, dass sie keine Zeit für sie haben. Weil sie es nicht schafft, ihnen zu erzählen, warum sie das traurig macht, verändert sich durch die Konfrontation mit ihnen nichts zum Besseren, und Vera, die sich noch zurückgewiesener fühlt als ohnehin schon, ruft ihren Freund an und beginnt einen neuen Streit. Der verheiratete Freund fährt nach Hause zu seiner Frau, nachdem sie aufgelegt haben, egal, was passiert, deshalb läuft auch dieser von ihr provozierte Streit darauf hinaus, dass sie zurückgewiesen wird, und auf diese Weise nimmt sie das nicht zu bewältigende Gefühl, von den Eltern benachteiligt zu werden, und steckt es bei ihrem Freund in einen etwas leichter erträglichen Rahmen. Nachdem eine halbe Stunde von unserer Sitzung vergangen ist, teile ich diese Beobachtung mit ihr.
»Ich weiß nicht«, sagt Vera und kräuselt lächelnd die Nase. »Ist das nicht ein bisschen zu einfach? Ein bisschen zu freudianisch, irgendwie?«
»Ist das so zu verstehen, dass Sie glauben, es stimmt nicht?«
Sie sieht zum Bücherregal hinüber, scheint meine Deutung zu überdenken. Ihre Finger zupfen an dem Armband, das sie um das Handgelenk trägt, es ist ein dünnes Silberkettchen mit einer einzelnen Perle, die sie zwischen Daumen und Zeigefinger hin- und herrollt. Dieser Schmuck ist ein bisschen zu erwachsen für sie, denke ich. Die anderen Mädchen, die zu mir kommen, tragen Ketten mit Buchstaben, zieren sich mit Worten wie LOVE oder TRUST oder ETERNITY. Veras Armband könnte auch einer erwachsenen Frau gehören.
»Ich weiß nicht. Ich hoffe es nicht. Ich glaube eigentlich nicht, dass ich Lars angerufen habe, weil ich Lust hatte, mich schlecht zu fühlen. Ich dachte, es geht mir schlecht, und wollte mich besser fühlen.«
»Verstehe«, sage ich. »Und am Ende haben Sie sich noch schlechter gefühlt als ohnehin schon.«
»Ja«, sagt sie und seufzt schwer. »Es war also eine schlechte Strategie, könnte man sagen.«
»Was wäre denn eine gute Strategie gewesen, glauben Sie?«
»Um mich besser zu fühlen? Ich weiß es nicht. Mir fallen nur schlechte Strategien ein.«
»Was denn zum Beispiel?«
»Selbstverletzung«, sagt sie. »Ist das nicht der Klassiker? Ein Mädchen aus meiner Klasse macht das auch. Sie bloggt sogar darüber, macht Fotos und zeigt ihre Wunden, vollkommen krank. Aber das ist nicht mein Stil. Es sei denn, Lars fällt auch unter selbstverletzendes Verhalten.«
Ihre letzte Bemerkung ist als Einladung gedacht, aber ich übergehe sie. Sie möchte über ihren Freund sprechen, verspürt das Bedürfnis, diese Beziehung mit jemandem zu diskutieren, hat aber niemanden, dem sie sich anvertrauen könnte. Allerdings ist das nicht der eigentliche Schmerz. Meiner Meinung nach ist der Freund nur eine Verlagerung, während die Ursache ihrer Depression tiefer liegt, dort, worüber Vera nicht sprechen möchte. Dorthin müssen wir vordringen. Mein Körper ist immer noch schläfrig, ich widerstehe der Lust, mich auf meinem Sessel zu räkeln. Hinter Vera kann ich sehen, wie sich der Nebel auflöst. Es wird ein schöner Tag werden.
»Nach dem Streit mit Ihren Eltern waren Sie traurig«, sage ich. »Sie wollten sich besser fühlen, und anstelle von selbstverletzendem Verhalten oder etwas anderem Dummen haben Sie sich für etwas entschieden, was funktionieren hätte können – Beistand bei einem anderen Menschen zu suchen. Das Problem war nur, dass Sie einen Menschen gewählt haben, von dem Sie wussten, er würde Sie zurückweisen. Mein Gedanke ist folgender: Was wäre gewesen, wenn Sie jemand anders kontaktiert hätten?«
»Wen denn?«
»Ich weiß nicht. Jemanden, auf den sie sich verlassen können. Eine Freundin zum Beispiel.«
»Eine Freundin«, sagt sie müde.
»Haben Sie Freundinnen, Vera?«
Sie sieht mich an. Mustert sie mich? In ihrem Blick blitzt etwas Provokantes auf, und sie sagt:
»Ich habe viele Freundinnen. Mein Gott, haufenweise, mehr, als ich gebrauchen kann. Aber wissen Sie, was das Problem ist?«
»Nein«, sage ich. »Was ist das Problem?«
»Sie sind total beschränkt. Alle miteinander.«
»Aha«, sage ich, denke einen Augenblick zurück und überlege. »Das klingt nicht so, als wären es besonders gute Freundinnen.«
Sie holt Luft. Ihr Gesicht wird sanfter.
»Na gut, vielleicht nicht total beschränkt. Aber sie verstehen so wenig. Sie ahnen ja nicht, wie die Mädchen in meiner Klasse sind. Sie lesen rosa Blogs und planen die Abifeier und finden, es wäre das Wichtigste der Welt, seine Augenbrauen auf eine bestimmte Weise zu zupfen. Verstehen Sie? Wenn man sie nach der Liebe fragt, reden sie davon, wie sie mal auf einer Party mit einem Typen aus der Parallelklasse geknutscht haben. Wie sollen die mir helfen?«
»Das heißt, obwohl Sie genug Menschen um sich haben, gibt es eigentlich nicht so viele, bei denen Sie Unterstützung finden können«, sage ich.
»Ich habe Lars.«
»Ja. Aber Lars ist etwas anderes als eine Freundin. Das klingt ein bisschen einsam?«
Diese Perspektive gefällt ihr nicht, das erkenne ich sofort. Vera wünscht sich, dass Lars ihr genügt. Sie hält sich für etwas Besseres als ihre Klassenkameradinnen, möchte aber nicht für diese Sonderstellung bemitleidet werden.
»Aber muss man denn wirklich die ganze Zeit so wahnsinnig vertraut mit anderen sein«, sagt sie.
»Ich glaube, alle Menschen brauchen jemanden, mit dem sie vertraut sein können.«
Auch das gefällt ihr nicht.
»Haben Sie denn Freundinnen, mit denen Sie das können?«, fragt sie, und jetzt schwingt etwas Gemeines, Spöttisches in ihrer Stimme mit, es trifft mich unvorbereitet, und ich spüre es im Bauch; das Unbehagen darüber, Ziel eines Angriffs zu werden. »Haben Sie überhaupt Freundinnen?«
Sie hat erneut ihre Augenbraue hochgezogen. So viele der Mädchen, die zu mir kommen, erzählen mir vom Überlebenskampf auf dem Schulhof, von brutalen Strategien, um in der Hackordnung aufzusteigen. Fressen oder gefressen werden. Vera betrachtet mich genau so, wie die Königin der Klasse das stille Mädchen in der letzten Reihe betrachtet.
»Ja, die habe ich«, sage ich ein wenig zu schnell. »Wir sprechen nicht die ganze Zeit über tiefschürfende Dinge, aber ich habe Vertraute. Ich glaube, das braucht man.«
Wir sehen einander an, mustern uns gegenseitig, und ich spüre bereits, dass ich mit meinem Konter gescheitert bin.
»Und daran kann man auch arbeiten«, sage ich in einem Versuch, doch noch etwas Konstruktives daraus zu machen.
In ihrem Blick liegt etwas, das ich nicht genau deuten kann, als würde sie mich messen. Dann scheint sie das Interesse zu verlieren.
»Na dann«, sagt sie und blickt auf die Perle hinab, die sie an ihrem Armband dreht. »Ja, Sie brauchen das vielleicht, aber bei mir ist es anders.«
Das ging schief. Sie ist wütend geworden. Sie hat ihre Wut an mir ausgelassen, wie es Jugendliche nun einmal tun. Ich habe es nicht geschafft, angemessen damit umzugehen, konnte ihr nicht geben, was sie brauchte. Stattdessen bin ich am Ende sogar in die Defensive gegangen. Vera streicht sich müde die Haare aus dem Gesicht, es ist eine erwachsene Geste, aber dann lässt sie es wieder fallen und betrachtet mich erneut, und dabei sieht sie jünger aus als achtzehn.
»Ich brauche keine Vertrauten«, sagt sie. »Ich brauche nur Liebe.«
Sie klingt wie ein trotziges Kind, ich hätte fast Lust, ihr über die Wange zu streichen. Das ist Veras blinder Fleck. Sie ist so überzeugt davon, dass sie schlau ist, fühlt sich so viel älter und weiser als ihre Freundinnen, dass sie nichts von dem Ausmaß all dessen ahnt, was sie noch nicht erlebt hat. Vielleicht wäre es meine Aufgabe, ihr dabei zu helfen, es zu verstehen. Aber ich bin so müde. Es ist Freitag, und außerdem ist unsere Stunde bald vorbei.
Ich blicke auf die Uhr, und Vera bemerkt es.
»Zeit zu gehen, Frau Doktor?«, fragt sie mich.
Ich mache schnell ein paar Notizen, die ich anschließend für ihre Akte ausformulieren will. Streit mit den Eltern, schreibe ich, provozierter Streit mit dem Freund. Ich mache eine kleine Pause, lese. Streiche provoziert. Überlege. Schreibe stattdessen hat einen Streit mit dem Freund angefangen. Bewertung, schreibe ich, und überlege. Wie soll ich Veras Verhalten bewerten? Furcht vor Zurückweisung, reagiert sensibel auf das Thema Einsamkeit. Intervention: Deutung, Versuch, die Reflektion über die eigenen Reaktionen anzuregen. Näher auf das Gefühl eingehen, dass sie keine Gemeinsamkeiten mit den Menschen in ihrer Umgebung hat.
Ich blicke hinaus und sehe, dass der BMW von Christoffers Mutter schon mit Standlicht am Straßenrand steht. Ich mache einen Punkt und strecke und drehe mich auf dem Stuhl, als wollte ich mich auswringen wie einen Lappen.
Christoffer sitzt im Wartezimmer, als ich hinauskomme. Er sitzt entspannt auf dem Holzstuhl, hat ein Bein angewinkelt über das andere geschlagen, sodass das Fußgelenk auf dem Knie liegt.
»Hallo, wie geht’s«, sagt er, während er aufsteht und in den Raum schlendert.
Ohne zu zögern, geht er zu dem Sessel, den er sich ausgesucht hat. In der ersten Sitzung ist das eine Art Lackmustest, weil ich mit allen Patienten denselben Ablauf befolge. Erst bitte ich sie herein. Die meisten Jugendlichen warten, bis ich sie auffordere, sich hinzusetzen, und ihnen ein Zeichen gebe, in welchem Sessel sie Platz nehmen sollen. Das ist ganz natürlich, es ist mein Behandlungszimmer, sie sind die Gäste. Manche fragen explizit: Welchen Stuhl soll ich nehmen? Einige wenige, darunter auch Christoffer, wählen selbst einen. In unserer ersten Sitzung blieb er einen Moment stehen und begutachtete die beiden Sessel, dann wählte er den linken, ließ sich daraufsinken, legte das eine Bein über das andere und sah aus, als würde der Raum ihm gehören.
Ich setze mich auf den anderen Sessel. Christoffer und Vera haben unterschiedliche Sessel, sodass ich nun auf dem sitze, der immer noch schwach von ihr aufgewärmt ist.
»Na dann«, sagt Christoffer und grinst so breit, dass ich all seine weißen Zähne sehen kann, von einem Backenzahn zum anderen. »Ich wäre so weit. Schießen Sie los.«
Fehlte nur noch, dass er mir zuzwinkert, er tut es nicht, aber es hätte mich nicht überrascht.
»Wie geht es Ihnen?«, frage ich.
Ich versuche, neutral zu klingen, freundlich, aber zurückhaltend. Ich will mich nicht von seinem Lächeln mitreißen lassen.
»Tja«, sagt er. »Mir geht’s blendend.«
Ich muss erwähnen, dass das Gesicht, das seine großen Zähne umrahmt, ein wenig unrasiert ist, sein Haar mit dem Mittelscheitel fast bis zum Kinn reicht, dass er es außerdem schwarz gefärbt hat und ein Lederband mit Nieten um den Hals trägt, das wie ein Hundehalsband aussieht. Er hat seine Lederjacke ausgezogen und sitzt im T-Shirt da, sodass die Tätowierungen auf seinen Armen zu sehen sind, und auch um Handgelenke und Taille trägt er Leder und Nieten. Ich überlege, ob er jemals umarmt wird. Er ist ein hübscher, ansprechender Junge, dessen Outsider-Position selbst gewählt ist, und ich nehme an, dass die Mädchen ihn, wenn schon nicht umschwärmen, dann doch wenigstens interessant finden. Aber ihn umarmen, mit all den Nieten und Nägeln? Wäre das nicht so, als würde man einen Igel umarmen?
»Die Schule?«, frage ich ihn.
»Na ja. Ich bin am unteren Ende der Notenskala. Aber ich schlage mich durch. Man darf nie den Mut verlieren, stimmt’s?«
»Und die Familie?«
Jetzt grinst Christoffer noch breiter; man kann die Stelle sehen, an der seine Weisheitszähne in ein paar Jahren hervorbrechen werden, und er sagt: »Alles bestens. Mein Alter ist in Brasilien und will nicht wieder nach Hause kommen. Und meine Alte zittert vor Angst wegen dem da.«
Er klopft mit den Knöcheln auf sein Stachelhalsband.
»Sie hätten sie mal hören sollen.«
Er spricht mit Fistelstimme und zieht eine idiotische Miene mit grotesk heruntergezogenen Mundwinkeln.
»Christoffer Alexander, willst du wirklich mit dem da um den Hals zur Schule gehen? Du siehst aus wie eine Hure.«
Ich muss mir das Grinsen verkneifen. Christoffer lehnt sich zurück und lacht aus vollem Hals.
»Und das freut Sie?«, frage ich ihn.
»Klar«, antwortet er zufrieden.
»Also«, sage ich. »Es ist nicht so, dass ich die Mühe, die Sie in Ihren Stil investieren, nicht zu schätzen wüsste. Aber glauben Sie nicht, Sie hätten auch eine andere Möglichkeit finden können, Ihre Mutter zu ärgern, die ein bisschen weniger an, Sie wissen schon, selbstschädigendes Verhalten erinnert?«
Ein weiteres Lachen entfährt Christoffer.
»Das mag ich so an Ihnen, das muss ich schon sagen. Die Mühe, die ich investiere, ja, das können Sie wohl sagen. Doch, Sie haben schon recht. Aber ich habe mich ja noch nie selbst verletzt.«
»Das weiß ich auch«, sage ich, und jetzt sehe ich ihn mit ernster Miene an, und er reduziert sein Grinsen um ein Drittel. »Aber Ihr Stil deutet das zumindest an.«
»Ich glaube, an dieser Stelle müssen wir uns darauf einigen, dass wir uneinig sind«, sagt er.
Manchmal verfällt er in solche erwachsenen Phrasen. Christoffer hat in den sechs Monaten, die wir uns schon kennen, immer ausgesehen wie ein Satansanbeter, aber hinter der Oberfläche verbirgt sich ein höflicher Junge aus einem guten Stadtteil. Als wir uns das erste Mal sahen, gab er mir die Hand, nannte seine Namen und sagte, er freue sich, mich kennenzulernen. Christoffer geht nur in Therapie, weil seine Mutter es für nötig hält. Seine Eltern hatten sich vor einigen Jahren in einem tränentriefenden, türenschlagenden Drama getrennt, und Christoffers Kleidungs- und Musikstil in Kombination mit einer gewissen Frechheit und einem rasant fallenden Notenschnitt hatte seine Mutter auf einen Schlag aus ihrer Scheidungsstarre geweckt. Sie rief mich mit ihrer hohen Stimme an und erklärte, ihr Sohn brauche dringend Hilfe.
Das ist eine Wahrheit mit Modifikationen. Schon seit unserer ersten Sitzung bin ich überzeugt, dass Christoffer klarkommen wird. Er wird seinen Protest so lange durchziehen, wie er seine Mutter damit ärgern kann, und vielleicht hofft er auch, er könnte so seinen Vater aus Brasilien zurücklocken. Doch eines Tages, in nicht allzu ferner Zeit, wird Christoffer seine schwarzen Klamotten und die Nietengürtel einpacken, er wird sich normal anziehen und in die Schule gehen, als wäre nichts gewesen, und das Versäumte aufholen. Er wird auf die weiterführende Schule wechseln und Noten haben, die für das genügen, was er im Leben erreichen möchte, und sich zurechtfinden. Das weiß ich, und Christoffer weiß es auch.
Die Einzige, die es nicht weiß, ist Christoffers Mutter, und hier liegt mein moralisches Dilemma. Denn ist es nicht unethisch, Christoffer Woche für Woche zu therapieren, wenn er es gar nicht nötig hat? Andererseits brauche ich jeden Patienten, und Christoffer kommt gern zu mir. Wir haben einen guten Ton miteinander gefunden, und ich vermute, dass er es spannend findet, eine Therapie zu machen, dass es zu dem Stil passt, den er gerade ausprobiert. Christoffers Mutter, die jetzt in dem BMW mit Standlicht sitzt und auf ihn wartet, schläft nachts garantiert besser, wenn sie weiß, dass er »in professionellen Händen« ist, wie sie es ausdrückt. Und ist es nicht eine Vereinbarung, von der alle Beteiligten profitieren?
Einmal habe ich versucht, die Therapie zu beenden, wenn auch nicht so nachdrücklich, wie es nötig gewesen wäre. Daraufhin rief mich Christoffers Mutter abends in Tränen aufgelöst an.
»Sie dürfen nicht aufgeben!«, jammerte sie. »Sie sind unsere einzige Hoffnung!«
Das war kurz vor Weihnachten, draußen schneite es, und ich saß in dem Sessel, in dem Christoffer jetzt sitzt, blickte in das dunkle Schneegestöber hinaus und dachte: Angenommen, ich behalte ihn. Welcher Schaden kann schon entstehen? Ich benannte alles mit Fachtermini, für mich allein, weil sonst ohnehin niemand da war, vor dem ich mich rechtfertigen musste. Ich biete ihm ein emotionales Korrektiv, sagte ich. Ich bin eine stabile erwachsene Bezugsperson, mit deren Hilfe er seine Identität ausforschen kann. Solche Sachen schreibe ich in seine Akte. Ich tröste mich damit, dass ich eine Privatpraxis habe und mit der Therapie keine Steuermittel verschwendet werden, sondern nur das Geld von Christoffers wohlhabendem Vater. Und wie ich den Gesprächen mit der Mutter entnehmen konnte, hat es der Vater, dieser Mistkerl, auch nicht besser verdient.
Sigurd hat angerufen. Er hat auf die Mailbox gesprochen, als ich gerade mitten in meiner Sitzung mit Vera war. Jetzt sitze ich in der Küche und mache Mittagspause mit einem Thunfischsandwich und Orangensaft. Ich stelle den Lautsprecher meines Handys an, lege es neben mich auf die Arbeitsplatte und höre mir seine Nachricht an.
»Hallo Liebste«, sagt er mit seiner Sigurdstimme, diesem warmen, melodischen Klang. »Wir sind jetzt in Thomas’ Ferienhaus angekommen. Hier ist es, ja, schön ist es hier, ich …«
Es knistert im Telefon, und dann höre ich ihn lachen, ein paar perlende Kiekser.
»Das ist nur Jan Erik, der macht hier irgendwelchen Quatsch mit den Holzscheiten, er sieht aus wie ein Idiot, ich … ich muss jetzt wohl Schluss machen. Ich wollte nur sagen, dass wir angekommen sind, und ich melde mich später wieder. Ich hab dich lieb. Na dann. Mach’s gut.«
Ich habe mein Sandwich fast aufgegessen. Ich sitze mit dem letzten Stück Brotkruste in der Hand da, während mein Mann redet, und ich spüre ein Ziehen im Bauch, ich vermisse ihn. Was für ein dummer Gedanke. Er ist doch erst seit ein paar Stunden weg. Eigentlich bin ich ja gern allein. Mache Sport. Esse etwas, das er nicht mag. Sehe Filme, die er albern findet. Trinke Weißwein, obwohl er meint, das wäre ein Getränk für alte Damen oder Junggesellinnen. Gehe früh ins Bett. Mache etwas aus dem Tag.
Es ist einfach nur seine Stimme auf der Mailbox. Ich werde ihn nach der Arbeit anrufen. Ich esse das letzte Stück Brot, spüle es mit Wasser herunter. Mein nächster Patient ist Trygve. Ich habe noch Zeit, eine Tasse Kaffee zu trinken, während ich seine Akte lese.
Trygve kommt um exakt zwei Uhr, immer pünktlich, nie auch nur eine Sekunde zu früh. Im Gegensatz zu Christoffer macht er deutlich, dass er keine Lust hat, hier zu sein. Er setzt sich nicht ins Vorzimmer, sondern lehnt mit verschränkten Armen an der Eingangstür, als ich ihn in den Therapieraum bitte.
»Kommen Sie rein«, sage ich, und er geht mit mürrischer Miene an mir vorbei, die Lippen so fest aufeinandergepresst, dass man sie kaum noch sieht.
Er hat denselben Sessel wie Vera, nimmt aber nie Platz, bevor ich ihn darum bitte. Wenn er erst einmal sitzt, macht er es sich nicht bequem, sondern bleibt an der Kante sitzen, als wollte er bereit sein, jeden Moment aufzustehen.
»Na dann«, sage ich. »Wie war Ihre Woche?«
»Gut«, sagt Trygve mit tonloser Stimme.
»Die Schulaufgaben?«
»Gut.«
»Haben Sie alles erledigt, was Sie machen sollten?«
»Ja.«
»Haben Sie gespielt?«
»Ein bisschen.«
»Haben Sie über unseren vereinbarten Zeitrahmen hinaus gespielt?«
Jetzt sieht er mich an. Er hat aschblondes Haar und braune Augen, regelmäßige Züge, nichts Außergewöhnliches, im Grunde ist er auffallend unauffällig, wenn man das so sagen kann. Seine Mimik wirkt geradezu unheimlich kontrolliert, und nur ausnahmsweise, zum Beispiel, wenn er gereizt genug ist, rutscht ihm eine nicht kalkulierte Bewegung durch die Zensur. Als ich ihn das erste Mal sah, dachte ich, es würde mich nicht überraschen, wenn er sich eines Tages als Serienmörder entpuppt.
Aber Trygve kommt nicht zu mir, weil er ein potentieller Killer ist oder zu kontrolliert, und auch nicht, weil er keinen Sinn im Leben sieht. Er geht in Therapie, weil er süchtig danach ist, World of Warcraft zu spielen, oder besser gesagt, weil seine Eltern die Therapie zur Bedingung gemacht haben, damit er weiter zu Hause wohnen darf. Er ist zwanzig, älter als die meisten anderen meiner Patienten, und hat die Schule sieben Monate vor dem Abitur abgebrochen, weil sie ihm beim Spielen zu sehr im Weg stand. Trygves Eltern machen sich Sorgen, und dazu haben sie allen Grund. Wir haben vereinbart, dass ich sie anrufe, wenn Trygve nicht zu den Sitzungen erscheint, und er hat, so stelle ich es mir vor, nur deshalb eingewilligt, weil er zu wenig Zeit zum Spielen hätte, wenn er zu Hause rausfliegen würde und gezwungen wäre, für seine eigene Miete zu arbeiten.
»Ich habe mich beinahe an die festgelegten Zeiten gehalten«, sagt er.
»In welchen Fällen haben Sie sich nicht daran gehalten?«
Er unterdrückt ein verächtliches Schnauben, als würde er ein Niesen unterdrücken.
»Das waren zwei Abende. Sonntag und Donnerstag. Ansonsten lief alles fast perfekt.«
Sein Mund ist gerade und starr, der Kiefer angespannt, und irgendetwas an seinem Widerwillen macht mich müde, ich hätte Lust, das Handtuch zu werfen und zu sagen, na wunderbar, fast perfekt, dann können wir ja Schluss machen für heute.
»Und wie lange haben Sie an diesen Tagen gespielt?«, frage ich.
»Ein bisschen.«
Ich seufze. Ich weiß schon, dass ich mit Trygve konkreter werden muss.
»Lassen Sie mich mal sehen. Sonntags dürfen Sie von sechs bis elf spielen. Wann haben Sie angefangen?«
»Um sechs.«
»Wann waren Sie fertig?«
Pause. An seinen Wangen tritt ein Muskel hervor, so fest beißt er die Zähne aufeinander. Im Übrigen ist seine untere Gesichtshälfte seltsam kantig, genau das ist vielleicht doch auffällig. Ich habe einmal gelesen, dass Männer mit einer breiten Kinnpartie als attraktiv gelten. Bei Trygve trägt dieser Bereich zu seiner undurchdringlichen Erscheinung bei, gewöhnlich, ja, vielleicht, aber genau dieser Ausdruck, dieser graue, fahle, austauschbare Ausdruck, wirkt kalkuliert. Schon möglich, dass Trygve noch große Pläne im Leben hat, aber mit Sicherheit lässt sich nur sagen, dass kein Mensch in der realen Welt weiß, worin sie bestehen.
»Bis nach Mitternacht.«
Ein eindeutiger Euphemismus.
»Wie lange nach Mitternacht?«
Eine neue Ausbeulung in der Wange.
»Drei Uhr.«
»Gut, bis drei also. Und donnerstags, also auch gestern, dürfen Sie von sieben bis elf spielen. Wie lange haben Sie da gespielt?«
Eine neue Pause.
»Bis drei.«
»Okay, verstehe. Wenn ich das nachrechne, haben Sie in dieser Woche also acht Stunden mehr gespielt als vereinbart.«
Er schweigt, sein Gesicht ist erneut zugeknöpft.
»Wie finden Sie das?«
Er zuckt mit den Schultern.
»Finden Sie das gut?«
Er zuckt erneut mit den Schultern, blickt auf die Uhr, legt die Hand wieder auf die Armlehne und blickt noch einmal auf die Uhr. Bei Trygve führt kein Weg an der harten Konfrontation vorbei, auf die er es anlegt, man muss in das Unbehagen vorstoßen.
»Denn mir ist aufgefallen, dass Sie anfangs das Wort ›perfekt‹ benutzt haben, Trygve.«
»Ich habe gesagt ›fast perfekt‹.«
»Ja, ich erinnere mich. Ich frage mich nur, was Sie dazu veranlasst hat, dieses Wort zu wählen?«
Er bläst ein wenig Luft aus dem Mund, schnell und laut, es ist kein richtiges Seufzen, sondern klingt eher wie eine Dampfmaschine, die Dampf ablässt.
»Ich weiß es nicht«, sagt er, und jetzt brodelt es unter seiner Oberfläche, »vielleicht habe ich das Wort gewählt, weil ich es nicht besonders witzig finde, hier jede Woche sitzen und Ihnen über meine privaten Gewohnheiten Auskunft geben zu müssen.«
Da ist sie, seine Wut. Mir fällt auf, dass sie heute deutlicher zum Vorschein kommt als sonst. Vielleicht fällt es ihm auch auf, denn es sieht so aus, als würde er sich selbst dabei ertappen. Er hält inne, seine Miene, seine heruntergezogenen Augenbrauen, der verzerrte Mund, scheinen für einen Moment in der Luft zu hängen, und dann wischt er alles weg und ersetzt es wieder durch einen neutralen Modus.
»Ja, das glaube ich auch«, stimme ich eilig zu, vielleicht kann ich ihn erreichen, bevor er wieder vollkommen dichtmacht. »Ich glaube, dass unsere Sitzungen sehr viel Unbehagen bei Ihnen auslösen. Können Sie etwas mehr darüber erzählen, wie es sich die restliche Woche mit Ihrem Unbehagen verhält, wenn Sie nicht hier sind?«
Neuerliches Schulterzucken.
»Weiß nicht. Ich denke nicht so viel darüber nach.«
»Dann sollten wir uns ein Beispiel vornehmen«, sage ich, abermals konkret. »Gestern Abend, als es zehn Uhr wurde und Sie aufhören sollten, was haben Sie da gedacht?«
Gefühlt, hätte ich sagen sollen, anstatt selbst in die Falle zu tappen, die Vernunft zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen.
»Weiß nicht. Nichts.«
»Sie wussten ja, dass ich Sie heute danach fragen würde.«
»Hab nicht darüber nachgedacht.«
»Ich frage mich, ob Sie überhaupt motiviert sind, sich der Aufgabe zu stellen, die wir vereinbart haben?«
»Keine Ahnung. Doch. Ich werde es versuchen.«
»Denn ich glaube nicht, dass ich Sie zum Aufhören zwingen kann, und Ihre Eltern können es im Übrigen auch nicht, Sie sind derjenige, der es wollen muss.«
»Jaja. Will ich auch.«
Die Müdigkeit vom Morgen überkommt mich erneut, hundertmal stärker als jene, die Vera in mir ausgelöst hat. Es stimmt, dass Trygve es selbst wollen muss, wenn er sich ändern möchte, und es ist überdeutlich, dass er es nicht will. Es gibt immer eine Motivation, oder zumindest eine Ambivalenz, bei den Patienten, die zur Therapie kommen, steht in den Lehrbüchern, und ich weiß, was die Ratgeber sagen, nehmen Sie das, was vorhanden ist – Trygve möchte weiter zu Hause wohnen bleiben –, und arbeiten Sie daran weiter, aber meine Werkzeugkiste erscheint mir leer und unbrauchbar. Vielleicht besteht das Problem darin, dass Trygves Wunsch so instrumentell ist. Es geht ihm nicht darum, die Beziehung zu den Eltern aufrechtzuerhalten, und er will auch nicht zu Hause wohnen bleiben, weil er sich dort geborgen fühlt. Er möchte einfach nur ein Dach über dem Kopf haben und Strom für seinen Computer. Und wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, weiß ich nicht sicher, wie man Trygve helfen kann. Viele Spielsüchtige verspielen Jahre ihres Lebens, so wie Trygve es offenbar auch fest vorhat. Seine Absicht scheint in Stein gemeißelt, und ein Teil von mir denkt, wenn es das ist, was er unbedingt will, kann man auch nichts dagegen unternehmen.
Aber es ist Freitagnachmittag. Ich ertrage nicht noch eine Scheindiskussion mit Trygve, bei der er sagt, was er laut unserer Vereinbarung sagen muss.
»Na dann«, sage ich. »Aber was, glauben Sie, wäre nötig, damit Sie unsere Ziele in der nächsten Woche erreichen?«
»Ich muss mich noch mehr anstrengen«, antwortet Trygve verbissen.
»Gut«, sage ich, »dann versuchen wir das. Sagen wir nächsten Freitag zur gleichen Zeit?«
Ehe ich zum Sport aufbreche, rufe ich Sigurd an, doch er geht nicht ans Telefon.
Ich sitze in der U-Bahn nach Hause, als mein Handy klingelt. Die U-Bahn windet sich ratternd von Ullevål bergauf, draußen ist es dunkel, hier drinnen leuchtet das Licht gelb, im Wagen sitzen ein paar müde Geschäftsleute mit Aktentaschen und Smartphones und der ein oder andere optimistische Skifahrer, der den Winter verlängern will, indem er tief in den Wald hinausfährt, und ansonsten nur noch ich, so verschwitzt, dass die Scheibe neben mir beschlägt. Bis auf das Rattern der Bahn herrscht eine missmutige Stille. Dann wird sie von der summenden Vibration meines Handys unterbrochen, und Jan Eriks Name leuchtet auf dem Display auf.
»Hallo?«, melde ich mich, als wüsste ich nicht, wer es ist.
»Ja, hallo Sara, hier ist Jan Erik«, erwidert er.
Seine Stimme klingt merkwürdig unstet und glucksend, so schwankend wie die Bahn, in der ich sitze, und ich unterdrücke einen Seufzer, sind sie jetzt schon betrunken, benehmen sie sich noch kindischer als sonst, machen sie jetzt sogar Telefonstreiche?
»Ja«, sage ich scharf, um ihm klarzumachen, dass er auf den Punkt kommen soll.
»Naja, es ist nur, also, Thomas und ich, wir fragen uns, ob du vielleicht etwas von Sigurd gehört hast?«
»Wie meinst du das?«, frage ich.
Draußen nimmt die Steigung zu, wir nähern uns der Haltestelle Berg, danach sind es nur noch zwei Stationen. Die Häuser sehen aus wie Modelle, schwarze Klötze mit leuchtenden Vierecken, sie wirken unecht, als würden keine Menschen darin wohnen.
»Nein, wir überlegen bloß …«
Er räuspert sich, und ich denke, so wirr redet normalerweise selbst er nicht.
»Was überlegt ihr, Jan Erik?«
»Na ja. Wann er kommt.«
»Wann er kommt?«
Es pocht in meinen Schläfen, erst Trygve, dann das Spinning, dann Jan Erik. Alles, was ich jetzt will, ist eine Dusche, ein Glas Weißwein und meinen Salat mit Hähnchen.
»Ja, genau. Denn er hat gesagt, er würde gegen fünf hier sein, und jetzt ist es nach sieben, und wir, na ja, wir erreichen ihn einfach nicht, deshalb, ja, also, wir wussten nicht genau, deshalb dachten wir, du vielleicht? Du wüsstest es vielleicht? Wo er ist. Oder hast etwas von ihm gehört.«
Hinter ihm murmelt jemand, ich erkenne Thomas’ Stimme. Ich richte mich auf.
»Ja, es ist ja sicher alles in Ordnung«, sagt Jan Erik jetzt, beinahe schrill, denke ich, »wir wollten nur mal nachfragen.«
Thomas ist vernünftiger als Jan Erik, ich weiß nicht, ob ich Thomas wirklich mag, aber ich ziehe ihn Jan Erik vor.
»Hör mal«, sage ich so leise, dass die anderen Fahrgäste mich nicht verstehen können. »Sigurd hat mich heute Vormittag um halb zehn angerufen und gesagt, ihr wärt alle schon da. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört.«
Es wird vollkommen still in der Leitung. Dann murmeln sie wieder etwas, das ich nicht verstehe, aber sie reden miteinander, flüstern beinahe.
»Was habt ihr gesagt?«, frage ich, jetzt spreche ich so laut, dass es garantiert auch die anderen Passagiere mitbekommen, »ich höre euch nicht.«
Sie verstummen erneut, dann murmelt Thomas wieder etwas, und Jan Erik sagt: »Das verstehe ich nicht ganz, Sara, Thomas und ich waren erst gegen eins hier. Sigurd hat gesagt, er wollte allein fahren und später nachkommen.«
Es hämmert in meinem Kopf, der Kopfschmerz, zäh und stechend.
»Er hat um halb zehn oder zehn angerufen«, sage ich müde, genervt von ihnen und der U-Bahn und diesem ganzen Tag. »Er hat gesagt, ihr wärt alle da, er hat gesagt …«
Ich denke kurz zurück, erinnere mich an Jan Erik und die Holzscheite.
»Er hat gesagt, du würdest irgendwelchen Quatsch mit Holzscheiten machen.«
Dann wird es vollkommen still. Die U-Bahn befindet sich auf einer geraden Strecke, nicht einmal sie gibt ein Geräusch von sich. Jan Erik sagt: »Aber Thomas und ich sind erst um zehn aus Oslo rausgefahren.«
Es gibt Ungereimtheiten in den Geschichten, die Leute erzählen, kleine Unwahrheiten, die keine richtigen Lügen sind, oder Auslassungen, die dafür sorgen, dass ein Mensch zu verschiedenen Zeiten, oder verschiedene Menschen zur gleichen Zeit, Geschichten erzählen, die nicht hundertprozentig aufgehen. Jemand nimmt einen Bus an einen Ort, den man schneller mit der U-Bahn erreicht hätte. Jemand war in Dänemark im Urlaub, musste sich aber in der Apotheke auf Deutsch verständlich machen. Wenn man das nicht wortwörtlich nimmt, ist es nicht weiter schlimm. Vielleicht hat man sich verhört, vielleicht ging es nicht um das und das Café an der und der U-Bahn-Station, sondern um eins mit ähnlichem Namen, das an einer Bushaltestelle liegt. Vielleicht waren sie nicht mit der Fähre nach Kopenhagen gefahren, sondern nach Kiel. Meistens gibt es nachvollziehbare Erklärungen. Ja, wir waren zwar in Dänemark, haben aber einen Tagesausflug nach Deutschland gemacht. Es war lediglich einfacher, nicht die ganze Geschichte zu erzählen.
Aber fundamental verschiedene Geschichten? Beschreibungen von Fakten, die sich gegenseitig ausschließen? Das kommt nicht so oft vor. Selbst im therapeutischen Bereich ist es ungewöhnlich. Ja, meine Mutter sagt zwar, ich wäre betrunken gewesen, aber eigentlich hatte ich nur ein oder zwei Bier, ich war einfach müde, ich habe undeutlich gesprochen, vielleicht lag es daran, aber richtig betrunken war ich nicht.