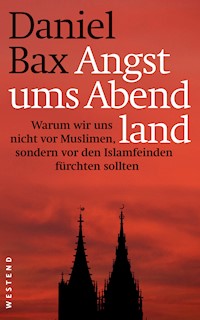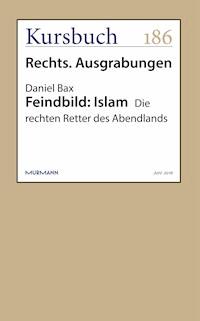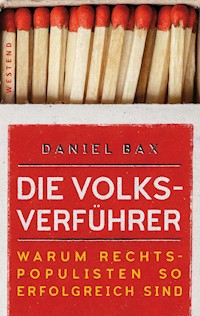
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Was tun gegen Rechts? Rechtspopulisten haben derzeit Auftrieb - autoritäre Demagogen liegen im Trend. Wer aber wählt diese rechten Verführer und was treibt die "besorgten Bürger" um? Ist es die Furcht vor wirtschaftlichem Abstieg, oder sind es andere Verlustängste? Welche Rolle spielen die Medien? Ist linker Populismus die probate Antwort? Daniel Bax zeigt die Gründe für den aktuellen Erfolg der Rechtspopulisten und wie wir dieser Entwicklung entgegenwirken können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 434
Ähnliche
Ebook Edition
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-86489-676-7
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2018
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Satz und Datenkonvertierung: Publikations Atelier, Dreieich
Daniel Bax
Die Volksverführer
Warum Rechtspopulisten so erfolgreich sind
Inhalt
Vorwort
Der Einzug der Alternative für Deutschland (AfD) in den deutschen Bundestag stellt eine Zäsur dar. Mit über zwölf Prozent der Wählerstimmen zogen die Rechtspopulisten im September 2017 auf Anhieb als drittstärkste Kraft ins höchste deutsche Parlament ein. Seitdem sind sie dort mit 92 Abgeordneten vertreten. Als »Oppositionsführer« sprechen sie direkt nach der Regierung. Das hat das politische Klima und die Arithmetik der Macht in Deutschland verändert. Besonders stark hat die AfD im Osten Deutschlands abgeschnitten: Den Zweitstimmen nach wurde sie dort überall zweitstärkste, in Sachsen sogar stärkste Kraft. Dort ist sie schon Volkspartei.
Wie konnte das passieren? Im Grunde holt Deutschland nur nach, was in vielen europäischen Nachbarländern längst die Regel ist. Fast überall in Europa haben sich populistische Parteien etabliert, die sich als »Alternative« zum herkömmlichen politischen System mit seiner traditionellen Konkurrenz aus linken und sozialdemokratischen, wirtschaftsliberalen und konservativen Parteien verstehen. Dabei zeigt sich eine deutliche Spaltung des europäischen Kontinents: In den Ländern Südeuropas, die die Hauptlast der Eurokrise von 2010 tragen mussten, sind linkspopulistische Parteien und Bewegungen stark: Podemos in Spanien, die »MoVimento 5 Stelle« (»Fünf-Sterne-Bewegung«) in Italien und Syriza in Griechenland. In Griechenland stellt Syriza seit 2015 die Regierung, sie hat dort ausgerechnet mit der rechtspopulistischen Kleinpartei der ANEL (»Anexartiti Ellines«, »Die Unabhängigen Griechen«) ein Bündnis geschlossen. In Italien wurde die Fünf-Sterne-Bewegung bei den Parlamentswahlen im März 2018 die stärkste Kraft. Prompt verständigte sie sich mit den Rechtspopulisten der Lega Nord, deren Bastionen im reichen Norden Italiens liegen, auf eine Regierungskoalition. Populisten können offenbar gut mit ihresgleichen.
Im Osteuropa liegen autoritäre Demagogen im Trend. In Ungarn und Polen stellen sie die Regierung und sorgen für zunehmend totalitäre und illiberale Verhältnisse, mit denen sich ihre Länder immer weiter von den Grundwerten der Europäischen Union entfernen. Auch in Tschechien und der Slowakei geben populistische Demagogen den Ton an. Diese vier Länder bilden mit der »Visegrad-Gruppe« schon lange ein Bündnis, das geschichtsträchtig nach der ungarischen Grenzstadt benannt ist, in der sich schon im vierzehnten Jahrhundert die Herrscher aus Ungarn, Polen und Böhmen zu Verhandlungen trafen. 2004 sind sie gemeinsam der Europäischen Union beigetreten und bilden einen Block, der seit 2015 als Bremsklotz auffällt, weil er ein gemeinsames europäisches Vorgehen in der Flüchtlingspolitik verhindert.
Die »Flüchtlingskrise« 2015 war der Moment, in dem die durch den Aufstieg der Populisten verursachten Bruchlinien innerhalb Europas unübersehbar wurden. Denn auch in den skandinavischen Ländern Dänemark, Norwegen und Finnland sind Rechtspopulisten an der Regierung beteiligt oder haben ein wichtiges Wort mitzureden. Und die Regierungen in westeuropäischen Ländern wie Österreich, Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden taten sich schwer mit der Aufnahme von Flüchtlingen, weil sie sich vor den Rechtspopulisten fürchteten, die ihnen im Nacken saßen. So waren es am Ende Schweden und Deutschland, die die meisten Geflüchteten aufnahmen. Großbritannien votierte dagegen im Juni 2016 sogar für den Brexit, den Ausstieg aus der Europäischen Union. In Frankreich schaffte es die rechte Populistin Marine Le Pen, wie vorausgesagt, in die Stichwahl ums Präsidentenamt. In Österreich sind die Rechtspopulisten der FPÖ seit Oktober 2017 wieder an einer Koalitionsregierung beteiligt. Und im Weißen Haus sitzt schon seit November 2016 der rechte Demagoge Donald Trump.
Der Aufstieg des Rechtspopulismus ist kein europäisches Phänomen, sondern ein weltweites. Da ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoan, der sein Land in eine Autokratie verwandeln möchte und seine politischen Gegner ins Gefängnis werfen lässt. Da ist der indische Premierminister Narendra Modi, der Hindu-Nationalismus mit einem neoliberalen Wirtschaftsprogramm verbindet und Millionen Muslime in seinem Land ausgrenzt. Da ist der philippinische Präsident Rodrigo Duterte, der im Kampf gegen die Drogenkriminalität Todesschwadronen walten lässt, die mutmaßliche Dealer auf offener Straße hinrichten. Da ist Wladimir Putin, der Russland schon seit Jahrzehnten eisern im Griff hat und zu neuer Größe führen will. Und da ist Venzuelas Präsident Nicolás Maduro, der das Erbe seines Vorgängers Hugo Chávez angetreten hat und sich mit Wahlmanipulationen, Einschüchterung und Verschwörungstheorien an der Macht hält. Die Grenzen zwischen Populisten, Autokraten und Diktatoren verschwimmen da langsam.
Deutschland wirkte lange Zeit wie eine Insel der Seligen, an der der allgemeine Rechtsruck vorbeizugehen schien. In einer Studie 2016 zeigten sich die Menschen in keinem der großen EU-Staaten weniger empfänglich für populistische Politik als in Deutschland.1 Noch vor wenigen Jahren fragten sich Politologen, »warum der parteiförmige Rechtspopulismus in Deutschland so erfolglos ist«, und hielten das Aufkommen einer solchen Partei für eher unwahrscheinlich.2 Während ringsherum Populisten reüssierten, schien das größte Land Europas davon seltsam unberührt. Doch das ist vorbei. Deutschland ist mit der AfD in der Realität angekommen.
Es ist kein Zufall, dass der Aufstieg der AfD mit der Euro-Krise begann. Denn Europa ist ein Kontinent, der durch seine gemeinsame Währung gespalten wird. Während Deutschland und andere vom Euro profitieren, haben andere Länder davon mehr Nachteile. Doch der reiche Norden will den Krisenländern des Südens nicht unter die Arme greifen. Auch die Mehrheit der Deutschen will die Vorteile der riesigen europäischen Freihandelszone mitnehmen, aber nichts dafür bezahlen. Die »Euro-Krise« war eine Krise der europäischen Solidarität, so wie nach ihr die »Flüchtlingskrise«, die in Wirklichkeit eine humanitäre und moralische Krise des Kontinents war.
Die Zentrifugalkräfte in der EU werden seitdem immer stärker. Doch es wäre zu einfach, den gegenwärtigen Siegeszug des Populismus nur auf den Euro und die strukturellen Probleme der EU zu schieben. Länder wie Großbritannien, Dänemark, Schweden, Polen, Ungarn und Tschechien sind gar nicht in der Eurozone, und die Schweiz und Norwegen sind noch nicht einmal in der EU. Trotzdem sind Rechtspopulisten dort ebenfalls stark. In der reichen Schweiz ist die rechte »Schweizer Volkspartei« (SVP) schon seit vielen Jahren die stärkste politische Kraft. Ihr starker Einfluss hat dafür gesorgt, dass die Schweiz nie der Europäischen Union beigetreten ist.
Das Beispiel der Schweiz zeigt, dass es falsch wäre, den Rechtspopulismus als eine plötzliche Erscheinung zu begreifen, die über Europa hereingebrochen wäre. Der Schweizer Milliardär Christoph Blocher, treibende Kraft und graue Eminenz der SVP, prägt die Geschicke der Alpenrepublik schon seit mehr als einem Vierteljahrhundert. Zweifellos gibt es derzeit ein populistisches Momentum. Aber es ist nicht die erste populistische Welle, die Europa erfasst. Die gegenwärtigen Erfolge populistischer Parteien haben eine Vorgeschichte.
In Italien hat Silvio Berlusconi den aktuellen Entwicklungen den Boden bereitet. Nach dem Zusammenbruch des alten Parteiensystems, das durch die Aufdeckung riesiger Korruptionsskandale und krimineller Machenschaften komplett umgepflügt wurde, setzte sich der Medienunternehmer als Saubermann in Szene. 1994 kam er zum ersten Mal an der Spitze eines Mitte-Rechts-Bündnisses an die Macht, was ihm nach seinem Comeback 2001 drei weitere Male gelang. Er hatte Erfolg, weil er sein ganzes Medienimperium im Rücken hatte und weil er sich mit einer einfachen, volkstümlichen Art direkt an die Bevölkerung wendete, sich als Alternative zu den Altparteien anpries und großzügige Wahlgeschenke versprach. Ähnlichkeiten mit anderen Populisten sind offenkundig. Dass er politische Gegner beschimpfte, sich abfällig über Frauen und Schwule äußerte, oder mit geschichtsrevisionistischen Bemerkungen den italienischen Faschismus verharmloste, schadete ihm nicht, sondern trug nur zu seiner Popularität bei. Auch seine vielen Interessenkonflikte als milliardenschwerer Unternehmer und Regierungschef sahen ihm seine Fans nach und seine Freundschaften mit Autokraten und Potentaten, von Wladimir Putin bis Muammar al-Gaddafi. Seine Präpotenz trug ihm den liebevollen Spitznamen »Cavaliere« ein, zu Deutsch: Ritter.
Berlusconi entspricht dem Prototyp eines Populisten. Dass er damit Avantgarde sein würde, war noch nicht so klar, als er seine politische Karriere begann. Aber er war damals nicht der Einzige. In Österreich sorgte etwa zur gleichen Zeit, in den Neunzigerjahren, der Rechtspopulist Jörg Haider für Furore. Haider stieg rasch zum Musterbeispiel eines modernen und medienaffinen Rechtspopulisten auf. Für seinen nassforschen Stil prägten Kritiker den Ausdruck »Feschismus«, zusammengesetzt aus »fesch« und »Faschismus« – eine Anspielung auf sein kerniges und sportlich-adrettes Äußeres, mit dem er seine oft knallharten politischen Vorstöße kalt lächelnd überstrahlte. In seinem Heimatland Kärnten, wo er von 1989 bis 1991 und von 1999 bis zu seinem Tod im Jahr 2005 die Regierung leitete, profilierte sich Haider auf dem Rücken der slowenischen Minderheit und der Muslime. Er zog gegen die zweisprachigen Ortstafeln in seinem Bundesland zu Felde und schob mit einem »Ortsbildpflegegesetz« dem Bau von Moscheen den Riegel vor. Seinen Nachfolgern hinterließ er einen Schuldenberg und einen Bankenskandal.
Haiders größter Erfolg war, dass seine Partei aus den Wahlen 1999 als zweitstärkste Kraft hervorging und anschließend in die Regierung eintrat. Die Koalition der Konservativen mit den Rechtspopulisten sorgte im Inland wie im Ausland für einen Sturm der Empörung, mehrere Länder verhängten deswegen diplomatische Sanktionen gegen Österreich. Angesichts der Normalität, die eine Regierungsbeteiligung von Rechtspopulisten in Europa heute darstellt, ist die Aufregung im Rückblick besonders bemerkenswert. Wenn man sieht, wie salonfähig Rechtspopulisten heute in Talkshows und anderswo sind, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie kritisch und auf Distanz bedacht die deutschen Medien einst gegenüber Populisten wie Jörg Haider waren.
Haider gefiel sich in der Rolle eines Rebellen gegen das Establishment, gegen »politische Korrektheit« und gegen Probleme, die er gerne skandalisierte und zum angeblichen Staatsversagen aufbauschte. Immer wieder tat er sich mit antisemitischen Anspielungen, Geschichtsrevisionismus und Verklärung der Vergangenheit hervor, mit Beleidigungen politischer Gegner und der Justiz als »Parteibonzen«.
Haider gelang in Österreich, was Franz Schönhuber in Deutschland verwehrt blieb. Beim Bayrischen Rundfunk war der Journalist Schönhuber 1982 in Ungnade gefallen, weil er in seinem autobiografischen Buch mit dem Titel Ich war dabei seine Mitgliedschaft in der Waffen-SS verklärt hatte. 1983 gründete Schönhuber die Partei »Die Republikaner«, deren Vorsitzender er wurde und die bis Ende der Neunziger bei Europa- und Landtagswahlen einige Achtungserfolge erzielen konnte. So zog sie 1992 und 1996 mit rund zehn Prozent in den Landtag von Baden-Württemberg ein. Schönhuber agitierte gegen »Altparteien«, »Ausländer« und »Asylanten« und pochte darauf, dass Deutsche auf ihre Vergangenheit wieder stolz sein sollten. Dass sich »Die Republikaner« nicht konsolidieren konnten, lag auch daran, dass sie sich mit anderen Rechtsparteien wie der NPD zu viel Konkurrenz machten.
Anders sieht es mit dem »Front National« aus, den der französische Rechtsextremist Jean-Marie Le Pen 1972 gegründet hatte: Er ist zu einer festen Größe geworden, die aus der französischen Parteienlandschaft nicht mehr wegzudenken ist. Le Pen hatte in der Fremdenlegion und im Algerienkrieg gekämpft, sein Auge hatte er schon zuvor bei einer Schlägerei mit linken Studenten verloren, deswegen trägt er eine Augenklappe. Fünf Mal trat er bei Präsidentschaftswahlen an, 2002 gelangte er sogar in die Stichwahl gegen den Konservativen Jacques Chirac. Le Pen war ein polternder Demagoge, der regelmäßig durch sexistische, rassistische, homophobe und antisemitische Ausfälle von sich reden machte: das Klischee eines Stammtischschwadroneurs. Seine Tochter und Nachfolgerin Marine Le Pen hat die Partei modernisiert, der Vater war ihr dabei im Wege. Weil er zum wiederholten Male die Gaskammern der Nazis als »Detail der Geschichte« bezeichnet und damit den Völkermord an den europäischen Juden verharmlost hatte, ließ sie ihn 2015 aus dem Front National werfen, und veranlasste drei Jahre später dessen Umbenennung in »Rassemblement Nationale« (»Nationale Sammlungsbewegung«).
Für einen modernen Rechtspopulismus, der sich von einer dumpfen Verklärung der Vergangenheit und von völkischen Vorstellungen abhebt, stand der niederländische Publizist und Professor der Soziologie, Populist Pim Fortuyn. Schon in den Neunzigerjahren hatte er Bücher wie Gegen die Islamisierung unserer Kultur geschrieben, die konstitutionelle Monarchie der Niederlande in Frage gestellt und mit provokanten Sprüchen gegen den sozialliberalen Konsens verstoßen. Mit seiner »Liste Pim Fortuyn« legte der extravagante Intellektuelle um die Jahrtausendwende einen kometenhaften Aufstieg hin. Seine Homosexualität trug er stolz zur Schau, sein exzentrisches Auftreten machte ihn zu einem Medienstar. Im Jahr 2002 wäre er wohl mit wehenden Fahnen ins niederländische Parlament in Den Haag eingezogen, wenn er nicht kurz zuvor auf dem Parkplatz eines Radiosenders von einem militanten Tierschützer ermordet worden wäre. Dessen Hass hatte sich Fortuyn durch seine offene Verachtung des Tierschutzes zugezogen. »Wählt mich, dann dürft ihr Pelzmäntel tragen«, lautete einer seiner Slogans.
Mit seiner scharfen, antimuslimischen Rhetorik unter Berufung auf vermeintliche westliche Werte brachte Pim Fortuyn einen neuen Ton in die niederländische Politik, die bis dahin von Konsens und Rücksichtnahme gegenüber Minderheiten geprägt war. Fortuyn wetterte gegen »politische Korrektheit«, legte dabei jedoch einen bemerkenswerten doppelten Maßstab an den Tag. Zwar trat er als engagierter Verfechter der Rechte von Homosexuellen auf, was Migranten und Muslime anging, zeigte er sich dagegen deutlich weniger liberal. Man müsse die Einwanderung beschränken, um die liberale Kultur der Niederlande zu bewahren, behauptete er.
Von seinen Anhängern wurde Pim Fortuyn vergöttert. Nach dem Attentat herrschte große Verzweiflung, und es blühten wilde Verschwörungstheorien, die Einfluß auf die niederländische Politik hatten.3 Es hieß unter anderem, linke Kritiker von Fortuyn trügen eine Mitschuld an seinem Tod, und der Staat habe von den Attentatsplänen gewusst, aber ihn nicht genug geschützt. Auch über Mittäter und eine Beteiligung ausländischer Geheimdienste wurde spekuliert. Nach seinem Tod errichteten seine Anhänger ihrem Idol auf dem Börsenplatz in Rotterdam ein Denkmal.
Nicht anders war es, als Jörg Haider im Oktober 2008 mit seinem Auto bei Klagenfurt tödlich verunglückte, nachdem er sich alkoholisiert ans Steuer gesetzt hatte und mit überhöhter Geschwindigkeit nach Hause gerast war. In Kärnten entwickelte sich ein Personenkult um den Politiker, am Unfallort wurde eine Kapelle errichtet, und um seinen Tod rankt sich eine Reihe von Verschwörungstheorien. Der Mossad sei schuld, meinten die einen, während andere die Hochfinanz, Banken oder Gewerkschaften hinter der vermeintlichen Tat vermuteten.
Jörg Haider war noch ein Rechtsextremist alten Schlages gewesen, der für alle Probleme Ausländer, Asylbewerber und »Sozialschmarotzer« verantwortlich machte. Pim Fortuyn dagegen hing der Idee eines »Kampfes der Kulturen« an und ging von einer Unvereinbarkeit von Islam und westlichen Werten aus. Er war dabei mehr von kulturalistischen als von völkischen Vorstellungen geprägt.
Viele andere Rechtsparteien in Europa haben diese Polemik gegen Muslime aufgriffen – allen voran die Rechtspopulisten in Skandinavien, wie etwa die Dänische Volkspartei »Dansk Folkeparti« (DF). Aber auch Marine Le Pen in Frankreich und die FPÖ in Österreich haben sich seit 2001 auf eine antimuslimische Agitation verlegt, die viel anschlussfähiger an bürgerliche Kreise ist als ein dumpfer Ausländerhass, der sich unterschiedslos gegen alle Einwanderer richtet. Der große Einfluss, den Pim Fortuyn noch postum hat, macht ihn zu einem Pionier des Rechtspopulismus des 21. Jahrhunderts. In den Niederlanden selbst hat Geert Wilders sein Erbe angetreten.
Auch die AfD hat sich, von ihren Anfängen als Anti-Euro-Partei zu einer Anti-Islam-Partei entwickelt. Ihr Aufstieg ist nur die neueste Etappe einer Entwicklung, die schon lange zurückreicht. Er ist die aktuelle Folge in einem Fortsetzungsroman, dessen Ende so schnell nicht abzusehen ist.
In diesem Buch geht es um die Frage, was die Gründe für das aktuelle Revival des Rechtspopulismus sind. Sind es wirklich die »Abgehängten«, die die rechten Populisten wählen? Ist es ein Protest gegen wachsende Ungleichheit, oder welche Motive treiben ihre Wähler an? Welche Rolle spielt die Frage der »Identitätspolitik«, der Globalisierung und der Migration? Was sind die Gründe für die allgemeine Verunsicherung, die Menschen in die Arme von Populisten treiben? Was ist Populismus überhaupt, und was unterscheidet ihn von anderen politischen Strömungen?
Ein Schwerpunkt liegt auf der Frage, welche Rolle die etablierten Medien und die neuen sozialen Medien und Netzwerke beim Aufstieg des Populismus von heute spielen. Denn zweifellos hat sich die mediale Öffentlichkeit in den vergangenen Jahrzehnten sehr verändert, und Populisten stützen sich stark auf die neuen Techniken. Welche Möglichkeiten der Manipulation eröffnen sich ihnen dadurch, und was ist ihr Verhältnis zu den etablierten Massenmedien? Warum verfangen ihre Parolen so gut? Und vor allem: Was passiert, wenn Populisten an der Macht sind, und was haben sie jetzt schon erreicht?
Nicht zuletzt soll es um die Frage gehen, was zu tun ist. Ist linker Populismus eine Antwort? Wo soll man ansetzen? Wer ist gefordert? Und was kann jeder Einzelne tun?
Sicher ist, dass es auf den Aufstieg des Populismus eine entschiedene Reaktion braucht. Damit dieser rechtspopulistische Fortsetzungsroman kein böses Ende findet.
Berlin, im Juni 2018
1Was ist Populismus? Eine »dünne Ideologie«
Das Wort Populismus hat in Deutschland keinen guten Klang. Manche halten es schlichtweg für eine Beleidigung. »Populismus« ist die neumodische Diffamierung eines politischen Standpunkts, den man nicht teilt«, schrieb die schrieb die FAZ einmal.1 Mit anderen Worten: Es sei bloß ein Kampfbegriff zur Stigmatisierung des politischen Gegners. Diese Sichtweise ist in bestimmten Kreisen sehr verbreitet. Gerade in Deutschland hat das Wort Populismus einen negativen Beigeschmack, es riecht nach Stammtisch und Bierzelt-Demagogie.
Andere sehen das allerdings weniger eng – sogar wenn sie selbst damit gemeint sind. AfD-Chef Alexander Gauland sagte in einem Interview einmal, der Begriff Populismus sei für ihn »eine Ehrenbezeichnung«. Die Alternative für Deutschland sei in der Tat eine populistische Partei, weil sie »dem Volk aufs Maul« schaue.2 Auch von CSU-Chef Horst Seehofer ist der Satz überliefert, für ihn sei die Bezeichnung Populist »kein Schimpfwort, sondern ein Kompliment«. Der Front National in Frankreich schmückt sich mit dem Adjektiv »populistisch«, klingt das doch allemal besser als »rechtsextremistisch«. Und selbst eher linke Politiker wie der französische Sozialist Jean-Luc Mélenchon, Pablo Iglesias Turrión von der spanischen Partei Podemos und Beppe Grillo, der Kopf der Fünf-Sterne-Bewegung in Italien, bezeichnen sich selbst stolz als Populisten. Ist Populismus also nur ein anderes Wort für »populär«, »volkstümlich« und »volksnah«? Steht »Populismus« also nur für einen bestimmten Politikstil? Das wäre verkürzt.
In der Tat gehören Vereinfachung und Polemik zum demokratischen Meinungsstreit dazu. Die politischen Forderungen nach den jeweiligen Vorlieben einer mutmaßlichen Mehrheit zu richten, um möglichst viele Wähler für sich zu gewinnen, gehört zum politischen Tagesgeschäft. Die Klage über populistische »Stammtischparolen« ist deshalb vermutlich so alt wie die moderne Demokratie selbst. Denn Politiker aller Parteien geraten gelegentlich in Versuchung, der Mehrheit nach dem Mund zu reden, wenn sie sich davon einen Vorteil versprechen. Insbesondere vor Wahlen zeigen sie sich anfällig dafür, die Positionen zu vertreten, von denen sie sich am meisten Applaus erhoffen. Auch die Verteilung von Wahlgeschenken wie Steuererleichterungen durch eine Regierung kurz vor einem Urnengang kann man gut und gerne als »populistisch« bezeichnen.
Doch man sollte Populismus als Methode oder Stilmittel vom Populismus als Prinzip oder gar Ideologie unterscheiden. Nach Politologen wie Jan-Werner Müller3 zeichnet sich Populismus im ideologischen Sinne dadurch aus, dass er die Bevölkerung in ein »Wir« und »die Anderen« spalte.
Meist ziehe der Populist eine scharfe Trennlinie zwischen dem angeblich authentischen, »wahren Volk« und dem vermeintlichen Establishment. »Kein Populismus ohne moralisch aufgeladene Polarisierung«, sagt Müller. Der Anspruch, als einzige Instanz den wahren Volkswillen zu kennen und zu vertreten, mache den Wesenskern von Populisten aus. Nicht die Kritik an der Euro-Rettung oder der Flüchtlingspolitik mache die AfD demnach zu einer populistischen Partei, sondern ihre Behauptung, damit für das »eigentliche« und »wahre« Volk zu sprechen, während alle anderen in ihrer Wahrnehmung ein »illegitimes Kartell« der »Altparteien« bildeten, das entfernt gehöre: eine Forderung, die bei AfD und Pegida in der Parole »Merkel muss weg« geronnen ist.
Für den niederländischen Politologen Cas Mudde sind Populisten der Ausdruck einer »pathologischen Normalität.«4 Sie würden weit verbreiteten Ängsten und Einstellungen in radikalisierter Weise Ausdruck verleihen. Ihre Erzählung ist, wie im Märchen, ein Kampf »Gut gegen Böse«, eine Heldensage vom tapferen, besorgten Bürger gegen das Establishment, vom Volk gegen die Elite. Die Gegner werden dabei als Antidemokraten und nicht zum Volk zugehörig diffamiert.Populistische Anführer inszenieren sich selbst gerne als eine Art Rächer der Erniedrigten und Beleidigten, die dem Volk wieder zur rechtmäßigen Herrschaft verhelfen wollen. Dabei greifen sie oft auf Geschichtsmythen und historische Analogien zurück, die ihnen helfen, dieses Bild zu zeichnen.
Populist war und ist nicht immer und überall ein Schimpfwort. Im Englischen ist das Wort traditionell eher positiv besetzt, im Sinne von »volksnah« und »volkstümlich«. Die »Populist Party« in den USA etwa, die das Wort im Namen trug und von 1891 bis 1908 existierte, war eine durchaus progressive Bewegung, welche sich als Interessenvertretung der Farmer gegenüber den Banken und Eisenbahnbesitzern verstand. In ihrer Rhetorik brachte sie »das wahre Volk« gegen »die Eliten« in Stellung, gegen Oligarchen und die Wall Street.
Als frühe Verkörperung des Populismus in Europa gilt die »Union zur Verteidigung der Händler und Handwerker« (UCDA), die im Frankreich der Fünfzigerjahre entstand und sich gegen zu hohe Steuern für kleine Geschäftsleute sowie die zunehmende Konzentration wirtschaftlicher Macht in den Händen weniger richtete. Die Anhänger dieser Bewegung wurden nach ihrem Anführer Pierre Poujade als »Poujadisten« bezeichnet. Die konservativ-reaktionäre Partei scheute nicht vor dem Schulterschluss mit Antisemiten zurück und gilt als ein indirekter Vorläufer des Front National, weil deren Gründer Jean-Marie Le Pen dort einst seine politische Karriere begann.
Auch in Lateinamerika hat der Populismus eine lange und schillernde Tradition. Dort wird er traditionell allerdings eher mit linker Politik in Verbindung gebracht. Namen wie Juan Péron, der einen »dritten Weg« zwischen Kapitalismus und Kommunismus propagierte, und der Brasilianer Getúlio Vargas, der als »Vater der Armen« gefeiert wurde, stehen zwar für Autoritarismus und charismatische Führung, aber auch für eine Politik der Umverteilung und der Sozialreformen, wofür sie teilweise bis heute verehrt werden. Péron regierte von 1946 bis 1955 und kurzzeitig von 1973 bis zu seinem Tod 1974 in Argentinien, Vargas war – mit einer kurzen Unterbrechung von 1930 bis 1954 an der Macht. Sie prägten eine ganze Generation von Populisten und »Caudillos«, wie jene Militärführer genannt wurden, die in vielen Ländern Lateinamerikas in den Jahrzehnten darauf die Macht an sich rissen und dabei nicht selten von einer Woge öffentlicher Zustimmung getragen wurden. Aus ländlichen Regionen in die Stadt abgewanderte Arbeiter bildeten für sie eine wichtige Wählerbasis. Aber auch Bauern, Beamte und Angehörige der Mittelschicht konnten sich in ihren Appellen an »das Volk« wiederfinden, eigentlich jeder.
Der ägyptische General Gamal Abdel Nasser und der erste frei gewählte Ministerpräsident der Türkei, Adnan Menderes, lassen sich ebenfalls als Populisten bezeichnen. Das Radio war für sie ein wichtiges Medium, um »zum Volk« zu sprechen und ihre Anhänger zu mobilisieren. Dieses Erbe hat nun der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoan angetreten. Zugleich konnte man mit Blick auf populäre Volkstribune wie Lula da Silva in Brasilien, Evo Morales in Bolivien, Rafael Correa in Ecuador und Hugo Chávez in Venezuela zu Beginn des neuen Jahrtausends von einer neuen Welle des Linkspopulismus in Lateinamerika sprechen.
Populismus zeichnet sich meist durch einen auffälligen Personenkult aus. Nicht selten sind populistische Parteien ganz auf ihre charismatischen Anführer zugeschnitten, die »das wahre Volk« in ihrer Person zu vertreten und zu verkörpern behaupten. Ein Extrembeispiel dafür ist der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders, dessen Partei nur ein einziges offizielles Mitglied hat: ihn selbst. Die charismatischen Anführer solcher Parteien sind traditionell männlich und stehen, als eine Art Vaterfigur, für Strenge und Autorität. Selbst wenn sie, wie der Medienunternehmer Silvio Berlusconi in Italien, der Schweizer Milliardär und Rechtspopulist Christoph Blocher oder Donald Trump, ökonomisch gesehen zweifellos zu den oberen Zehntausend gehören, inszenieren sie sich in der politischen Arena als Außenseiter. Aufgrund ihrer angeblichen »Volksnähe« und ihres Gespürs für Stimmungen verkörpern sie in den Augen ihrer Anhänger die »richtige Elite«, die eine »falsche«, fehlgeleitete Elite ablösen soll.
Komplott-Vorwürfe und Verschwörungstheorien erfüllen dabei eine wichtige Funktion. Sie erklären, warum die Populisten (noch) nicht an der Macht sind, wo sie doch im Unterschied zu allen anderen den wahren Volkswillen vertreten. Verschwörungstheorien erlauben es Populisten, sich zu Kämpfern gegen finstere Mächte und illegitime Kräfte zu stilisieren und, wenn sie die Macht errungen haben, diese weiter zu festigen. Donald Trump lief sich für das Rennen um die US-Präsidentschaft warm, indem er öffentlich in Frage stellte, ob Barack Obama wirklich in den USA geboren sei. Er schloss sich damit der sogenannten »Birther«-Bewegung an, die anzweifelte, dass Obama ein legitimer Präsident sei, und forderte diesen demonstrativ dazu auf, seine Geburtsurkunde zu veröffentlichen.
Die polnische »Partei für Recht und Gerechtigkeit« von Jarosław Kaczyski nutzte den Flugzeugabsturz von Smolensk, bei dem 2010 dessen Bruder Lech Kaczyski und viele andere Kabinettsmitglieder ums Leben gekommen waren, um den innenpolitischen Gegnern und Russland eine Mitschuld an jenem Unfall zu geben und sich zum Opfer einer Intrige zu stilisieren. Und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoan nutzte die mutmaßliche Beteiligung der sogenannten Gülen-Bewegung am Militärputsch von 2016, um die Institutionen in seinem Land von jeglicher Opposition zu säubern. Der seit 1999 in den USA lebende islamische Prediger Fethullah Gülen gehörte einst zu Erdogans Weggefährten.
Nach Politologen wie Cas Mudde ist Populismus eine »dünne Ideologie«.5 Das heißt, er kann sich mit praktisch jeder anderen Ideologie verbinden – so, wie ein Chamäleon jede beliebige Farbe seiner Umgebung annehmen kann. Populismus kann mit einem sozialistischen oder stramm neoliberalen Wirtschaftsprogramm, mit konservativen oder liberalen Werten, mit Nationalismus oder Kosmopolitismus kombiniert werden. Der Erfolg hängt ganz vom gesellschaftlichen Umfeld ab. Nicht wenige Populisten sind veritable Wendehälse, die früher ganz andere Positionen vertreten haben, als sie das heute tun. Der junge Viktor Orbán begann einst als liberaler Reformer, bevor er sich als autoritärer Autokrat in die Pose eines Retters des »christlichen Abendlands« warf. Auch Recep Tayyip Erdoan strebte in seinen ersten Regierungsjahren als Ministerpräsident mit liberalen Reformen und einer politischen Öffnung in der Kurdenfrage einen EU-Beitritt seines Landes an, bevor er eine politische Wende um 180 Grad vollführte und einen autoritären und ultranationalistischen Kurs einschlug. Und Donald Trump war früher ein Anhänger der Demokraten, bevor er für die Republikaner als extremer Rechtsaußen-Kandidat ins Rennen ging, den sogar der Ku-Klux-Klan unterstützte.
Grob kann man zwischen eher linken und eher rechten Formen des Populismus unterscheiden. Linker Populismus behauptet, »das einfache Volk« gegen die »Elite« zu vertreten, und ist inklusiv. Er strebt mehr ökonomische Teilhabe bisher benachteiligter Bevölkerungsschichten an und steht im Prinzip jedem offen, der sich diesem Ziel verbunden fühlt. Linker Populismus wendet sich im Namen einer tatsächlich oder vermeintlich entrechteten Gruppe gegen »die da oben«. Damit können Regierungen, Banken und EU-Gremien gemeint sein, aber auch globale Konzerne und imperiale Weltmächte.
Rechter Populismus dagegen ist exklusiv: Er grenzt Gruppen von Menschen aus der als »Volk« definierten Gemeinschaft aus und behauptet, die Interessen der einheimischen und leistungsfähigen Bevölkerung zu vertreten. Den herrschenden Eliten wird der Vorwurf gemacht, sich zu sehr um die Interessen von Minderheiten zu kümmern, oder gar mit diesen zu kollaborieren, und die »eigenen« Leute zu vergessen. Bestehende politische, soziale und ökonomische Hierarchien werden tendenziell eher verteidigt.
Rechter Populismus profiliert sich vor allem auf dem Rücken von Minderheiten: Das können Einwanderer und Flüchtlinge sein, aber auch Angehörige von alteingesessenen Gruppen wie Muslime, Juden, Roma oder Homosexuelle. Diese Minderheiten werden von europäischen Populisten mehr oder weniger deutlich als Feindbilder und Gefahr für Staat und Gesellschaft ausgemacht. Kosmopolitische Intellektuelle, kritische Journalisten und Menschenrechtler werden als Teile der angeblichen »Eliten«, die sich vom Volk entfremdet haben, oder, schlimmer noch, als Agenten ausländischer Mächte denunziert.
Dabei tritt nicht selten ein latenter Antisemitismus zu Tage: etwa wenn der philanthropische (und jüdische) Milliardär George Soros als Drahtzieher potentieller Umstürze diffamiert wird, weil seine Stiftung (»Open Society Foundations«) zivilgesellschaftliche Organisationen in diesen Ländern finanziert.
Es gibt aber auch eine neoliberale Form des Populismus, für den Parteien wie die »Forza Italia« des italienischen Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi oder die Schweizer Volkspartei (SVP) von Christoph Blocher stehen. Ihre Anführer versprechen, den Staat wie ein Unternehmen zu führen und die »Leistungsträger« von Steuern zu »entlasten«. »Für neoliberale Populisten ist das Volk die Summe der kleinen Unternehmer und Angestellten«, sagt die Populismus-Expertin Paula Diehl, die in Berlin und Bielefeld lehrt.6 Auch das »Team Stronach« des österreichischen Unternehmers Frank Stronach, das von 2013 bis 2017 in mehrere Parlamente der Republik einzog, oder der milliardenschwere Unternehmer und zweitreichste Mann Tschechiens, Andrej Babiš, gehören in diese Reihe.
Babiš gründete im November 2011 die tschechische Bewegungspartei ANO 2011, Abkürzung für »Akce nespokojených oban« (»Aktion unzufriedener Bürger«) und zugleich das tschechische Wort für »Ja«. Seit 2017 ist Babiš Ministerpräsident Tschechiens und, trotz Vorwürfen der Steuerhinterziehung und des Subventionsbetrugs, immer noch im Amt. Und natürlich gehört auch Donald Trump dazu, obwohl er sich zudem auf rechte, ultrakonservative bis rechtsextreme Ideologen stützt.
Der US-amerikanische Politologe Herbert Kitschelt bezeichnete die Kombination von autoritären und chauvinistischen Forderungen mit einem neoliberalen Wirtschaftsprogramm einmal als »winning formula« für Rechtspopulisten.7 Der »Idealtyp« des Rechtspopulisten stehe für eine neoliberale Wirtschaftspolitik, einen politischen Autoritarismus, für Chauvinismus und Fremdenfeindlichkeit. Damit grenzte er Parteien wie den Front National oder die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) von klassisch rechtsextremen Parteien ab und versuchte, deren Wahlerfolge in den Neunzigerjahren zu erklären.
Parteien wie die Schweizer Volkspartei (SVP), die sich immer mehr in eine rechtspopulistische Partei entwickelt hat, die norwegische Fortschrittspartei oder die Lega Nord in Italien entsprechen immer noch diesem Modell: Sie vertreten einen ausgeprägten Wohlstandschauvinismus und eine neoliberale Leistungsideologie – auch gegenüber den Verlierern in der eigenen Gesellschaft.
Mit der Zeit sind aber viele Rechtspopulisten mehr in die Mitte gerückt und geben sich einen sozialeren Anstrich. Der Front National, die FPÖ oder die Dänische Volkspartei gerieren sich als Anwälte des kleinen Mannes oder gar als neue Arbeiterparteien. Sie profilieren sich als »soziale Heimatpartei« (so ein Slogan der FPÖ), indem sie Härte gegenüber Flüchtlingen und Migranten mit Fürsorge gegenüber »den eigenen Leuten« verbinden. Damit machen sie den linken Parteien in deren traditionellen Milieus starke Konkurrenz und haben ihnen viele Wähler abgeworben. Gerade die Rechtspopulisten in Skandinavien stehen für einen Kurs, den man als »Wohlfahrtschauvinismus« bezeichnen kann: Die Vorzüge des Sozialstaats sollen ausschließlich den alteingesessenen Bürgern des Landes zugutekommen, während Einwanderer und Flüchtlinge pauschal als Gefahr für den Wohlstand dargestellt und diskriminiert werden.
Auch die polnische »Partei für Recht und Gerechtigkeit« (»Prawo i Sprawiedliwo«, PiS) punktete nach ihrem Regierungsantritt mit sozialen Wohltaten, indem sie ein Kindergeld einführte und das Renteneintrittsalter wieder absenkte. Zugleich senkte sie die Steuern für Unternehmen und stempelte Muslime und Flüchtlinge pauschal zu Feinden der Gesellschaft. Auch Feministinnen, Homosexuelle, kritische Intellektuelle und Journalisten haben es schwer. Polens Ex-Außenminister Witold Waszczykowski erklärte einmal, seine Regierung wende sich gegen »eine Welt aus Radfahrern und Vegetariern, die nur noch auf erneuerbare Energien setzen und gegen jede Form der Religion kämpfen«. Das habe mit Polens traditionellen Werten »nichts mehr zu tun«.8
Jedes Land hat den Populismus, den es verdient.9 Es sagt einiges über die politische Kultur der USA aus, dass dort ein Mann Präsident werden konnte, der als halbseidener Unternehmer jahrzehntelang die Schlagzeilen der Klatschpresse dominierte und zuletzt in einer Reality Show reüssiert hatte. Trump ist ein Produkt der US-amerikanischen Celebrity-Kultur. Der britische Rechtspopulist und Kettenraucher Nigel Farage von der »UK Independence Party« (UKIP) hingegen bedient perfekt jedes Old-England-Klischee zwischen Pub und Pferderennen. »Wir Tories sehen ihn mit seinem Pint, seiner Zigarre, seinem Humor und erkennen instinktiv einen von uns«, sagte sein konservativer Konkurrent, der nicht minder populistische Tory-Politiker Boris Johnson, einmal über ihn. Es ist vermutlich kein Zufall, dass in Deutschland das Gesicht des Rechtspopulismus dem Typus des radikalisierten Studienrats entspricht. Der AfD-Chef Alexander Gauland ist kein polternder Wirtshaus-Demagoge, sondern ein Bildungsbürger, der lange so wirkte, als hätte es ihn nur rein zufällig auf die Bühne des Populismus verschlagen. Das hat er mit Thilo Sarrazin gemein, der der AfD publizistisch den Boden bereitet hat.
Rechtspopulisten bieten einfache Antworten auf komplexe Fragen an. Sie rühmen sich gerne damit, »Klartext« zu sprechen, und berufen sich auf den »gesunden Menschenverstand«. Damit einher geht eine Verachtung von Bildung und Wissen, ja sogar für Tatsachen und Fakten. Die Leute hätten »genug von Experten«, behauptete der britische Ex-Justizminister Michael Gove, einer der maßgeblichen Befürworter der Brexit-Kampagne, als er damit konfrontiert wurde, dass die meisten Ökonomen vor den unkalkulierbaren Risiken eines Austritts aus der EU warnten. Donald Trump beschimpfte bei seiner ersten Pressekonferenz die versammelten Medien als »Fake News«. Und viele Rechtspopulisten, von Trump bis zur AfD, zweifeln die Realität des Klimawandels an.
Rechtspopulisten sind nicht an der Lösung realer Probleme interessiert. Stattdessen blähen sie Scheinprobleme zu existenziellen Fragen auf, die mit symbolischer Politik beantwortet werden. Auch wenn nur wenige Frauen in Europa einen Ganzkörperschleier tragen, setzen sich Rechtspopulisten mit Erfolg dafür ein, genau das unter Strafe zu stellen. »Burka-Verbot« ist das Schlagwort, das eine dunkle Gefahr in Verzug suggerieren soll. Und jede Straftat eines Flüchtlings oder Einwanderers wird skandalisiert, als wäre sie schon ein Zeichen für »Staatsversagen.« Die Hetzer spielen dabei oft virtuos auf der Klaviatur der Ängste und beschwören schon bei nichtigen Anlässen den Ausnahmezustand herbei.
Ihre Suggestionskraft liegt darin, dass sie meist eine einfache, alltägliche und leicht verständliche Sprache sprechen. Ihre simplen Botschaften hämmern sie ihrem Publikum gerne in ständiger Wiederholung ein. Mit seinen kurzen, griffigen und einprägsamen Parolen wie »Build that wall« (»Baut diese Mauer«), »Drain the swamp« (»Den Sumpf trockenlegen«) oder »Lock her up« (»Sperrt sie ein« zu Hillary Clinton), die von seinen Anhängern frenetisch skandiert wurden, hat es Donald Trump auf diesem Feld zu wahrer Meisterschaft gebracht.
Es gibt Themen, die den Populisten vieler Länder gemein sind. Die Ablehnung der EU und angeblicher »Diktate« aus Brüssel eint Populisten quer durch Europa und durch alle Lager, von rechts bis links.
Bei Rechtspopulisten ist der Wille zum nationalen Alleingang (»America first«, »Österreich zuerst«) besonders ausgeprägt, so wie die Ablehnung von internationalen Organisationen wie der UN und von internationalen Abkommen, etwa zum Klimaschutz. Sie paaren sich mit der Feindseligkeit gegenüber Einwanderern und Flüchtlingen und der Forderung nach einer strikten Kontrolle der Grenzen. Da ist der Ruf nach Law and Order, nach härteren Gesetzen. Und da ist eine Rhetorik, die sich in klaren Feindbildern ergeht: Der politische Gegner, unabhängige Medien, die Justiz und Wissenschaftler, sie alle werden zum Feind erklärt.
Rechtspopulisten haben in Europa derzeit wieder Konjunktur. Das liegt auch daran, dass sie sich erfolgreich modernisiert und zum Teil ganz neu erfunden haben. Dieser Imagewechsel erlaubt es ihnen, auch Wählerschichten anzusprechen, die sie vorher nicht erreichen konnten.
Teil dieser Modernisierungsstrategie ist der Versuch, sich etwas »femininer« zu geben. Rechtspopulistische Parteien stehen zwar für ein konservatives Familien- und Geschlechterbild und sprechen mit ihrer martialischen Rhetorik und ihrem Ruf nach mehr Härte tendenziell eher männliche Wähler an. Aber auch sie bemühen sich heute, Frauen in prominente Positionen nach vorne zu rücken, nicht zuletzt, um so mehr weibliche Wähler anzusprechen.
In manchen Ländern finden sich Frauen sogar an der Spitze rechtspopulistischer Parteien. In Dänemark stand Pia Kjærsgaard, die Tochter eines Farbenhändlers, von 1995 bis 2012 der rechtspopulistischen Dänischen Volkspartei vor und führte diese zum Erfolg. In Frankreich löste Marine Le Pen 2011 ihren Vater als Vorsitzenden des Front National ab und verpasste ihrer Partei eine Imagekorrektur, indem sie deren rechtsextreme Agenda abschwächte. Die 1969 geborene Siv Jensen ist seit 2006 Vorsitzende der rechtspopulistischen norwegischen »Fortschrittspartei« und seit 2013 Finanzministerin ihres Landes. In Polen wählte die PiS 2015 Beata Szydło als Ministerpräsidentin an die Spitze der von ihr gebildeten Regierung, der sie bis 2017 vorstand.
»Identität« ist für Rechtspopulisten ein zentraler Begriff. Sie beanspruchen seit jeher für sich, eine als homogen verstandene nationale Identität zu verteidigen: gegen eine zunehmende Internationalisierung und die Auswüchse der Globalisierung, gegen Einwanderer und Flüchtlinge, gegen eine vermeintliche »Überfremdung« oder »Islamisierung«. Dabei ist nationale Identität immer ein Konstrukt. Der britische Politologe Benedict Anderson betonte in seinem bekanntesten Werk, dass Nationen eine moderne Erfindung sind, und sprach von ihnen als »vorgestellten Gemeinschaften«.10 Wen Menschen als zu ihrer Nation zugehörig betrachten, ist auch heute noch von Land zu Land unterschiedlich. Meist ist es eine Mischung aus Sprache, Herkunft, geteilten Traditionen, Religionszugehörigkeit und Geburtsort, die darüber entscheidet, ob man von der Mehrheit als »echter Mitbürger« betrachtet wird oder nicht. Das hängt von historischen und politischen Faktoren ab und davon, ob sich Nationen als Einwanderungsländer verstehen oder nicht.
Das Pew Research Center hat 2017 untersucht, wie nationale Zugehörigkeit in verschiedenen Ländern definiert wird. Dabei kam heraus, dass 51 Prozent der Ungarn, aber nur acht Prozent der Schweden und 13 Prozent der Deutschen es wichtig finden, ob eine Person im eigenen Land geboren ist oder nicht. Die Landessprache zu beherrschen, fanden 77 Prozent der Europäer, aber nur 60 Prozent der Kanadier wichtig. Knapp die Hälfte aller Griechen (45 Prozent), rund ein Drittel aller US-Amerikaner (32 Prozent), aber nur sieben Prozent aller Schweden legten auf die gleiche Religionszugehörigkeit wert. 11
Auch Rechtspopulisten haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was die jeweilige nationale Identität ihrer Länder ausmacht, und wer in ihren Augen dazu gehört.
Rechte Populisten in Osteuropa hängen oftmals noch der Illusion einer ethnisch homogenen Nation nach. Dort wird Identität stark in völkischen und religiösen Kategorien definiert, als Kombination von Nation und Christentum. Viele Populisten in Osteuropa zählen beispielsweise auch Roma nicht zu ihrer Nation, obwohl diese eine alteingesessene und angestammte Minderheit ist. Die Kultur und die Volksmusik in Ungarn, Tschechien und der Slowakei, in Rumänien und Bulgarien und auf dem Balkan ist traditionell von Roma geprägt. Doch überall, wo Populisten regieren, nimmt die Segregation zu. Roma werden in abgeschlossenen Ghettos sich selbst überlassen und in eigenen Schulklassen unterrichtet. Die Rede von einer angeblich spezifischen »Zigeunerkriminalität« und Hasstiraden gegen Roma gehören zum Alltag, führende Politiker schüren Vorurteile gegen sie, und der Staat bietet ihnen nur wenig Schutz vor rechtsradikalen Übergriffen.12
Auch der Antisemitismus ist in Osteuropa salonfähiger als im Westen. Eine Kampagne wie gegen George Soros in Ungarn wäre in Westeuropa wohl undenkbar. Viele rechtspopulistische Parteien in Westeuropa vermeiden offenen Antisemitismus und versuchen, wie der Front National oder die FPÖ, ihre rechtsextreme Vergangenheit abzustreifen und vergessen zu machen. Dabei buhlen sie um jüdische Wähler und stellen sich demonstrativ hinter Israel und dessen rechte Regierung. Der Front National hat besonders deutlich mit seinen antisemitischen und homophoben Traditionen gebrochen. Sogar ihren Vater ließ Marine Le Pen deshalb 2015 aus der Partei ausschließen. Während Jean-Marie Le Pen den Holocaust wiederholt als »Detail der Geschichte« verharmloste und sich über Homosexuelle lustig machte, hat seine Tochter den Front National für Juden, Schwule und Einwanderer wählbar gemacht, die das gemeinsame Feindbild Muslime verbinden soll.
Wenn Rechtspopulisten in Westeuropa von »Identität« reden, dann ist damit meist eine kulturelle Identität gemeint, eine diffuse Leitkultur, an die sich Einwanderer anpassen sollten. Muslimen wird allerdings pauschal abgesprochen, sich überhaupt an eine westlich-europäische Kultur anpassen zu können. Ihnen begegnen Rechtspopulisten daher mit besonderem Misstrauen und offener Ablehnung. Kampagnen gegen Minarette oder Moscheen, gegen Kopftücher und andere Formen der Verhüllung sind bei ihnen sehr populär. »Der Islam gehört nicht zu Deutschland«, heißt es dazu im Wahlprogramm der AfD. Am weitesten geht dabei der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders. Er will Koran und Kopftücher verbieten, den Bau von Moscheen untersagen und jede weitere Einwanderung von Muslimen unterbinden.
Viele Rechtspopulisten in Europa haben die pauschale Ablehnung von Einwanderern und Ausländern heute durch das Ressentiment gegen Muslime ersetzt. So kommt es, dass viele von ihnen heutzutage sogar Einwanderer anzusprechen vermögen – jedenfalls solange diese keine Muslime sind. Die AfD warnt zwar vollmundig vor »Parallelgesellschaften« und »Überfremdung«, meint damit aber nur Muslime. Wenn sie russlanddeutsche Wähler umwirbt, dann druckt sie ihre Wahlkampfbroschüren auch schon mal auf Russisch. Es ist daher nicht völlig überraschend, dass die AfD in ihren Reihen mehr Abgeordnete mit Migrationshintergrund verzeichnet als CDU oder FDP. Diese stammen dann meist aus dem nahen europäischen Ausland, aus Osteuropa oder Südtirol.
Auch die belgischen Rechtspopulisten des separatistischen »Vlaams Belang«, einer belgischen Regionalpartei, umwerben in ihrer Hochburg Antwerpen die jüdische Gemeinde, eine der größten in Europa. Schon seit Jahren versucht die Partei mit mäßigem Erfolg, die Gemeinde als »Bündnispartner gegen die Islamisierung« zu gewinnen. Dafür sucht sie auch Kontakt zur israelischen Regierung. 2014 traf eine Delegation den Wissenschaftsminister Ofir Akunis des konservativen Parteienbündnisses »Likud« in Israel. Drei Jahre zuvor hatte der israelische Likud-Politiker Hiob Kara die rechte Partei in Antwerpen besucht und damit die jüdische Gemeinde des Landes in Verlegenheit gebracht, die offiziell für einen Boykott der Rechtspopulisten eintritt.
Nicht anders macht es die FPÖ in Österreich. Deren Parteichef Heinz-Christian Strache buhlt um serbische und kroatische Wähler, indem er sich auf deren Partys sehen lässt oder demonstrativ eine Brojanica, die orthodoxe Gebetsschnur, als Armband trägt. Als Vizekanzler gratulierte Strache der serbischen Gemeinschaft in Österreich per Facebook zum orthodoxen Weihnachtsfest. Und auch politisch stellt sich die FPÖ mit Blick auf Bosnien und den Kosovo ganz auf die Seite Serbiens, um den in Österreich lebenden Serben zu schmeicheln. Diese »Teile und herrsche«-Strategie geht auf.
Das steht nur bedingt im Widerspruch zu den völkischen Strömungen, die sich weiterhin auch bei Rechtspopulisten in Westeuropa finden lassen. Front National und FPÖ geben sich heute nach außen hin umgänglicher. Einwanderung lehnen sie nicht mehr grundsätzlich ab, solange sich Einwanderer assimilieren und an eine imaginierte »Leitkultur« anpassen. Beide Parteien besitzen jedoch immer noch einen harten Kern, der eine völkische Vorstellung davon vertritt, was es heißt, ein Franzose oder Österreicher zu sein.
Der Front National gibt sich zwar »republikanisch« geläutert, doch will er das Staatsbürgerschaftsrecht drastisch einschränken: Das Prinzip, dass jeder, der in Frankreich geboren wird, einen französischen Pass erhält, will er abschaffen, doppelte Staatsbürgerschaften will er auf EU-Bürger begrenzen und Ausbürgerungen möglich machen. Nach dem Prinzip der »nationalen Priorität« sollen Franzosen bei der Stellensuche, bei der Wohnungssuche, in der Sozialversicherung bevorzugt werden. Die alltägliche Diskriminierung, unter der viele Migranten ohnehin schon leiden, soll damit institutionalisiert und legalisiert werden.
In der FPÖ hat man ähnliche Absichten. In den höchsten Parteigremien dominieren außerdem Angehörige deutsch-nationaler und völkischer Burschenschaften. Zwanzig der 51 Abgeordneten, die seit der Wahl 2017 für die FPÖ im Wiener Nationalrat sitzen, gehören einer solchen Verbindung an, hat das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW) errechnet.13 Die AfD besitzt ebenfalls einen völkisch-nationalen Flügel, der sich um Björn Höcke gruppiert und Einwanderer nicht als »echte Deutsche« ansieht. Auch Donald Trump stützt sich auf ultrarechte Kreise und Anhänger der »White Supremacy«, der »Überlegenheit der weißen Rasse«.
Diese rassistischen Strömungen sind eine Gefahr für die Demokratie. Denn die Idee des ethnisch homogenen Volkskörpers steht dem demokratischen Prinzip der Gleichheit entgegen – der Idee, dass alle Menschen gleich geboren sind und gleiche Rechte genießen.
Populismus folge der Demokratie »wie ein Schatten«, sagen die Populismus-Experten Cas Mudde und Cristóbal Rovira Kaltwasser.14 Populismus sei »essentiell demokratisch, aber er ist ambivalent gegenüber der liberalen Demokratie«. Seine Anhänger hätten ein »parasitäres Verhältnis zur Demokratie«, ergänzt Paula Diehl. Denn gerade Rechtspopulisten nehmen die Vorzüge der liberalen Demokratie wie die Meinungsfreiheit und andere gesetzlich verbrieften Rechte gerne in Anspruch. Für andere möchten sie diese Rechte aber einschränken, wenn nicht gar abschaffen. Dabei berufen sie sich auf einen vermeintlichen Willen der Mehrheit und rufen nach plebiszitären Elementen. Durch Volksabstimmungen wollen manche selbst Grundrechte einschränken. Immer wieder liebäugeln Rechtspopulisten in Europa mit Referenden über die Wiedereinführung der Todesstrafe. Und mit ihrer Volksabstimmung über ein »Minarettverbot« versetzten Rechtspopulisten in der Schweiz 2009 dem Recht auf Religionsfreiheit für Muslime einen empfindlichen Schlag.
Zwischen dem demokratischen Versprechen auf »Volkssouveränität« und dem Schutz von Minderheiten, den der Rechtsstaat garantieren soll, herrscht ein Spannungsverhältnis. Damit Mehrheiten nicht diktatorisch über Minderheiten bestimmen können, gibt es in liberalen Demokratien ein kompliziertes System von »checks and balances«. Populisten wollen diese Systeme aushebeln. Gegenüber den Institutionen von Rechtsstaat und liberaler Demokratie, der Justiz und den Medien, sind sie oft feindlich eingestellt.
Warum sind Populisten derzeit überhaupt so populär? »Populisten ernten nur dort, wo andere gesät und ein Vakuum der politischen Repräsentation haben entstehen lassen«, meint die Münsteraner Politologin und Populismus-Expertin Karin Priester.15 Ohne gravierende Fehler und Defizite der etablierten Politik gebe es keinen Populismus als Gegenreaktion. Das Gefühl des Kontrollverlusts, der Machtlosigkeit und des Ausgeliefertseins gegenüber den herrschenden Verhältnissen in der vermeintlichen »Postdemokratie« (Colin Crouch) sei Wasser auf die Mühlen von Populisten.
2 Der Mythos von den Abgehängten: It’s not the economy, stupid
Nach Donald Trumps Überraschungserfolg bei den US-Präsidentschaftswahlen im November 2016 war für viele Beobachter rasch klar, wer dafür verantwortlich zu machen sei: Dies sei die Rache der »Abgehängten« an den abgehobenen Eliten. Jene Eliten hätten die Sorgen und Ängste der einfachen Arbeiter einfach nicht ernst genommen, so lautete eine gängige Diagnose in vielen Medien. Das Wort vom »Trumpenproletariat« machte die Runde. Und hatte der französische Soziologe Didier Eribon in seinem autobiografischen Buch Rückkehr nach Reims nicht diagnostiziert, Frankreichs Linke habe die traditionelle Arbeiterklasse vergessen, weswegen diese sich nun dem Front National an die Brust werfe?
In der Tat beruhte Trumps Überraschungssieg darauf, dass es ihm gelang, die Staaten des sogenannten »Rust Belt« im Nordwesten der USA für sich einzunehmen. Mit einer von einem republikanischen Präsidentschaftskandidaten bis dahin ungehörten Anti-Freihandels-Rhetorik und dem Versprechen eines massiven Konjunkturprogramms hatte Trump um die Wähler aus der ehemaligen Industrieregion der USA gebuhlt, die seit Jahrzehnten unter dem Niedergang ihrer einst mächtigen Stahlwerke und ihrer Schwerindustrie, unter Verarmung und Abwanderung leiden. Frühere Hochburgen der Demokraten wie Pennsylvania, Ohio, Michigan und Wisconsin fielen der Reihe nach an Trump und besiegelten seinen Einzug in das Weiße Haus.
Man darf aber nicht vergessen, dass Trump nur aufgrund des komplizierten US-Wahlsystems Präsident geworden ist. Er konnte knapp 63 Millionen Wähler mobilisieren, und damit etwas mehr als vor ihm John McCain und Mitt Romney. Für Hillary Clinton stimmten am Ende fast drei Millionen Menschen mehr – und damit ungefähr so viele, wie auch für Barack Obama bei seinem zweiten Wahlsieg 2012. Nur nutzte ihr das wegen des US-Wahlsystems nichts.
Das Mehrheitswahlrecht in den USA mit seinem »The winner takes it all«-Prinzip verführt dazu, jenen Faktoren, die am Ende den Unterschied machen, zu viel Gewicht beizumessen. Dabei übersieht man Kontinuitäten. So gehört es zu den Evergreens des US-Wahlkampfs, dass die Kandidatinnen oder Kandidaten, wollen sie Erfolg haben, den Eindruck erwecken müssen, für einen grundlegenden Wandel zu stehen. Deswegen müssen sie insbesondere deutlich machen, nichts mit dem vorherigen Establishment von Washington zu tun zu haben. So hielten es schon Ronald Reagan, Bill Clinton, George W. Bush und Barack Obama. Letzterer punktete einst mit dem ebenso simplen wie vagen Slogan »Change«. Nun war es Trump, der den Nimbus des Außenseiters und Aufräumers erfolgreich für sich reklamierte. Trumps Kampagne konzentrierte sich stark auf die weiße Kernwählerschaft der Republikaner, die ihn als einen der Ihren betrachtete. Viel stärker als sein Vorgänger Mitt Romney, mobilisierte Trump dabei viele Arbeiter und vormalige Nichtwähler.
Dass es sich vorwiegend um wirtschaftlich »Abgehängte« handelte, die Trump ihre Stimme gaben, ist allerdings ein Klischee. Der durchschnittliche US-Wähler, der ihn in den Vorwahlen unterstützte, verfügte über ein Haushaltseinkommen von 72 000 US-Dollar – und damit deutlich mehr als das amerikanische Durchschnittseinkommen von 56 000 US-Dollar. Die Wähler von Hillary Clinton und Bernie Sanders kamen im Vergleich nur auf rund 61 000 US-Dollar. 1
Die tatsächlich »Abgehängten«, die weniger als 50 000 US-Dollar im Jahr verdienen – das Dienstleistungsproletariat und die »Working Poor« –, stimmten überwiegend für Hillary Clinton. Trump lag bei der unteren Mittelschicht und den Besserverdienenden leicht vorne – vor allem aber bei weißen Männern und Frauen, auch solchen mit College-Abschluss.2 Nicht Einkommen und Bildung, sondern die Hautfarbe machte bei der US-Wahl 2016 den Unterschied.
Ähnlich ist es bei der »Alternative für Deutschland«. Zwar erzielte sie Spitzenergebnisse in strukturschwachen Regionen, die von hoher Arbeitslosigkeit geprägt sind, zum Beispiel in der Region um Bitterfeld, im östlichen Vorpommern, im Norden Mannheims und in Ludwigshafen. Bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen punktete sie zweistellig in Gelsenkirchen, im Essener Norden oder in Duisburg-Marxloh. Mehrere Studien zeigen aber, dass es zu kurz greifen würde, die AfD deshalb als eine Partei der »Abgehängten« zu betrachten. Denn die Anhänger der AfD verfügen laut einer Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2016 im Schnitt über ein Haushaltseinkommen von 3 140 Euro – das ist mehr als die Wähler von SPD (3 000 Euro) und Linkspartei (2 690 Euro) verdienen.3
Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) ermittelte 2017 für die AfD-Wähler, 25 Prozent von ihnen hätten ein hohes Bildungsniveau, 55 Prozent ein mittleres und zwanzig Prozent ein niedriges. Auch das Nettoeinkommen ihrer Wähler liege über dem Durchschnitt: Ein Drittel von ihnen soll sogar zum reichsten Fünftel der Bevölkerung zählen. Sie sei keine Partei der »Abgehängten«, sondern in ihr spiegele sich die Mitte der Gesellschaft.4 Auch Besserverdienende und ein sozialdarwinistisch eingestelltes, verrohtes Bürgertum sympathisieren mit der Partei, die wirtschaftspolitisch immer noch einen strikt marktliberalen und wenig sozialen Kurs vertritt.
Publizisten wie Roland Tichy, die mit der AfD sympathisieren, halten es sogar für eine Beleidigung, deren Wähler als »Abgehängte« und »Deklassierte« zu bezeichnen. Und auch die führenden Köpfe der AfD wie Alexander Gauland, Beatrix von Storch, Alice Weidel und Jörg Meuthen sind alles, aber ganz sicher keine Abgehängten.
Mit Blick auf die Schweizer Volkspartei, die Freiheitliche Partei Österreichs, die Rechtspopulisten in Dänemark, Norwegen und Finnland und auf die »Lega«, die einst den reichen Norden Italiens vom armen Süden abspalten wollte, ist es ebenfalls fragwürdig, die Wähler rechtspopulistischer Parteien pauschal als »Modernisierungsverlierer« abzuqualifizieren. Diese Parteien erzielen in einigen der reichsten Länder der Welt und in deren reichsten Regionen Spitzenergebnisse, und ihre Wähler sind oft wohlhabend. In den armen Regionen Europas, in Süditalien, Spanien und Griechenland, werden überwiegend eher Linkspopulisten gewählt, die sich die soziale Frage auf ihre Fahnen geschrieben haben.
Der Front National bemüht sich zwar stark um ein Image als neue »Arbeiterpartei«, und er verzeichnet in den vom industriellen Niedergang gezeichneten Regionen einen hohen Zulauf: In den Départements Aisne und Pas-de-Calais im Nordosten Frankreichs stimmten in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl 2017 über die Hälfte aller Wähler für Marine Le Pen. Dort herrscht hohe Arbeitslosigkeit, und viele sympathisieren mit dem Front National. Insgesamt machen Arbeiterinnen, Arbeiter und kleine Angestellte im öffentlichen Dienst mehr als zwei Drittel seiner Wähler aus, weshalb sich die Partei zur Fürsprecherin eines starken öffentlichen Diensts und zum Anwalt der ländlichen Regionen gemacht hat, und sich für mehr Protektionismus sowie einen Austritt aus dem Euro starkmacht. Aber auch Anwälte, Ärzte, Notare, Ingenieure und Unternehmer wählen die Partei.
Die andere Hochburg des Front National liegt am Mittelmeer, in den reichen Regionen der Départements Provence-Alpes-Côte d’Azur. Dort, um die Badeorte Cannes, Nizza und Saint-Tropez herum, liegt sein Wähleranteil stabil bei über 20 Prozent. Die Gegend an der Mittelmeerküste mit den Postkartenstränden und den malerischen Bergdörfern an der französischen Riviera ist eine der reichsten Regionen Europas. Sie ist im Sommer bei Touristen sehr beliebt, und viele Franzosen besitzen dort ein Häuschen. Seit den Regionalwahlen im Dezember 2015, bei denen er landesweit mit 28 Prozent ein Rekordergebnis errang und alle anderen Parteien überrundete, stellt der Front National in elf Rathäusern den Bürgermeister, fünf davon liegen im Süden Frankreichs.
Der französische Soziologe Gérard Mauger sagte in seiner Auswertung der letzten Wahlen, der Front National werde von Menschen mit völlig entgegengesetzten Lebenswelten und Überzeugungen gewählt.5 Seine Wählerschaft sei kein »Elektorat«, sondern ein »Konglomerat«. Einzig die Angst vor Migranten und Muslimen halte sie zusammen. In seinem Buch Les classes populaires et le FN schreibt Mauger, der Front National habe die Trennung in Arm und Reich erfolgreich durch die penible Unterscheidung in »fleißige Franzosen« und »faule Nicht-Franzosen« ersetzt. Zwar stammten mehr als die Hälfte der Stimmen für den Front National aus den unteren Schichten der Bevölkerung, und zuletzt habe ihn jeder siebte Arbeiter gewählt. Aber der Front National ermögliche es ihnen, sich nicht nur von »denen da oben« abzugrenzen, der Pariser Elite, sondern auch von »denen da unten«, die noch schwächer sind als sie selbst: den Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern. Die ständige Sorge um das eigene soziale Ansehen, die sich stets auch in einer Abgrenzung nach unten geäußert habe, sei ein besonderes Merkmal der gehobenen französischen Unterschicht. Der Front National bediene dieses Bedürfnis, indem er Nationalstolz und konservative Werte propagiere.