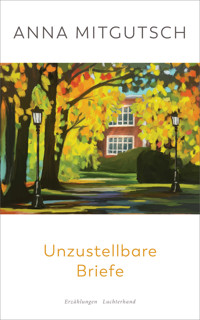9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Die Wiederveröffentlichung eines Klassikers.
Das Protokoll einer Peinigung: Marie ist als ungeliebtes, misshandeltes und ausgebeutetes Bauernkind in einem oberösterreichischen Dorf aufgewachsen. Es gelingt ihr, diesem Milieu zu entfliehen, indem sie heiratet und mit ihrem Mann in die Stadt zieht. Aber es gelingt ihr nicht, das von Generation zu Generation weitergegebene dumpfe Lebensgefühl abzulegen, das geprägt ist von Lieblosigkeit und Unfreiheit. Sie will, dass ihre Tochter Vera etwas Besseres wird, ein ›anständiges‹ Leben führt. Und so schlägt sie das Kind, wie sie selber geschlagen wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 404
Ähnliche
Zum Buch
Das Protokoll einer Peinigung: Marie ist als ungeliebtes, misshandeltes und ausgebeutetes Bauernkind in einem oberösterreichischen Dorf aufgewachsen. Es gelingt ihr, diesem Milieu zu entfliehen, indem sie heiratet und mit ihrem Mann in die Stadt zieht. Aber es gelingt ihr nicht, das von Generation zu Generation weitergegebene dumpfe Lebensgefühl abzulegen, das geprägt ist von Lieblosigkeit und Unfreiheit. Sie will, dass ihre Tochter Vera etwas Besseres wird, ein »anständiges« Leben führt. Und so schlägt sie das Kind, wie sie selber geschlagen wurde.
Zur Autorin
ANNA MITGUTSCH, 1948 in Linz geboren, ist eine der bedeutendsten österreichischen Autorinnen. Für ihr Werk erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, u.a. den Solothurner Literaturpreis sowie jüngst den Adalbert-Stifter-Preis. Sie lehrte an österreichischen und amerikanischen Universitäten und lebte viele Jahre in den USA. Anna Mitgutsch übersetzte Lyrik, verfasste Essays und zehn Romane, die in mehrere Sprachen übertragen wurden.
ANNA MITGUTSCH
DIE ZÜCHTIGUNG
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Neuveröffentlichung Juni 2020
btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © 1985 Anna Mitgutsch
Umschlaggestaltung: semper smile, München
nach einem Motiv von © Tea in the Garden, Richard Willis/Private Collectio/Bridgeman Images
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Klü · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-26009-5V001www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
War deine Mutter so wie du, fragt meine zwölfjährige Tochter, während sie sich an die Badezimmertür lehnt und mich beim Kämmen betrachtet. Die Frage überfällt mich aus vielen Jahren Schweigen heraus. Ich lasse mein gescheiteltes Haar über die Augen fallen. Nein, sage ich, nein, deine Großmutter war ganz anders. Wie anders? Stell dir das Gegenteil vor. Sie zögert, sieht mich fragend an. Wie soll sie sich das Gegenteil vorstellen, wenn ich ihr ein Rätsel bin. Ein Rätsel und eine Selbstverständlichkeit. Wie meine Mutter für mich, bis heute.
Andere Leute mussten sie mir erklären, als sie tot war. Ihr Gesicht, spitz und streng, unnahbar durch das Sargfenster. Mama, sagte ich und dachte, sie müsse die Augen öffnen, zumindest für mich. Sie hatte zu riechen begonnen, sie war drei Tage aufgebahrt. Zu Hause schob ich ein Foto in einen Rahmen, meine Mutter mit ihrer zweijährigen Tochter, aufrecht, mit hochgetürmter Frisur, sitzt sie da, unnahbar. Ihre kräftigen Hände umklammern meine Kinderärmchen wie Vogelkrallen. Schau nicht so streng, ich brauche dich, sagte ich zu dem Foto. Ich hielt ihren Blick nicht lange aus, dann legte ich das Foto wieder zu den anderen zurück. Sie war eine unglückliche Frau, sagten die Trauergäste, enttäuscht vom Leben, sie hatte zu niemandem Vertrauen. Kein Mensch mochte sie, sagte die Frau, die mein Vater ein Jahr später heiratete, verächtlich. Sie kam mit niemandem aus. Ich erinnerte mich, wenn sie zitternd vom Einkaufen zurückkam, Bitt-schön-Frau-Doktor war wieder dort, da muss unsereiner natürlich warten. Die vielen Demütigungen von dreißig Jahren, ich hatte sie miterlebt, als seien sie mir zugefügt worden, mir, der Achtjährigen, die wehrlos auf dem Sofa lag, während sie ihren angesammelten Hass über mich ergoss, wieder und wieder, bis ich weinte vor Schmerz und Wut. Später hasste ich sie dafür, dann vergaß ich sie. Nach zehn Jahren sagte ich, Gott sei Dank, dass sie so früh gestorben ist, ich hätte mich unter ihrem Blick nicht entfalten können.
Wenn ich mit meinem Kind in unserem Sommerhaus die Ferien verbringe, in dem Haus, in dem ich aufwuchs, siebzehn Jahre lang, bis ich fortging und fünf Jahre nicht wiederkam, sitze ich auf ihrem Platz zwischen Küche und Esstisch. Ich hantiere mit ihrem Geschirr und schlafe in ihrem Bett. Ihre Kleider habe ich hergeschenkt, die Heiligenbilder und den Weihwasserkessel habe ich von der Wand genommen, aber über meinem Bett hängt noch immer die Zeichnung von mir, die ich ihr zu ihren letzten Weihnachten geschenkt habe. Ein junges Mädchen im Profil, das sehnsüchtig aus einem Spitzbogenfenster auf eine weite Landschaft hinausschaut. Auf dem Bücherregal steht das Foto, das sie als Sterbebild wollte, das in ihren Grabstein eingelassen ist, eine Vierundzwanzigjährige mit aufrechtem Rücken und aufgetürmtem schweren Haar, Hochmut und Verletzlichkeit in dem zarten Gesicht. Es ist nicht das Gesicht einer jungen Frau, dieses Gesicht hat endgültig Stellung bezogen zum Leben, für dieses Gesicht gibt es keine Überraschungen mehr, ihr habt mich verletzt, ihr werdet es wieder tun, ich werde euch keine Angriffsflächen bieten. Es war das erste Jahr ihrer Ehe, das erste Jahr nach dem Krieg, zwei Jahre später war sie meine Mutter. Das ist das Bild, das vor mir auftaucht, wenn ich an Mutter denke, eine Vierundzwanzigjährige in der Nachkriegsmode mit steifem, unnahbarem Rücken. Später ließ sie sich nicht mehr fotografieren.
Erst als ich schwanger war, dachte ich wieder an sie. Damals war sie schon viele Jahre tot. Ich schob meinen Bauch durch Supermärkte und verlangte nach Sulz, hausgemachtem Sulz. Ich wachte mit dem Geruch von Surbraten in der Nase auf, ich konnte ihren herb-süßen gallertigen Schokoladenpudding zwischen Zunge und Gaumen schmecken. Meine Mutter kam in mein Leben zurück als Nahrung, nach der ich Heimweh hatte. Als ich mit dem Neugeborenen in die fremde, heiße Wohnung zurückkam und der Vater meines Kindes mich verließ, saß ich weinend neben dem schreienden Kind und rief nach ihr. Ich wollte in ihre Arme zurück, ich schrie nach der Liebe, die ich meinem Kind verweigerte, ich wollte gewiegt werden, mich ganz klein machen in ihrem Schoß und nie mehr in die Wirklichkeit zurückmüssen. Eingesperrt in eine kleine Vorstadtwohnung zwischen Windeln, Kindergeschrei und schmutzigem Geschirr und dem Gefühl, das Leben hätte mich abgestellt und vergessen, begann ich sie zu verstehen. Mama, schrie ich, wenn ich mich hinter versperrter Tür auf den Teppich warf, den Spiegel zertrümmerte und meinen Kopf gegen die Wand schlug. Du bist irrenhausreif, du bist verrückt, sagte der Mann, dem ich mein Leben anvertraut hatte, und ich hörte meinen Vater sagen, sie war nicht richtig im Kopf, sie war aus dem Häusl, man hätte sie in eine Anstalt tun sollen. Ich hörte meine Mutter schreien, mit verzerrtem, verquollenem Gesicht, du liebst mich nicht, du Schwein, und ging in die Küche, um schweigend und systematisch Geschirr zu zerschlagen.
Ich fand ihre Spuren, als ich mit meiner zweijährigen Tochter im Arm in das alte Haus an der Donau zurückkehrte, das ich mit neunzehn verlassen hatte. Ich fand den Teppichklopfer am Türrahmen der Waschküche hängen, er hing da wie ihre blaue Drillichschürze unterhalb der Bodenstiege, seit zwölf Jahren unberührt, ein Teil von zu Hause, ein Teil von mir, von meiner Kindheit, ein Teil der Lebensangst, die sie an mich weitergegeben, in mich hineingeprügelt hatte. Ich hielt ihn in der Hand, und die Angst stieg wieder in mir hoch, die Angst vor den Schlägen, die Angst vor der Drohung der hereinbrechenden Züchtigung. Ich hielt ihn in der Hand und sah ihn zum ersten Mal in seiner konkreten Beschaffenheit, so wie sie ihn gesehen haben muss, eine dicke, gebogene Gummiwurst mit einer Eisenspirale umwunden, ein Folterwerkzeug. Ich hielt das Kind in einem Arm, den Teppichklopfer im anderen. So klein war ich, als sie begann, mich zu schlagen. Trotzalter hat’s bei uns nicht gegeben, sagte sie oft stolz zu Verwandten, das muss man im Keim ersticken, sobald das erste Nein kommt, sobald der Fuß aufstampft. Ich hörte zu und war stolz, ein wohlerzogenes Kind zu sein, ein geschlagenes Kind zu sein. Bitte, bitte, liebe Mama, ich tu alles, nur bitte, bitte, dieses eine Mal nicht, nur dieses eine Mal. Ich lief auf die Straße und bat Fremde, mir zu helfen, ich schrie nach meinem Vater, auf den Knien rutschte ich über den Kiesweg und umfing ihre Beine. Es half nichts, sie schlug mich. Nie das Kind im Affekt schlagen, sagte sie zu ihren jüngeren Schwestern. Wart nur, wenn ich in zwei Stunden heimkomm, kriegst du Treff, dann schlag ich dir die Läufe ab. Bitte, bitte, lieber Gott, flehte ich kniend, gib, dass sie stirbt. Wie oft habe ich ihr den Tod gewünscht, der dann zu früh kam. Ich war das besterzogene Kind in der Verwandtschaft, Mund halten und sitzen bleiben, nicht dreinreden, still und alleine spielen, niemanden belästigen; lehn dich doch nicht an mich an, kannst du nicht allein sitzen, Anlehnungsbedürfnis ist Schwäche. Sie erlaubte sich keine Schwäche. Ich wagte es nicht, sie zu hassen. Ich konnte es mir nicht leisten, sie zu hassen, sie war der einzige Mensch, der mich liebte. Danke, liebe Mama, musste ich sagen, wenn sie vom Schlagen erschöpft war und sich schwer atmend niedersetzte. Manchmal ließ sie sich der Länge nach auf den Boden fallen, und ich bekam Angst um sie, hoffte, sie sei nicht ohnmächtig geworden von der schweren Arbeit der Züchtigung, ich fühlte mich schuldig, ihr so viel Kummer zu bereiten. Nachher hatte ich rote Wülste auf Beinen und Hüften, die wurden blutunterlaufen, dann grün und blau, und sie schrieb mir eine Entschuldigung fürs Turnen, damit niemand Fragen stellen konnte. Es gab viele Gründe, gezüchtigt zu werden, einen Befehl mit Nein oder Warum zu beantworten, eine halbe Stunde zu spät von der Schule heimzukommen, in der Kirche mit anderen Kindern zu flüstern oder zu kichern, im Schönschreibheft unter die Zeile zu geraten und f mit k zu verwechseln, eine Rüge von der Lehrerin, ein Befriedigend auf die Schularbeit.
Als ich vierzehn war, bekam ich die letzten Schläge. Wir wurden die besten Freundinnen, ich erzählte ihr nichts, sie mir alles. Ich war gut dressiert, meine Antworten waren spontan und entsprachen ihrer Erwartung. Ich brauche kein Fahrrad, es wäre zu gefährlich für mich. Alle in der Klasse gehen auf den Ball, das wäre mir zu kindisch. Meine Freundin Eva hat einen Freund, der sie geküsst hat, wie widerlich. Als sie tot war, wollte ich nicht mehr weiterleben. Ich setzte mich im Hemd ans Fenster, es schneite mir auf die Beine, aber ich bekam keine Lungenentzündung. Ich fühlte mich wie ein Krüppel ohne Krücken, und ich hatte keine Lust, gehen zu lernen. Ich behielt die strenge Frisur, die sie für mich richtig gefunden hatte, trug die wadenlangen Röcke, die sie für mich gekauft hatte, ging ein Jahr lang in Trauer, obwohl mir Schwarz nicht steht, und sah keinen Sinn in meinem Leben mehr. Meine Mutter hat sich für mich aufgeopfert, sagte ich, meine Mutter war mir alles, nur sie verstand mich, nur sie liebte mich, ich konnte über alles mit ihr reden. Und jetzt ist sie tot, und ich stehe allein in der Welt. Ich saß an ihrem Grab und schrieb weinend Briefe an sie. Wenn du von mir fortgehst, werde ich sterben, hatte sie gesagt. Ich ging in eine andere Stadt zur Universität, ein halbes Jahr später war sie tot. Ich bin an ihrem Tod schuld, schrieb ich in mein Tagebuch.
Als ich später als andere die Welt entdeckte, begann ich sie zu hassen. Als ich nicht mehr ohne Abenteuer leben konnte, begann ich sie zu verachten. Ich wurde alles, worüber sie sich am meisten entsetzt hätte. Ich schlief mit allen Männern, die mich haben wollten, und vielen, die mich nicht wollten. Ich fuhr per Autostopp durch zwei Kontinente und wusch mich in drei Monaten nicht ein einziges Mal. Ich gab meine Karriere auf für einen Mann und gab diesen Mann für einen anderen auf, nur um ihn wieder zu verlassen. Du bist eine Zigeunerin wie deine Großmutter, die alte Hexe, hörte ich meine Mutter sagen, und plötzlich hasste ich sie nicht einmal mehr, ich vergaß sie, sie hatte keinen Platz mehr in meinem Leben. Aber das Schicksal der Mütter setzt sich in den Töchtern fort. Einmal kommt die Mutter und sagt, so, mein Kind, jetzt bist du alt genug, jetzt zeige ich dir mein Leben. Ich schrie, du liebst mich nicht, du Schwein, und sah das verquollene Gesicht meiner Mutter, ich sah mit entsetzten Augen, wie sie meinem Vater ins Gesicht spuckte, aber es war der Mann, mit dem ich lebte, der sich den Speichel abwischte und mir ins Gesicht schlug. Ich bin keine Hausfrau, ich will keine Hausfrau sein, ich bin mir zu gut zum Verblöden, schrie ich und fegte Gläser und Geschirr vom Tisch. Nur ein total verblödetes, gottergebenes Schaf ist eine gute Hausfrau, hatte meine Mutter zu unserer jungen Nachbarin gesagt, die Karriere und Haushalt verbinden wollte. Ich warf das schreiende Kind ins Bett, schloss die Tür und schmiss an die Wand, was mir als Erstes in die Hand fiel. Da kam meine erste Erinnerung zurück. Ich liege im Kinderwagen, es ist Nacht, nur eine Nachttischlampe brennt, der Wagen rollt, immer schneller, ein Anprall, noch ein Anprall, ich liege auf dem Boden, brülle noch lauter, eine Hand packt mich, wirft mich zurück in den Wagen, ich halte den Atem an, in Todesangst, der Wagen steht still. Bald werde ich mein Kind schlagen, dachte ich entsetzt. Als ich zu toben begann, als ich mich beobachtet und von allen verachtet fühlte, als ich zu fürchten begann, man wolle mich auf heimtückische Weise ermorden, retteten mich die weit aufgerissenen Augen meiner Mutter, sie holen mich, lauf, Kind, bevor sie dich auch erwischen. Ich lief. Ich packte die zwei Koffer, mit denen ich gekommen war, ich nahm meine Tochter mit. Ihr kriegt mich nicht, sagte ich zu meinem Mann und reichte die Scheidung ein, als ich einen Job und eine Zweizimmerwohnung gefunden hatte.
Meine Tochter steht wie eingerahmt in der Badezimmertür. Sie hat das kastanienrote Haar meiner Mutter, ihre bernsteinfarbenen Augen, ihre hohe Stirn mit dem perfekten Haaransatz. Sie wartet auf eine Antwort. Ich kämme mir das Haar nach hinten, prüfe mein Augen-Make-up. Deine Großmutter hatte ein schweres Leben und keine Wahl. Es waren andere Zeiten. Alle Sätze gehen daneben. Schau, ich habe gegen meine Mutter und ihr Leben rebelliert, du wirst einmal gegen mich rebellieren. Und dann werde ich so wie meine Großmutter? Kaum, lache ich. Vielleicht, sage ich dann. Wer gibt Garantien, denke ich, sie wird eine Frau sein, sie wird einen Mann lieben und ihn besitzen wollen, auf ewig, sie wird heiraten, vielleicht Kinder haben, und wird sie die Kraft haben, sich zu retten?
*
Ein kleines Mädchen sitzt auf den breiten, unebenen Steinstufen des Bauernhauses. Schneekrusten liegen auf den Mauern, der Himmel über dem Hofviereck ist hoch und blau. Ein Knecht kommt mit einer Schaufel aus dem Stall, der Kuhmist fällt dampfend und weich auf den gefrorenen Misthaufen. Das Kind hält ein Stück Brot in der Hand und leckt an dem Zucker, der auf die Butter gestreut ist. Hühner scharren in der gefrorenen Erde, trippeln die Steinstufen hinauf, eine Henne streckt den Kopf vor und pickt in das Brot hinein, das Kind lässt das Brot fallen und beginnt zu plärren. Die Hühner raufen um das Butterbrot, zerren es über den Hof. Die Kindsmagd kommt aus dem dunklen Hausflur, ein kleines Mädchen auf dem Arm, das kaum größer ist als das Kind auf den Stufen. Sie packt die Kleine, zerrt sie in den Flur zurück, stellt das andere Kind ab und geht langsam hüftenwiegend über den Hof. Der Stallknecht steht, an die Mistschaufel gelehnt, in der Stalltür und grinst. Das größere Mädchen läuft in die Stube zurück, die Kleine kriecht wieder zu den Stufen und sieht daumenlutschend den Hühnern zu.
Erst am späten Nachmittag, als das neun Monate alte Mariechen vor Hunger zu schreien beginnt, erbarmt sich die Stallmagd und schleppt zwischen Schweinefüttern und Melken die Kleine in die Stube. Kalt wie ein Eiszapfen ist das Kind, sagt sie vorwurfsvoll in Richtung Herd, wo die Kindsmagd hantiert. Ich kann auch nicht überall zugleich sein, mault diese zurück, zwei Kinder, kochen, aufbetten, abwaschen, Stube auskehren, ich renn mir ja eh die Füße aus. Wenigstens bist in der warmen Stube, sagt die Stallmagd und haucht sich auf die roten, geschwollenen Finger, bevor sie die Milchpitschen hinausträgt. Tätst lieber den ganzen Tag Holz hacken? Das Mädchen am Herd, selbst noch keine zwanzig, nimmt das schreiende Bündel, legt es auf den Tisch. Das Windel ist steif gefroren. Wenigstens kein Dreck, denkt sie.
Als zwei Wochen später die Mutter vom Spital heimkam, waren Mariechens Beine gelähmt. Die Mutter war geschwächt, sie hatte die erste Brustoperation hinter sich, die Arbeit häufte sich, Fanni, die Größere der beiden Kinder, hing ihr auf Schritt und Tritt am Kittel, der Mann hatte sich über die Abwesenheit der Frau hinweggetröstet und kam auch jetzt nächtelang nicht heim. Mariechen lag in ihrem Bett, wimmerte vor sich hin, rang keuchend nach Luft, wurde blau im Gesicht. Die Mutter hob sie kurz heraus, löffelte ihr Griesbrei in den Mund, setzte das Kind auf den Boden, aber das Kind fiel zur Seite. Es war hilflos wie ein Säugling. Der Frühling kam, man holte den Arzt, bald würde die Feldarbeit anfallen, und jetzt gab es Scherereien mit dem Kind. Ein Unglückskind, ein Freitagskind, dachte die Mutter und schaute ratlos und bitter auf den roten Haarschopf und das teigige Gesicht hinunter. Ein hässliches Kind. Ein ungewolltes Kind. Es war neun Monate nach dem ersten geboren. Sechs Wochen gibt’s jetzt Ruh, hatte die Hebamme zum Bauern gesagt, als sie mit den blutigen Tüchern an ihm vorbei zum Herd ging. Aber in der nächsten Nacht schon fiel er über sie her, sie stöhnte, au, du tust mir weh. Halt’s Maul, hatte er gesagt, soll ich zu einer anderen gehen, ich brauch nur mit dem Finger zu schnalzen. Sie schwieg und biss die Zähne zusammen, es würde ja gleich vorbei sein. Er war zwölf Jahre jünger als sie, der schönste Mann im Dorf. Die Frauen kriegten einen wiegenden Gang, wenn sie seinen Blick im Rücken spürten. Du Vieh, stieß sie zwischen den Zähnen hervor, er hörte es nicht mehr, er rollte zur Seite, drehte ihr den Rücken zu. Sie setzte sich auf, der Schmerz raste, stopfte sich noch zwei Windeln zwischen die Beine. Das Kind war groß gewesen, die Risse mussten von selbst verheilen, und er stieß ihr in der Euphorie der Vaterschaft seinen Samen in den zerrissenen Schoß, Nacht für Nacht. Solang man stillt, kann nichts passieren, hieß es. Es passierte etwas. Neun Monate später kam Marie zur Welt. Wieder ein Mädchen. Der Bauer ging enttäuscht hinaus, das zweite Mal hätte sie ihm einen Stammhalter gebären können. Als er dieses Mal über sie kam, stieß sie ihn weg, du Sau, ich bin auch keine Gebärmaschine. Er stand auf, stieß mit dem Fuß verächtlich gegen den Korb, in dem das Kind schlief. Wozu hat man eine Frau? Pass auf, heut Nacht mach ich dir einen Buben, sagte er zur Wirtstochter, als er sich in ihrer Kammer das Hemd aufknöpfte und die Hose hinunterließ. Sie zog sich das Nachthemd über den Kopf und kicherte, gar nichts machst mir, du geiler Bock, lachte sie.
Der Arzt verschrieb Salben zum Einmassieren. Zweimal täglich eine halbe Stunde massieren, wer hatte dazu Zeit. Das Kochen, das Melken, Ausmisten, Grasmähen, das musste zuerst geschehen. Das Vieh will fressen, das Vieh will gemolken werden, das Vieh brüllt lauter als ein hungriges Kind. Die Narbe an der Brust wollte nicht verheilen, schonen, riet der Arzt. Wie denn, fragte die Bäuerin. Er zuckte die Achseln. Kinderlähmung ist es nicht, sagte der Arzt, ich bin am Ende meines Lateins. Da kann nur noch ein Wunder helfen, liebe Frau. Mariechen war sechzehn Monate alt und noch immer gelähmt. Ihre großen Augen folgten dem Schattenspiel der Blätter vor dem Fenster, manchmal griff sie mit den Händen danach. Die Flasche mit dem verdünnten Grießbrei konnte sie sich schon selber halten. Ihr kleiner Popo war rot und wund vom tagelangen Liegen in den schmutzigen, nassen Windeln. Ein Wunder muss geschehen, hat der Arzt gesagt. Andere Leute haben Kinder, damit Arbeitskräfte heranwachsen, dass man’s einmal leichter hat in seinen alten Tagen, sagte der Bauer, als die Frau die gelähmten Beinchen in den Holztrog hielt, um den Schorf und den verkrusteten Dreck herunterzuwaschen. Am nächsten Samstag nach dem Melken band sie sich das Kind mit einem großen wollenen Umhängtuch auf den Rücken, packte Speck und einen halben Laib Brot in ein Sacktuch, als ob sie in die Waldwiesen zum Heuen ginge, aber sie zweigte nicht auf die Feldwege in Richtung Wald ab. Sie blieb auf der asphaltierten Straße, schaute nicht links und rechts, wenn sie durch Dörfer kam, bekreuzigte sie sich an den Marterln am Straßenrand und sagte schnell ein Jesus, Maria, sei uns armen Sündern gnädig. Als die Sonne hoch stand und kein Schatten weit und breit, zog sie dem Kind einen Zipfel des Umhängtuchs über den Kopf, brach ein Stück Brot ab und gab ihm das Brot zum Kauen. Zu Mittag war sie an der Grenze. Wohin, fragte der Zöllner. Pässe waren damals nicht nötig, um über die Grenze zu kommen. Nach Altötting, sagte sie und ging um den Schlagbaum herum. Als sie am späten Nachmittag vor der wundertätigen Madonna kniete, war sie zu erschöpft, um beten zu können. Das Kind auf ihrem Rücken schlief, die wundgegangenen Füße pochten vor Schmerz. Sie nickte ein, riss sich hoch, fasste ihre Bitte in Gebetsformeln, über denen sie einnickte. Bevor sie ging, zündete sie eine Kerze vor dem Altar an. Die Nacht war klar und kühl, sie fror, das Kind weinte. Sie band es sich vor die Brust und legte die Arme um das wimmernde Bündel. Als am Morgen die Farben langsam in die graue, bleierne Landschaft zurückkehrten und sich ein klares weißes Licht auf die Häuser legte, bevor noch die Sonne über den Rand der Felder stieg, war sie wieder im Dorf. Sie wickelte sich Fetzen um die wunden Füße, zwang sie in die Gummistiefel, und mit Sense und Scheibtruhe ging sie zum Grasmähen.
Als Mariechen achtzehn Monate alt war, begann sie wieder zu kriechen. Mit zwei Jahren stand sie auf den etwas verkümmerten Beinchen und streckte die Arme aus dem Gitterbett. Zu diesem Zeitpunkt war die Mutter wieder schwanger. Als Mariechen das erste Mal in den Hof hinaustorkelte, hinfiel, wieder aufstand und mit großen, erstaunten Augen die Welt betrachtete, die Hühner und die Tauben, die sich um den Kukuruz rauften, die Katzen, die sich schläfrig in der Sonne das Fell leckten, das blaue Himmelsviereck, den dampfenden Misthaufen, war da niemand, der sagte, ein Wunder ist geschehen. Die Mutter lag wieder in den Wehen. Stunden später, als das Stöhnen und die kurzen Schreie verstummt waren und das dünne Klagen eines Neugeborenen einsetzte, steckte der Bauer den Kopf zur Tür herein. Na, was ist es? Ein Sohn, sagte die Hebamme, die Bäuerin strahlte. Das muss gefeiert werden, sagte der Bauer und ging ins Wirtshaus. Eine Runde, Herr Wirt, rief er, als er die rauchige Stube betrat, ich habe einen Stammhalter. Die Bauern schlugen ihm auf den Rücken, Bierschaum um den Mund, ein fescher Kerl wie du muss ja Glück in der Liebe haben. Die Wirtstochter lachte und rieb ihren Busen an seiner Schulter.
*
Und das ist die Leidensgeschichte ihrer Jugend, die ich so oft gehört habe, auf dem Sofa nach dem Mittagessen, zur besseren Verdauung, dass mir seither nach jeder Mahlzeit speiübel ist. Diese Geschichten sollten mich für sie gewinnen, sie sollten mich lehren, sie zu lieben, weil sie von niemandem geliebt worden war und weil sich nie jemand die Mühe genommen hatte, sie zu verstehen oder ihr überhaupt zuzuhören. Wer sollte sie denn verstehen, wenn nicht die Tochter, die ihr und ihren Geschichten ausgeliefert war, wehrlos, eine fortgesetzte Vergewaltigung, die auf sie niederging wie die körperlichen Züchtigungen, täglich, in den Alltag gemengt, die sie lehren sollten, den Menschen zu misstrauen, die Menschen zu hassen, alle, bis auf die Einzige, die den Schmerz zufügte, die ihn weiterreichen musste, damit der Hass fortlebe. Und ich habe nie jemanden, der dabei gewesen war, damals gefragt, ist es wahr, war es wirklich so? So schrecklich, so freudlos, so grausam? Ich glaubte ihr alles, und ich weinte um sie, um ihre betrogene Kindheit, um ihre verlorene Jugend, und sie sah mir zu und sagte, da siehst du, wie viel besser du es hast, wie glücklich du sein kannst. Ich war empört über ihren Vater, der sie geschlagen hatte. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, eine Verbindung herzustellen zwischen seinen Leibgurten und ihrem Teppichklopfer, zwischen den brutalen, ungerechten Schlägen, die sie ertragen hatte, und den gerechten Züchtigungen, die sie mir erteilen musste, auf dass ein ordentlicher Mensch aus mir werde.
*
Flascherl wärmen, den Franzl trockenlegen, auskehren, Geschirr waschen, das Mittagessen steht im Ofenrohr. Knappe Arbeitsanweisungen, bevor die Mutter wieder aufs Feld ging. Der Leiterwagen stand schon vor der Haustür, hü, schnalzte der Bauer, und die Ochsen zogen an, die Bäuerin sprang auf den fahrenden Wagen. Sie würde vor Abend nicht mehr in die Stube kommen. Die sechsjährige Marie warf den Ranzen auf die Bank, die rund um den Tisch fast von einer Wand zur anderen lief, und öffnete das Ofenrohr. Fettes Bauchfleisch und Mehlknödel schwammen im Fett, Rüben und Erdäpfel standen in zwei Häfen auf der Herdplatte, alles schon kalt. Der Säugling im Gitterbett plärrte, sie tauchte den Fetzen in die Zuckerlösung am Herd und steckte ihn dem schreienden Kind in den Mund. Im Schiff über dem Herd war das Wasser noch warm. Sie musste auf einen Sessel steigen, um die Babyflasche hineinzustellen. Heini, der Stammhalter, saß mit verschmiertem Mund auf dem Boden, schob den Schemel vor sich her und rief hü, hott, hü, hott. Wo ist die Fanni, fragte Marie den Vierjährigen. Er antwortete nicht. Sie nahm den Besen, scheuchte den Bruder vom Boden, die Katze unter dem Tisch hervor, geht’s weg, dass ich auskehren kann. Der Bruder zwickte sie in die Waden und lachte, als er ihr entwischte. Das Baby begann wieder zu brüllen, sie holte das Flascherl aus dem Wasser, die gierigen kleinen Hände warteten schon. Eine große, dunkelschillernde Fleischfliege prallte summend gegen das Fensterglas. Die Tür ging auf, und Fanni kam hereingetänzelt, sie warf den Ranzen neben die Tür, in der Hand hielt sie eine Semmel. Wo warst denn so lang, fragte Marie und raffte das schmutzige Tischtuch zusammen. Geht dich einen Dreck an, mampfte die Ältere. Marie fuhr herum. Woher hast du die Semmel, lass mich abbeißen. Fanni grinste, hielt die Semmel hoch über beide Köpfe. Kauf dir selber eine. Mit was denn? Mit einem halben Kreuzer. Woher hast ihn denn du? Von der Mutter, fürs Holztragen. Ich krieg die Arbeit angeschafft, und du kriegst das Geld. Die Augen blind vor Wut fiel Marie über die ältere Schwester her, du Luder, du hinterfotziges, sie kratzte, Fanni biss, bald wälzten sie sich auf dem Boden, die Semmel rollte unter die Ofenbank. Heini steckte sie sich mit einem schnellen Griff vorne in seine Hose. Die Mädchen ließen voneinander ab. Sie suchten vergeblich nach der Semmel, während sich Heini verstohlen zur Tür hinausdrückte.
Nach dem Baden am Samstag, vor dem Melken und Viehfüttern, kommt die Entlausung, jede Woche, im Sommer neben dem Misthaufen. Die Mutter hat einen dünnzahnigen eisernen Kamm, der sich in die Kopfhaut gräbt und erbarmungslos an den verfilzten Haaren reißt, ganze Büschel gehen mit. Die Läuse werden zwischen Zeigefinger- und Daumennagel zerdrückt, dass es knackt. Fanni hat dunkelbraunes, seidiges Haar, das ihr in großen Wellen auf den Rücken fällt. Maries Kopf ist wie eine verrostete Kappe aus Blumendraht. Rotschädel, Rotschädel, schreien ihr die Buben auf der Dorfstraße nach. Au, schreit Marie, als die Mutter mit dem Kamm dreinfährt. Die Haarbüschel fallen mitsamt den Läusen auf den Misthaufen. Hast eh so viel Haar, sagt die Mutter, da gehen die paar Büschel nicht ab. In den Betten hausen die Wanzen und in den Kleidern die Flöhe. Dass ihr euch ja nicht kratzt in der Kirche, droht die Mutter, schämen müsst man sich. Während der Wandlung, bevor die Kirchenglocken zu läuten beginnen, spürt Marie, wie langsam eine Laus über ihren frisch gewaschenen Hals kriecht. Ein schneller Griff, sie betrachtet das Insekt, das zwischen Daumen und Zeigefinger zappelt, mit Genuss. Es ist so still, dass man das Knacken hört, als sie der Laus den Panzer bricht. Die Mädchen in ihrer Reihe beginnen zu kichern, prusten laut heraus, in der Reihe dahinter kichern sie auch schon. Agnus Dei, sagt der Priester und hebt die Hostie in die Höhe, sein strafender Blick fällt auf die kichernden Mädchen. Maries Kopf ist so rot wie ihre Haare. Nach der Messe packt die Mutter sie am Arm und schleift sie mit, über den Marktplatz, die lange Straße entlang bis zum Dorf, ohne ein Wort. Wart nur, wenn der Vater kommt, sagt sie, als sie Marie beim Hoftor hineinstößt. Marie versteckt sich auf dem Heuboden. Als sie zu Mittag der Hunger in die Stube treibt, sitzt der Vater beim Tisch. Bevor sie wieder hinauskann, hat er schon den Gürtel abgeschnallt. Es ist kein Wort gefallen. Alle lassen die Gabeln sinken und schauen zu mit einer Mischung aus Schadenfreude und Entsetzen, wie der Lederriemen auf ihre nackten Schenkel, Waden, Arme heruntersaust, wieder und wieder, bis sie mit dem Kopf auf die Herdkante aufschlägt und hinfällt. Dann packt die Mutter sie am Arm und schleift sie in die Kammer ins Bett. Die anderen essen schweigend weiter. Es ist nicht das erste Mal, dass sie dem Vater zur Züchtigung übergeben wird. Er schlägt selten mit der bloßen Hand zu, seine Schläge hinterlassen immer Spuren, Nasenbluten, blutunterlaufene Flecken, geschwollene blaue Augen, manchmal einen wackelnden Zahn. Die Strafe ist immer gerecht und wohlverdient. Wer sein Kind liebt, der züchtigt es.
Alle Kinder in der Schule haben zumindest zwei Paar Schuhe. Halbschuhe für den Sommer, hohe Schnürschuhe für den Winter. Fanni und Marie haben gemeinsam drei Paar Schuhe, zwei Paar hohe Schuhe und ein Paar Lackschuhe mit einer glänzenden Spange. Fanni trägt die Lackschuhe, sie ist die Hübschere, die Leute bleiben stehen und sagen, so ein sauberes Mensch. Als sie noch im Kinderwagen saß, waren die Leute schon stehen geblieben, ganz der Vater, und das war ein Kompliment. Fanni hat eine hellblaue Seidenschleife im dunklen Haar und lachende dunkelgraue Augen. Dazu gehören schwarze Lackschuhe. Sie passt auf die Sachen auf, sie macht sich nie schmutzig, Unterwäsche bleibt bei ihr länger weiß und Schürzen länger gebügelt. Marie läuft herum wie ein Bub, verlaust und verdreckt, mit aufgeschundenen Knien, kein bisschen Eitelkeit, nichts Gewinnendes an diesem Kind, immer ernst, ein sommersprossiges, spitzes Gesicht mit vorwurfsvollen, misstrauischen Augen unter einer unbändigen roten Mähne. Selbst der Versuch, diese Mähne unter Schleifen und Maschen zu zähmen, muss scheitern. Marie kann auch Fannis abgetragene Kleider nicht anziehen, obwohl sie jünger ist. Sie ist größer, knochiger, breitschultriger als ihre zierliche Schwester. Seit Fanni in der zweiten Klasse sitzengeblieben ist, gehen sie in dieselbe Klasse. Marie ist Klassenbeste und sitzt vorn, Fanni liest die Zettel unter der Bank, die ihr die Buben schreiben, und kichert. Marie zeigt nie auf, aber wenn sie eine Antwort weiß, strahlt sie, und im Winter weiß sie immer alle Antworten richtig. Im Sommer, während der Erntezeit, muss sie oft daheimbleiben und mithelfen. Für die Hausaufgaben ist dann keine Zeit. Sie muss Heu umkehren, zusammenrechen, Steine von den Feldern aufklauben und die Kleinen versorgen. Es gibt immer noch Kleine im Haus. Als sie neun wird, ist das Kleinste fünf Monate alt, und die Mutter muss wieder ins Spital. Diesmal wird ihr die zweite Brust wegoperiert und die Gebärmutter herausgenommen. Ein Tumor war’s, heißt es, die Ärzte reden nicht aus, sagt der Vater. Sieben Kinder, es ist Zeit, dass ein Ende wird. Er geniert sich, wenn er mit seiner Familie in die Kirche geht; wie die Orgelpfeifen, und er ist erst zweiunddreißig und noch immer der schönste Mann im Dorf. Es gibt wenig unverheiratete und sogar einige verheiratete Frauen in der Gemeinde, mit denen er nicht schon einmal im Bett gelegen ist, und Bankerte gibt’s auch von ihm, manche sehen ihm sogar ähnlich, aber er streitet alles ab, und bei einem Vaterschaftsprozess macht sich nur das Mädchen lächerlich.
Es ist Erntezeit, und die Mutter ist im Spital. Sie wollte noch bis zum Herbst aushalten, aber die Schmerzen waren schon unerträglich, und dann kam der Blutsturz. Der Arzt fuhr sofort mit ihr zum Kreisspital. Der Bauer fluchte, Hurnsweiber, verdammte, nix wie Scherereien. Fanni und Marie wuschen die blutigen Leintücher und wischten das Blut vom Boden auf. Sie waren beide verstört und überzeugt, die Mutter würde noch auf dem Weg ins Spital sterben. So viel Blut kann ein Mensch ja gar nicht haben. Die Kleineren standen herum und weinten, nur die zweijährige Angela saß auf dem Fensterbrett und staunte dem Auto des Doktors mit offenem Mund nach. Es gab nicht viele Autos auf der Dorfstraße. Wenn eins vorbeifuhr, rannten alle zu den Fenstern und schauten ihm nach, bis es um die Biegung verschwunden war. Der Bauer heuerte noch einen Knecht für die Erntearbeit, aber die Hausarbeit und die Kinder fielen auf die beiden Ältesten. Fanni kochte und versorgte die Kinder, Marie musste die groben Arbeiten machen. Melken, Schweinefüttern und Grasmähen ist Weiberarbeit, kein Mann würde sich mit dieser Arbeit die Hände dreckig machen. Die Neunjährige musste jetzt jeden Tag um vier Uhr in der Früh aufstehen. Raus, ihr Faulenzer, rief der Vater vor der Tür der Mädchenkammer und gab ihr einen Tritt mit dem Holzschuh. Fünf Minuten später musste sie im Stall sein, sonst gab es Flüche, Tritte und Watschen. Da sitz her, sagte der Vater beim ersten Mal und schob einen Schemel unter den Kuhbauch, so geht’s, und die Milch floß in einem dünnen, gleichmäßigen Strahl in den Eimer. Elf Kühe melken, jeden Morgen, Schlaf in den Gliedern und mit leerem Magen. Aber ihre Hände waren noch zu klein, sie hatten nicht genug Kraft, das Euter ganz auszupressen. Die Finger verkrampften sich, versagten den Dienst. Wenn eine Kuh gemolken war, setzte sich der Bauer dran und fluchte, siehst denn nicht, dass die noch ganz voll ist? Er gab ihr einen Fußtritt, dass sie in den Kuhmist taumelte. Sie schwieg, verbiss sich die Tränen. Wenn sie den Mund aufmachte, gab es nur noch mehr Tritte. Einmal, als sie hemmungslos aufheulte und ins Haus zurücklief, zerrte er sie an den Zöpfen in den Stall zurück und prügelte sie mit der Wagendeichsel, bis sie sich nicht mehr rührte. Die Kühe schlugen mit den Hinterbeinen nach ihr, sie waren ihre Hände nicht gewohnt. Sitzt noch immer da, brüllte der Vater eine halbe Stunde später. Er stieß sie bei der Stalltür hinaus, Gras mähen, du faules Luder, aus dir wird nie eine Bäuerin.
Bettelleut, alle werdet’s einmal Bettelleut, sagte der Großvater, der eine meist unsichtbare Gegenwart im Auszugsstüberl war. Die Mutter trug ihm das Essen hinüber. Am Sonntag schritt er wie ein Patriarch zur Kommunion, und die Leute traten ehrfürchtig zurück. Er war noch immer groß, aufrecht und majestätisch, eine Hoheit von einem Bauern. Der reichste Bauer im Kreis, er schaute niemanden an, blieb bei niemandem stehen, die jungen Bauern näherten sich ihm mit dem Hut in der Hand. Er blickte kurz von seiner Höhe auf sie herab, pressiert net, sagte er und schritt davon. Sein Schwiegersohn hasste ihn und versuchte, ihn nachzuahmen. Mit der Tochter hatte er in vierzig Jahren kaum ein Wort gewechselt. Ich hab Euch das Essen auf den Tisch gestellt, Vater, sagte sie schüchtern, bevor sie, die Klinke fest in der Hand, unhörbar die Tür zuzog. Er drehte sich meist gar nicht um. Bei den Taufen war er dabei und bei den Hochzeiten, und seine schweigende, hochmütige Gegenwart war eine Ehre. Er hatte nie mit den Kindern gespielt, sie durften sich nur kurze Zeit in seiner niedrigen, verrauchten Stube sehen lassen, stehend, schüchtern, ehrerbietig. Alle werdet’s Bettelleut, er hasste ihre großäugige, devote Schüchternheit, nicht eins, das seinem Blick mit derselben Anmaßung und Selbstsicherheit begegnen konnte. Aber weil er eines Morgens aus der Tür getreten war, als der Bauer seine Tochter mit einem Fußtritt aus der Stalltür stieß, und mit seiner überlegenen Nasalstimme über den Hof gerufen hatte, das Leuteschinden macht auch keinen Bauern aus dir, du Erbschleicher, deshalb bewunderte sie ihn. Er war der Einzige, der sich traute, gegen den Bauern aufzutreten, und der ihn mit einem Blick zum Schweigen bringen konnte. Von da an schlug der Vater sie nicht mehr auf dem Hof, er lauerte ihr vor dem Heustadel in der Hofwiese auf, er prügelte sie in der Stube von einem Eck ins andere, aber das Viereck zwischen Saustall, Rinderstall und Hausstufen, auf das das Fenster des Auszugshäusls hinausging, wurde zu einem Unterschlupf für sie.
Nach vier Wochen kam die Mutter aus dem Spital zurück, bleich und abgemagert. Um die Brust trug sie noch einen Verband, den musste sie jede Woche vom Arzt wechseln lassen, am schönsten Wochentag die Arbeit liegen und stehen lassen und eine halbe Stunde zum nächsten Marktfleck gehen, wo der Doktor ordinierte. Extrawürschte, sagte der Bauer verächtlich, die ganze Arbeit muss man sich selber machen. Marie brauchte nur mehr sechs Kühe zu melken, aber die blieben ihr und das Aufstehen um vier Uhr in der Früh auch. Beim Grasmähen waren sie jetzt zu zweit, sie und die Mutter, aber wenn sie manchmal stehen blieb, die nackten Zehen im nassen Gras und das Gesicht der aufgehenden Sonne zugewandt, nörgelte die Mutter, vergaff dich nicht, pack zu, oder ich sag’s dem Vater.
Nach vier Wochen saß Marie wieder in der Schule, müde zum Umfallen, froh, endlich sitzen zu können und von niemandem angeschrien, von niemandem mit Schlägen bedroht zu werden, aber sie verstand nicht mehr, was an der Tafel vorn geschah, sie kam nicht mehr mit, und sie war zu müde, sich zu konzentrieren. Wenn sie gerufen wurde, stand sie auf, musste zur Strafe für ihre Unwissenheit stehen bleiben, mit hochrotem Kopf, während alles um sie herum immer unwirklicher wurde. Die Aufgaben musste sie heimlich machen, am Abend beim letzten Tageslicht auf einem Fensterbrett, nachdem sie ihre sechs Kühe gemolken und die Milchpitschen zur Abholstelle für das Molkereiauto geschleppt hatte. Der Vater durfte sie beim Aufgabenmachen nicht erwischen, sonst schlug er ihr das Heft um den Kopf. Zeitverschwendung, wer braucht eine studierte Bäuerin. Er rühmte sich, dass er in der zweiten Klasse sitzengeblieben war bis zur Schulentlassung. Er konnte gerade seinen Namen schreiben, aber beim Kuhhandel, beim Grundstücktausch und beim Kartenspielen legte ihn niemand herein.
Die Lieblosigkeit und die Demütigungen ihrer Kindheit verwandelten sich in Einsamkeit und abgrundtiefe Selbstverachtung ihrer Jugend. Sie wuchs schnell, und ihre starken Knochen ließen sie kräftig erscheinen. Bald brauchte sie keine neuen Kleider mehr, sie bekam die abgetragenen Jacken und Röcke der Mutter, die die Dorfschneiderin mit ein paar Nähten enger gemacht hatte. Die schwarzen Lackschuhe bekam die nächste in der Reihe der fünf Schwestern, und Fanni bekam neue. Als die Mutter ihrer hübschen ältesten Tochter neue Halbschuhe und ein blaues Taftkleid kaufte, schnitt Marie ihre schweren Schnürschuhe auf Knöchellänge ab. Sie saß auf dem Fensterbrett, einen abgeschnittenen Schuh am linken Fuß, den sie stolz über die Mauer baumeln ließ. Unter den bewundernden Augen der jüngeren Geschwister fuhrwerkte sie mit dem Brotmesser am zweiten Schuh herum. Da kam die Mutter herein, unbemerkt von der atemlosen Gruppe, sah Maries Bein, den Schuh mit dem unebenen, ausgezackten Rand und stieß einen Schrei aus, na wart’, wann das der Vater erfährt. Sie fand ihn auch bald, verpetzte ihre Tochter, als sei sie ihre rivalisierende Schwester, und rieb sich die Hände an der Schürze, als er Marie an den dicken roten Zöpfen vom Fenster herunterzerrte und mit Fäusten und Füßen so lange auf sie einschlug, bis ihr das Blut aus Nase und Mund rann. Dann ging er wieder zu seiner Arbeit. Wasch dir das Gesicht, wie du ausschaust, sagte die Mutter. Von da an war der Hass zwischen Mutter und Tochter unversöhnlich. Undankbares Luder nannte die Mutter sie, wenn Marie mit Verachtung in den Augen ihr mit jedem Handgriff ihre grenzenlose Abneigung zeigte, mit kleinen unscheinbaren Gesten, wenn Marie den Tisch deckte und den Teller der Mutter vergaß, wenn sie ihr die Tür vor der Nase zuknallte, wenn sie pfeifend an ihr vorbeiging und die Arme schlenkerte, während der Mutter das Saufutter über die randvollen Eimer auf die Füße schwabbte. Dankbarkeit wofür, fragte Marie herausfordernd. Für das, dass man euch auf die Welt gesetzt hat. Ich bin nicht gefragt worden, konterte Marie, hättest mich auch in den Abort scheißen können. Dann kamen die Tränen und das endlose Schluchzen und dazwischen stoßweise die Erzählung von der Lähmung und der Wallfahrt nach Altötting, und wie die Tochter ihr die geraden Glieder verdanke und mehr zu Dank verpflichtet sei als alle anderen Kinder, und Marie schlich hinaus und hasste sich dafür, dass sie die Mutter trotz allem hasste.
Als sich Marie eines Morgens mit entsetzten Augen und Blutflecken im Nachthemd vor sie hinstellte, weil etwas Furchtbares passiert sein musste, eine unverdiente, beschämende Heimsuchung, lachte die Mutter und wandte sich ab. Marie musste allein damit fertigwerden, sich alte Fetzen zwischen die Beine stopfen und auf den Knien die Heilige Jungfrau anflehen, sie möge dieses schreckliche Übel von ihr wenden. Erst Fanni, die mit allen Wassern gewaschen war und längst über das Kinderkriegen und das Kindermachen Bescheid wusste, klärte sie auf, und als Fanni ein halbes Jahr später die Regel bekam, gab es plötzlich auch Binden. Aber als Marie an einem heißen Augustabend, verstaubt von der Feldarbeit, sich am Brunnen neben der Haustür die Bluse vom Leib riss und sich das kalte Wasser über den Körper rinnen ließ, zerrte die Mutter sie schreiend ins Haus, ohrfeigte sie und nannte sie eine ausg’schamte, gottverdammte Hure. Scham war das einzige Gefühl, das die Dreizehnjährige über ihren Körper empfand, und je weiblicher dieser Körper wurde, desto mehr Scham empfand sie. Wenn Fanni sie in ihre Schmusereien im Hofgarten und ihre Entdeckungen hinter abendlichen Kornmandeln einweihen wollte, sagte sie, dass dich net schamst, und verzog das Gesicht vor Ekel. Mit dem sechsten Gebot hatte sie nie ein Problem beim Beichten.
Als Marie vierzehn war, schickte der Bauer den Großknecht weg. Marie konnte ihn ersetzen, sie hatte Kraft wie ein Mann, und sie wurde aus der Volksschule entlassen. Dem Tag der Schulentlassung sah sie wie einem Todesurteil entgegen. Klosterlehrerin hatte sie werden wollen, wollte sie noch immer werden. Mit diesem Traumziel vor Augen hatte sie heimlich ihre Schulaufgaben gemacht und sich Hefte ausgeborgt, damit ihr kein Unterrichtstag entging. Sie hatte lauter Einser im Schulentlassungszeugnis. Am Sonntag strich sie um die achtklassige Volksschule herum und kam sich ausgestoßen vor. Von jetzt an gab es keinen Ort mehr, wo sie beweisen konnte, dass sie auch etwas wert war, mehr sogar als die anderen Bauernkinder, fast so viel wie die Bürgerkinder, die immer Zeit zum Lernen hatten. Es gab nun kein Entkommen mehr nach dem Melken und dem Grasmähen, bis zum Abend, wenn sie todmüde ins Bett fiel. Melken, Gras mähen, Rahmsuppe mit Brotbröckeln zum Frühstück, Heu umkehren, ausmisten, Mist führen, Bauchfleisch mit Mehlknödeln und Rüben zu Mittag, Vieh füttern, Holz tragen, Heu auf Leiterwagen schupfen und in der stickig heißen Scheune abladen, melken, Milch abtreiben und Milchpitschen zum Dorfstand schleppen, Speck, Topfen und Brot mit Rahmsuppe zum Abendessen, das würde jetzt ihr Leben sein, Tag für Tag, bis ein Mann sie wegholte und auf einem anderen Hof unter der Fuchtel der Schwiegermutter dasselbe von vorne beginnen würde. Sie wollte aber gar nicht heiraten, ihr ekelte vor Männern, ihr ekelte vor dem, was die Erwachsenen heimlich auf Heuböden, zwischen Erdäpfelzeilen und in den Betten trieben, sie wollte gar nichts davon wissen, nie etwas damit zu tun haben. An Sonntagen, wenn Fanni in ihren besten Kleidern ausflog und erst nach Mitternacht lautlos ins Mädchenzimmer schlich und doch bemerkt wurde, weil sie ihre Betthälfte neben der jüngeren Schwester in Anspruch nahm und Heidi davon aufwachte, an solchen Sonntagen ging Marie schon nach dem Mittagessen ins Bett, starrte eine Zeitlang durchs Fensterkreuz in den Himmel, beobachtete die Tauben, die kurz auf dem Fenstersims landeten und schnäbelten, und fiel dann in einen schweren, traumlosen Schlaf, aus dem sie mit Übelkeit im Magen aufwachte, wenn der Himmel schon zu dunkeln begann. Der Brechreiz stieg ihr so schnell in den Mund, dass sie es oft nicht schaffte, quer über den Hof zum Abort zu laufen und sich dort in die Knie fallen zu lassen, weil sie zu schwach zum Stehen war. Nachher tanzten ihr bunte Kreise vor den Augen, aber wenn das Vieh zu brüllen und an den Ketten zu rasseln begann, saß sie schon unter einem Kuhbauch, und mit dem kreisenden Kopf an der warmen Flanke drückte sie mit kräftigen, mechanischen Handbewegungen die Euter leer.
Gemeinsamkeiten mit den Geschwistern hatte es für Marie nie gegeben. Als sie jünger war, hatte sie das jeweils Kleinste trockenlegen, füttern und herumtragen müssen. Schmutzige Windeln und der süßliche Geruch von Säuglingen erregten ihr Widerwillen und Wut. Wenn die Geschwister aus den Windeln waren und sich selbst das Essen holen konnten, nahm sie von ihnen keine Notiz mehr, auch nicht, wenn sie sich brüllend mit aufgeschundenen Knien und eingeschlagenen Zähnen an ihren Rock hängten. Geht’s zur Mutter, sagte sie. Die Buben, zwei und drei Jahre jünger als sie, hasste sie am meisten, denn die hatten schnell herausgefunden, dass sie die ältere Schwester quälen durften und dann noch des Beifalls der Mutter sicher sein konnten. Der Marie was zu Fleiß tun, die Marie sekieren, wurde bald zum ergiebigsten Vergnügen, und man brauchte sich nicht einmal vor der Strafe zu fürchten. Wenn Marie einmal einen ihrer Brüder verdrosch, bekam sie anschließend selbst Prügel, und die Buben schauten mit besonderer Genugtuung zu. Wie kam sie auch dazu, die kleineren, schwächeren Geschwister zu schlagen. Je älter sie wurden, um so ausgesuchter wurden die Quälereien. Eine Bande Zehn- bis Fünfzehnjähriger band die Dreizehnjährige an einen Baum und folterte vor ihren Augen langsam ihre Lieblingskatze Schorsch zu Tode. Schorsch riss sich los. Mit leeren, blutenden Augenhöhlen und abgehacktem Schwanz kam er zurück, als sie wieder losgebunden war und weinend in der nächtlichen Hofwiese saß. Sie traute sich mit der Katze nicht ins Haus, sie trug Schorsch in die Scheune und legte sich neben ihn, aber in der Früh war er tot. Damals verfluchte sie ihren Bruder Heini. Dass es dir einmal genauso geht, das wünsch ich dir, dass du im Dreck liegst und krepierst, und kein Mensch hilft dir. Neun Jahre später erinnerte sie sich an diesen Fluch, als sie die Todesnachricht von der russischen Front bekamen, dass er im Feldlazarett Worsk an der Ostfront an Ruhr und Typhus den Heldentod gestorben war.
Ihr Neid auf Fanni war nicht weniger wild als ihr Hass auf die Brüder. Fanni, die sie als gleichaltrig empfand und die von klein auf bevorzugt worden war, und nicht nur von den Eltern, auch vom Schicksal. Überall war sie beliebt. Sie saß in derselben Klasse wie Marie, sie lernte zu Hause keinen Strich, nahm sich nicht einmal die Mühe, die Aufgaben abzuschreiben, und war trotzdem der Liebling des Lehrers. Er nahm sie sogar auf dem Motorrad auf Ausflüge mit. Was sie niemandem erzählte, war, dass sie auf einem dieser Ausflüge mit dem Lehrer ihre Jungfernschaft verlor. Mit sechzehn wurde Fanni auf dem Kirtag zur Schönheitskönigin gewählt. Gibt’s das auch, sagten die Leute, dass die zwei Schwestern sind, wie Tag und Nacht, und Marie wurde so rot wie ihre Haare und rannte mit geballten Fäusten davon. Jeder Sonntag war für Fanni Anlass, ihre Schönheit auf dem Kirchplatz zu zeigen, für Marie war es ein Spießrutenlauf, und bald ging sie nur mehr in die Frühmesse, wo es noch dunkel war und kein Mensch sie sah, außer ein paar alten, halbblinden Weibern und ausgeschundenen Bäuerinnen, die das Kirchengehen als lästige Pflicht schnell hinter sich bringen wollten. Fanni, die schöne Schwester, die neue, figurbetonte Kleider bekam, die in der Früh Zeit zum Frisieren hatte und mit frisch gewelltem Haarschopf unter dem blütenweißen Kopftuch für ein oder zwei Stunden im Lauf des Vormittags aufs Feld hinauskam, um dem Vater oder dem Knecht schöne Augen zu machen, diese Schwester, für die sie dreißig Jahre lang die dunkle, hässliche Folie abgab, damit die andere noch heller strahlte, prägte Maries Selbstverständnis als Frau mehr als die Grausamkeit der Brüder und des Vaters. Die andere der höhnende Spiegel, tu, was du willst, du schaffst es nie, mich erreichst du nie. Und der Entschluss, dann zerstöre ich dich und alle Frauen und alles, was weiblich in mir ist.