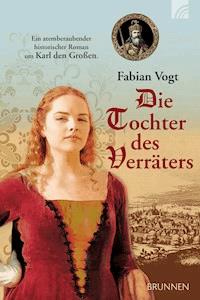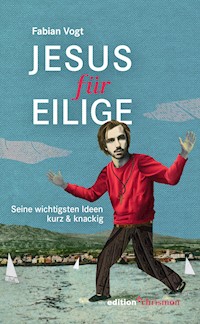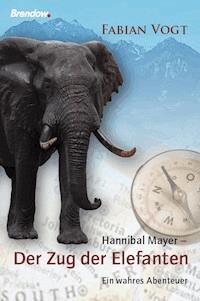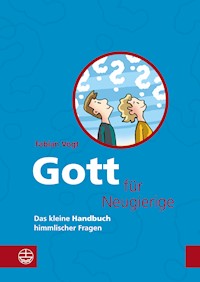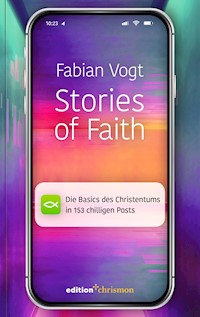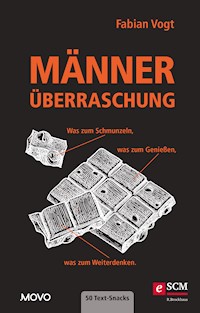Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition chrismon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Drei Leben hätte Isabella gerne, um sich alle ihre Träume erfüllen zu können – und um ja nichts zu verpassen. Dann kommt Jasper und erfüllt ihr diesen Wunsch. Einzige Bedingung: Nach sieben Jahren muss sie sich für eines ihrer Leben entscheiden – für das der abenteuerlustigen Weltenbummlerin, das der erfolgreichen Managerin oder dem glamourösen Leben einer Gitarristin in einer erfolgreichen Frauenrockband. Das "Wiedersehen" der drei Isabellas wird zu einer schillernden Abrechnung mit dem Dasein: Welches Leben ist am Kostbarsten? Und: Welches "gewinnt"? "Drei Leben" spürt phantasievoll und dabei höchst unterhaltsam der alten Menschheitsfrage nach: Was wäre geworden, wenn ich bestimmte Entscheidungen anders gefällt hätte? Ein Roman voller Überraschungen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fabian Vogt
DREI
LEBEN
Roman
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2020 by edition chrismon in der Evangelischen Verlagsanstalt GmbH · Leipzig Printed in Germany
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Das Buch wurde auf alterungsbeständigem Papier gedruckt.
Covergestaltung: Ellina Hartlaub, Frankfurt/Main Innengestaltung und Satz: Friederike Arndt, Leipzig
ISBN 978-3-96038-247-8
www.eva-leipzig.de
Wir alle haben zwei Leben. Das zweite beginnt, wenn wir realisieren, dass wir nur eines haben.
Tom Hiddleston
INHALT
Cover
Titel
Impressum
1Dreieinigkeit oder Freudensprünge
2Verlorenheit oder Zwei Wochen davor
3Hoffnungsschimmer oder Das Angebot
4Nachrichten oder Sieben Jahre später
5Wiedersehen oder Wer bist du?
6Freitag oder Wie es anfing
7Zwischenspiel I: Panik
8Samstag oder Wie es weiterging
9Zwischenspiel II: Chaos
10Sonntag oder Wo es hinführte
11Sonntagabend oder Die Entscheidung
12Nachklang oder Vier Wochen später
Danksagung
Über den Autor
KAPITEL 1
Dreieinigkeit oderFreudensprünge
Als Erstes haben wir uns umarmt. Völlig aufgedreht. Und es hat sich unglaublich gut angefühlt.
Natürlich haben wir uns umarmt. Minutenlang. Immer und immer wieder. Wie Schwestern. Wie Seelenverwandte. Wie Gleichgesinnte. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht, das tief bis ins Herz reichte.
Wir standen zu dritt auf dem Bürgersteig vor dem etwas heruntergekommenen Eiscafé »La Gondola« und haben uns gegenseitig so fest gedrückt, wie wir nur konnten. Überwältigt, hingerissen und vor allem völlig verblüfft. Als müssten, nein, als könnten wir uns aneinander festhalten.
Drei junge Frauen, die einfach nicht wahrhaben wollten oder konnten, was sie da gerade erleben … und dass sie gleich für lange Zeit auseinandergehen werden.
Wir haben uns umarmt, und als ich die anderen beiden irgendwann doch wieder losgelassen habe, hat mich die unfassbare Weite in ihren Blicken überrascht. Dieses grenzenlose Vertrauen in das Leben. Als wäre die Welt für sie in den letzten Minuten größer geworden. Das war ein wundervoller Anblick.
Vor allem aber wusste ich: Genau so sehe ich jetzt auch aus. Auch ich schaue gerade mit einer nie gekannten Zuversicht die viel befahrene Straße hinunter, weil meine Blicke an den ausgebleichten Vorstadt-Schaufenstern nicht mehr enden, weil sie sich von keiner noch so fordernden Realität mehr aufhalten lassen.
Ich erinnere mich, dass ich, ohne darüber nachzudenken, einen Freudenschrei ausgestoßen habe, einen lauten Jauchzer, obwohl ich in diesem Moment vor Aufregung die Zähne fest zusammengebissen habe.
Und die anderen beiden haben eingestimmt. Da standen wir zusammen auf dem Gehweg, und unsere Schreie hallten von den Glasfronten des Gebäudes zurück. Von den überdimensionalen, ausgebleichten Bildern von Spaghetti-Eis und Schoko-Eisbechern.
Am liebsten hätten wir sofort irgendwas gemacht – und weil wir nicht wussten, was, haben wir vor lauter Übermut mit unseren Fäusten auf imaginäre Pauken gehauen. Was für ein surreales Konzert!
Ein alter Mann mit einem grauen Filzhut, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit seinem ebenfalls ergrauten Dackel vorbeitrottete, drehte den Kopf zu uns herüber und verlangsamte seinen Schritt. Ich konnte es ihm nicht verdenken. Wir waren in diesem Moment ein äußerst skurriler Anblick. Drei ausgeflippte Frauen außer Rand und Band.
Wahrscheinlich dachte er sich: Sieh an, eineiige Drillinge … aber müssen die, wenn sie schon gleich aussehen, auch noch genau die gleichen Klamotten anziehen? Und warum kreischen die so hysterisch herum?
Ich deutete mit dem Kopf zu ihm rüber, die beiden anderen schauten ebenfalls in seine Richtung, und gemeinsam brachen wir in schallendes Gelächter aus. Woraufhin der arme Mann trotzig das Kinn hob und, seinen Hund stur hinter sich her schleifend, abzog.
Es war, als hätte sich in diesem Moment all die Schwere der vergangenen Wochen verflüchtigt. Auf und davon. Und die ungewohnte Leichtigkeit verband sich mit dem Erstaunen darüber, dass Jasper Wort gehalten hatte. Dass er sein Versprechen wahr gemacht hatte. Denn unweigerlich hatte ich bis zuletzt geglaubt, er wäre nur ein Spinner. Ein aufgeblasener Wichtigtuer.
Kein Wunder. Alles, was er mir erzählt hatte, hatte so bizarr geklungen. Und ich war lange überzeugt gewesen, er hätte sich diesen verrückten Vorschlag nur ausgedacht, um sich irgendwie interessant zu machen. Oder um mich möglichst schnell ins Bett zu bekommen. Eben eine neue Masche: Gib der Kleinen die Hoffnung, dass du ihre innigsten Träume erfüllen kannst, dann lässt sie bestimmt alles mit sich machen.
Und jetzt standen wir leibhaftig hier.
Zu dritt. Dreimal ich! Ja! Dreimal ich!
Es war, als schaute ich in einen doppelten Spiegel, an dem ich mich trotz aller Irritation auch nach den ersten Minuten nicht sattsehen konnte. Vor allem, weil ich nicht mehr so aussah wie am Morgen, als ich im Badezimmer vor dem Spiegel noch schnell einen Hauch Make-up aufgelegt hatte. Überhaupt nicht mehr. Nein, mein ganzer Körper hatte sich verändert. War sanfter geworden. Weicher. Freier. Das Getriebene, das Verkrampfte, das Haltlose in meinen Zügen war einer tiefen Entspannung gewichen.
»Geht mal ein paar Schritte«, sagte ich zu den beiden. Und als sie den Bürgersteig entlangliefen, da war das kein Schlurfen mehr wie gestern, nein, sie tanzten. Jeder Schritt ein winziger, aber kraftvoller Freudensprung. Weil die Füße sich vor lauter Lust am Laufen nicht festlegen wollten, wohin sie zuerst treten sollen.
»Jetzt du«, sagten die beiden anderen gleichzeitig, woraufhin sie wieder kichern mussten, und ich bewegte mich leichtfüßig vor ihren Augen auf dem Gehweg auf und ab, weil ich ja schon wusste, wie verlockend das aussah. So, als malten meine Beine meine Freude, die Freude der ganzen Welt auf die hellgrauen Waschbetonplatten am Boden.
»Jasper hat gesagt, wir müssen uns sofort trennen.« Erwähnte eine der beiden anderen mahnend.
Oder war ich es?
Egal. Noch waren wir wie eins. Doch als der Name »Jasper« laut ausgesprochen wurde, da durchzuckte mich der Gedanke, wie absurd das alles war. Dass wir hier zusammenstanden: dreimal der gleiche Mensch. Dreimal die gleiche Frau. Und diese Frau durfte jetzt drei Leben leben. Gleichzeitig!
›Drei Leben‹!
Als wären wir Synchronschwimmerinnen, schauten wir gemeinsam in den Himmel, an dem in diesem Augenblick ein sandfarbener Vogel mit spitzem Schnabel, vermutlich ein Kranich, vorbeizog.
Woraufhin eine von uns sagte: »Noch sehen wir den gleichen Himmel. Aber bald wird jede von uns einen anderen Himmel sehen. Ist das nicht unglaublich?«
»Ja«, erwiderte ich, »und das nicht nur, weil wir unterschiedliche Ausschnitte des Himmels wahrnehmen werden, sondern vor allem, weil wir den Himmel aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten werden. Mit anderen Augen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue!«
Atemlos starrten wir zusammen auf das gleiche Stück Blau über uns. Als sähen wir das alles zum ersten Mal.
»Wer von uns geht eigentlich wohin? Also: Wer übernimmt welchen Traum?«
Wir sahen einander an. Mit hochgezogenen Augenbrauen. Wegen dieser so naheliegenden Frage. Denn darüber hatten wir uns, hatte ich mir vorher überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich wollte unbedingt drei verschiedene Lebensmodelle ausprobieren, doch welche von uns nun welche Option wählen würde, hatte in all den Grübeleien keine Rolle gespielt. Wie auch? Bislang war ich ja nur eine gewesen.
»Also ich …«, sagten wir alle drei gleichzeitig und mussten den Satz nicht vollenden, weil jede von uns dieselben Worte im Kopf hatte: »Tja, ich kann mich für alles gleichermaßen begeistern.«
Selbstverständlich, dachte ich, denn wenn mir die Möglichkeiten nicht alle ähnlich verlockend erschienen wären, dann stünden wir jetzt nicht hier. Weil ich eben nicht hatte entscheiden wollen. Weil ich auf keinen der Wege hatte verzichten wollen.
Eine von uns deutete auf eine leicht schräge Linde, die neben uns aus dem Bürgersteig ragte, eingebettet in ein rundes Beet aus Kieselsteinen. »Kommt, wir suchen uns drei verschiedenfarbige Steine und losen.«
Alle drei wandten wir uns gleichzeitig der Einfassung des Baumes zu, doch dann bückte sich nur eine von uns und hielt gleich darauf drei flache Kiesel in der Hand: »Hier, ich denke, so geht’s, seht ihr, die Steine sind alle ungefähr gleich groß, ein schwarzer, ein weißer und einer, der ein bisschen rötlich schimmert. Ich schlage vor …«
»Weiß steht für das strahlende Licht der Scheinwerfer«, sagten wir mit einer Stimme. »Schwarz für ein elegantes Business-Kostüm. Und Rot für die schönsten Sonnenuntergänge der Welt. Drei Farben, drei Wege.«
Ich schluckte einmal und schaute die beiden dann schelmisch an: »Seid ihr bereit?«
»Ja!«
Ich nahm die drei Kiesel aus der ausgestreckten Hand, steckte sie in die hintere Hosentasche meiner Jeans und schob einer der beiden anderen freudestrahlend meinen Po entgegen. Dann sagte ich: »Du ziehst zuerst.«
Mein anderes Ich drehte den Kopf zur Seite, tastete mit zwei Fingern in meiner Tasche herum und zog schließlich einen Stein hervor. Den hielt sie hoch und strahlte dann: »Schwarz. Ich gehe also zurück an die Uni. Schön. Big Business, ich komme! New Economy, mach dich auf was gefasst.«
Mein zweites Gegenüber zog Rot und freute sich darüber genauso. »Wow, ich ziehe in die Ferne. Klasse! Ich verspreche euch: Ich werde die Abenteurerin in mir zum Strahlen bringen.«
Ich deutete eine Verbeugung an. Denn das hieß zugleich: Ich würde nach Hamburg ziehen. Und von dort hoffentlich zu den besten Locations. Zu den ganz großen Bühnen. Auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Großartig.
Schon als ich daran dachte, begannen meine Finger in der Luft zu zucken, als spielten sie ein filigranes Solo auf einer wunderschönen E-Gitarre … vermutlich einer schwarzen Fender Stratocaster mit einem satten Humbacker-Pickup als Tonabnehmer – und mit einem warmen Delay, das den Ton so kraftvoll zum Singen bringt.
Und plötzlich gab es nichts mehr zu sagen. Was auch? Alles andere wussten wir ja voneinander.
Dieser einzigartige Augenblick war vorüber. Das spürte jede von uns.
Wir nahmen uns noch einmal an der Hand – wie es die Teams bei Sportwettkämpfen machen, die sich vor dem Anpfiff einer Partie, in einer kritischen Phase oder bei der Eröffnung eines Turniers gegenseitig Mut zusprechen und einander anstacheln.
Dabei musterten wir uns sorgfältig, als könnten wir so die Gesichter der jeweils anderen beiden in unseren Köpfen einlagern, sie fixieren oder konservieren. Und wussten doch, dass das nicht gelingen würde.
Ein letzter, kraftvoller Händedruck. Dann gingen wir in drei verschiedene Himmelsrichtungen auseinander. Dabei hüpften unsere Schritte über die Straße. Leichtfüßig und verspielt. Fröhlich und befreit.
Nach wenigen Schritten hielten wir im selben Moment inne, drehten uns fast gleichzeitig, aber nur noch fast gleichzeitig, ein letztes Mal um und riefen: »Bis in sieben Jahren!«
Und wir antworteten wie aus einem Mund: »Ja, bis in sieben Jahren!«
Denn in diesem Augenblick dachte keine daran, dass zwei von uns in sieben Jahren würden sterben müssen.
KAPITEL 2
Verlorenheit oderZwei Wochen davor
Isabella schloss die Augen und legte den Kopf in den Nacken, während sie versuchte, ganz gleichmäßig zu atmen. Ein und aus. Aus und ein.
Es gelang ihr nicht wirklich.
Das Bild der Gedenktafel auf dem gepflegten Rasenstück vor ihr hatte sich so tief in ihren Blick eingebrannt, als projiziere jemand das Negativ von innen auf ihre Augenlider. Ein helles Rechteck mit zwei kurzen Bibelversen darauf:
»Gott spricht: Ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter bereitet habe.« Jeremia 1,5
»Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.« Jesaja 43,1
Die beschriftete Tontafel stand in der Mitte des liebevoll angelegten Kindergräberfelds auf einer Stele – umgeben von hellen Steinen, auf die die Eltern die Vornamen ihrer verlorenen Kinder geschrieben hatten: Mia, Elias, Bine, Thomas, Anka, Ben, Frederik, Xenia, Jan, Meike, Erwin und viele weitere. Viel zu viele.
Unter den Namen waren nicht zwei Daten zu sehen, wie auf all den anderen Grabsteinen des kleinen, an einem Hang gelegenen Friedhofs im Frankfurter Vorort Ginnheim, sondern jeweils nur eines: der Todestag des Kindes, das vor seiner Geburt im Bauch der Mutter gestorben war und dabei das ganze Leben mit sich gerissen hatte.
Jeder Name ein Tränenmeer. Jede Zahl ein nicht enden wollender Aufschrei.
»Ich hatte noch nicht einmal einen Namen für meine Tochter«, dachte Isabella, als sie die Augen nach einigen Minuten wieder öffnete. »Vielleicht bin ich deshalb nicht zur Trauerfeier gegangen. Von wem hätte ich mich denn verabschieden sollen? Von jemandem ohne Namen? Ich hätte gar nichts auf meinen Stein schreiben können. Nur eine Zahl. Nur eine beschissene Zahl.«
Für einen kurzen Augenblick fühlte sie sich verloren, weil sie es während der vielen Wochen der Schwangerschaft versäumt hatte, dem Embryo in ihrem Bauch einen Vornamen zu geben. Eine Identität. Ja, sie hatte, unerklärlicherweise, während ihr Umfang allmählich zunahm, noch nicht einmal angefangen, eine Liste potenzieller Mädchennamen anzufertigen. Wie achtlos!
»Ich würde zu gerne wissen, ob Gott deinen Namen wirklich kennt, meine Kleine? Oder sagen sie das nur so?«, fragte Isabella laut, weil auf dem Friedhofsgelände außer zwei gebückten Frauen mit Gießkanne ohnehin niemand zu sehen war.
»Ruft Gott dich jetzt liebevoll bei deinem Vornamen? Und wenn ja, wie heißt du? Vielleicht … Anne? Franziska? Berenike? Oder Jasmin? Ich wünschte so sehr, ich wüsste es.«
Die Ärztin im Krankenhaus war einfühlsam gewesen. Sie hatte Isabella erklärt, dass das Kind, das die Studentin in der einundzwanzigsten Schwangerschaftswoche verloren hatte, erst dreihundertvierzig Gramm gewogen habe und deshalb nicht der Bestattungspflicht unterlag.
Trotzdem würden die sogenannten »Sternenkinder«, die es nicht geschafft hatten, vom Klinikum in einer gemeinsamen Trauerfeier in einigen Wochen in der Nähe beigesetzt.
Gestern hatte diese Beerdigung stattgefunden. Nachmittags. Um fünfzehn Uhr. Doch Isabella hatte sich im letzten Moment entschieden, nicht daran teilzunehmen.
Sie hatte ihren grauen Mantel einfach wieder ausgezogen und sich zurück aufs Sofa gesetzt, um weiter an die Wand zu starren. Weil sie überzeugt gewesen war, dass die salbungsvollen Worte der Beteiligten ihren Schmerz ohnehin nicht hätten stillen können. Und weil sie Angst gehabt hatte, die grenzenlose Traurigkeit der anderen Eltern nicht auch noch ertragen zu können, diese Armee der Trostlosen.
Irgendwo hier vor ihr in der Erde, unter den langsam verwelkenden Blumen, lag die Asche ihres Kindes. Eines Kindes, das in der Welt noch nicht einmal einen Namen bekommen hatte.
Und mit den spärlichen Überresten des winzigen Körpers – sicherlich nicht viel mehr als einer Handvoll Staub – hatte der Bestatter zugleich ein ganzes Leben zu Grabe getragen. All die Möglichkeiten, die einem Menschen mit der Geburt geschenkt werden. Das grenzenlose Füllhorn des Seins hätte diesem winzigen Wesen zur Verfügung gestanden. Diesem wunderbaren Mädchen, das nicht hatte sein sollen, nicht hatte sein dürfen.
Dabei hätte es vermutlich so viel Wunderbares vor sich gehabt: Es hätte spielend die Welt entdeckt, sich die Knie regelmäßig blutig gestoßen, Erde gegessen, Rutschen erobert, seinen Kindergarten durchtobt, seine Schultüte in die Luft gereckt, seine Lehrerinnen geärgert und sich irgendwann unsterblich verliebt.
Es wäre groß geworden und neugierig, es hätte den Führerschein gemacht, die angesagten Clubs besucht, womöglich studiert, eine berufliche Karriere angefangen, selbst eine Familie gegründet, jahrelang ein verfallenes, altes Schulhaus im hinteren Vogelsberg restauriert und ihren Ort mit ihrem fröhlichen Engagement grundlegend verändert.
Oder es hätte die Welt mit einem Katamaran umsegelt. Ganz allein. Zwei Jahre lang. Warum nicht? Die sieben Weltmeere. Oder die Nordostpassage. Es hätte doch alle diese Optionen gehabt. Und noch viele, viele mehr. Unendlich viele mehr.
Jetzt erst kamen Isabella die Tränen, als sie an all das ungelebte Leben dachte, auf das sie gerade hinabschaute. Und mit einem Mal wusste sie nicht mehr, ob sie über den Verlust ihres Kindes, dieses noch so kleinen Embryos, weinte – oder über all die verlorenen Chancen, mit denen sie an diesem Kindergräberfeld konfrontiert wurde. Dieser sinnlosen Vergeudung des Daseins.
Was für ein Verlust für diese werdenden Geschöpfe! Und für deren Familien. Und natürlich auch für sie selbst. Denn Isabella hatte sich in den vergangenen Wochen in allen Einzelheiten ausgemalt, wie sie als junge Mutter ihren Alltag gestalten wollte – mit ihrem Baby. Mit diesem Wesen, das ihr im wahrsten Sinne des Wortes in den Schoß gefallen war.
Und nun würde alles ganz anders werden. Jetzt würde sie eben nicht als sechsundzwanzigjährige Frau ein eigenes Kind in den Armen halten.
»Brauchst du ein Taschentuch?«
Isabella hatte nicht bemerkt, dass jemand neben sie getreten war, und wich vor Schreck einen Schritt zurück; so abrupt, dass sie fast nach hinten gestolpert wäre.
»Entschuldigung, ich wollte dich nicht … äh … stören.«
Der Mann, der etwa in ihrem Alter war, hob die Hände in einer unbeholfenen Geste vor sein Gesicht. »Ich … ich habe nur gesehen, dass du weinst, und wollte dir ein Taschentuch anbieten … falls du eines brauchst.«
Er hielt das zerknautschte Paket mit den gefalteten Papiertüchern in ihre Richtung.
»Mmh, danke, das ist sehr freundlich.«
Isabella versuchte, ein Tuch mit einem Ruck herauszuziehen und hielt auf einmal die gesamte Packung in der Hand.
»Äh, das tut mir leid, Moment …«
Da lachte der Mann. Und sein Lachen kam an diesem Ort so unerwartet daher, dass die junge Frau ungewollt mitlachen musste. Zumindest ein wenig.
Sie nestelte ein Taschentuch heraus und gab ihrem Gegenüber die restlichen Exemplare zurück, die der Mann in der Tasche seiner grauen Lederjacke verschwinden ließ.
»Ich bin Jasper!«
»Isabella!«
Sie deutete auf die Stele. »Hast du auch ein Kind verloren?«
Er biss sich kurz auf die Lippen. »Nein! Gar nicht. Ich gehe nur gerne in der Mittagspause hier auf dem Friedhof spazieren. Das hilft mir, den Kopf frei zu bekommen. Es ist so ruhig, und man läuft wie … wie durch einen Garten aus lauter Geschichten. ›Garten der Geschichten‹, so nenne ich den Friedhof für mich. Weil jeder dieser Grabsteine, jeder dieser scheinbar belanglosen Namen, also dieser für mich belanglosen Namen, für die Erinnerung an einen Menschen steht. Für eine Lebensgeschichte. Manchmal setze ich mich auf die Bank da drüben, die neben der Linde, und stelle mir vor, wie der Mensch wohl war, dessen Name auf diesem oder jenem Grabstein steht. Was war das für ein Typ? War er glücklich oder traurig? Welchen Job hatte er? Was für ein Auto hat er gefahren? Hat er das Leben genossen? Hat er einen Menschen wirklich geliebt? Und wenn ja, wen? Und wenn ein Paar ein Gemeinschaftsgrab hat, dann überlege ich mir, was das wohl für eine Ehe war. War das eine leidenschaftliche Beziehung? Oder gab es da unterdrückte Wut? Aber sorry, ich texte dich hier zu. Das wollte ich nicht. Du bist gerade am Trauern.«
Isabella schaute den Mann zum ersten Mal bewusst an. Er hatte einen schmalen Kopf mit dichten rotbraunen Haaren und wenig Bartwuchs – und irgendetwas an seinem Gesicht irritierte sie. Vermutlich, dass sein linkes Auge einen Hauch tiefer lag als sein rechtes. Das machte ihn keineswegs unattraktiv, im Gegenteil, aber es verlockte, den eigenen Kopf ein wenig schräg zu legen, um mit diesem Blick wieder auf eine Ebene zu kommen.
»Nein, ist schon gut. Ich grübele ohnehin genug alleine vor mich hin. Ach … Scheiße.«
Wieder schossen Isabella die Tränen in die Augen.
Als Jasper seine Hand auf ihren Arm legte, um sie zu trösten, versteifte sie erst, ließ es dann aber zu.
»Was ist denn mit dem Vater deines Kindes?«
Isabella drückte die Schultern nach vorne und biss sich auf die Lippen. »Kein gutes Thema. Überhaupt nicht. Um ehrlich zu sein, es war …«
Sie atmete tief ein. Dann sagte sie mit einem Seufzer: »Es war bloß ein One-Night-Stand. Mehr nicht. Nach dem Polterabend einer Kommilitonin. Gute Musik. Gutes Buffet. Spaß beim Tanzen. Ich war angeheitert und er auch. Genauer gesagt: Ich war einsam, und er war auch einsam. Wie das halt so ist. Doch als der Typ dann am Morgen schnorchelnd in meinem Bett lag und mich angrinste, wollte ich ihn nur noch so schnell wie möglich loswerden. Und dabei ist es geblieben. Zum Glück.«
Jasper räusperte sich und zog seine Hand wieder zurück. »Heißt das, der Vater weiß gar nichts von seinem Kind?«
Isabelle schwieg einen Moment. Dann murmelte sie: »Nein. Ich habe natürlich überlegt, ob ich es ihm sage, wenn meine Tochter geboren ist – aber das hat sich ja jetzt erledigt. Aus und vorbei. Ich finde: Er kann froh sein, dass er diesen verfluchten Schmerz nicht ertragen muss.
Mein Gott, warum erzähle ich dir das alles überhaupt?«
Der junge Mann ignorierte ihre Frage und sagte: »Aber was ist, wenn er diesen Schmerz gerne ertragen hätte? So, wie du ihn ertragen musst?«
»Das ist Schwachsinn! Niemand leidet gerne.«
Jasper nickte. »Stimmt. Aber vielleicht hätte er sich auch auf das Kind gefreut. Und jetzt fehlen ihm beide Erfahrungen. Die Freude und die Trauer. Etwas Wesentliches, das zu ihm und zu seinem Leben gehört, ist für ihn verloren. Dadurch wird er ein anderer Mensch werden, als der, der er hätte sein können. Das ist doch bedauerlich, oder?«
Mit gehauchter Stimme fügte er hinzu: »Ich persönlich finde, man sollte einem Menschen niemals eine Erfahrung rauben, die er hätte machen können.«
Isabella schluckte. »Na toll, ich habe ohnehin ständig ein schlechtes Gewissen wegen all dem hier. Willst du mir jetzt auch noch eine reinwürgen? Willst du das? Wenn ja, dann kann ich nur sagen: Prima, das ist dir gelungen. Sehr gut sogar! Gratulation!«
Sie kniff die Augen zusammen und fixierte ihr Gegenüber. »Sag mal, was soll das hier überhaupt werden? Nutzt du etwa die Hilflosigkeit von trauernden Frauen aus, um dich an sie ranzumachen oder was?«
Jasper schüttelte den Kopf. Er sah verletzt aus. »Nein, das mache ich nicht. Glaub mir! Das war überhaupt nicht meine Absicht. Wirklich nicht. Aber ich mache mir viele Gedanken darüber, was man tun kann, damit ein Mensch in die Lage versetzt wird, sein Leben am besten zu entfalten. Gerade, wenn er sich für oder gegen etwas entscheiden muss. Wenn er den richtigen Weg finden will. Und als ich dich hier so stehen sah, weinend, da dachte ich, dass du vielleicht … also: dass du meine Hilfe brauchst. Ich könnte dir da etwas anbieten …«
Isabella starrte ihn ungläubig an. »Augenblick mal! Du willst mir … du willst mir was verkaufen? Ich fasse es nicht! Wie pervers ist das denn? Du sprichst wildfremde Leute auf dem Friedhof an, an dieser Stele, um ihnen irgendeinen Scheiß anzudrehen …«
Jasper hob beide Hände, als würde er mit einer Pistole bedroht. »Nein! Ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich will kein Geld von dir. Oder sonst irgendetwas. Wie gesagt: Ich helfe Menschen, die partout nicht wissen, wie sie sich in ihrem Leben entscheiden sollen …«
»Toll, und worin besteht deine ach so tolle Dienstleistung?« Isabella blitzte ihn an.
»Das ist eine längere Geschichte. Aber du hast Recht. Ich hätte dich nicht ansprechen dürfen. Nicht hier am Kindergräberfeld. Das tut mir leid. Wirklich!«
Die junge Frau drehte sich abrupt von ihm weg. »Das sollte es auch. Hör zu: Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du mich einfach in Ruhe lassen könntest. Kapiert?«
Jasper senkte den Kopf. »Selbstverständlich.«
Er griff in die Brusttasche seiner Jacke und holte eine Visitenkarte hervor. »Hier! Falls du vielleicht doch mal meine Unterstützung brauchst. Wie gesagt: ohne Verpflichtungen. Wenn ich helfen kann, dann unterstütze ich dich gerne. Wenn du zum Beispiel nicht weißt, wie es weitergehen soll, dann hätte ich eventuell einen unkonventionellen Lösungsansatz … Also, das wird jetzt hier … wohl nichts. Mein … äh … mein herzliches Beileid. Und noch mal: Entschuldige, wenn ich mich unangemessen verhalten habe. Das war nicht meine Absicht.«
Ehe Isabella darüber nachdenken konnte, hatte sie die Visitenkarte reflexartig entgegengenommen und schaute Jasper hinterher, der mit schnellen Schritten auf dem Weg zwischen den Grabreihen davoneilte und um eine Hecke bog, so dass er ihren Blicken schon nach kurzer Zeit entzogen war.
Sie schaute nach unten und las: »JASPER. Drei Leben.« Darunter nur eine Frankfurter Telefonnummer. Mehr stand nicht auf der Karte.
Kurz überlegte sie, ob sie die unscheinbare Pappe einfach in den Mülleimer zu den entsorgten Blumenkränzen werfen sollte, steckte die Visitenkarte dann aber doch in ihre Hosentasche und ging langsam in Richtung Ausgang.
Als Isabella ihre Wohnung betrat, fiel ihr als Erstes auf, wie stickig es in den Räumen war. Als hätte sich die gesamte Trauer der vergangenen Tage in den Gardinen verfangen und wie Staub auf den Möbeln niedergelassen.
Ohne nachzudenken riss sie die beiden Fenster zum Garten hin auf und genoss die frische Luft, die hereinströmte – obwohl sie ja bis vor wenigen Minuten noch draußen gewesen war.
Sie wollte eben ihren Mantel an die Garderobe im Flur hängen, als das Blinken des Anrufbeantworters auf dem Sideboard mit der Marmorplatte sie innehalten ließ.
Hoffentlich nicht noch eine Kommilitonin, die ihr Beileid ausdrücken wollte und die nicht verstand, dass Isabella zurzeit überhaupt kein Interesse hatte, über ihren Verlust zu reden, weil sie mit allen Mitteln versuchte, endlich einmal wieder an etwas anderes zu denken als an ihre tote Tochter.
Wiederwillig drückte sie den Wiedergabeknopf und lauschte einer aufgeregten Männerstimme, die eine ausführliche Mitteilung hinterlassen hatte.
»Hey, hier ist Tom. Vielleicht erinnerst du dich? Der mit dem Sonnen-Tattoo am Hals. Wir haben uns im Mai backstage bei diesem Independent-Festival in Gießen unterhalten, wo du mit deiner Band gespielt hast. Weißt du bestimmt noch! Ich fand vor allem euren Song ›Monkey Girl‹ so geil. Dein Gitarrenriff aufm zwölften Bund. Mit den Flageoletttönen. Echt stark! Wir haben damals ziemlich gemeine Witze über den Gesang des Sängers gemacht, der nach euch drankam. Boah, das klang ja auch grottig. Und immer zu tief, so tief, so dass auch kein Auto-Tune mehr hilft.
Ich hoffe, du weißt jetzt wieder, wer ich bin. War übrigens gar nicht so leicht, dich zu erreichen. Hast du eine neue Handynummer? Bei deiner alten bin ich jedenfalls nie durchgekommen.«
Kein Wunder, dachte Isabella, ich habe das Teil auch seit Ewigkeiten nicht angeschaltet, weil ich mit keinem Menschen mehr was zu tun haben wollte.
»Egal, jetzt hab’ ich dich ja endlich erreicht. Die Sache ist die: Mir hat die Art, wie du Gitarre spielst, supergut gefallen. Technisch sauber und gleichzeitig rotzfrech. Das groovt und zieht mit. Und ich glaube, dass du mehr drauf hast, als ein bisschen regionalen Rock ’n’ Roll auf Dorffesten. Und jetzt pass auf: Ich bin gerade dabei, hier oben im Norden unserer schönen Republik eine Mädels-Rockband zusammenzustellen. Irgendwas zwischen Scorpions, Bon Jovi und Guns N’ Roses, mit einem Hauch Metallica. Aber halt nur Frauen. Quasi Gianna Nannini aus Deutschland. Könnte ’ne große Sache werden, weil ich eine ziemlich etablierte Agentur an der Hand habe, die sich für die Idee interessiert und uns höchstwahrscheinlich unterstützen will. Selbst Udo Lindenberg hat angedeutet, dass er was für das Projekt tun will.
Und ich fände es perfekt, wenn du mit dabei wärst! Gerade, weil du offensichtlich nicht nur auf rockige Licks, sondern auch auf Satzgesang stehst …« In diesem Moment hatte der Anrufbeantworter die Aufnahme beendet. Vermutlich wegen der Länge. Doch es piepste gleich wieder.
»Hey, ich bin’s noch mal. Ich habe keine Ahnung, ob dich so ein Projekt aktuell überhaupt interessiert, aber ich würde mich auf jeden Fall tierisch über einen schnellen Rückruf freuen. Bevor ich’s vergesse: Vielleicht kennst du ja Lina, die früher bei den ›Hot Goblins‹ gesungen hat, oder Jacky, die funky Bassistin von ›Backslash‹ … die sind auch mit dabei. Und eine Wahnsinns-Drummerin, die frisch die Popakademie in Mannheim abgeschlossen hat. Echt der Hammer! Solche fetten Beats hast du lang nicht mehr gehört.«
Er machte eine Pause, dann fuhr er fort: »Ach ja: Ich rede hier natürlich nicht von Hobby-Mucke oder ein paar Gigs in muffigen Clubs. Wir wollen das Ganze professionell aufziehen. Mit eigenem Album und möglichst bald einer ersten Tour durch Deutschland. Lina hat schon einige Titel im Studio vorproduziert – aber du kannst auch eigene Songs einbringen, wenn du Lust hast. ›Monkey Girl‹ ist doch von dir, oder?
Wie dem auch sei: Wir, also die Agentur und ich, sind davon überzeugt, dass ihr als Musikerinnen gut zusammenpasst – und dass daraus mit ein bisschen Fleiß und Glück was Fettes werden kann. Du müsstest dafür allerdings hier nach Hamburg ziehen … sollte aber kein Problem sein, bei Lina in der WG ist ein Zimmer frei. Ich finde: Wäre ’ne Riesenchance für dich. Wie sieht’s aus? Bist du dabei?«
Dann nuschelte Tom noch eine Mobilfunknummer auf das Band, bevor er mit einem albernen »Let’s Rock!« auflegte.
Isabella wankte in die Küche und ließ sich auf einen Stuhl fallen. »Scheiße. Scheiße. Scheiße!«
Sie klammerte sich an der Tischkante fest, als könnte die graue Resopalplatte mit den Brandspuren ehemaliger Vorbesitzer sie vor dem Umkippen bewahren.
Ganz langsam. Erst mal konzentrieren.
Wenn sie den Typen richtig verstanden hatte, dann hatte der ihr soeben einen Job als Gitarristin in einer neuen Frauen-Band angeboten. Und das nach all den endlosen Diskussionen mit ihren Eltern, die sie über Jahre bedrängt hatten, doch bitte etwas Anständiges zu lernen und das ständige Gitarrespielen sein zu lassen.
Sie konnte immer noch die wehleidige Stimme ihrer Mutter hören: »Komm, Isabella, studier BWL oder VWL. Zahlen liegen dir doch. Du mit vierzehn Punkten im Mathe-Leistungskurs. Außerdem kannst du strategisch denken. Das hattest du schon drauf, als du noch ganz klein warst. Mal im Ernst: Musikerin, das ist ein nettes Hobby, aber doch kein Beruf. Du wirst dein Leben lang in irgendwelchen Musikgruppen spielen können, so viel du willst, das mag dir ja auch keiner nehmen, nur sorge erst mal dafür, dass du ein berufliches Fundament bekommst.«
Und Isabella hatte sich beschwatzen lassen. Hatte mit BWL angefangen. Hatte an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt nicht nur den Bachelor gemacht, sondern stand nun kurz vor dem Abschluss ihres Masters.
Manfred Berner, der Professor, der ihre Masterarbeit betreute – »Abu l’Fadl Gafar und sein ›Buch über die Schönheiten des Handels‹: Die Geburtsstunde der Marktwirtschaft« – hatte schon mehrfach angedeutet, dass er fest davon ausgehe, dass sie bei ihm anschließend auch promovieren würde.
Mehr noch: Er war von ihren Forschungsleistungen so angetan, dass er ihr eine Assistentenstelle in Aussicht gestellt hatte; den perfekten Einstieg in eine Laufbahn am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der »Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule« in Aachen. Dorthin würde Berner nämlich im nächsten Semester auf einen höher dotierten Lehrstuhl wechseln. Und er wollte Isabella unter allen Umständen in sein neues Team integrieren.
Bis vor Kurzem war sie auch davon ausgegangen, dass sie diesen Weg weitergehen und die akademische Erfolgsleiter Schritt für Schritt hochklettern würde.
Schon, um ihre Eltern zu ehren, die vor zwei Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren: Ein besoffener LKW-Fahrer hatte die beiden von der Straße abgedrängt. Am helllichten Tag. Ihr Vater hatte noch versucht, das Steuer herumzureißen, und war genau deshalb über die Böschung gegen einen Kastanienbaum gerast.
Ihre Eltern waren sofort tot gewesen, während der LKW-Fahrer und sein Brummi nicht einen Kratzer abbekommen hatten. Vor Gericht konnte der Mann sich nicht einmal an den Vorfall erinnern. Kein Wunder, bei mehr als 2,4 Promille im Blut. Jetzt saß er in einer Justizvollzugsanstalt, was ihr ihre Eltern auch nicht zurückgebracht hatte.
Die junge Frau hatte nach dieser Tragödie lange mit ihrem Professor gesprochen, zwei Urlaubssemester genommen, um sich erst einmal wieder selbst zu finden – und anschließend entschieden, dass sie gerade für ihre Eltern das BWL-Studium erfolgreich zu Ende bringen wollte. Das war sie ihnen schuldig.
Zumindest war sie damals davon überzeugt gewesen.
Doch inzwischen hatte sie ein Kind verloren – und diese erneute Tragödie hatte alle Selbstverständlichkeiten vom Tisch gewischt.
BWL? Was für ein Unsinn!
Wollte sie wirklich den Rest ihres Lebens über faden Unternehmenskonzepten brüten, die Feinheiten des »Agilen Projektmanagements« ergründen und »Scrum Frameworks« entwickeln – während sie bei jedem Rockkonzert, das sie besuchen würde, mit blutendem Herz im Publikum stehen und sich verzweifelt auf die Bühne wünschen würde?
Sicher nicht!
Durch die Traurigkeit der vergangenen Wochen hatte Isabella ihre Prüfungsvorbereitungen ohnehin vernachlässigt, und der Gedanke »Warum schmeiße ich nicht einfach mein Studium und mache etwas ganz anderes?« tauchte in letzter Zeit überraschend oft in ihrem Kopf auf. Wie ein Springteufelchen: »Lass den ganzen Mist hinter dir. Mach einen Schlussstrich und fang noch mal von vorne an.«
Natürlich wusste Isabella, dass sie gerade nicht in der Verfassung war, um derart weitreichende Entscheidungen zu fällen. Außerdem hatte sie schon viel zu viel Zeit in ihren komplexen Studiengang investiert.