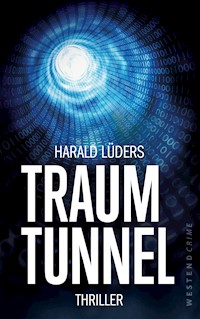11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Realität im Thriller-Format: Dunkeldeutschland von seiner finstersten Seite. Dem Fernseh-Journalisten Mitch Berger wird anonym eine DVD zugespielt, die Bilder aus dem Wohnmobil der beiden NSU-Mörder zeigt: schwer bewaffnet und kurz vor dem Eintreffen der Polizei. Wer überwacht die Killer? Und warum bekommt ausgerechnet Mitch diese brisante DVD? Zur selben Zeit plant eine konspirative Gruppe um den hochrangigen Verfassungsschützer Werner Dickmann, einen Bombenanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft. Denn im zweiten Jahr des ungebremsten Flüchtlingszuzugs organisiert sich der Widerstand gegen die Politik der Kanzlerin. Und zwar in den Tiefen des Staatsapparates. Lüders intelligent inszenierter Thriller zur Flüchtlingskrise und den NSU-Morden ist eine Reality-Fiktion - durch die geschilderten Fahndungspannen und radikalrechten Verstrickungen von Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz sind bittere Wirklichkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 452
Ähnliche
Ebook Edition
Harald Lüders
Dunkelmacht
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-86489-657-6
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2016
Umschlaggestaltung: Buchgut Berlin
Satz und Datenkonvertierung: Publikations Atelier, Dreieich
Inhalt
Für Christine
Nur zögernd besiegt das Tageslicht die Schwärze der Nacht.
Ein Läufer hetzt in einem Höllentempo durch die New Yorker East Side.
Vorbei an Nachtschwärmern, die aus den Bars der 2nd Avenue fallen, vorbei an Paaren, die sich auf dem späten Nachhauseweg schon mal anheizen, für das, was da kommt, vorbei an Junkies und Alkoholleichen.
Er stoppt vor einem alten Gebäude in der 1st Street, betritt eine fast leere Wohnung.
Mehrere Hantelbänke, zwei Computermonitore, ein Tisch, ein Sofa, ein Flachbildschirm.
Der Raum atmet mönchische Kargheit und Konzentration.
Der Läufer reißt sich sein Kapuzenshirt vom verschwitzten Leib, trinkt gierig einen halben Liter Wasser. In einer Ecke des Zimmers sind mehrere silberne Kisten übereinander gestapelt. Der Läufer trinkt erneut, öffnet dann eine rechteckige, etwa zwanzig Zentimeter hohe und gut einen Meter fünfzig lange, silbrig glänzende Box. Auf dunklem Wildleder liegt mattschwarz schimmernd eine tödliche Schönheit der Firma Barrett Firearms, die legendäre M82, ein Präzisionsgewehr für Scharfschützen.
Der Mann lächelt, achtet darauf, dass kein Schweiß auf den Lauf tropft.
In seinem letzten Leben war er bei der CIA, jetzt arbeitet er auf eigene Rechnung.
Er fährt den Computer hoch, checkt seine Mails.
Ein erstaunter Pfiff. »Wow, eine Anfrage aus good old Germany, das hatte ich noch nie.« Die Mail mit dem Jobangebot aus Deutschland kommt von einem Exkollegen aus Langley.
Der Preis scheint zu stimmen. Er tippt: »Sag Deutschland, ich bin interessiert« – und schickt die Mail ab.
1
Punkt 7:30 flackert das Display des Radioweckers kurz hell auf, dann dröhnt die sonore Stimme eines Nachrichtensprechers durch das abgedunkelte Schlafzimmer und verkündet, dass in Sachsen bei einem Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim 4 Personen zum Teil schwer verletzt wurden.
Mitch drischt nach dem Wecker, verpasst ihn, fegt stattdessen ein Weinglas vom Nachttisch. Gerade als der Sprecher mit seiner unerträglich gut gelaunten Stimme verkündet, dass eine Mehrheit der Deutschen kein Vertrauen mehr in die Kanzlerin habe, trifft ein Handkantenschlag den Wecker.
Mitch kickt die Bettdecke zur Seite, bemerkt, dass er Jeans und ein völlig zerknittertes Hemd trägt.
Ein schlechtes Zeichen. Immerhin, keine Schuhe und keine Krawatte. Er schlürft einen Espresso aus seiner nagelneuen DeLonghi Maschine, ohne große Wirkung. Zwei Ibuprofen 600 helfen wenigstens gegen den Schmerz im Hinterkopf. Unter der eiskalten Dusche vergeht der Kater, dafür kommen erste Erinnerungen an den gestrigen Abend. Keine guten.
Dann bemerkt er die leere Flasche Wein auf dem Küchentisch. Er hatte es also nach Hause geschafft, nur um hier noch mal nachzulegen.
Er trinkt zu viel und er weiß das.
Heute dauert die Suche nach dem Wagen besonders lang.
Äußerlich ist das Auto okay, drinnen riecht es wie in einer Kneipe.
Er quält sich in die Redaktion. Um 12 Uhr folgt ein heftiger Anpfiff auf der großen Themenkonferenz. Er wird vorgeführt vom großen Boss. Geschlachtet, ohne größere Gegenwehr. Dass der Chefredakteur jünger und einige Kilo leichter ist, macht die Sache nicht besser.
Nur der Blick aus dem Fenster versöhnt, hier aus dem 20. Stock scheint die Frankfurter Skyline ihm ganz alleine zu gehören. Mitch spürt eine diffuse Wehmut in sich aufsteigen. Seit Lilly ihn verlassen hat, sind diese Stimmungen heftiger geworden. Aber den Grauschleier in seinem Leben gab es schon, als sie noch da war. Vielleicht waren es ja gerade diese Gefühlsschwankungen, die sie vertrieben haben. Jedenfalls ist Lilly nach München durchgestartet.
Mitch ist schon viel zu lange kreuzunglücklich in seinem Job. Er liebt seine Arbeit als Reporter, aber es ist nervig, immer mehr seichte, künstlich aufgepeppte Geschichten abliefern zu müssen. Sein Preis für die zunehmende Quotengeilheit der Fernseh-Chefs.
Er stürzt den dritten Espresso runter und bemerkt plötzlich vor sich auf dem Schreibtisch einen Umschlag. Grobes braunes Papier, sehr ordentlich mit Tesafilm verschlossen. Auf dem Adressensticker sein Name:
Herr Matthias Berger
Redaktion Star TV
60334 Frankfurt.
Niemand nennt ihn Matthias, alle Welt sagt Mitch zu ihm. Er hasst den Namen Matthias, verflucht auch mit Anfang fünfzig noch seine Eltern für die Schnapsidee. Persönlich/Vertraulich steht da. Drinnen etwas Flaches, Quadratisches. Er reißt den Umschlag auf und hält eine DVD ohne Beschriftung in den Händen. Er startet den Laptop, ein verrauschtes Bild, ganz unten am Bildrand läuft eine eingeblendete Zeitangabe, der Time Code. Kein Ton. »Matthias«, murmelt Mitch, dann erstarrt er vor dem Bildschirm.
Zwei Typen in einem Camper, die ihm bekannt vorkommen. Einer fummelt an seiner Knarre, der andere spricht hektisch in ein Telefon. Beide kurze Haare, Ende zwanzig.
Der Typ mit dem Telefon flucht, leider immer noch ohne Ton und tippt eine neue Nummer in sein Handy. Auf dem Tisch des Wohnmobils ist jetzt eine fette Pumpgun zu erkennen. Der andere dreht sich zum rückwärtigen Fenster, die Knarre schussbereit. Das Bild bricht ab, der Time Code unten aber läuft weiter.
»Fuck«, flüstert Mitch, er flucht immer auf Englisch, das ist er seinem Spitznamen schuldig. »Fuck, ich kenne die Typen«, er geht bei Google auf Bildersuche, gibt NSU ein. Treffer – die NSU Killer zweifellos, auf den Fotos sehen sie jünger aus, irgendwie ordentlicher als auf dem Band. Böhnhardt und Mundlos, die zehnfachen Mörder des Nationalsozialistischen Untergrunds.
Der Time Code der DVD läuft immer noch, erst jetzt bemerkt Mitch, dass die Zeitangabe auf Real Time gestellt ist, also die Uhrzeit zum Zeitpunkt der Aufnahme anzeigt. 11 Uhr 46 und 23 Sekunden liest er, 11:46:24. Bei 11:47:05 bricht der eingeblendete Time Code ab.
Er fährt die DVD zurück, Bildanfang bei 11:45:03, bei 11:45:54 bricht das Bild ab, der Time Code aber läuft noch über eine Minute weiter.
Star TV ist eine ziemlich große Fernsehproduktionsfirma, die im Auftrag privater und öffentlich-rechtlicher Sender arbeitet. Mitch greift zum Telefon, ruft in einem der Schneideräume an. »Timo, sorry, komm mal kurz rüber, ist dringend, ich brauche Hilfe.«
Timo ist ein junger Cutter, etwas wirr, aber blitzschnell und technisch der Beste weit und breit. »Mitch, hey, was ist los, du siehst fürchterlich aus. Hab schon gehört, dass der Chef dich rund gemacht hat, aber das kann dich doch nicht so aus der Kurve tragen.«
»Timo, bitte lass mich in Ruhe mit dem Chef. Schau dir die Bilder hier an, ist das ein Fake, will mich jemand verarschen, ist das hier echtes Material oder was?«
Timo starrt auf die schlierigen schwarz-weißen Bilder, sieht sich die Aufnahmen mehrmals an. »Nagel mich nicht fest, müsste man in der Messtechnik überprüfen, aber aus dem Bauch sage ich dir, das sind keine am Computer bearbeiteten Bilder, das ist echtes Material, das sind Aufnahmen einer kleinen, aber sehr feinen, winzigen versteckten Gopro-Kamera, die ihre Aufnahmen drahtlos gesendet hat. Eine kleine Optik, aber verdammt leistungsstark und nicht ganz billig.«
Das muss Mitch erst mal verdauen.
»Warum läuft der Scheiß Time-Code länger als das Bild, habe ich selten so gehabt?«
»Mitch, keine Ahnung, entweder ist da einer eingepennt, als er das auf die DVD gepackt hat, oder…«
»Oder?«
»Oder, da will dir jemand sagen, dass die Aufnahme weitergeht.« Timo grinst, als er bemerkt, dass er Mitch mit dieser Bemerkung voll in den Bauch getroffen hat. »Ich muss los, sorry, wir schneiden nebenan ein Flüchtlingsstück für heute Abend, bin echt in Eile.« An der Tür hält er plötzlich inne. »Sag mal, sind das nicht die beiden durchgeknallten Nazikiller, die sich in einem Camper gegenseitig umgelegt haben. Ist ja der Hammer, woher hast du die Bilder?«
»Timo, bitte, kein Ton zu niemandem, du hast hier gar nichts gesehen. Ich sitze da an einer Story, brauche noch Zeit und kein Gerede, schulde dir was, gut?« Timo grinst, streckt den Daumen hoch, zieht die Tür hinter sich zu.
Mitch ist bedient, beginnt aber langsam wie ein Profi zu reagieren.
Am 4.11.2011 waren die beiden Nazis nach einem Banküberfall mit Fahrädern zu einem Wohnmobil geflüchtet und hatten, als sich die Polizei dem Camper näherte, Selbstmord begangen.
So die amtliche Fassung.
Er gibt das Datum in die große Datenbank ein, in der alle Agenturmeldungen gespeichert werden.
Am 4.11. meldete dpa um 12:08 eine Schießerei nach einem Banküberfall in Eisenach. Deutlich später auf einer Pressekonferenz der Polizei wird erklärt, um 12:05 erfolgte der Zugriff auf ein brennendes Wohnmobil, in dem zwei männliche Leichen gefunden wurden.
»Wahnsinn«, stöhnt Mitch, »die Aufnahmen sind 20 Minuten vor dem Zugriff der Polizei entstanden.«
Er gießt sich einen Fingerbreit Laphroig ein, Single Malt, Cask Strength.
Bilder aus dem Inneren des Campers, zwanzig Minuten vor dem Zugriff der Polizei, so etwas kann es nicht geben. Unmöglich. So etwas darf es nicht geben.
Aber es gibt sie, ganz augenscheinlich. Sie laufen auf seinem Computer.
Was hatte Timo gesagt: Bilder einer Gopro-Kamera, die drahtlos übertragen kann. Also eine kleine Kamera im Wohnmobil versteckt, die ihre Bilder drahtlos an einen Empfänger in einem Umkreis bis zu einem Kilometer sendet. Und solche Kameras laufen immer mit einem Echtzeit-Time-Code. Wie Überwachungskameras in einer Tankstelle.
Mitch merkt, dass ihm kalt wird, trotz des Single Malt.
Wenn die beiden während der Flucht nach einem Banküberfall mit einer Kamera überwacht wurden, dann kann man getrost mehrere zehntausend Seiten Akten diverser Untersuchungsausschüsse des Bundestages und einiger Landtage auf die Müllkippe werfen. Und das Verfahren gegen Beate Z. in München müsste neu beginnen.
Das wäre ein Riesenskandal.
Mitch spürt eine diffuse Angst in sich aufsteigen. Wer überwacht Nazikiller? Und warum? Wer kann so etwas überhaupt? Deutsche Dienste? Die Israelis? Die Amerikaner?
Der Laphroig hilft bei der Antwort – »Quatsch, nicht die Israelis, der Mossad hätte sie umgelegt, die Amerikaner interessieren sich nicht für Nachwuchsnazis, die kopieren lieber interne Akten von BMW und Mercedes und lauschen dem Handy der Kanzlerin.« Deutsche Dienste, schwer zu glauben.
Aber nicht unmöglich. Wer hatte ihm die Aufnahmen geschickt? Und warum?
Dieses Material ist eine Bombe für jeden Journalisten, die BILD, SPIEGELTV, die Tagesschau, das heute journal würden sich zerreißen für diese DVD.
Warum sendet jemand so heißes Material an ihn, an Mathias Berger von Star TV?
Normalerweise schicken Informanten, die geheim bleiben wollen, Akten oder Bilder nur an Journalisten, mit denen sie schon in Kontakt stehen, oder aber an Kollegen, die aktuell mit einem bestimmten Thema auf sich aufmerksam gemacht haben.
Aber er hat gar keine Nazistory in der Mache.
Er hat schon seit Ewigkeiten keine intensiv recherchierte Story mehr gemacht. Sie alle, auch die Hamburger und Berliner Büros von Star TV, produzieren seit Wochen nur noch Flüchtlingsstories. Syrische Kinder mit großen runden Augen, bildfüllend. Anrührende Begleitreportagen. Helferporträts.
Niemand hat mehr Zeit für investigative Stücke, kein Sender bestellt so was. Wahrscheinlich weil niemand solche Berichte sehen will. Schon gar nicht Hintergrundstücke über mordende Neonazis.
Dann durchzuckt ihn ein Gedanke.
Ihm fällt plötzlich seine Recherche zu Caren ein. Verdammt, da gibt es sehr wohl einen Nazi. Caren allerdings ist kein Job, Caren ist eine Obsession. Eine vertraute alte Freundin, die in einem schicken Luxusresort in Thailand Selbstmord begangen hatte. Ihr Tod ließ ihm keine Ruhe, er wusste zwar um ihre Depressionen, dennoch: Er hatte nie begriffen, warum sie unbedingt sterben wollte.
Er hatte ein paar Mal rumtelefoniert, an einigen Türen geklopft auf der Suche nach einem Neonazi, der Caren angeblich nahe gestanden hatte. Fred hieß der Typ, aus Thüringen oder Sachsen. Eigentlich unvorstellbar, aber einige Briefe, die er und die anderen Freunde gefunden hatten, waren unmissverständlich: Dieser Nazi war Carens Lover.
Es war Mitch bisher nicht gelungen, mehr über diesen Fred herauszufinden. Er hatte sich allerdings auch kein Bein dafür ausgerissen, bis jetzt. »Was hat Carens Nazigigolo mit der NSU zu tun«, flucht Mitch und schlägt mit der Handkante auf seinen Schreibtisch. Wie auch immer, er muss ihn finden. Er starrt aus dem Fenster. Die Skyline hat nichts Tröstendes mehr. Es liegt Spannung in der Luft – und Ärger.
2
Mitch dreht gerade die dritte Runde um den Block. Er liebt sein Nordend, aber er hasst es, hier nach Mitternacht einen Parkplatz zu suchen. Er hat im Büro immer und immer wieder die DVD laufen lassen. Bis ihm schwindelig wurde.
Für morgen hat er einen Termin bei einer Firma für digitale Bildeffekte ausgemacht. Er muss völlig sicher sein, dass dieses Material echt ist. Es gibt heute sogenannte CGI, Computer generated images, die kaum von realen Bildern zu unterscheiden sind.
Das Material hier ist eine Bombe, keine Frage. Es könnte ihm den größten journalistischen Scoop seines Lebens bringen, seine Schaffenskrise mit einem Schlag beenden. Sollten diese Bilder aber gefälscht sein, und sollte sich das erst herausstellen, nachdem er damit an die Öffentlichkeit gegangen war, dann hätte er jede Reputation in der Branche verspielt. Viel gibt es ohnehin nicht mehr zu verspielen.
Mitch schaut nervös in den Rückspiegel.
Er hat noch einen Stopp im »Größenwahn« hinter sich, einer stets rammelvollen Kultkneipe im Viertel. Wie immer hat er an der Bar Bekannte getroffen, zwei Gläser Rioja sind es dann doch wieder geworden. Plus dem obligatorischen Grappa to go. Dann der abendliche Stress im Nordend, einen halblegalen Parkplatz suchen und dabei im Rückspiegel stets nach den Freunden und Helfern Ausschau halten.
Er hat Glück. Vor ihm schert ein Golf mit dem bei Frankfurtern berüchtigten Taunus-Kennzeichen MTK aus einer verdammt kleinen Lücke. Er rangiert seinen ohnehin angeschrammten Alfa Spider zwischen zwei fette Limousinen. Das würde er auch mit geschlossenen Augen nach vier Gläsern noch schaffen.
Beim Aussteigen fällt sein Blick auf einen Elektrokasten. Dort klebt ein schon leicht zerfetztes Konzertplakat, ein riesiger Fuchs, bedrohlich über einer Stadtsilhouette, der Himmel glüht in einem gefährlichen Rot-Gelb. The Prodigy kommt in die Festhalle. Er liest den Namen der Band und sein Gehirn schickt ihn auf eine Zeitreise. Im Sommer 1999 war er mit einem Team im Kosovo, wenige Tage nach dem die KFOR-Verbände der Nato eingerückt waren. Kein ungefährlicher Trip, zwei Kollegen vom Stern waren wenige Tage zuvor von serbischen Heckenschützen beim Durchqueren eines Waldstücks erschossen worden. Junge albanische Kämpfer der UÇK führten Mitch und sein Team in ein abgelegenes Tal, in dem fünf größere Gehöfte lagen, alle ausgebrannt. Sie näherten sich einem der Höfe. Auf der Wiese vor dem Haus lagen zerrissene Frauenkleider. Das Haus war weißgetüncht, schwarze Rußfahnen reichten von den Fenstern im Erdgeschoß hoch in den ersten Stock und weiter nach oben. Man hatte die Menschen in das Haus getrieben, dann Molotow Cocktails ins Erdgeschoss geworfen.
Eine fünfköpfige Familie war hier verbrannt, die Leichen fand man im Dachgeschoss.
An der Hofmauer frische Graffiti The Prodigy und Arkan was here.
Arkan war ein Belgrader Krimineller, der mit einer durchgeknallten Mörder-Gang das Geschäft ethnischer Säuberungen betrieb. Beim Morden und Vergewaltigen hatten die Männer wohl The Prodigy gehört. Stakkatomusik, knallhart, Mördermusik.
Nächste Woche also in der Festhalle.
Als Mitch von dieser Reise zurückgekehrt war, bekam er Krach mit vielen Freunden. Sein halber Bekanntenkreis ging damals zu Friedensdemos, erfreute sich an Menschenketten im Kerzenschein. Mitch kam vom Balkan zurück und erzählte allen, dass man gegen Killer nicht mit Kerzen kämpfen könne. Das allerdings wollte keiner hören.
Er schnauft die steile Treppe hoch in den dritten Stock. Abnehmen ist angesagt. Hatte schon Lilly immer gefordert. Zurecht. Die ganze Wohnung riecht noch nach ihr, atmet ihre Gegenwart. Er lässt die Wohnung jetzt bewusst verwildern. Doch all sein Chaos vermag einer schönen 4-Zimmer-Altbauwohnung in bester Nordendlage nicht den Charme zu nehmen.
Er tritt auf den Balkon und genießt in der Ferne das Glitzern der geliebten Skyline.
Im Bad ein kurzer Blick in den Spiegel. Er vermeidet es, sich länger in die Augen zu sehen, zu viel Trauer sieht er da, zu wenig Schlaf und zu viel Alk.
Seit kurzem trägt Mitch die Haare ganz kurz, er hasst Geheimratsecken und haarlose Löcher am Hinterkopf. Er hat einen Friseur, dem er blind vertraut, Frank heißt der Mann. Mit Frank war seit Langem abgemacht, werden die Haare zu dünn, zu wenig, dann kommt der amerikanische Astronauten-Look zum Tragen. Neulich war es soweit, Frank hatte ihn angeschaut und dann gemeint: »Houston is calling.«
Mitch streicht sich über den Kopf, er mag den neuen Look. Dann fährt er den Laptop hoch und beginnt zu arbeiten. Er liest über das schier unglaubliche Versagen der deutschen Sicherheitsbehörden in der NSU-Affäre.
Er liest, wie ein Referatsleiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz Hunderte von Akten schreddern lässt, die vermutlich wichtige Hinweise auf das NSU-Trio und mögliche Hintermänner und Mittäter enthielten. Und das, obwohl diverse Untersuchungsausschüsse die Akten verlangt haben.
Er sieht das berühmte Video einer Überwachungskamera aus der Kölner Keupstraße, in der die NSU-Leute eine mit Nägeln gefüllte Rohrbombe hochgehen ließen. Das Video zeigt zwei schmale junge Männer mit kurzen Haaren und T-Shirts, die zwei Fahrräder durch die Straße schieben, im Korb des einen die Bombe.
Wer dieses Video sorgfältig betrachtet, kann einfach nicht begreifen, wie deutsche Kriminalbeamte angesichts dieser Bilder auf die Idee kamen, die Täter im Umfeld der türkischen organisierten Kriminalität zu suchen. Die beiden Männer auf dem Video sahen nicht aus wie kurdische Heroin-Pusher, auch nicht wie türkische Nachclubbesitzer. Sie sahen aus wie typisch deutsche Neonazis.
Sie sahen aus wie die beiden Männer in seinem Campervideo.
Zu der Zeit waren Böhnhardt und Mundlos zur Fahndung ausgeschrieben. Man hätte auf sie kommen können. War man aber nicht.
Und der Wahnsinn ging weiter. In Kassel saß ein Verfassungsschützer in einem Internetcafe an der Holländischen Straße, als der Betreiber Halit Yozgat erschossen wurde. Der Verfassungsschutzmann Temme beteuerte immer wieder, die Tat nicht bemerkt zu haben. Er wurde freigelassen, stattdessen wurde auch hier wie immer im Umfeld der Familie recherchiert, die Angehörigen der Opfer wurden zu Verdächtigten oder gar Beschuldigten.
Es ist unglaublich. Konnten alle diese Pannen Zufall sein?
Auch bei der erschossenen Polizistin Michele Kiesewetter gibt es Ungereimtheiten ohne Ende. Mehrere glaubwürdige Zeugen berichten von drei flüchtenden Personen, die Polizei aber bleibt bei den bekannten zwei Tätern. Unter dem Schutt der zerstörten Wohnung des Trios fanden Ermittler eine Trainigshose mit Blutspuren. Blut der toten Polizistin. In einer akribischen Untersuchung wurde festgestellt, dass nicht der Todesschütze diese Hose getragen hatte, sondern ein Mann, der etwa einen Meter hinter dem Schützen gestanden hatte. Da zur selben Sekunde ein weiterer Täter auf den Kollegen von Frau Kiesewetter schoss, ergab auch diese Untersuchung, dass mindestens drei Personen an dem Mord beteiligt gewesen sein mussten.
Doch Ermittler und die Bundesanwaltschaft bleiben bei der Zwei-Täter-These.
Mitch liest Untersuchungsberichte, die unzählige Fehler und Unstimmigkeiten auflisten. Er wird hellwach, als er Berichte findet, die sich mit den Toten im Camper beschäftigen. Die ersten, die in dem Camper fotografierten, waren Feuerwehrleute. Polizeibeamte beschlagnahmten die Kameras der Feuerwehrleute, die Bilder gingen verloren, sie finden sich nirgends in den Akten.
Zufall?
Die offizielle These lautet: Böhnhardt und Mundlos sahen die Polizei draußen, fühlten sich in der Falle und verabredeten sich zum Selbstmord. Zunächst habe Mundlos Böhnhardt erschossen, dann sich selbst. Polizisten, die vor Ort waren, berichten von drei Schüssen, die beiden letzten aus einer großkalibrigen Waffe. Danach habe der Camper zu brennen begonnen. Wie aber kann Mundlos, der sich mit einem großkalibrigen Gewehr in den Kopf geschossen haben soll, danach noch einmal abgedrückt haben? Mitch liest mit wachsendem Entsetzen, dass der offizielle Bericht des Untersuchungsausschusses des thüringischen Landtages lapidar von der Selbstmordthese spricht und diese alles andere als belegt empfindet. In den Lungen der beiden Toten wurden keinerlei Rauchspuren entdeckt, das aber kann nur bedeuten, dass sie bereits tot waren, als der Brand ausbrach. Da Tote bekanntlich kein Feuer legen, muss mindestens eine weitere Person im Spiel gewesen sein. Wenn nun eine dritte Person das Feuer gelegt hat, dann war diese Person wahrscheinlich auch der Mörder der beiden NSU-Männer.
Mitch fühlt, wie er im Treibsand versinkt.
Wurden die Mörder ermordet? Von wem und warum? Hat die geheime Kamera im Camper darauf eine Antwort? Zeigt die Fortsetzung seiner DVD, was wirklich geschah?
Die ganze NSU-Chose stinkt zum Himmel. Zu viele Zufälle, zu viele Fehler. Geht man jedoch vom Versagen oder gar von aktiver Hilfe einiger Behörden aus, dann wird aus den wirren Puzzleteilen plötzlich ein Bild.
Sollten deutsche Dienste tatsächlich rechten Mördern geholfen haben?
Für Mitch nur schwer vorstellbar, verflucht, das hier ist die Bundesrepublik Deutschland, wir sind Weltmeister und lesen den SPIEGEL, wir sind keine Bananenrepublik.
Aber nur mit dieser Arbeitsthese werden Konturen eines klareren Bildes sichtbar. In dem Moment stolpert Mitch über einen Satz des zurückgetretenen Vizepräsidenten des Verfassungsschutzes: »Es dürfen keine Staatsgeheimnisse bekannt werden, die ein Regierungshandeln unterminieren.«
Ein Hammersatz.
Mitch liest Stunde um Stunde. Er wird immer wacher. Er liebt dieses Gefühl: volle Konzentration, voller Tunnelblick. Er kennt es von früher. Spätnachts in einem Schneideraum in irgendeinem Fernsehsender, draußen die Gänge dunkel. Viele Espressi, manchmal ein Joint, mit offenen Augen in das Material eintauchen und den Weg zu einem optimalen Film suchen. Damals hatte er noch Filme gemacht, die er selbst als wichtig empfand.
Star TV, sein heutiger Arbeitgeber, ist kein Sender, sondern eine Produktionsfirma. Sender bestellen bei Star TV fertige Filme. Manchmal Reportagen von 30 oder 45 Minuten Länge, manchmal kurze Stücke für Magazine, in der Regel harmlose, gefällige Filmchen. Wir begleiten die Autobahnpolizei, wir begleiten Rettungssanitäter usw. Journalistisch gesehen Meterware, aber Themen, die heutzutage gute Einschaltquoten versprechen. Deswegen bestellen die Sender sie bei Star TV, deswegen machen Autoren wie Mitch einen Film nach dem anderen, alle in derselben Machart. Mitch hat diese Jobs so satt, aber er weiß nicht, wie er aus der Nummer rauskommen soll. Er ist Anfang 50, kein gutes Alter für einen radikalen Neuanfang. Vor allem, wenn es klare selbstgesetzte Bedingungen gibt, kein Neuanfang ohne seine schöne Wohnung in einem angesagten Viertel von Mainhattan. Und auch den Alfa wird er nicht abgeben.
Und trotzdem: Mitch weiß, dass der Frust, der sein Leben vergiftet und Lilly vertrieben hat, genau von dieser Art Arbeit kommt.
Plötzlich spürt er, dass ihm das Schicksal eine Chance serviert.
Er wird zupacken und sie festhalten. Es ist jetzt drei Uhr, früher Morgen.
Er hat den Wecker auf 7:00 gestellt.
Neben dem Bett ein kleiner Kasten mit Unterlagen zu Caren, die will er noch durchgehen, bevor er in den Tag startet. Er ist müde, aber glasklar, kein Kater, das übliche flaue Gefühl im Magen wie weggeblasen. Zügig und doch sorgfältig macht er sich an den Inhalt des Kastens. Briefe, Notizen, so sorgfältig hat er noch nie gesucht.
Verdammt, Caren hatte mindestens dreimal Urlaub mit dem Typ gemacht. In Südfrankreich und Spanien. Caren hatte offenbar versucht, ihren Nazi zu einem Genießer zu erziehen. Lange Beschreibungen von Abendessen auf einer Terrasse mit Kerzen, besten Weinen und Armagnac zum Abschluss. Caren war verliebt gewesen, keine Frage, mehr als einmal stößt er auf weinerliche Briefe, in denen sie Fred anfleht, sich zu melden.
Aus vielen dieser Briefe weht ihn eine Einsamkeit an, die ihm die Luft nimmt. Dann findet er, was er gesucht hat, einen nicht abgeschickten Brief mit vollem Namen und Adresse. Fred Wagner, Friedenau, Thüringen.
Es ist kurz vor acht, als er Hanna anruft. Hanna gehört zu ihrer Clique, sie war eine gute Freundin von Caren, mit Mitch ist sie nicht wirklich eng. Aber sie ist zäh und zuverlässig.
»Hanna, hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Ja, ungewöhnliche Uhrzeit, zugegeben, nein, ich bin nicht betrunken, nein, ich will nicht mit dir über Lilly reden. Hör zu, es geht um Caren, ich bin da auf etwas Wichtiges gestoßen. Wir müssen schnell und äußerst sorgfältig die Nachlasskiste durcharbeiten. Kannst du das machen, ich bin im Stress, hab echt viel zu erledigen. Schlüssel bei den Nachbarn, die Kiste steht neben meinem Bett.«
Mitch duscht, trinkt den ersten Espresso, machte sich ein kleines Marmeladenbrot. Er ist kein großer Freund von opulentem Frühstücken.
Wow, was ein Wunder, heute Morgen findet er seinen Spider auf Anhieb. Mitch grinst und vergewissert sich, dass die kostbare DVD an ihrem Platz ist. Die Firma, zu der er will, ist ein gehypter Laden in Sachen Bildbearbeitung. Sie haben die unglaublichsten digitalen Effekte drauf, vergeuden ihr Talent aber hauptsächlich für Werbung und Music-Clips. Sie verlangen und bekommen für ihre Dienste eine Mörderkohle. Er quält sich durch den morgendlichen Verkehr, er muss ans andere Ende der Stadt. Eine alte Lagerhalle aus Ziegel, schicker Eingang, davor einige fette Schlitten. Die Eigentümer können sich vom Panamera an aufwärts eigentlich alles leisten, was schick und teuer ist. Ein grelles Neon über dem Eingang »City Lights Post Production«.
Mitch geht ziemlich beeindruckt durch die Eingangstür.
Timo, sein Cutter, hat ihm ein Date mit André gemacht, einem Magier der digitalen Welten.
Er sieht André, einen schick und locker gestylten jungen Schwulen in einem Wartebereich, der mehr an eine Lounge für Nachtschwärmer erinnert als an die Teeküche einer Filmfirma. Es hätte ihn nicht überrascht, wenn André, dem Ambiente entsprechend, ihm ein paar Wachmacher zum Frühstück angeboten hätte, es gab dann aber doch nur Espresso mit Keks statt Champagner und Koks.
André führt ihn in einen futuristischen Schneideraum. »Okay, zeig mal, was du da hast. Timo hat sich fast in die Hose gemacht vor Geheimniskrämerei, hat mir mit allen Strafen der Hölle gedroht, wenn ich mit irgendjemandem über das Band reden würde. Geheimnisse bewahren ist eigentlich nicht meine starke Seite, ehrlich gesagt. Aber wenn es sein muss. Also lass sehen.«
Mitch gibt etwas zögerlich das Band heraus. André spielt die DVD auf einen riesigen Flachbildschirm, der, leicht nach vorne geneigt, den Raum dominiert. Schon nach zwei, drei Minuten pfeift André mit halbgeöffnetem Mund. »Nicht das Zeug, das wir hier normalerweise sehen. Der Hammer, wer sind die Typen, sehen böse aus. Und machen sich bald in die Hose vor Angst.«
Mitch murmelt was von Ossi-Gangstern und will dann wissen, ob das Material bearbeitet worden sei.
Vor seinen Augen verwandelt sich der etwas schrille MTV-André in einen Messtechniker, der routiniert von einem Menü ins nächste wechselt, Oszillografen dazu schaltet, die Bilder kippt und dreht. Schließlich sein erlösendes Urteil: »Dies hier ist unbearbeitetes Originalmaterial, von einer verdammt leistungsstarken gopro aufgenommen und drahtlos gesendet. Dann mehrfach kopiert, aber nicht bearbeitet, hundertpro, da wette ich meinen Arsch drauf.« Dann legt André seine sorgfältig manikürte Hand auf Mitchs Arm:« Du musst mich nicht für blöd halten, nur weil ich Musikclips schneide. Ich weiß, wer das da ist, und keine Sorge, bei so was kann ich mein Maul halten. Ich mag keine Nazis.«
André wirbelt weiter, es reizt ihn, mehr aus den Bildern herauszuholen. »Was hat der Typ da für ein Handy«, er zoomt auf das Telefon, markiert die Umrisse mit einer schmalen grünen Linie, während auf einem anderen Bildschirm eine Auswahl handelsüblicher Handys erscheint. »Hier«, er fährt eines der Internetbilder über das Handy aus der DVD. »Sag ich doch, der Junge hat ein Sony Xperia. Mal sehen, wo da die Wahltasten liegen, unteres Drittel bis Mitte.«
Er betrachtet die Abbildung des Telefons auf der Internetseite, legt dann ein grünliches Raster über die Fläche mit den Nummern und trägt die Ziffernbelegung in dieses Raster ein. Dann vergrößert er das Telefon aus der DVD auf gleiche Größe und überträgt das Raster auf das DVD-Bild.
Jetzt lässt er das Band in extremer Zeitlupe laufen.
Uwe Böhnhardt tippt plötzlich in das digitale Raster.
André ist hin und weg: »Es klappt, hier schreib mit, nein, wähl besser gleich 0, das war leicht, 170 und 3, nein 2, dann 00400 und eine 1.«
Mitch sitzt da wie ein kleines Kind in einer Zaubershow, trotzdem ist er Profi genug, um auf seinem Handy schnell die eigene Rufnummer zu unterdrücken. Von Andrés Zaubertricks begeistert, tippt er los.
0170 2004001.
Ein Freizeichen ertönt, drei-, viermal. Für eine Sekunde hat Mitch den Eindruck, dass jemand abgehoben hat, dann bricht die Verbindung ab.
Er erschrickt, stöhnt: »Mann, ich hätte das nicht mit meinem Handy machen dürfen. Ich hätte irgendein beschissenes Prepaidhandy nehmen sollen.«
Auch André ist verunsichert. Sie haben einen Riesenerfolg erzielt, sind aber auch ein unnötiges Risiko eingegangen.
Mitch fühlt sich unbehaglich, er muss das hier verdammt ernst nehmen. Der NSU-Mann hat in den letzten Minuten seines verpfuschten Lebens bestimmt nicht die Telefonseelsorge angerufen. Wem auch immer die Nummer 0170 2004001 gehört, der ist garantiert kein Zeitgenosse, der sich freut, dass irgendein Unbekannter mal eben telefonisch vorbeischaut. Mitch befürchtet, dass der Typ am anderen Ende der Leitung trotz der Nummernunterdrückung seine Identität ermitteln könnte. Dann beruhigt er sich, wahrscheinlich denkt der andere nur an eine Fehlverbindung, das gibt es ja häufig genug.
Jetzt aber muss er rauskriegen, wem die Nummer 0170 2004001 gehört. Und zwar schnell. Bevor die Nummer rauskriegt, wer da um 11:17 angerufen hat.
Er überlegt kurz, sein Handy wegzuwerfen, aber Mist, alle Kontakte, sein halbes Leben steckt in diesem Telefon.
»Ich muss aufpassen, ich Idiot«, flucht er, »das ist kein Spiel hier.«
3
Ein hochgewachsener älterer Herr im klassischen dunkelblauen Kaschmirmantel schlendert vor dem Gate Nummer 9 des Berliner Flughafens Tegel auf und ab. Unter dem Mantel blitzt ein eleganter dreiteiliger Anzug hervor, dazu ein weißes Hemd, eine klassisch gestreifte Krawatte.
Der Herr wirkt ruhig und doch irritiert, er ist es nicht gewohnt zu warten. Er hat ein hageres Gesicht, graumeliertes Haar, relativ kurz geschnitten, glatt zurückgekämmt.
Eine schwarze S-Klasse fährt vor, gibt kurz Lichtzeichen und hält dann vor dem plötzlich zufrieden wirkenden Mann. Ein Wagen mit 0-Nummernschild, eine Regierungskarosse, hier in Tegel nichts Besonderes. »Guten Tag, Herr Doktor, hoffe, Sie hatten einen angenehmen Tag.« Der Chauffeur öffnet die Tür zum Fonds, verbeugt sich und hilft seinem Fahrgast aus dem Mantel. Mit einem knappen Danke gleitet der auf die eleganten schwarzen Ledersitze. Leise und zügig setzt sich die schwere Limousine in Bewegung.
Ein Mercedes S 500 steht ihm als Chef der Hauptabteilung 2 des Bundesamtes für Verfassungsschutz eigentlich nicht zu, aber Werner Dickmann hat beste Beziehungen, sogar zur Fahrbereitschaft des Innenministeriums.
Die Hauptabteilung 2 ist für Rechtsextremismus/Rechtsterrorismus zuständig. Als die NSU-Affäre hochkochte, hatte er um seinen Stuhl zu kämpfen, jetzt sitzt er fester denn je im Sattel, die Abteilung wurde vergrößert, er bekam mehr Mittel, mehr Macht. Und er, Werner Dickmann, hatte die neuen Beamten fast alle persönlich ausgewählt, handverlesen im wahrsten Sinne des Wortes.
Einige jüngere Herren, Führungsnachwuchs, waren ihm vom Ministerbüro reingedrückt worden, ansonsten passte seine Truppe.
Er hatte seine Leute auf Deutschland verpflichtet, auf das Vaterland. Die egoistischen Einzelinteressen wechselnder Minister oder Kanzler verachtete er zutiefst. Werner Dickmann und seine Truppe arbeiteten für Deutschland. Punkt.
Er bittet den Fahrer, die Nachrichten laut zu stellen.
Die ersten drei Meldungen beschäftigten sich, was sonst, mit den erneut steigenden Flüchtlingszahlen. Die Millionengrenze war längst überschritten, seine Experten sprachen intern von bis zu drei Millionen, mit denen man zu rechnen hätte.
Als dann der Nachrichtensprecher von einem neuen Termin für ein weiteres Krisengespräch der zerstrittenen Großkoalitionäre berichtet, kann sich Werner Dickmann einen kleinen Fluch nicht verkneifen. »Unverantwortlich, es herrscht Ausnahmezustand an der Grenze und Frau Merkel und Genosse Gabriel vertagen sich wieder einmal. Toll, armes Deutschland, du hast es ja.«
Der Fahrer nickt bestätigend. Er hat Dickmann schon häufig gefahren, kennt dessen Ansichten, die von einigen, vor allem aber von den Älteren im BMI geteilt werden.
Dickmann greift zum Telefon. Er senkt seine Stimme.
Am Apparat ist ein befreundeter Generalmajor, einer der Chefs des MAD, des Militärischen Abschirmdienstes. Die beiden Herren erregen sich über eine Studie des BMI zur Historie des Ministeriums. 64 Prozent der Männer der ersten Stunde des Ministeriums seien NSDAP-Mitglieder gewesen. »Hört nie auf, die Hexenjagd«, zischt Dickmann in den Hörer. »Jetzt sind die Historiker dran, die natürlich alles brühwarm an die Presseheinis durchstecken.«
»Das waren gute Männer der ersten Stunde, Patrioten, was man von vielen gewählten Politikern nicht sagen kann. Macht mich wütend, diese ewige Hetze. Wird wieder einen Riesenartikel im SPIEGEL geben. Mir unverständlich, warum der Minister so einen Dreck überhaupt in Auftrag gibt. Man muss auch mal aufstehen gegen den Zeitgeist. Gut, wir sehen uns heute Abend auf dem Schloss, komm pünktlich, es gibt viel zu besprechen.«
Die Fahrt geht nach Schloss Meseberg, einem Gästehaus der Bundesregierung. Ein mokantes Lächeln spielt um Dickmanns schmale Lippen. Dass die Regierung für sein Treffen die Räume – wirklich stilvolle Räume – zur Verfügung stellt, amüsiert ihn. Es wird schwer werden heute Abend. Nicht risikolos.
Seit ewig schon trifft sich die Runde in wechselnder Besetzung. Man ist ein handverlesener Kreis, der in letzter Zeit etwas unter Nachwuchsmangel leidet. Bisher hatten sie sich meistens zum unverbindlichen Meinungsaustausch getroffen und bei altem Margaux und Cohibas über den Zeitgeist geschimpft. Leute, die verbal aufgeknüpft wurden, fanden sich immer, in der ersten Generation war es der verhasste Fritz Bauer, Jahre später wurde Willy Brandt das Hassobjekt, in neuerer Zeit ereiferte man sich über die rüpelhaften Emporkömmlinge Schröder und Fischer. Mit Angela Merkel führt nun erstmals eine Persönlichkeit aus der Union die Negativliste an.
Heute geht es nicht mehr ums Plauschen, heute ist Handeln angesagt. Am Abend wird Werner Dickmann einen Vorschlag machen, der es in sich hat.
Er zuckt die Schultern, er hat keine Wahl – bei drei Millionen zu erwartenden muslimischen Einwanderern. Merkel mit ihrem »Wir schaffen dass« ist schuld.
Deutschland geht vor die Hunde.
Er handelt in Notwehr. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss.
Sein anderes Telefon klingelt, das geheime, abhörsichere. Diese Nummer haben vielleicht 30 Personen. »Ja, Wagner, fassen Sie sich kurz, ich bin unterwegs. Okay, das höre ich gerne. Ihr Problem in Fernost ist geregelt? Gut. Halten Sie sich bereit, es wird Arbeit geben.«
Er blickt aus dem Fenster, späht in die aufziehende Dämmerung, genießt den herben Reiz der brandenburgischen Landschaft. Fred Wagner ist ein Problem, mit dem er sich befassen muss. Der Mann weiß zu viel, ist nicht immer steuerbar. Diese Frauengeschichte jetzt, unverantwortlich. Außerdem hat der Mann ein Alkoholproblem.
Der Hauptabteilungsleiter Rechtsextremismus/Rechtsterrorismus wird sich auch um diesen – in seinen Kreisen prominenten – Neonazi kümmern.
Gerade als er das Handy wegstecken will, fällt ihm ein blinkendes Symbol auf – verpasster Anruf um 11:17, unbekannter Teilnehmer, verborgene Nummer. Er ist nicht gerade ein Experte in moderner mobiler Kommunikation, aber das hier kann nicht sein. Diese Nummer haben vielleicht dreißig Personen und alle sind mit ihren Decknamen in der Kontaktliste abgelegt. Alle sind gehalten, immer von denselben Handys aus dieses Telefon anzurufen. Es kann also keine Anrufe von unbekannten Teilnehmern geben, und verborgene Nummern schon gar nicht. Er ist irritiert, kann jetzt aber nichts veranlassen. Er tröstet sich mit dem Gedanken, dass es wahrscheinlich ein ganz banaler Irrläufer war. Jemand hat die falsche Nummer gewählt. Und wenn nicht? Dann hätte er ein Sicherheitsproblem, und das kann er jetzt überhaupt nicht gebrauchen.
Dickmann seufzt, schließt die Augen. Er erwacht, als der Wagen auf die Kieseinfahrt zum Schloss einbiegt.
Er liebt Schloss Meseberg. Hier riecht noch alles nach längst vergangenen großen Tagen. Der Portier grüßt, weist ihm den Weg zum vertrauten Zimmer.
Das Schloss ist herrlich renoviert, der umliegende Park eine Augenweide. Der Anblick erinnert ihn an die Hoffnungen, mit denen er seinerzeit auf den Umzug nach Berlin reagiert hatte. Die alte Hauptstadt Deutschlands würde den Bonner Krämerseelen Größe einhauchen, so hoffte er damals.
Das Gegenteil war passiert.
Nicht die überall spürbare Tradition der deutschen Geschichte hat die Gemüter beeinflusst, nein, der moderne Dreck des Multikulti-Molochs Berlin vernebelt die Hirne der politischen Klasse. Kreuzberg, Neukölln, das ist die Zukunft Deutschlands. Schwule, Schwarze, Araber sind auf dem Weg zur Mehrheit.
Heute gehört uns die Hauptstadt und morgen das ganze Land. Das ist das Lied, das in Berlin gespielt wird. Und die ostdeutsche Pfarrerstochter, die die Union entmannt hat, dirigiert den grausigen Chor.
Er merkt, wie die Wut wieder einmal in ihm aufsteigt.
Er macht sich frisch und eilt dann zum Dinner.
Eine illustre Runde ist seinem Ruf gefolgt. Ministerialdirigenten, Direktoren, Hauptabteilungsleiter aus dem Innersten der deutschen Sicherheitsbehörden. Sechs Herren vom Verfassungsschutz, dem BND, der Bundeswehr und dem Innenministerium geben sich die Ehre.
Für eine im Kern deutschnationale Runde lassen die Männer es beim Essen recht international angehen. Französische Gänsestopfleber mit Brioche und edlem Süßwein, gefolgt von italienischer Pasta mit frischen Trüffeln. Dann zum Höhepunkt des Abends Wildsau aus der Uckermark, allerdings begleitet von einem Saint Émilion Grand Cru.
Beim Essen nur Small Talk, Behördensnack, gepfeffert mit deftiger werdenden Witzen über die Kanzlerin. Angenehm beschwingt ziehen die Herren um ins legendäre Kaminzimmer: Ledersessel, dunkles Holz. Dickmann füllt persönlich die Cognacschwenker. Sein Blick gleitet über die Versammelten. Sie alle sind in die Jahre gekommen, das gilt nicht zuletzt für ihn selbst.
Da sitzt Karl Schwanberg, der stellvertretende Leiter des Thüringer Verfassungsschutzes. Neben ihm Hauptabteilungsleiter Gunther Kratscher vom Bundesnachrichtendienst, der es hasst, jetzt noch vom schönen Pullach an die Müllerstraße nach Berlin umziehen zu müssen, zwei Jahre vor der verdienten Pensionierung. Kratscher ist stark übergewichtig, sein Kardiologe sitzt ihm deswegen im Nacken. Zu Recht findet Werner Dickmann, der immer auf seine Figur geachtet hat. Sein Blick bleibt an Peter Neubert hängen, drahtige Erscheinung, alterslos, seines Zeichens Generalmajor beim militärischen Abschirmdienst. Ein harter Hund, unbedingt verlässlich, der Mann ist eine Bank.
Plötzlich fliegen Dickmann Zweifel an. Darf eine solche Altherrenrunde über die Zukunft des Landes entscheiden? Warum sind keine Jungen in ihrem Kreis. Haben sie die Schlacht nicht schon längst verloren? Er spürt ein Kratzen im Hals.
Er schüttelt sich, nimmt einen Schluck Cognac.
Dann beginnt er die vielleicht wichtigste Rede seines Lebens, auf jeden Fall die gefährlichste.
»Meine Freunde, die Türken haben für Leute wie uns einen wunderbaren Namen – der tiefe Staat. Das trifft exakt den Punkt. Die Ebene über uns, Minister, Staatssekretäre, sind ausschließlich ihrer Partei und der nächsten Wahl verpflichtet. Sie kommen und gehen, selbst die Kanzler kommen und gehen.
Wir aber bleiben. Wir repräsentieren Kontinuität, wir sind keinen wechselnden Moden oder dem wankelmütigen Zeitgeist verpflichtet.
Wir dienen dem deutschen Staat, wir dienen Deutschland.
Aus dieser Position ergibt sich unsere Legitimität, aber aus dieser Position lassen sich auch unsere Pflichten ableiten. Meine Freunde, unsere Vorgänger in dieser Runde – einige von uns waren als Novizen damals in Bonn noch selbst dabei – haben einst diesen Gesprächskreis scherzhaft als die Wacht am Rhein bezeichnet. Immer wachsam, immer bereit zum Eingreifen, wenn das Vaterland bedroht ist.
So ein Moment ist nun gekommen. Unser Deutschland ist in höchster Gefahr. Die Kanzlerin hat entgegen ihrem Amtseid dem eigenen Land den Krieg erklärt. Über 1,5 Millionen Muslime sind in Deutschland einmarschiert, weitere 2 Millionen stehen bereit, um ebenfalls zu kommen. Unsere rotgrünen Gutmenschen vergießen humanitäre Krokodilstränen über das Elend der Flüchtlinge. Die meisten Mitglieder der grünen Bundestagsfraktion würden ja noch den letzten rumänischen Zigeuner persönlich am Hauptbahnhof abholen und erst Ruhe geben, wenn er Kindergeld für 12 Personen erhält und sein Hartz-IV-Antrag positiv beschieden wird.
Von diesen Grünen ist nichts anderes zu erwarten.
Was aber ist mit der Union? Was tut unsere Kanzlerin? Sie posiert rechts mit einem Syrer und links mit einem Afghanen im Arm und ruft entzückt, you are welcome.
Solche Bilder wurden auf Facebook hunderttausendmal geliked, solche Bilder sind zu Waffen gegen Deutschland geworden.
Mittlerweile besorgen sich Pakistanis zu Tausenden syrische Pässe, von den Afghanen ganz zu schweigen. Das muss aufhören. Jeder von uns hier hat sich bereits eingebracht, wir alle haben mit den Entscheidungsträgern in der Union diskutiert, wir haben versucht, für einen Richtungswechsel zu werben. Vergeblich. An der Kanzlerin führt kein Weg vorbei. Nach den Anschlägen in Paris haben wir Sicherheitsleute immer wieder darauf hingewiesen, dass sich unter den Flüchtlingen natürlich in großer Zahl Schläfer des IS befinden, die den klaren Auftrag haben, hier in Deutschland, in Europa Anschläge durchzuführen.
Die Stimmung in der Union beginnt sich zwar zu drehen, aber noch bleibt Merkel bei ihrem fatalen Kurs. Die Bayern, die als einzige noch einen halbwegs klaren Kopf behalten haben, fordern von der Regierung ein deutliches Zeichen, dass Deutschland nicht unbegrenzt junge islamische Männer aufnehmen wird. Jedoch die Kanzlerin weigert sich, dieses notwendige Zeichen zu geben.
Ich sage euch, die Zeit läuft uns davon. Jeden Tag drängen Tausende neuer Muslime in unser wehrloses Land. Wenn aber Deutschland ein Zeichen gegen die Einwanderung braucht, die Bundeskanzlerin aber nicht bereit ist, dieses Zeichen zu setzen, dann sind wir verpflichtet, es zu tun.
Deutschland wartet darauf. Die Zeit ist gekommen. Wir müssen eingreifen.«
Es gibt Beifall für Dickmann, der Generalmajor klopft Dickmann anerkennend auf die Schulter. »Hat jemand Vorschläge.«
Einer dreht sich zu Dickmann um: »Lass deine rechten Kettenhunde von der Leine. Jede Woche sich steigernde Randale vor den Heimen. Mehr Brandanschläge.«
Dickmann steht auf, jetzt ist der Moment gekommen: »Freunde, ihr wisst, dass ich recht kreativ mit den rechten Schlägern umgehen kann. Ich bin da schon deutlich weitergegangen, als viele hier ahnen. Das aber reicht nicht mehr. Bilder von brennenden Heimen laufen hier bei uns in den Nachrichten, aber sie erreichen niemanden in Kabul oder in Damaskus. Wir haben nichts davon, wenn wir die Zahl der Pegida-Demonstranten erhöhen, wir haben nur wenig davon, wenn in Umfragen und bei Landtagswahlen die ja ganz nützliche AfD ungefähr bei 15 Prozent landet. Es ist doch so: Jeder Brandanschlag der Glatzen produziert eine Gutmenschendemonstration mit Kerzen und kirchlicher Begleitung. Und jeder Chefredakteur, der bei der Kanzlerin punkten will, sendet die Bilder der Gegendemo. Langhaarige mit Kerzen in der Hand sehen einfach öffentlich-rechtlicher aus als kokelnde Dachstühle mit rechten Biertrinkern im Vordergrund. Nein, meine Freunde, so wird es nicht gehen.«
Dickmann nippt am Cognacglas, nimmt einen Schluck Wasser hinterher. Dann fährt er fort: »Wir müssen die Herrschaft über die Bilder erlangen, und zwar international. Das aber heißt, wir müssen das Undenkbare denken, uns verhalten, als wären wir im Krieg – und wir sind ja auch im Krieg. Wir müssen Bilder liefern, die jeder Kameltreiber im Orient begreift. Bilder, die unter die Haut gehen, Bilder, deren Botschaft klar und eindeutig ist. Bilder, die Angst verbreiten.
Bilder, die um die Welt gehen, Bilder, die man senden muss.
Die Botschaft, die wir in den Orient senden, lautet: Bleibt zu Hause, ihr seid hier weder willkommen noch sicher. Ja, lasst Deutschland in Frieden.
Liebe Freunde! Ich kann und will die geplante Aktion jetzt nicht weiter präzisieren, dafür ist es noch zu früh. Aber ihr dürft versichert sein, ich denke an einen klaren, radikalen und vor allem effektiven Schlag.«
Es ist totenstill im Raum, das Schweigen fast unerträglich. Dickmann spürt, dass er leicht zu schwitzen beginnt. Ist er zu weit gegangen? Dann räuspert sich hinten am Kamin Generalmajor Neubert vom MAD, er steht auf, drückt seinen Rücken durch, nimmt Haltung an: »Danke, Werner, ich glaube, dass ich für alle hier im Raum sagen darf: Das war eine klare Ansage eines echten Patrioten. Das, was du da forderst, klingt nach Risiken und Opfern von allen Beteiligten, aber angesichts der täglich schlimmer werdenden Lage, angesichts der Not unseres Vaterlandes stimme ich zu. Zu Ihrer Verfügung, Doktor Dickmann.«
Jetzt weicht bei den anderen die Beklemmung, sie murmeln zustimmend und klopfen auf die Tische. »Moralisch in Ordnung, lieber Dickmann, aber wer soll, was auch immer du da planst, organisieren? Das muss ja alles in einer Hand liegen, nur so ist strengste Geheimhaltung gewährleistet.« Kratscher verspürt wenig Lust, so kurz vor der Pensionierung nochmal alles zu riskieren.
Dickmann reckt sich zu voller Größe: »Liebe Freunde, ich will heute nur euer prinzipielles Einverständnis, denn so eine Verantwortung kann kein einzelner vor der Geschichte auf sich nehmen. Ich werte eure Reaktion jetzt als Zustimmung. Ich werde die operative Planung selber übernehmen, ich werde zu gegebener Zeit auf einzelne aus unserer Gruppe zukommen und Hilfe einfordern. Sollte etwas scheitern, sollten wir verraten werden, so hat es dieses Treffen nie gegeben, dann trage ich die alleinige Verantwortung.«
Man sieht Kratscher die Erleichterung an. Es werden Schnäpse gereicht, viele suchen die Nähe und das kurze persönliche Gespräch mit Dickmann. Neubert, der Mann vom MAD, zieht ihn zur Seite. »Das war ein wenig kryptisch, Werner. Ich bin bei dir, aber du wirst schon präziser werden müssen. Willst du ein Flüchtlingsschiff versenken?«
Dickmann deutet ein Lächeln an:«Ich bin nicht der Mann für Seeschlachten. Du wirst bald mehr erfahren, ich werde gerade deine Hilfe, deine Kontakte brauchen.«
Generalmajor Neubert hat viele Talente, vor allem aber ist er der Mann in der deutschen Geheimdienst-Community, der über die besten Kontakte zu den großen Brüdern jenseits des Atlantiks verfügt. Wer auf dem kleinen Dienstweg etwas von CIA oder NSA will, wendet sich an Neubert.
Die Atmosphäre entspannt sich nun. Plaudermodus ist angesagt. Dickmann bekommt Komplimente für sein Handling der NSU-Affäre. Keiner der zahlreichen Untersuchungsausschüsse, keines der journalistischen Vollstreckungskommandos war in Dickmanns Verteidigungsring eingedrungen. Dickmann ergreift nur noch einmal das Wort. Er erinnert an den letzten Vizepräsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der vor dem Edathy-Auschuss zu Protokoll gab:« Es durften keine Staatsgeheimnisse bekannt werden, die ein Regierungshandeln unterminieren.«
Dickmann lobt die tadellose, beispielhafte Haltung des Zurückgetretenen. Man trinkt auf den Mann. Absolute Vertraulichkeit ist vereinbart, eine Selbstverständlichkeit. Gegen Mitternacht gehen die Herren zu Bett.
Dickmann beschließt, noch eine Runde allein im Park zu laufen. Er muss seine Gedanken ordnen, muss Dampf ablassen. Darf er seinen Plan tatsächlich umsetzen, hat er das Recht dazu?
Er seufzt, steht auf, atmet tief durch und betrachtet die Silhouette des Schlosses im Mondschein. Er streicht sich über die Wange, als müsse er sich selber Mut machen. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss.
Dann fällt ihm plötzlich wieder der merkwürdige Anruf auf dem geheimen Handy ein, sofort meldet sich die Unruhe wieder. Muss morgen geklärt werden, darf er auf keinen Fall vergessen. Das Kaminzimmer von Schloss Meeseberg gehört in der nächsten Stunde einer türkischen Reinigungskolonne.
4
Der Wind peitscht, die Wellen sind mannshoch und werden immer noch gewaltiger. Das Wasser kracht aus wechselnden Richtungen über das kleine Boot, als mache es ihm Spaß, die Menschen zu Tode zu erschrecken.
Amir wimmert leise vor sich hin, klammert sich an die Hand seiner größeren Schwester Mayla.
Amir ist acht, er selbst allerdings antwortet auf die Frage nach seinem Alter immer mit achteinhalb. Er sieht aus wie maximal sieben, ist dürr, wiegt mehrere Kilos zu wenig. Tiefe Schatten um die Augen verraten, dass der Kleine unter Schlafentzug leidet. Amir ist zum ersten Mal auf dem Meer, er hat Angst, schreckliche Angst, am liebsten würde er laut losheulen, aber sein Vater Basim hat ihm vor Antritt der Fahrt eingeschärft, er müsse tapfer sein. Also ist Amir tapfer. Nur seine Augen verraten die Panik.
Amir hat schon viele Dinge gesehen, die ein kleiner Junge nicht hätte sehen dürfen. Auf das Meer hat er sich eigentlich gefreut, Vater Basim und seine Mutter Samira haben ihm immer wieder davon erzählt: »Wir werden über ein großes Wasser reisen nach Europa. Da werden wir sicher sein, und Du wirst zur Schule gehen und Fußball spielen.« Das mit dem Fußball hat ihn schließlich überzeugt, denn Amir liebt Fußball.
Da wo er herkommt, gibt es kein Meer, keine Wellen.
Dafür gibt es Panzer, Fassbomben, einen Präsidenten, der gegen sein Volk Krieg führt, und eine Menge verrückter mordender Männer. Amir und seine Familie kommen aus Homs in Syrien.
Sein Vater, Basim Marwan, ist kein wirklich frommer Mann, aber jetzt betet er für seine Familie. Er hat mit Frau und Kindern seine Heimatstadt verlassen, als die Truppen des Diktators zu Eroberung von Homs ansetzten. Basim Marwan und seine Familie hatten Artilleriebeschuss und Fassbomben getrotzt, hatten in ihrem halbzerstörten kleinen Haus ausgeharrt. Als Mörsergranaten den Anbau mit dem kleinen Laden zerstörten, verlegte Basim Marwan seine Elektrowerkstatt in die heil gebliebene Küche. Basim ist Mitte dreißig, zweifacher Vater, ein Mann mit Verantwortung. Er und seine Frau Samira wurden Meister der Improvisation. Samira gelang es immer wieder, Brot, Reis, Öl und Oliven aufzutreiben, um die 13-jährige Mayla und Amir halbwegs satt zu kriegen.
Doch dann wurde der Ring der Assad-Truppen um die Stadt immer enger. Die Aussicht auf Straßenkämpfe, auf blutige Schießereien Haus um Haus, war für Basim Marwan und Samira zu viel. Sie hatten ein paar Habseligkeiten gepackt, alles verfügbare Geld eingesteckt, die Handys geladen und waren dann Richtung türkische Grenze aufgebrochen.
Der Wind wird stärker, immer häufiger krachen Brecher in das übervolle Schlauchboot. Auch ein erfahrener Bootsführer hätte Mühe, das Boot richtig in die Wellen zu legen, der Mann am Motor aber macht das alles zum ersten Mal.
Basim und Samira sehen die Angst in den Augen ihrer Kinder, haben aber nicht mehr die Kraft, beruhigend zu lächeln.
Amirs Hände werden steif, er schafft es nicht mehr, sich an dem Seil festzuhalten. Drei Seile sind in Längsrichtung gespannt. Daran müssen sich alle Insassen festklammern, sie sind der einzige feste Halt in dem rutschigen Boot.
Jetzt hält ihn nur noch der Griff seiner Schwester.
Amir fühlt eine entsetzliche Übelkeit in sich aufsteigen. Um nicht einfach loszukotzen, träumt Amir sich einfach aus dem Boot hinaus.
Er hat das schon zu Hause manchmal gemacht, immer wenn das Schießen und die Explosionen zu laut wurden, zu nahe kamen, wenn die ganze Welt sich in ohrenbetäubenden Lärm auflöste, dann verfiel Amir in eine Art Starre, schloss die Augen und wechselte in seine eigene Welt. Wie jetzt auch. Amir ist nun auf dem Fußballballplatz unweit der Chalid ibn al-Walid-Moschee im Zentrum der Stadt. Dort hat er seinen Helden kennengelernt, einen jungen Mann, den alle in Homs lieben, den Torwart der Jugendnationalmannschaft, liebevoll Baset gerufen. Als Baset zum ersten Mal mit Amir sprach, ihm die Hand auf die Schulter legte, da war dem Kleinen schlagartig klar, dass auch er Torwart werden würde.
Doch Baset und seine Freunde spielten nicht nur Fußball, sie organisierten Demonstrationen gegen das Regime von Baschar al-Assad. Sie luden alle ihre Aktionen auf You Tube hoch, und schon bald war der gut aussehende Baset ein Internetstar. Auch Amir bewunderte Baset auf You Tube. Seine Schwester Mayla ebenfalls, obwohl sie sich eigentlich nicht für Fußball interessierte. Maylas dunkle, sanft geschwungene Augen begannen zu leuchten, wenn sie Baset auf You Tube und Facebook bewunderte.
Das Boot kracht in ein Wellental, scheint in der Mitte einzuknicken, richtet sich dann wieder auf. Mayla verstärkt ihren Griff auf Amirs Schulter. Jedes Mal, wenn sich das Boot hebt, wird der Kleine gefährlich hoch geschleudert. »Amir, halt dich am Seil fest, bitte. Wir müssen bald da sein, sind doch nur zehn Kilometer.«
»Sind doch nur knapp zehn Kilometer vom türkischen Behram rüber zur Nordspitze von Lesbos.« Das hatte auch der türkische Schlepper zu Basim gesagt, als er für die vier Personen 4 000 Dollar kassierte. Dafür rückte er auch vier Schwimmwesten heraus. Die meisten Syrer kaufen Schwimmwesten, den Afghanen sind sie zu teuer. An dem türkischen Ufer ging es zu wie auf einem Basar. Hunderte von Flüchtlingen drängten sich um die Schlepper, die ihre Boote anpriesen. Von türkischer Polizei oder Armee keine Spur. Die Türken unternahmen nichts gegen den ständigen Strom der Flüchtlinge. Wahrscheinlich zahlten die Schlepper für das Wegsehen der Staatsgewalt. Das Geld holten sie sich doppelt und dreifach zurück. Der Familienvater Basim Marwan erschrak, als er bemerkte, dass keiner der Schleuser Anzeichen machte, mit in das Boot zu steigen, stattdessen begannen zwei Männer einem der jüngeren Flüchtlinge die Funktionsweise des altertümlich wirkenden Außenbordmotors zu erläutern.
»Ihr werdet in Lesbos festgenommen werden, wir holen das Boot später zurück. Macht euch keine Gedanken, die Strecke schafft ihr auch so. Gott ist mit euch, habt Vertrauen.« Dass der Schleuser dabei einen Stapel Geldscheine zu einer speckigen Rolle drehte, ließ ihn nicht vertrauenswürdiger wirken. Aber Basim sah für sich und seine Familie keine Alternative. Also schob er Frau und Kinder in das schlingernde Schlauchboot.
25 Personen, eng gedrängt. In den nahegelegenen Badeorten an der türkischen Riviera lassen sich jetzt wohlhabende Türken und Touristen zum Abendessen nieder. Man kann sehr gut speisen an der Küste, auch die Weine sind ausgezeichnet.
»Amir, bitte halt dich fest«, flüstert Mayla ihrem frierenden Bruder ins Ohr. Doch Amir flüchtet sich nur tiefer in seine Träume.
Aber diesmal schenkt ihm sein Traum keinen Frieden. Er hatte wieder an seinen großen Freund Baset gedacht, aber dann hatte Baset plötzlich selber Tränen in den Augen und Blut an den Händen. Der junge Torwart hatte mit seinen Demoaufrufen im Netz den allmächtigen syrischen Geheimdienst provoziert. Ein Killerkommando im Dienste Assads stürmte die Wohnung von Basets Eltern. Sie verpassten den Torwart knapp, aber da sie nun schon mal da waren, töteten sie seinen Bruder Walid und zwei weitere nahe Verwandte. Als Baset nach Hause kam, fand er seinen Bruder tot mit drei Kugeln im Kopf. Baset fühlte sich schuldig am Tod des Bruders. Er stürmte los, versammelte seine Freunde um sich, und sie begannen im Zentrum der Stadt eine Demonstration. Diesmal eröffnete das Militär ohne zu zögern das Feuer. Es gab viele Tote. Danach war Baset und seinen Freunden klar: Die Zeit der Demonstrationen ist vorbei, wir müssen kämpfen, müssen uns bewaffnen. In dieser Zeit versäumte es der Westen, den demokratischen, moderaten Gruppen mit Waffen und Ausbildern zu helfen. Baset und seinen Freunden blieb keine Wahl: Wer wirklich kämpfen wollte, der fand Waffen und Anleitungen zum Krieg nur bei militanten sunnitischen Gruppen, die den Dschihad predigen und von Saudi Arabien mit Waffen aller Art versorgt werden.
Aus modernen jungen Männern, die vom Fußball und einem lockeren Leben schwärmten, wurden bewaffnete Kämpfer, in deren Leben der Islam eine immer größere Rolle spielt. Den Baset, den Amir kannte und bewunderte, gibt es nicht mehr.
Jetzt ist Amir auch in seinen Träumen allein.
Wieder schießt das Boot in die Höhe. Mayla schreit auf, merkt, dass sie den Bruder nicht mehr halten kann. Amir scheint einen entsetzlich langen Moment in der Luft zu schweben. Trifft jetzt die nächste Welle das Schlauchboot seitlich, dann ist Amir verloren, er wird unweigerlich im dunklen, fast schwarzen Wasser landen. Samira erfasst die Situation am schnellsten. Sie lässt das Seil los, springt hoch, erwischt im letzten Moment die Schulter ihres Sohnes, krallt sich fest und kracht mit ihm auf den ölverschmierten stinkenden Boden des Bootes. Amir wimmert, er hat sich weh getan, hat vergessen, dass er versprochen hat, tapfer zu sein. Er will hier raus, er hasst das Meer, sein Magen dreht sich, die Schulter schmerzt. Amir lässt den Tränen freien Lauf.
Der Kahn schaukelt noch wilder jetzt, das Heck fliegt weit aus dem Wasser, die Schraube heult auf, dreht sich rasend ohne den Widerstand des Wassers, der Motor stottert, fängt sich dann wieder.
Basim wirft sich über seine Frau und seinen Sohn. Er hilft Samira auf, sie hat jetzt wieder das Seil erreicht und Halt gefunden. Basim holt einen Strick aus seiner Jacke, wickelt ihn einmal um Amirs schmale Taille und verknotet ihn dann an seinem Gürtel. Durchatmen. Noch immer kein Land in Sicht.