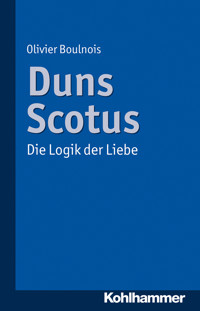
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Johannes Duns Scotus (ca. 1265-1308) hat in Oxford, Paris und Köln gelehrt. Der Franziskaner, Philosoph und Theologe verbindet in seinem Werk scholastische Präzision mit dem Vorrang der Liebe (caritas), wie er für das franziskanische Denken charakteristisch ist. Scotus ist davon überzeugt, dass alle Menschen nach dem Glück streben: Das Ziel menschlicher Existenz ist die Vereinigung des Menschen mit Gott. Die Liebe zu Gott und dem Nächsten ist das Mittel, dieses Ziel zu erlangen. Aber unsere Natur reicht dazu nicht aus; die Gnade (oder ungeschaffene Liebe) muss ihr beistehen. Die Theologie wird dadurch zu einer praktischen Wissenschaft: Sie lehrt, wie unser Wille die Handlungen an der göttlichen Liebe ausrichten und sich so der Glückseligkeit nähern kann. Die Liebe wird zum Strukturprinzip der ganzen Theologie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Johannes Duns Scotus (ca. 1265-1308) hat in Oxford, Paris und Köln gelehrt. Der Franziskaner, Philosoph und Theologe verbindet in seinem Werk scholastische Präzision mit dem Vorrang der Liebe (caritas), wie er für das franziskanische Denken charakteristisch ist. Scotus ist davon überzeugt, dass alle Menschen nach dem Glück streben: Das Ziel menschlicher Existenz ist die Vereinigung des Menschen mit Gott. Die Liebe zu Gott und dem Nächsten ist das Mittel, dieses Ziel zu erlangen. Aber unsere Natur reicht dazu nicht aus; die Gnade (oder ungeschaffene Liebe) muss ihr beistehen. Die Theologie wird dadurch zu einer praktischen Wissenschaft: Sie lehrt, wie unser Wille die Handlungen an der göttlichen Liebe ausrichten und sich so der Glückseligkeit nähern kann. Die Liebe wird zum Strukturprinzip der ganzen Theologie.
Prof. Dr. Olivier Boulnois lehrt Religion und Philosophie des Mittelalters an der École Pratique des Hautes Études (EPHE) und am Institut Catholique de Paris.
Olivier Boulnois
Duns Scotus
Die Logik der Liebe
Übersetzt aus dem Französischen von Bernd Goebel, Thomas Möllenbeck und Anja Solbach
Verlag W. Kohlhammer
Titel der italienischen Originalausgabe: DUNS SCOTO © Editoriale Jaca Book S.p.A. Deutsche Ausgabe veröffentlicht durch Arrangement mit der Literaturagentur Eulama International.
Alle Rechte vorbehalten Für die deutsche Ausgabe: © 2014 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
ISBN 978-3-17-022952-5
E-Book-Formate
pdf:
978-3-17-025431-2
epub:
978-3-17-025432-9
mobi:
978-3-17-025433-6
Inhaltsverzeichnis
Die Logik der Liebe Vorwort des Autors zur deutschen Übersetzung von Duns Scot. La rigueur de la charité
I. Forschungsstand
1. Leben und Werk
2. Interpretationen
3. Methode
II. Lektüre
Erstes Kapitel: Philosophen und Theologen. Die Kontroverse
1. „Die Philosophen behaupten die Vollkommenheit der Natur und leugnen die übernatürliche Vervollkommnung.“
a. Die Vollkommenheit der Natur
b. Die Überflüssigkeit des Übernatürlichen
2. „Die Theologen kennen den Mangel der Natur und die übernatürliche Vervollkommnung.“
a. Natürlich und übernatürlich
b. Das Übernatürliche, Vollkommenheit der Natur
c. Die Neutralität der Natur
3. Das Zusammenspiel von Philosophie und Theologie
a. Die Würde des Menschen
b. Die Unterscheidung der Ordnungen
c. Von den Philosophen zur Philosophie
Zweites Kapitel: Offenbarung
1. Die Wahrheit der Schrift
2. Die Offenbarung
3. Der Glaube
4. Von der Liebe zur caritas
5. Der Glaube und die Offenbarung
6. Der Glaube und die Theologie
Drittes Kapitel: Theologien
1. Das Notwendige
a. In der Theologie an sich
b. In unserer Theologie
2. Das Kontingente
a. An sich
b. Für uns
3. Christus
4. Die Erkenntnis aller Dinge
a. Die göttliche Theologie
b. Die Theologie der Seligen
c. Unsere Theologie
d. Die Theologie in ihrer Gesamtheit
Viertes Kapitel: Wissenschaften
1. Die Kriterien
2. Keine Unterordnung
Fünftes Kapitel: Ethik
Schluss: Theologie und Metaphysik
III. Bibliographie
IV. Namensregister
Die Logik der Liebe
Vorwort des Autors zur deutschen Übersetzung von Duns Scot. La rigueur de la charité
Vor nunmehr fünfzehn Jahren habe ich mich bereit erklärt, eine kurze Einführung in das Denken von Duns Scotus zu verfassen. Es ging darum, zum Wesentlichen vorzudringen. Ich entschied, mich auf die caritas zu konzentrieren.
Was ist die caritas? Im Französischen steht charité zunächst für eine Form von Liebe, die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Das Wort ist die Übersetzung des neutestamentlichen agape: „Gott ist die Liebe (agape)“, heißt es im ersten Johannesbrief (4,8). Manche Historiker, so Nygren, haben gemeint, die menschliche, vom Begehren bestimmte Liebe (eros) der christlichen, interesselosen Liebe (agape) entgegensetzen zu können.1 In Wahrheit verhält es sich einfacher. Aus christlicher Sicht offenbart sich Gott dem Menschen als Liebe, macht sich als Liebe erkenntlich und gibt sich in der Liebe zu erkennen. Indem man den Anderen liebt, erkennt man Gott (Mt 25,37; 40). Lieben bedeutet hier kein passives Gefühl. Es beinhaltet, dem Anderen Gutes zu tun – alles zu geben, indem man sich selber gibt. Die caritas, das ist keine Vergöttlichung der menschlichen Liebe, das sind auch nicht bloß die Wohltaten karitativer Einrichtungen. Sie ist dem Begehren nicht entgegengesetzt, sondern geht über es hinaus, insofern sie die Gabe offenbart – die göttliche Gabe oder die Gabe seiner selbst an den Anderen.
Der berühmte Satz des Augustinus: „Man tritt nicht in die Wahrheit ein, außer durch die caritas“,2 besagt, dass die caritas den Zugang zu einer Offenbarung eröffnet. Sie lässt sich als eine platonische Variation der Definition der Philosophie als „Liebe zur Weisheit“ lesen, aber auch als eine Auslegung von 1 Joh 4,8: „Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt“. Zur Erkenntnis der Wahrheit gelangt man nur in der Liebe und durch sie.
Vor fünfzehn Jahren bedeutete die Bezugnahme auf die caritas einen neuen Tonfall in der Philosophie. Als die Deutung der Philosophie und ihrer Geschichte, zumindest in Frankreich, weitgehend vom Werk Heideggers dominiert war, stand die Rede von der caritas dafür, sich neuen Fragen zu öffnen. Bereits Levinas hatte die herrschende Deutung erschüttert, indem er uns zu einem Ausgreifen über die Metaphysik, die theoretische und totalisierende, hinaus einlud – im Namen eines Primats der Andersheit und der Ethik, der unmittelbaren moralischen Verpflichtung, die ich mir in Gegenwart des Anderen und seines Angesichts zuziehe.3 Später hat Jean-Luc Marion seine Prolégomènes à la charité (Prolegomena zur Liebe) vorgelegt,4 deren Titel die von Kant heraufbeschworene „zukünftige Metaphysik“ durch einen neuen Begriff ersetzte, die caritas. Marion glaubte, dass die Liebe einer anderen Logik folgt als den Logiken der metaphysischen und berechnenden Rationalität. „Nicht dass ihr jede logische Strenge fehlt, ganz im Gegenteil. Sondern die Liebe entfaltet einfach ihre eigene logische Strenge – die letzte Strenge – und folgt dabei einer absolut unvergleichlichen Axiomatik.“5 Hier waren die Logik und die Liebe miteinander verbunden, auf paradoxe Weise und in einer Zeit, da der Ausdruck caritas entwertet worden war, so sehr, dass er fast nur noch das Spenden von Wohltaten bedeutete. Es reicht zur Erklärung nicht aus zu sagen, dass die caritas das Opfer einer Begriffsgeschichte wurde; sie litt an den Schwächen der Philosophie, die die Geschichte eines Begriffs nur widerspiegelt. Die Analyse von Marion eröffnete einen Weg zu den Gipfeln; sie schöpfte aus einer doppelten Quelle: der Überwindung der Metaphysik in der Nachfolge Heideggers (vor allem bei Levinas), und einer Relecture der griechischen Kirchenväter.6
Wenngleich rein historisch ausgerichtet, war der Begriff der caritas für meine Scotus-Auslegung ein einzigartiger Schlüssel zur Interpretation. Denn der Begriff der caritas ist für Scotus auf gleich mehreren Ebenen grundlegend geworden.
Der Primat der Liebe nimmt bei Scotus die Form eines Primats der Freiheit an. 1. Gott ist Freiheit, was so viel bedeutet wie, dass er sich wesentlich durch das Attribut der Freiheit auszeichnet. 2. In sich selbst geht er durch eine sich mit Notwendigkeit verbindende Freiheit in Gestalt des Heiligen Geistes hervor. 3. Nach außen hin setzt er die Ordnung der Welt und das Offenbarungshandeln auf freie und kontingente Weise fest. 4. Die Wege der Rückkehr zu Gott, das Halten der Zehn Gebote, die in der caritas zusammenlaufen, sind ihrerseits kontingent (jedenfalls die auf die Geschöpfe bezogenen), sind weder natürlich noch notwendig. 5. Aufgrund dessen ist die Theologie eine praktische Wissenschaft. Praktisch ist alles, was uns erlaubt, durch unser Handeln zu Gott zu gelangen. Die Ethik ist somit die Anleitung zur freien Ausrichtung unseres Handelns gemäß der caritas (d.h. nach den von Gott erlassenen Geboten). Doch ist Gott seinerseits frei, unsere Handlungen als gefällig anzunehmen – als seiner Gnade würdig – oder nicht. Daher gibt es Gerechtigkeit nur in der Übereinstimmung zweier guter Freiheiten, der menschlichen und der göttlichen.7
Der zweite Bestandteil des Untertitels, der Begriff der Logik – der logischen Strenge: rigueur – muss in seinen beiden Bedeutungen verstanden werden; denn wir finden bei Scotus zugleich eine äußerste intellektuelle Anstrengung, die ihm den Beinamen Doctor subtilis einbrachte, wie auch die Strenge einer unerbittlichen Regel: Scotus ist besonders kompromisslos im Umgang mit seinen philosophischen Gegnern. Den gegen die Mitglieder der Artistenfakultät gerichteten Pariser Verurteilungen von 1277 weist er einen maximalen Verbindlichkeitsgrad zu.8 Die Verbindung der beiden Begriffe Logik und Liebe spiegelt recht genau den Inhalt und die Form jener Wissenschaft wider, die in den Augen des Scotus die höchste ist, der Theologie.
Die Einteilung meines Buchs folgt jener des Prologs von Duns Scotus. Dieser ist der erste in einer langen, sich mindestens bis Peter von Ailly fortsetzenden Reihe von Theologen, der seinem Kommentar zum Sentenzenwerk des Petrus Lombardus eine lange (den ganzen ersten Band seiner kritischen Werkausgabe umfassende) epistemologische Einleitung voranstellt, in der er die Bedingungen der Möglichkeit der im weiteren Verlauf entwickelten Wissenschaft darlegt. Die fünf Kapitel meiner Einführung entsprechen den fünf großen von Scotus diskutierten Fragen: 1. Die Notwendigkeit der Offenbarung; 2. Das Genügen der Heiligen Schrift; 3. Der Gegenstand der Theologie; 4. Die Theologie als Wissenschaft; 5. Die Theologie als praktische Wissenschaft.
Ich bin mir der Unvollkommenheit meines kleinen Werks bewusst. Als ich es verfasst habe, glaubte ich noch, der Metaphysik eine Theologie der caritas entgegensetzen zu können, wovon besonders zwei Sätze zeugen: „Was die Metaphysik übersteigt, strebt zur caritas“ (Kapitel 5, Ende), und: „Paradoxerweise vollendet die Logik der Liebe die Metaphysik, weil sie diese übersteigt“ (Schluss). Damals ahnte ich bereits und sehe heute ein, dass die caritas und eine an ihr Maß nehmende Theologie nicht so konzipiert werden können, als wären sie der Metaphysik äußerlich: Bevor man das Phänomen der caritas losgelöst denken kann, müsste man sich von der metaphysischen Struktur der Theologie frei machen – von den Strukturen, die ihr Verständnis der caritas bestimmen. Aber dazu wäre eine andere Analytik vonnöten, die zu errichten wir noch nicht begonnen haben.
Ich träume manchmal davon, dieses Buch neu zu schreiben. Aber es hat sein eigenes Leben gelebt; es hat seine Wirkung gehabt, seine Leser und eine Rezeptionsgeschichte. Ich habe es deshalb lieber so gelassen, wie es ist.
Mögen diese kurzen Hinweise zumindest eine Hilfe sein, das vorliegende Buch bei der Lektüre zu übersteigen.
Paris, im Januar 2013.
1 Vgl. Nygren, 21954. Für die Verweise (Name des Autors, gefolgt vom Erscheinungsjahr der Publikation) siehe die Bibliographie am Ende des Bandes.
2Contra Faustum 32, 18: „Non intratur in veritatem nisi per caritatem.“
3 Vgl. Levinas, 32002; Levinas, 32011.
4 Vgl. Marion, 1986.
5 Vgl. ebd., S. 7.
6 Siehe Garrigues, 1976.
7 Siehe dazu Boulnois, 22002, S. 354–357.
8 Alain de Libera und Luca Bianchi hatten mich auf die philosophische und institutionelle Bedeutung dieser Verurteilungen aufmerksam gemacht; vgl. de Libera, 1991; Bianchi, 1999.
I. Forschungsstand
1. Leben und Werk
Über das Leben des Johannes Duns Scotus ist fast nichts bekannt. Anhand des Datums seiner Priesterweihe (dem 17. März 1291) und des geforderten Mindestalters nimmt man an, er sei 1265 oder 1266 geboren. Der Beiname ‚Scotus‘ bezieht sich auf seine schottische Heimat und ‚Duns‘ auf seinen Geburtsort, eine kleine Stadt in der Nähe der englischen Grenze. Aufgenommen in den Orden des Heiligen Franziskus (über fünfzig Jahre nach dessen Tod), studiert er in den Kollegien des Ordens und beendet seine Ausbildung in Oxford, wo er gegen 1291–1293 Wilhelm von Ware zum Lehrer hat. Zur Orientierung sei daran erinnert, dass Thomas von Aquin und Bonaventura seit zwanzig Jahren (1274) tot sind, dass die großen Gelehrten der Pariser Universität nunmehr Heinrich von Gent und Gottfried von Fontaines heißen und dass Petrus Johannes Olivi der große Theologe der Franziskaner ist. Anders als manchmal vorgebracht wurde (auch von den Editoren des Scotus), erscheint es nicht notwendig anzunehmen, dass er seine Ausbildung in Paris abschloss. Seine Kenntnis der lässt sich hinreichend mit der Verbreitung der Handschriften und der Lehrtätigkeit des Simon von Faversham erklären. Eher hat er in einem englischen Milieu studiert. Von einer weiteren Hypothese sollte ebenfalls Abstand genommen werden: dass er zwischen 1297 und 1300 in Cambridge unterrichtet hat.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























