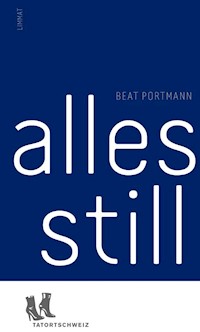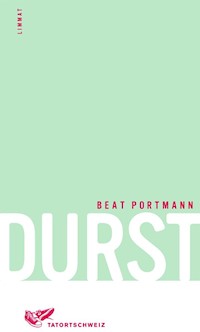
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Limmat Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Der serbische Reiseunternehmer Zoran Slavkovic wird in anonymen Briefen mit Ivo-Andric-Zitaten bedroht. Er beauftragt einen jungen, abgebrannten Schriftsteller, der sich als Detektiv ausgibt, mit der Suche nach dem Verfasser. Doch bevor dieser die Ermittlungen aufnehmen kann, ist Slavkovic auch schon tot, hingerichtet nach angekündigter osmanischer Art. Seine Witwe will, dass der vermeintliche Detektiv weitermacht. Die Spurensuche führt ihn bald ins Drogen- und Rotlichtmilieu und in Geldwäscherkreise der guten Schweizer Gesellschaft. Zusätzlich kommt ihm eine Frau in die Quere, von der er aber bald mehr möchte, als er sich selber eingesteht. Während Rechtspolitiker Unterschriften für die Initiative "Einbürgerungen vors Volk" sammeln und in Frankreich die Fussballweltmeisterschaft anläuft, gerät der Schriftstellerdetektiv immer tiefer in die unvergangene Vergangenheit des Bosnienkrieges.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BEAT PORTMANN
DURST
Roman
Es begann damit, dass mich mein Verleger bei einem Mittagessen aufforderte, mal etwas Spannendes, Unterhaltsames zu schreiben – «einen Krimi oder so öppis». Ich musste ihn auf eine Weise angeschaut haben, dass er sich genötigt sah hinzuzufügen: «Ich will damit ja nicht sagen, deine bisherigen Erzählungen seien langweilig.» Aber im Grunde genommen war es genau das, was er damit sagen wollte.
Mein Verleger war noch nicht sehr lang im Literaturbetrieb. Welcher Tätigkeit er zuvor nachgegangen war, hatte mich nie wirklich interessiert. Er liess mal durchblicken, mit Immobilien gehandelt zu haben, was ihm aber auf die Dauer verleidet sei. In der Zeit musste er ein kleines Vermögen angehäuft haben.
Guido Brechbühl war nicht gerade der Typ Mensch, den man mit Büchern in Verbindung gebracht hätte. Von seiner Statur her, gross und kräftig, hätte er sich gut in einer Sicherheitsfirma gemacht. Er war Mitte vierzig, immer braungebrannt und hatte eine närrische Freude an goldenen Gegenständen. Um den Hals und am rechten Armgelenk trug er eine solche Kette, seine Uhr war vergoldet und das Feuerzeug, mit dem er mir die Zigarette ansteckte. Er interessierte sich für den Segelsport, kostspielige Autos und die Raumfahrt. In seiner Freizeit spielte er Tennis und ging mit Freunden in der Karibik segeln. Wobei Freizeit in Bezug auf Brechbühl, der in erster Linie andere für sich arbeiten liess, vielleicht nicht das richtige Wort ist. Sein Verlag brachte im Jahr an die fünfzehn Bücher heraus. Dafür sorgte der Verlagsleiter, eine Produktionsleiterin, die zugleich für das Layout zuständig war, und eine Handvoll externer Lektoren. Um die Buchhaltung kümmerte sich Brechbühls Treuhänder.
Ich hatte Brechbühl noch nie mit einem Buch gesehen, auch Zeitungen rührte er nicht an. Stattdessen war er mit der Tastatur seines Mobiltelefons beschäftigt, als ich mit viertelstündiger Verspätung das vereinbarte Restaurant betrat. Ich war mir nicht einmal sicher, ob er die Werke, die er herausgab, je las.
Seine Bekanntschaft war alles andere als inspirierend. Aber sie trug immerhin dazu bei, dass meine Arbeit veröffentlicht wurde.
Seine Frau hingegen war eine leidenschaftliche Leserin. Sie hatte Germanistik und einige Semester Anglistik studiert und war mit dem Verlagsleiter für die künstlerische Ausrichtung verantwortlich. Ich glaube, Brechbühl wollte ihr einen Gefallen tun, als er damals den Verlag gründete.
Dorothea kannte alles, was in den letzten zwanzig Jahren an interessanter Literatur erschienen war. Ihr Leben drehte sich ausschliesslich um Bücher. Ich hatte manchmal den Eindruck, dass sie darüber jeden Realitätssinn verloren hatte. Ihre Empfehlungen aber waren höchstes Leseglück. Bücher, die einem den Schlaf raubten.
Es schmeichelt mir noch heute, dass sie es war, die auf mich aufmerksam geworden war. Sie hatte mich vor einigen Jahren an einem Literaturfest lesen gehört, in dessen Vorprogramm ich nur Dank eines glücklichen Umstandes gerückt war. Ich durfte an Stelle einer Kollegin lesen, deren Erstling, soeben bei der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen, ein durchschlagender Erfolg war, weshalb ihr die Veranstalter einen Platz im Abendprogramm einräumten.
Meine zwei bisherigen Romane waren von der Kritik zwar mehrheitlich wohlwollend aufgenommen worden; kaufen gingen die Leute sie trotzdem nicht. Auch die anderen Autoren – einige Lyriker, ein paar schwer verdauliche Prosaisten und ein publikumsbeschimpfender Slammer – waren nicht gerade mehrheitsfähig. Brechbühl schien aus irgendwelchen Gründen einen Publikumserfolg zu benötigen – wahrscheinlich aus Eitelkeit.
Ich hatte keine Ahnung, wie man einen Krimi schreibt. Krimis interessierten mich nicht. Ich las keine und wollte auch keine schreiben. Ich gab Brechbühl zu verstehen, dass ich mich gegen jede Einschränkung meiner künstlerischen Freiheit verwahre. Ich würde beim Schreiben ästhetische, vielleicht noch ethische Gesichtspunkte berücksichtigen und keinesfalls irgendwelche profanen Marktanalysen, ereiferte ich mich.
Ich wusste, solange seine Frau im Verlag die Fäden zog, hatte ich nichts zu befürchten. Brechbühl wusste das auch und liess es dabei bewenden, nochmals auf die Verkaufszahlen hinzuweisen, die kaum einen Viertel der Auflage rechtfertigten. Ich hatte damals gegen seinen Willen auf fünftausend Exemplaren bestanden, weil alles darunter, so argumentierte ich, vorauseilendem Gehorsam gegenüber dem Markt gleichkäme.
Gleichwohl gab mir unser Gespräch zu denken. Abgesehen davon, dass ich es nicht mochte, von einem wie Brechbühl Tipps zu erhalten, hätte ich ihm ja gern bewiesen, dass ich durchaus etwas schreiben kann, das sich auch absetzen lässt.
So liess ich mich im neuen Telefonbuch unter falschem Namen als Privatdetektiv eintragen. Keine Ahnung, was ich mir dabei dachte. Vielleicht hielt ich das für eine Art, Nachforschungen anzustellen. Um einen Krimi zu schreiben, brauchte ich geeigneten Stoff, und den musste ich mir ja irgendwoher besorgen.
Lange geschah nichts. Meine Bekannten wunderten sich, weshalb ich neuerdings nur noch ein fragendes «Ja?» am Telefon vernehmen liess. Dann, eines Tages meldete sich eine Männerstimme.
«Spreche ich mit Herrn Arnold?»
«Jawohl, am Apparat.» Ich war aufgeregt.
Der Mann zögerte: «Kann ich mich auf Ihre Diskretion verlassen?»
«Absolut, das gehört zur Branche wie die Pfeife zum Holmes!»
«Wie bitte?»
«Ich wollte damit sagen, dass Sie sich vollkommen auf meine Diskretion verlassen können.»
«Gut, es geht nämlich um eine sehr delikate Angelegenheit …»
«Nur frisch von der Leber damit.»
Der Mann räusperte sich. «Es handelt sich um meinen Lebenspartner …»
«Ihren Lebenspartner.»
«Ich glaube, er betrügt mich. Ich kann es zwar nicht beweisen, aber ich bin mir ziemlich sicher.»
«Ja?»
«Sie sollen mir den Nachweis erbringen. Wenn es stimmt, dass er mich betrügt, setz ich ihn sofort auf die Strasse. Ich will aber nichts unternehmen, bevor ich nicht Gewissheit hab. Ich würde mich gern mit Ihnen treffen, dann kann ich Ihnen weitere Informationen geben.»
Ich überlegte, ob das wirklich der Stoff war, aus dem man Krimis schreibt.
«Hallo?»
«Ja, mh, wissen Sie … Ich muss Sie leider enttäuschen. Beschattungen gehören nicht zu meinen Kernkompetenzen. Wenn Sie sich bitte an meinen Kollegen wenden würden? Warten Sie, ich geb Ihnen die Nummer.»
Ich schlug im Telefonbuch nach und nannte ihm den Namen und die Nummer des Privatdetektivs, der in seinem Eintrag auch das Wort Observationsdienstleistungen aufführte. Der Mann bedankte sich und legte auf.
Es verging über eine Woche bis zum nächsten Anruf. Diesmal war es eine Frau.
«Guten Tag. Herr Arnold?»
«Exakt, so heisse ich.»
«Kann ich mich auf Ihre Verschwiegenheit verlassen?»
«Keine Frage!»
«Es ist in der Tat unabdingbar, wissen Sie. Mein Gemahl ist nämlich Anwalt, ein vielbeschäftigter Mann … Er darf von unserem Gespräch nichts erfahren.»
«Machen Sie sich keine Sorgen, von mir erfährt ers nicht.»
Sie wurde plötzlich misstrauisch. «Sind Sie schon lang in dem Beruf tätig?»
«Ich hab mich vor drei Jahren selbständig gemacht. Zuvor war ich bei der Polizei.»
«Gut. Hören Sie, es handelt sich um unsere Haushaltshilfe. Kolumbianerin. Sie stiehlt. Zuerst nur kleine Sachen, eine Gabel, eine Packung Spaghetti. Mittlerweile ist sie zu Wertvollerem übergegangen. Eine Flasche Wein, eine seltene Blumenvase. Ich hab sie zur Rede gestellt. Wissen Sie, was sie darauf geantwortet hat?»
Weil ich nicht gleich begriff, dass das eine rhetorische Frage war, sagte ich: «Nein?»
«Sie meinte, sie benötige mehr Lohn!»
«So was …»
«Wenn man bedenkt, wie viel ehrliche Menschen froh wären, überhaupt eine Arbeit zu haben … Doch das tut hier nichts zur Sache. Ich und mein Gemahl sind entschlossen, sie zu entlassen. Aber zuvor möchte ich die Vase zurück. Ihre Aufgabe ist es, diese ausfindig zu machen und mir zurückzubringen.»
«Weshalb gehen Sie nicht zur Polizei?»
Die Frau wechselte in die nächsthöhere Oktave: «Aber dann würde sie ja unverzüglich des Landes verwiesen! Sie ist halt ohne Papiere hier … Hören Sie, wir sind doch keine Unmenschen. – Wann können wir uns treffen?»
«Wegen einer Vase?»
«Ich hab Ihnen bereits gesagt, dass sie selten ist. Ein Erbstück meines Gemahls. Ich bezahle im Voraus, und wenn Sie die Vase zurückbringen, erhalten Sie den restlichen Betrag.»
Ich stellte mir vor: «Die Vasendiebin». Das reichte nicht mal für eine Kurzgeschichte.
«Es tut mir leid, aber zur Zeit bin ich voll und ganz ausgelastet. Wenn Sie sich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt an mich wenden möchten …»
«Warum sagen Sie das nicht gleich von Anfang an?!»
«Sie haben mich nicht danach gefragt.»
Einige Tage später hatte ich wieder jemanden am Telefon.
«Ja?»
«Hallo!»
«Ja?»
«Sie sein Privatdetektiv?» Der Mann sprach mit unverkennbar slawischem Akzent.
«Jawohl, Arnold, Privatdetektiv.»
«Sie missen kommen. Treffen mit mir. Noch heute!» Die Stimme klang nicht unfreundlich, trotz der imperativen Wortwahl.
«Worum gehts denn?»
«Nicht am Telefon. Ich will sprechen mit Sie an Tisch. Heut abend, sechs Uhr. Im Dancing Bahnhefli. Sie kennen?»
«Ja, ich weiss wo. Und woran erkenn ich Sie?»
«Sie fragen bei Frau von Bar – Zoran Slavković!»
«Gut, dann werd ich um sechs dort sein.»
Der Mann hatte bereits wieder aufgelegt.
Es regnete, als ich kurz nach sechs die Wohnung verliess. Zum «Bahnhöfli» war es nicht weit. Ich ging zu Fuss, unter aufgespanntem Regenschirm, die Gerliswilstrasse hinunter. Durch die Strassenschlucht defilierte der Feierabendverkehr, Autoreifen zischten, Scheinwerfer blendeten.
Ich kam an der neuen Tankstelle vorbei, die ihre Umgebung in ultraviolettes Licht tauchte – als ob man irgendwelche Fixer an der Ausübung ihrer Sucht hindern wollte –, und zweigte in die Bahnhofstrasse ab. Beim Kebabstand, wo es die beste Joghurtsauce im ganzen Kanton gab, waren einige Gestalten unter dem Vordach versammelt.
Das Restaurant war leer bis auf die Bahnarbeiter, die Eistee tranken, und drei sich anschweigende Männer am Stammtisch. Die Kellnerin hatte sich hinter der Kaffeemaschine verschanzt. Ich grüsste mit einem knappen Nicken und ging weiter zur Treppe, die ins Untergeschoss führte. Hier waren die Toiletten, der Zigarettenautomat und am Ende des Korridors das Dancing.
Der Raum war nur spärlich beleuchtet. Ich ging auf Teppich. Deutscher Schlagerpop troff aus den Lautsprechern. In einer Nische sassen eine junge Osteuropäerin und ein Mann mit Schnauz. Sie beachteten mich nicht. Soweit ich erkennen konnte, waren sie die einzigen Gäste. Auf der kleinen Bühne neben der Bar standen ein Keyboard, zwei Barhocker und ein Mikrofonständer. Die Frau hinter dem Ausschank sah mir müde entgegen. Sie war weit über dreissig und stark geschminkt. Ich ging auf sie zu und sagte, ich sei mit Herrn Slavković verabredet. Sie wies mit einer kurzen Kopfbewegung auf eine dunkle Ecke.
Erst jetzt erkannte ich, dass dort noch jemand sass. Ich sah das Aufglimmen der Zigarettenglut und kurz darauf die filigrane Rauchsäule, die das verstreute Licht einer Spotlampe einfing.
«Sie kommen zu spät, fünfzehn Minuten!», sagte er, wobei er fünfzehn wie finfzehn aussprach und dazu mit dem Zeigfinger auf seine Armbanduhr klopfte.
Ich setzte mich und sagte: «Tut mir leid, ich wurde aufgehalten.»
Ohne sich abzuwenden, griff er mit der linken Hand hinter sich und schaltete eine Lampe ein, die über seinem Kopf an der Wand hing. Dann musterte er mich, was ich umgekehrt ebenfalls zu tun versuchte. Aber er war eindeutig im Vorteil. Was ich im Gegenlicht erkennen konnte, war, dass Slavković einen aussergewöhnlich grossen Kopf hatte. Die Haare waren militärisch gestutzt, sein Kinn fliehend, seine ganze Gestalt wirkte massig. Er trug einen dunklen Anzug, dunkles Hemd und eine violette Krawatte. Es fiel mir schwer, die geckenhafte Bekleidung mit seinem vulgären Gesichtsausdruck zusammenzubringen.
«Sie sind jung, sehr jung.»
Ich erwiderte nichts.
«Sind Sie so gut, wie Sie meinen?»
«Ich bin der Beste!», versuchte ich schlagfertig zu sein.
«Gut. Nur die Besten können zu spät kommen. Ich kann meine Zeit nicht mit jungen Schweizerburschen verschwenden. Verstanden!?»
Die Kellnerin war an unseren Tisch herangetreten. Slavković bestellte dasselbe wie zuvor – irgendwas Hochprozentiges –, ich ein Bier.
Er drückte die Zigarette, die er bis fast zum Filter heruntergeraucht hatte, im Aschenbecher aus. Dann leerte er den Inhalt des halbvollen Glases in einem Zug.
«Ich werde bedroht, von anonyme Schweinehund!», begann er schliesslich. «Ich habe Briefe bekommen, worin steht, dass man mich töten will.» «Töten» sprach er wie «teten» aus, was ein wenig lächerlich klang. Er kniff die Augen zusammen und setzte hinzu: «Sie müssen herausfinden, wer diese Briefe geschrieben hat!»
Er unterbrach sich, während die Kellnerin die Getränke hinstellte. Nachdem sie sich lautlos auf dem schweren Spannteppich entfernt hatte, fragte ich: «Haben Sie die Briefe bei sich?»
Er griff mit der Rechten in die Innentasche seines Sakkos und nahm drei zusammengefaltete Couverts hervor. Einen Augenblick lang behielt er sie zwischen seinen dicken Fingern, als müsse ers sich noch einmal überlegen, ob er sie mir aushändigen sollte.
Ich sah mir die Couverts an. Sie waren mit einer alten Schreibmaschine adressiert, ein Absender fehlte. Slavković wohnte in einem ruhigen Aussenquartier, wo sich die Vermögenden ihre Einfamilienhäuser hinstellten. Den Poststempeln entnahm ich, dass sie im Abstand von wenigen Tagen bei der Hauptpost in Emmenbrücke aufgegeben worden waren. Ich öffnete den ersten Umschlag. Die Zeilen waren am Computer geschrieben worden, trotzdem konnte ich kein Wort lesen. Der Text war in kyrillischer Schrift verfasst. Ich sah auch die anderen Briefe durch. Dasselbe Bild. Ich legte sie hin und blickte auf.
«Was steht da drin?»
«Dass sie mich töten wollen!»
«Wer?»
«Wenn ich das wüsste, wäre ich nicht mit Ihnen hier!»
Slavković steckte sich eine weitere Zigarette an; ich folgte seinem Beispiel. Er gab mir Feuer.
«Warum gehen Sie nicht zur Polizei?»
Er sah mich an, als wäre ich nicht ganz normal. «Polizei nicht gut. Machen immer Probleme. Sind alles Rassisten, verstehen Sie?»
Ich nickte. «Haben Sie einen Verdacht?»
Er stiess den Rauch durch die Nase aus. «Schwierig. Ich habe viele Neider hier, weil ich viel Erfolg habe.»
«Aber es müsste einer Ihrer Landsleute sein, der Ihre Sprache spricht.»
«Sicher! Vielleicht ein Türkenschwein.»
«Wie bitte?»
«Sie wissen, was ich meine: Ein Moslem – Kosovare, oder ein Bosniake.»
«Wie kommen Sie darauf?»
«Weil sie die Serben hassen, besonders, wenn sie Erfolg haben!»
«Und Sie glauben, weil Sie ein erfolgreiches Reisebüro führen, wollen diese Leute Sie einschüchtern?»
«Warum wissen Sie das vom Reisebüro?»
Ich blies den Rauch gemächlich in den Lichtkegel. «Nachforschungen …»
Slavković verzog sein feistes Gesicht zu so was wie einem Grinsen. «Sie sind gut. Sie sind der richtige Mann für mich.» Erneut griff er in seinen Sakko und holte ein weiteres Couvert hervor. Er legte es auf den Tisch.
«Sie finden heraus, wer die Briefe geschrieben hat. Wenn Sie wissen wer, Sie bekommen den Rest von dem Geld. Hier meine Telefonnummer.» Er notierte eine Zahlenreihe auf das Couvert und schob es mir zu. Dann gab er seiner Stimme einen bedrohlichen Unterton: «Aber wenn Sie den Schweinehund nicht finden, geben Sie alles Geld zurück!» Er drückte mir die Hand und stand auf.
Ich war überrascht, wie klein er war. Er war beinahe breiter als hoch. Er klapste mir auf die rechte Schulter und verliess den Raum. Dabei gab er der Barfrau ein Zeichen. Sie nickte und notierte sich was.
Ich ging mit der halbvollen Tulpe an die Theke und sah mich um. Das Paar war verschwunden. Sonst waren keine neue Gäste gekommen.
Ich fragte die Frau, die in einer Illustrierten blätterte, ob es hier dienstags immer so ruhig sei.
«Die Leute kommen erst später, so gegen neun Uhr», sagte sie, ohne von ihrem bunten Magazin aufzusehen.
Ich trank aus und wollte bezahlen.
Das gehe aufs Haus, sagte sie.
«Sie wollen sagen, auf Herrn Slavkovićs Rechnung?»
Sie runzelte die Stirn. «Mhm, schon möglich …»
Ich verliess das «Bahnhöfli» direkt durch die Tür auf der Hinterseite des Gebäudes.
Zu Hause öffnete ich das Couvert. Zweitausend Franken war Slavković die Identität des anonymen Verfassers wert.
Ich kannte Adnan aus der Zeit, als ich noch Sport trieb. Wir spielten zusammen beim FC von Moos. Adnan war unser Starstürmer, ich wurde in der Verteidigung geduldet. Nach dem Training gingen wir jeweils in den «Adler», die ganze Gruppe. Ich gehörte mit Adnan zusammen zum harten Kern. Was ich auf dem Platz nicht zu leisten vermochte, machte ich hier mit meinen Sprüchen wett. Das konnte auch mal in eine Prügelei ausarten, etwa wenn wir den Stammtisch provozierten. Aber meistens waren die zu sehr damit beschäftigt, miteinander zu zanken und gegen Ausländer, den Staat und was auch immer zu wettern. Johnny, der Wirt mit dem unerschöpflichen Fundus an Witzen, die aber nur komisch waren, wenn er sie zum Besten gab, wusste jedenfalls genau, an welchem Wochentag wir Training hatten. Er musste dann öfter, als ihm lieb war, von seinem Platz aufstehen, um den Kellnerinnen zu Hilfe zu eilen, die selten genug die Probezeit durchielten. Nachdem nämlich Ulla, seine langjährige Kellnerin mit den Eigenschaften einer Dompteuse, aus ungeklärten Gründen gekündigt hatte, fand er nie mehr einen vollwertigen Ersatz. Ullas Verschwinden hatte gleichsam den Niedergang des verrufenen Spuntens mit seinen berüchtigten Hardrock-Konzerten hinten im Saal eingeleitet.
Nach der Matura versuchte sich Adnan im Profifussball. Er wechselte vom FC Emmenbrücke zu Kriens, wurde von Luzern unter Vertrag genommen und kickte für eine Saison beim FC Zürich, bevor er wieder zu Emmenbrücke zurückkehrte und mit dem Sportstudium begann.
Wir hatte uns im «Central» verabredet. Vor einigen Monaten war im «Adler» der absehbare Pächterwechsel erfolgt. Der Neue versuchte die Patrioten zu bedienen, indem er an den Wochenenden Schwyzerörgeli aufbot und die AC/DC-Scheiben aus der Jukebox entfernte.
Als ich im «Central» eintraf, sass Adnan bereits an einem Tisch und unterhielt sich mit der Kellnerin. Sie war etwas älter als wir und sah gar nicht mal schlecht aus.
Wir begrüssten uns mit dem FCVM-Handschlag. Ich setzte mich und bestellte eine Flasche Bier. Die Kellnerin bedachte Adnan mit einem vorläufigen Lächeln und ging zum Ausschank.
Adnan war ein Charmeur. Ich hatte ihn deswegen oft beneidet. Aber er war keiner, der einen in Gegenwart attraktiver Frauen anders behandelte. Wenn er merkte, dass es mir jemand angetan hatte, hielt er sich vornehm zurück. Freilich nützte das nicht viel. Am Ende interessierten sich die Mädchen doch nur für ihn. Ich führte das neben seinem guten Aussehen – blond, blaue Augen, gewinnendes Lächeln – auf sein humorvolles und spontanes Wesen zurück, das nicht zuletzt ja auch mich für ihn einnahm.
Nachdem wir einander zugeprostet hatten, fragte ich Adnan geradeheraus, ob er die kyrillische Schrift lesen könne.
«Ich habs mal im Serbokroatisch gelernt. Ist aber lang her. Warum?»
«Ich hab hier drei Texte, von denen ich gern wüsste, was sie bedeuten.»
Ich reichte ihm die Briefe. Adnan betrachtete den ersten und runzelte die Stirn. Nach einer Weile blickte er verwundert auf.
«Ich glaub, ich kanns noch einigermassen. Wo hast du die her?»
«Später … Kannst dus übersetzen?»
«Mal schauen …»
«Moment …» Ich gab der Kellnerin ein Handzeichen. Sie kam lächelnd näher. Ob sie mir einen Kugelschreiber leihen könne, fragte ich.
Sie wiegte sich in den Hüften, schmunzelte und sah dabei Adnan an. «Wenn du mich nicht mehr siezen tust! Ich komm mir nämlich sonst so alt vor.»
Ich erklärte mich damit einverstanden, nahm den Kugelschreiber entgegen und sah ihr nach, während sie sich entfernte. Adnan grinste, nahm einen kräftigen Schluck und schob das Glas zur Seite.
«Also hier steht … Moment, ich bin nicht mehr so geübt darin … Also der erste Satz: Die Welt ist … ist überfüllt mit – wie sagt man dem auf Deutsch? Dreck? Schmutz? Abschaum? … Also, noch einmal: Die Welt ist überfüllt mit Abschaum. Odasvud! – Von überall her.»
«Die Welt ist überfüllt mit Abschaum von überall her?»
«Nach Schmutz kommt ein Punkt.»
«Schreibs auf, darüber.»
Ich gab ihm den Kugelschreiber. Er kritzelte mit seiner ungelenken Schrift über den kyrillischen Zeichen.
Ich steckte mir eine Zigarette an.
«Hast du mir auch eine?»
«Ich dachte, du hast damit aufgehört?»
«Hab ich auch.»
Ich gab ihm Feuer.
«Also, und darunter steht: Ja, Bosnien ist das Land des Hasses.»
«Aufschreiben.»
Wieder schrieb er.
«Soll ich weitermachen?»
«Ja, bitte.»
«Von ihm verbreitete sich … širio oštar zadah ranjene zverke … der scharfe Geruch … einer verletzten Bestie?»
«Einer verwundeten Bestie», schlug ich vor.
Adnan schrieb. Dann griff er nach seiner Zigarette, die in einer der Rillen des Aschenbechers steckte, und zog daran.
«Und weiter?»
«Das ist alles.»
«Also gut – der nächste Brief.»
«Was soll das bedeuten?»
«Ich erklärs dir gleich.»
Adnan nahm noch einen Zug und klemmte die Zigarette wieder in die Rille.
«Hier steht … Wie sagt man dem … nicht Pater, sondern …»
«Pfarrer?»
«Nein …»
«Priester, Abt, Dekan?»
«Neinnein, das was unter dem Pater ist …»
«Unter dem Pater? … Du meinst Bruder.»
«Ja genau, Bruder. Okay: Bruder Radomir konnte nicht sprechen, weil sein Mund voll Blut war …»
Adnan schrieb. Nachdem er auch den letzten Brief übertragen hatte, reichte er ihn mir. Ich las noch einmal alle Sätze durch. «Die Welt ist überfüllt mit Abschaum. Von überall her.» – «Ja, Bosnien ist das Land des Hasses.» – «Von ihm verbreitete sich der scharfe Gestank einer verwundeten Bestie.» – «Bruder Radomir konnte nicht sprechen, weil sein Mund voll Blut war.» – «Nun warteten wir auf die ungewisse Ankunft des Zugs nach Foča.» – «Er richtete sie hin zu der Seite, wo Vuković stand, und drückte ab.» – «Da wurden ihnen die Köpfe abgeschnitten und auf Pfähle gesteckt.» – «Ihre Körper aber warf man von der Brücke in die Drina.» – Und zum Schluss noch einmal der Satz «Ja, Bosnien ist das Land des Hasses.»
Ich blickte auf. Adnan sah mich fragend an.
«Würdest du mir jetzt bitte erklären, was das Ganze soll?»
«Stell dir vor, du bekämst diese drei Briefe zugeschickt. Ohne Absender, ohne Unterschrift. Was würdest du denken?»
«Ich weiss nicht …»
«Komm schon, versetz dich in die Lage!»
Adnan nahm einen Schluck.
«Nun?»
«Ich würde denken, dass mich jemand bedrohen möchte.»
«Siehst du, genau das hat der Empfänger auch gedacht.»
«Aber was sollen diese seltsamen Sätze?»
«Es sind Zitate.»
«Zitate?»
«Erkennst du keines?»
«Du bist hier der Literat.»
Ich trank und behielt das Glas in der Hand: «Ich glaube, sie stammen von Ivo Andrić.»
«Du meinst das mit den Leichen, die sie in die Drina werfen.»
«‹Die Brücke über die Drina›, genau. Dafür hat er den Nobelpreis erhalten.»
Ich erzählte Adnan von meinem Gespräch mit Brechbühl und dass ich mich als Privatdetektiv ins Telefonbuch hatte eintragen lassen. Als der Name Slavković fiel, horchte er auf.
«Kennst du ihn?»
«Ich weiss, wer er ist. Er hat ein Geschäft, das Busreisen auf den Balkan organisiert. Man kann bei ihm auch Geld überweisen, glaub ich. Mein Vater behauptet, er habe mit Drogen und Prostitution zu tun.»
«Ah ja?», fragte ich interessiert.
Adnan winkte ab. «Du kennst doch meinen Vater, für ihn haben seit dem Krieg alle Serben irgendwas mit dem organisierten Verbrechen zu tun.»
Ich erkundigte mich, ob Adnans Familie auch schon bei Slavković gebucht habe. Er verneinte. Seit sein Vater ein Auto habe, seien sie jeweils selbst gefahren.
«Und zuvor?»
«Zuvor haben wir bei Taliqi gebucht.»
«Wie heisst der?»
«Taliqi, Mehmet Taliqi. Kosovare, er lebt schon lange hier. Mein Vater lässt über ihn Geld an die Verwandten in Bosnien zukommen.»
Ich schrieb mir den Namen auf.
Nach und nach kamen wir auf andere Dinge zu sprechen. Wir tranken noch einige Flaschen Bier, und Adnan half mir eine Schachtel Zigaretten leeren. Die Kellnerin, die sich zwischendurch zu uns setzte und plauderte, wurde von Viertelstunde zu Viertelstunde hübscher. Es wurde trotzdem nicht zu spät. Adnan musste anderntags früh zum Training.
Ich betrat den Raum und sah mich um. Endlich hatte ich sie gefunden: Sie hatte sich an die Wand gelehnt und schien mich erwartet zu haben. Ich ging auf sie zu. Sie lächelte wissend, ihr Gesicht war ganz nah. Ihre Augenlider sanken wie Rollläden an heissen Tagen, ihre Lippen schimmerten feucht.
Plötzlich begann sie aus unerfindlichen Gründen zu schreien. Sie brüllte aus voller Kehle und hatte die Augen weit aufgerissen. Während sie diesen scheusslichen Schrei zum dritten Mal ausstiess, merkte ich, dass das Telefon klingelte. Ich blieb liegen und harrte aus, bis der Beantworter einschaltete. Dann drehte ich mich auf die andere Seite und versuchte dort anzuknüpfen, wo ich unterbrochen worden war. Als ihr Gesicht im Nebel der Imagination allmählich Gestalt annahm, begann das Telefon erneut zu klingeln. Ich drehte mich auf den Rücken, weigerte mich aber, die Augen zu öffnen. Vielleicht gabs einen Schalter, womit ich den Klingelton verändern konnte. Oder wenigstens die Lautstärke. Beim dritten Anruf stand ich auf.
«Ja?», fauchte ich.
«Hab ich dich geweckt?»
«Was willst du?»
«Es ist bereits halb elf.»
«Na und?»
«Ich bin seit vier Stunden auf …»
«Na und?»
«Ich komm gerade vom Training. Ein wunderschöner Tag – kein Wölkchen am Himmel. Einen so schönen Morgen verbringt man doch nicht im Bett!»
Ich hatte nie begriffen, wie Frühaufsteher zu ihrem Selbstverständnis kamen. Mir wäre es ja auch nicht in den Sinn gekommen, jemanden um zwei in der Früh anzurufen, nur weil die Sterne gerade so schön funkelten.
«Was willst du?»
«Ich sitze im ‹Gerliswil›, trinke einen Kaffee, blättere dazu die Zeitung wie üblich von hinten durch und – rat mal, worauf ich da stosse!»
Ich war inzwischen mit dem verknoteten Kabel von der Küche ins Schlafzimmer gelangt, hatte das Gerät neben die Matratze gestellt und die Decke bis ans Kinn hochgezogen.
«Keine Ahnung, vielleicht verrätst dus mir ja …»
«Ich blättere also die Seiten um, überfliege dies und das, komme zum Regionalteil und – du wirst nicht glauben, was ich da lese …»
Ich gähnte und prüfte, ob die Sprechmuschel in meinen Mund passte.
«Mord in Emmenbrücke! So die Überschrift. Im Rotlichtmilieu, geschehen vorgestern Nacht. Und jetzt das: Es handelt sich um einen Mann aus Exjugoslawien, wie sich die Pressefritzen ausdrücken. Er wurde enthauptet.»
«Enthauptet?!» Ich hatte mich im Bett aufgerichtet.
«Jawohl, enthauptet. Ist das nicht unglaublich?»
«Scheisse! Scheisse. Und du erzählst keinen Mist?»
«Mit so was spass ich nicht. Kannst es ja nachlesen. Du bist doch Abonnent.»
«Ja, ich …» Ich war hellwach. «Weisst du was, ich ruf dich später zurück.» Ich legte auf und stieg in die Jeans, die über der Stuhllehne hingen. Dann streifte ich mir ein T-Shirt über und ging barfuss das Treppenhaus hinunter. Der Hauswart war ein seit über zwanzig Jahren in der Schweiz lebender, überassimilierter Kroate, und ich hätte auf den Stufen mein Konfibrot streichen können, so sauber waren sie.
Noch im Treppenhaus überflog ich die Schlagzeilen. «Mord in Emmenbrücke» stand dick auf der Frontseite geschrieben. Ich blätterte weiter. Auf der ersten Seite des Regionalteils fand ich den kurzen Beitrag. Ich schloss die Tür und las im Stehen. «Die Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt. Die Polizei geht von einer Abrechnung im Milieu aus.» Ich hatte keine Zweifel. Es musste sich um Slavković handeln!
Ich setzte mich an den Küchentisch und zündete mir eine Zigarette an. Meine Hände zitterten, meine Gedanken wirbelten konzeptlos durcheinander. Endlich gelang es einem, sich von den anderen abzusetzen: Slavković musste nur wenige Stunden, nachdem ich ihn im «Bahnhöfli» getroffen hatte, ermordet worden sein.
Ich war überrascht, als mir Frau Slavković öffnete. Ich hatte ein verweintes Häufchen Elend erwartet, das kaum ein Wort hervorbrachte, ohne in Tränen auszubrechen. Statt dessen stand ich einer gefasst wirkenden, korpulenten Frau gegenüber, die kurz abwesend lächelte, als ich mich vorstellte.
«Kommen Sie herein – die Polizei war heute auch schon hier», sagte sie in gutem, nahezu akzentfreiem Hochdeutsch.
Ich folgte ihr ins Wohnzimmer.
Eine breite Fensterfront gab den Blick auf den Pilatus und die östlich anschliessenden Firste der Voralpenkette frei. Auf der anderen Seite der Weide, die unmittelbar an die Einfamilienhäuser anschloss, waren der Bauernhof und eine alte Arbeitersiedlung der Eisenwerke zu erkennen.
«Möchten Sie einen Kaffee?»
Als ich vor Jahren zum ersten Mal bei Adnan zu Hause war, hatte ich, als mir seine Mutter ein Stück Kuchen anbot, aus Höflichkeit abgelehnt. Sie solle sich keine Umstände machen, hatte ich gesagt. Dass ich sie damit beleidigte, wurde mir erst bewusst, als mich Adnan nachträglich darauf aufmerksam machte. Seither schlug ich einer südslawischen Gastgeberin nach Möglichkeit nichts mehr aus.
Frau Slavković ging aus dem Zimmer. Kurz darauf hörte ich sie in der Küche hantieren.
Ich sah mich im Wohnzimmer um. Eine wuchtige, dunkel lackierte Wohnwand, darauf allerlei Kleinkram, Fotografien und eine Menge Bücher. Ich studierte die Titel der Werke, zog wahllos eines hervor, blätterte darin und stellte es wieder zurück. Manche waren in kyrillischer Schrift, die meisten aber in lateinischer. Darunter solche in englischer, französischer, italienischer und deutscher Sprache. Letztere war durch kein geringeres als «Das Kapital» vertreten.
Auf den glatten Marmorfliesen lag ein orientalischer Teppich. Der niedere Glastisch flankiert von zwei schwarzen Armsesseln und längs dazu – an der Wand – ein ebensolches Sofa. Dar über im goldenen Rahmen eine kitschig kolorierte Fotografie, die ein Brautpaar zeigte. Die Frau war etwas grösser als der Mann, auch schien sie älter zu sein. Der Bräutigam blickte aus glasigen Augen und so, als wisse er nicht genau, wozu er fotografiert wird. Es handelte sich zweifelsohne um Zoran Slavković in jüngeren Jahren. Der Gedanke an sein grausiges Ende machte mich schaudern. Ein anderes Bild zeigte eine naturalistische Darstellung eines Fischerdorfs. In der Wohnung roch es eigenartig, nach künstlichem Vanilleduft oder ähnlich – nach den Duftbäumchen, die sich die Leute in die Autos hängen.
Als Frau Slavković mit dem Kaffee aus der Küche kam, setzten wir uns an den Couchtisch. Ich war ein wenig enttäuscht, statt eines türkischen den üblichen Maschinenkaffee serviert zu bekommen. Für sich selbst hatte sie einen Früchtetee gemacht. Ich wartete vergeblich darauf, ihr Blick, der auf ihren rotlackierten Fingernägeln ruhte, würde sich mir zuwenden.
«Ich möchte Ihnen mein herzliches Beileid aussprechen …»
Sie reagierte nicht.
«Ich kannte Ihren Mann nicht gut, ich hatte ihn gerade ein einziges Mal gesehen – vermutlich an dem Abend, als er …» Ich unterbrach mich, denn Frau Slavković hatte ihre kalten Augen auf mich gerichtet.
Sie erinnerte mich ein wenig an Mira Marković, Miloševićs Frau. Wie diese trug sie ihr schwarzes Haar zu einem Pony geschnitten. Tatsächlich hatte ich unter den Büchern eine Autobiografie von Mira Marković entdeckt. Frau Slavkovićs Gesichtszüge waren nicht ganz so hart, aber sie war bestimmt noch bleicher als die einflussreiche Präsidentengattin.
Ich zog die Couverts aus meiner Jackentasche und legte sie auf den Tisch. «Ihr Mann, wie Sie sicher wissen, hat mich beauftragt, die Person ausfindig zu machen, die ihm diese Drohbriefe geschrieben hat. Leider bin ich nicht sehr weit gekommen …» Ich räusperte mich.
«Selbstverständlich erstatte ich Ihnen die Anzahlung zurück, die er mir gegeben hat. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie unangenehm es mir ist … Wie sehr ich es bedaure, dass ich diese schreckliche Tat nicht verhindern konnte … Ich hoffe, die Polizei kriegt den Mörder schon bald zu fassen …»
«Die Polizei …», murmelte Frau Slavković.
Ich sah sie aufmerksam an.
«Die Polizei? Die Polizei war schon hier. Ich …» Sie richtete sich in ihrem Sessel auf. «Ich meine, was machen sie dann mit dem Mörder? Stecken ihn in eine Zelle mit Tageslicht, Farbfernseher und Bad.» Sie bewegte den Kopf langsam hin und her. «Neinnein – behalten Sie das Geld. Finden Sie heraus, wer die Briefe geschrieben hat. Ich gebe Ihnen das Doppelte von dem, was Zoran Ihnen versprochen hat.»
Ich dachte einen Moment nach. Ich fürchtete, das Ganze könnte mir über den Kopf wachsen. Noch sass mir der Schreck über den grausamen Mord in den Gliedern. Zugleich war mir bewusst, dass ich mir wohl kaum eine spannendere Ausgangslage für einen Krimi hätte ausdenken können.
«Und dann, was beabsichtigen Sie?», nahm ich das Gespräch wie der auf.
Ein seltsames Lächeln huschte über ihr Gesicht: «Lassen Sie das meine Sorge sein.»
Ich schob meine Zweifel beiseite. Wir einigten uns auf das neue Honorar, ich liess mir die wöchentliche Deckung der Spesen zusichern und versprach, sie regelmässig über den Stand der Ermittlungen zu informieren.
Zum Schluss fragte ich sie nach verdächtigen Personen. Sie dachte lange nach, öffnete ein paar Mal den Mund, sagte dann aber doch nichts.
«Ihr Mann war überzeugt, er habe viele Neider. Vor allem unter den bosnischen Muslimen und den Kosovaren. Können Sie mir darüber etwas sagen?»
«Schon möglich. Wer Erfolg hat, hat auch Neider.»
«Aber wer könnte an seinem Tod ein Interesse haben?», versuchte ich mich verständlich zu machen.
«Die Person, welche die Briefe geschrieben hat!», sagte sie bestimmt.
Ich überlegte. «Was ist mit Mehmet Taliqi – sie waren immerhin direkte Konkurrenten?»
Sie zuckte mit den Achseln. «Das glaube ich nicht. Mein Mann war zwar nicht gut auf ihn zu sprechen. Aber es gab doch genug Arbeit für beide.»
Ein Schweigen trat ein. Frau Slavkovićs Blick ruhte wieder auf ihren Händen. Ich wartete eine Weile, bevor ich sagte: «Mir ist da zu Ohren gekommen, ihr Mann habe schmutziges Geld investiert, Geld aus dem Drogenhandel …»
«Keine Ahnung.»
«Glauben Sie, dass was Wahres dran ist?»
Ihr Augen wurden zu schmalen Schlitzen. «Fragen Sie mich nicht. Mein Mann hat niemals mit mir über seine Geschäfte geredet.»
Ich versuchte abzuschätzen, wie weit ich gehen durfte. «Ich meine, hätten Sie Ihrem Mann etwas in der Art zugetraut …» Ich erschrak, weil sie ein unmenschliches Zischen ausstiess, und fügte beschwichtigend hinzu: «Oder dürfte es sich dabei um Rufmord handeln – Lügen, die in die Welt gesetzt werden, um Ihren Mann schlechtzumachen?»
Noch während ich sprach, spürte ich, dass ich gegen eine Wand redete. Ihr Blick ging durch mich hindurch, ihr Körper hing schlaff im Sessel.
Ich atmete auf, als die Tür hinter mir ins Schloss fiel. Ich beschloss, einen Umweg zu machen, und kam über den Abstieg durch den Wald zur Hinter-Emmenweid. Entlang der Emme an verrussten Fabrikhallen und verschachtelten Produktionsgebäuden vorbei gelangte ich zurück ins Stadtzentrum. Ich hatte Hunger und genügend Geld in der Tasche und beschloss, im Migrosrestaurant zu Mittag zu essen. Ich stellte mir ein Menü aus panierten Schnitzeln, Teigwaren und Gemüse zusammen, bezahlte an der Kasse, griff mir die «Neue Luzerner Zeitung» und den «Blick» und setzte mich an einen Tisch bei der Fensterfront, die sich in einem Viertelkreis zum Sonnenplatz hin wölbte.
Slavkovićs Tod schien allenthalben für Gesprächsstoff zu sorgen. Am Nachbartisch sass ein dicker Mann mit seiner dicken Frau und der dicken Tochter. Er unterhielt sich mit zwei Männern an einem anderen Tisch, die vor ihren leeren Kaffeetassen sassen. Sie redeten von den kriminellen Jugos und dass es gut sei, wenn sie sich gegenseitig die Grinde einschlügen. Der Dicke meinte, man müsse bald eine Bürgerwehr aufstellen, um seine Familie zu schützen.
«Man muss ja Schiss haben, dass sie einem die eigene Tochter vergewaltigen.»
Die Tochter errötete und lächelte verlegen, während die Mutter die Gesprächsrunde mit zustimmenden Einwürfen anfeuerte.
Es waren traurige Menschen, und die Vorstellung, dass ich das gleiche Essen ass wie sie zuvor, verdarb mir ein wenig den Appetit. Ich vertiefte mich in die Lektüre und schob nebenbei immer mal wieder eine gehäufte Gabel in den Mund.
Über Slavkovićs Tod war nicht wirklich was Neues zu lesen. Sie hatten die enthauptete Leiche im Wehr von Rathausen gefunden. Der «Blick» wusste zudem zu berichten, dass ihm sein «bestes Stück» abgeschnitten und sein Kopf beim Cabaret Paradise auf einen Zaunpfahl gespiesst worden war. Es passte alles zusammen, auch die Schüsse im Brustbereich, an denen er vermutlich gestorben war. Bis auf das Detail mit seinem Penis. Ich rechnete das der überbordenden Fantasie des «Blick»-Journalisten zu, denn in der «NLZ» war davon nichts zu lesen. Von den Tätern fehlte nach Angaben der Polizei jede Spur. Ich lag also weiter im Rennen. Mit den Briefen hatte ich ausserdem einen wichtigen Anhaltspunkt in der Hand. Slavkovićs Frau hatte mir versichert, diese der Polizei gegenüber nicht erwähnt zu haben.
Zu Hause schlug ich die Nummer der Kantonspolizei nach. Ich musste es mehrmals versuchen, bis endlich jemand abhob und mich mit dem Pressesprecher verband. Dessen Stimme klang entnervt. Ich war vermutlich nicht der Erste, mit dem er heute telefonierte. Ich gab mich als Journalist des «Süddeutschen Wochenmagazins» aus und stellte einige Fragen, die er mir bestätigte.
«Hören Sie, ich kann Ihnen nichts Neues berichten. Die Ermittlungen sind in vollem Gang.»
«Stimmt es, dass dem Enthaupteten das Geschlechtsteil abgeschnitten wurde?»
«Das haben Sie aus der Boulevardpresse …»
«Es entspricht also nicht der Wahrheit?»
«Nun passen Sie mal auf. Alles, was zurzeit gesichert ist und an die Öffentlichkeit gehört, hab ich Ihnen bereits gesagt. Mehr erfahren Sie, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind.»
Ich trat die Flucht nach vorne an und behauptete: «Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Herrn Slavković wegen Beziehungen zum internationalen Drogenhandel. Können Sie bestätigen, dass der Mörder im Umfeld der kosovarischen Mafia zu finden ist?»
Eine Weile blieb es still. Ich glaubte zu spüren, wie er den Atem anhielt. «Ich hab Ihnen alles gesagt, was Sie zu wissen brauchen.»
Ich hatte den Hörer bereits aufgelegt. Ich blätterte im Telefonbuch und stellte die Nummer der Staatsanwaltschaft ein. Dass die Leitung nicht besetzt war, deutete ich als ein gutes Zeichen. Nach fünfmaligem Klingeln meldete sich eine Stimme.
«Guten Tag, hier ist Arnold vom ‹Süddeutschen Magazin›. Ihr Kollege von der Kripo hat mir bestätigt, dass gegen Herrn Slavković ermittelt wird wegen Beziehungen zum internationalen Drogenhandel. Besteht ein Zusammenhang zwischen seinem Reiseunternehmen und diesen Machenschaften?»
Der Mann zögerte. «Herr Graber hat mit Ihnen darüber gesprochen?»
«Er hat mich für weitere Auskünfte an Sie verwiesen …»
Er räusperte sich. «Nun ja, das erstaunt mich einigermassen. Wir pflegen mit Informationen erst an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind.»
«Herr Graber hat erzählt, Herrn Slavkovićs Reisebüro biete Transaktionen auf den Balkan an. Es sei diesbezüglich ein Untersuchungsverfahren wegen mangelnder Sorgfalt bei Finanzgeschäften im Gang. Geht es um Geldwäscherei?»
«In seinem Reisebüro werden Geldwechsel und Geldüberweisungen auf den Balkan offeriert, das ist richtig so. Für welche Zeitung schreiben Sie, haben Sie gesagt?»
«Für das ‹Süddeutsche Wochenmagazin›. Sie haben die Transaktionen in Slavkovićs Reisebüro erwähnt …»
«Genau, ja. Herr Slavković gehört zu den ganz Grossen im Geldwechsel- und Geldtransfergeschäft. Es geht um bis zu Hunderttausende an Geldüberweisungen, gegen Bezahlung von Kommissionen, versteht sich.»
«Und weiter?»
«Zur Zeit läuft eine zweijährige Übergangsfrist des neuen Geldwäschereigesetzes. Ab April 2000 brauchen die im Geldtransfergeschäft tätigen Personen eine behördliche Bewilligung.»
«Und inwiefern wird Slavkovićs Geschäft dadurch tangiert?»
«Es besteht die Vermutung, dass Herr Slavković die wirtschaftliche Berechtigung der entgegengenommenen Vermögen nicht in allen Fällen mit der notwendigen Sorgfalt geprüft hat.»
«Sie vermuten?»
«Bis jetzt ist noch nichts erwiesen.»
«Laufen weitere Ermittlungen in ähnlichen Bereichen? Steht Mehmet Taliqis Reisebüro ebenfalls unter Geldwäschereiverdacht?»
«Wie kommen Sie darauf?»
«Es ist doch naheliegend, dass Sie sein Geschäft auch im Visier haben.»
«Der Name sagt mir nichts. Haben Sie noch weitere Fragen?»
«Das wäre alles. Haben Sie vielen Dank.»
Mehmet Taliqi wohnte in einem Hochhaus im Arbeiter- und Ausländerquartier Meierhöfli. Ich hatte mit seinem Sohn telefoniert und gesagt, ich führte im Auftrag des Bundesamtes für Migration Umfragen bei Ausländern durch, die seit mehreren Jahren in der Schweiz lebten. Nach Rücksprache mit seinem Vater hatte er einen Termin mit mir vereinbart.
Taliqis Wohnung befand sich im sechsten Stock des mit weissen und braunen Steinplatten verkleideten Hochhauses. Der Lift war gerade defekt; so war ich ausser Atem, als ich den Klingelknopf drückte. Ein Junge von ungefähr sechzehn Jahren öffnete mir. Er hatte kurze, schwarze Haare und ein längliches, blasses Gesicht. Sein Blick hinter der schwarzen Drahtbrille war klug und wach. Er bat mich in den schmalen Korridor. Ich zog die Schuhe aus und stellte sie zu den anderen, die auf einem Gestell bei der Garderobe aufgereiht waren. Ich vergewisserte mich, dass ich keine löchrigen Socken trug, und folgte dem Jungen auf dem hellgrauen Spannteppich. Er führte mich ins Wohnzimmer.
«Bitte nehmen Sie doch Platz.»
Ich fragte den Jungen, der tadellos Schweizerdeutsch sprach, nach seinem Namen. «Fadil, jetzt erinnere ich mich – wir haben zusammen telefoniert.»
Er nickte.
«Und gehst du noch zur Schule?»
«Ich bin an der Kanti, vierte Klasse.»
«Ah ja, im Rothen, nehm ich an.»
Er bestätigte und verliess darauf den Raum, um seinen Vater zu benachrichtigen. Ich blieb stehen und begutachtete die Einrichtung. Der farbenprächtige Teppich am Boden war an manchen Stellen fadenscheinig. Das an der Wand angebrachte Bücherregal wurde ausschliesslich so genutzt, wie es gedacht war, und liess auf eine gewisse Belesenheit seines Besitzers schliessen. Über dem Sofa hing ein aufwändig gearbeiteter Gebetsteppich. Durch ein Fenster und die Glastür, die auf den Balkon gingen, genoss man einen guten Ausblick auf die unmittelbare und die fernere Umgebung: die Strassen und Häuser des Quartiers, die monströsen Bahnen und Brücken der A2 und in täuschender Nähe die Voralpenkette.
Herr Taliqi erschien im dreiteiligen schwarzen Anzug. Bis auf die hellbraunen Pantoffeln an den Füssen war er eine äusserst elegante Erscheinung: mittelgross und schlank, die pechschwarzen Haare zu einem Seitenscheitel gekämmt. An den Schläfen waren einzelne graue Strähnen zu erkennen. Er begrüsste mich mit kurzem Händedruck und bat mich, im Armsessel Platz zu nehmen. Er selbst setzte sich diagonal mir gegenüber unter den Gebetsteppich.
Ich stellte mich vor und kramte einige A4-Seiten und den Kugelschreiber aus meinem Rucksack. Fadil, der sich neben seinen Vater gesetzt hatte, übersetzte. Ich war gerade dabei, die Absicht der Umfrage zu erläutern, als eine kleine Frau mit Kopftuch das Zimmer betrat. Sie lächelte mir kurz zu und stellte ein Tablett auf den Tisch. Dann ging sie wieder aus dem Raum. Zurück blieb der intensive Duft frisch gebrühten Kaffees.
«Trinken Sie?», fragte Fadil.
«Sehr gern.»
Taliqi machte sich daran, aus einem länglichen Metallkrug Kaffee in die kleinen Tassen einzuschenken. Ich bediente mich mit Zucker aus einer winzigen Porzellanschale.
Nachdem ich vorsichtig vom starken Getränk probiert hatte, fuhr ich in meiner Einleitung fort. Ich hatte sie mir zuvor zurechtgelegt und einige Fragen notiert. Ich hatte keine Ahnung, wie glaubwürdig ich wirken würde. Aber Mehmet Taliqi gab bereitwillig Auskunft, beantwortete die Fragen nach seiner Herkunft, Nationalität, Konfession, Beruf und Familie, seinem Aufenthaltsstatus und dem Jahr seiner Einreise. Ausser des siebzehnjährigen Fadils hatte er noch eine dreizehnjährige Tochter, die ebenfalls die Kantonsschule besuchte. Ich machte gewissenhaft Notizen.
Einzelne Fragen beantwortete Taliqi gleich selbst in gebrochenem Deutsch. Er sagte, in seinem Beruf müsse er praktisch kein Deutsch sprechen. Deshalb lasse er lieber seinen Sohn übersetzen, der in der Schweiz aufgewachsen war. Ich stellte einige weitere Fragen und lenkte dann das Gespräch unauffällig auf Slavkovićs Reisebüro.
«Ist sein Geschäft eine grosse Konkurrenz für Sie?»
Während Fadil übersetzte, huschte ein Anflug von Unmut über Taliqis Gesicht. Er sprach ziemlich lang.
«Er sagt, ihr Kundensegment unterscheide sich deutlich. Zu ihm kommen vor allem Kosovo-Albaner, Bosnier und Kroaten, während die Serben eher zu Slavkovićs Stammkundschaft gehörten. Zudem nehme er nur Geldüberweisungen von Leuten vor, bei denen er sicher sei, dass sie sauber sind.»
«Wollen Sie damit andeuten, Slavković habe Gelder aus dubiosen Quellen entgegengenommen?»
Taliqi lächelte vornehm. Das sei doch ein offenes Geheimnis. Wie liesse sich sonst erklären, dass er in so kurzer Zeit ein Vermögen erworben habe.