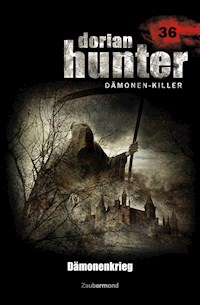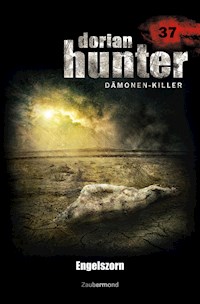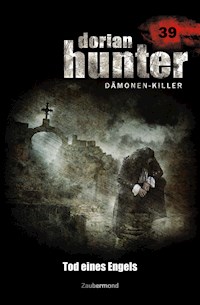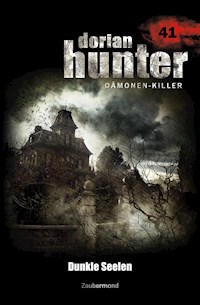2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: DUST
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Freund oder Feind? Mit dieser Frage sehen sich Simon McLaird und seine Gefährten konfrontiert, als sie den Planeten Cloudgarden erreichen. Kaum dass die Freedom den Flug durch den galaktischen Leerraum beendet hat, wird das Schiff Shadow Commands von einer Flotte fremder Raumer empfangen. Währenddessen starten Sealdric und Helen Dryer ihren Angriff auf die Erde – es kommt zu einem offenen Gefecht zwischen den Scardeenern und einer bisher unbekannten Macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 369
Ähnliche
Inhalt
Band 7 Die Frauen von Cloudgarden
Band 8 Familienbande
Band 9 Tag des Verrats
Martin Kay
DUST 3 – Tage des Verrats
Band 7 Die Frauen von Cloudgarden
Es war Zeit zu fliehen.
Das dumpfe Gefühl, dass etwas nicht in Ordnung war, beschlich ihn schon seit Wochen. Vor wenigen Tagen hatte er erste Konsequenzen daraus gezogen und seinen E-Mail-Account bei Gate.com abgemeldet. Er hoffte nur, dass McLaird nicht versuchte, ihn ausgerechnet jetzt zu erreichen, sonst würde er eine Überraschung erleben.
Jeremiah Hurley beschloss, noch an diesem Tag seinen Wohnsitz aufzugeben und unterzutauchen. Er machte so etwas nicht zum ersten Mal, aber nie zuvor waren sie ihm so dicht auf den Fersen gewesen. Dabei war er überaus gründlich darin, seine Spuren zu verwischen – anscheinend nicht gründlich genug.
Er verstaute das Notwendigste an Kleidung und Ausrüstung in einem großen Campingrucksack. Als dieser fertig gepackt war, sah es tatsächlich so aus, als wollte Jeremiah auf eine große Bergwanderung. Hosen, T-Shirts, Jacken, Handtücher, Hygieneartikel, eine Iso-Matte und ein Schlafsack fanden sich darin, dazu allerlei nützliche Gegenstände, die man draußen im Wald oder in den Bergen zum Einsatz bringen konnte.
Jeremiah schulterte den Rucksack, blickte sich ein letztes Mal in dem möblierten Zimmer um und wandte sich dann zum Gehen.
Es klopfte an der Tür …
Jeremiah erstarrte, zog dann die Hand zurück, die er gerade schon zur Klinke ausgestreckt hatte. Auf Zehenspitzen bewegte er sich zum Fenster hinüber und spähte durch die Lamellen der Jalousie nach draußen. Die eingeschränkte Sicht ließ ihn nicht viel erkennen, aber er sah deutlich die auf Hochglanz polierte, silberne Limousine auf der anderen Straßenseite.
Verflixt!, dachte er und trat automatisch einen Schritt vom Fenster zurück. Das Klopfen klang erneut auf. Er hatte das Fahrzeug bereits gestern auf dem Heimweg vom Kendo-Training gesehen. Sie beobachteten ihn, so viel stand fest. Nur hatte er noch nicht ganz herausgefunden, wer sie eigentlich waren. Die Fallen und Irrwege, die er über seinen Namen und die E-Mail-Adresse aufgebaut hatte, hatten die CIA bereits einmal an der Nase herumgeführt. Er glaubte nicht, dass der Geheimdienst inzwischen schlauer geworden war. Eher nahm er an, dass jemand der anderen ihn gefunden hatte.
Gar nicht gut.
»Hurley? Machen Sie auf!«
Die Stimme dröhnte förmlich mit tiefem Bass von draußen durch die geschlossene Tür. Jeremiahs Rechte klammerte sich um den Trageriemen des Rucksacks. Er durchquerte rasch den Wohnraum, betrat das Bad auf der anderen Seite und riss das Fenster auf. Im Vorbeigehen warf er einen flüchtigen Blick in den Spiegel. Das Bild eines jungen, etwa fünfundzwanzigjährigen Mannes mit blondem Haar blickte ihm entgegen. Natürlich wussten Sie, dass er kein zwölfjähriger Pennäler mehr war, auch wenn er Simon McLaird in den Mails in diesem Glauben ließ. Simon hätte sich nie auf eine Freundschaft mit ihm eingelassen, wenn Jeremiah ihm von Anfang an reinen Wein eingeschenkt hätte. Jetzt war es zu spät für Erklärungen, denn McLaird weilte nicht mehr auf der Erde. Jeremiah wusste jedoch, wo er sich befand – er hatte ihn schließlich erst in diese Lage gebracht, aber auch das musste Simon nicht notwendigerweise wissen.
Jeremiah kletterte behände auf den Badewannenrand, warf den Rucksack nach draußen und zog sich dann am Fenstersims hoch. Als er sich durch die Öffnung gezwängt hatte, hörte er hinter sich den dumpfen Knall einer aufgestoßenen Tür. Sie waren in seiner Wohnung!
Jeremiah kam federnd auf dem Boden auf, langte nach dem Rucksack und lief los. Er rannte quer durch den anschließenden Garten, sprang über einen Zaun und landete in einer Nebenstraße auf der Rückseite des Wohnhauses. Zwei Blocks lang lief er, so schnell er konnte. Immer wieder blickte er sich um. Er schien seine Verfolger abgeschüttelt zu haben. In der 32ten, Ecke Main, stieg er in einen Bus. Als er die Fahrkarte löste und einen Blick aus dem Rückfenster warf, glaubte er für einen Augenblick, die silbrige Limousine zu erkennen, doch ein den Bus überholender 387er Peterbilt versperrte für einige Sekunden die Sicht. Als der Bus anfuhr und sich in den fließenden Verkehr einreihte, war die Limousine verschwunden.
Nach drei Stationen stieg Jeremiah aus und legte den Rest des Weges zu Tom’s Inn, seiner Stammkneipe, zu Fuß zurück. Bevor er endgültig die Stadt verließ, wollte er auch sichergehen, dass er seine Verfolger abgehängt hatte. Falls sie ihn hier fanden und Ärger machten, hatte er Tom und die üblichen Verdächtigen am Billardtisch im Rücken. Jeremiah nickte den Jungs kurz zu, stellte sich an den Tresen und bestellte bei Candy ein Bier. Das junge Ding mit dem verlebten und mit Piercings übersäten Gesicht schaute nicht mal auf, als sie ihm das frische Budweiser herüberschob. Tom selbst stand an der Kasse und rechnete sein Tagesgeschäft ab, obwohl es dafür noch reichlich früh war.
Jeremiah lehnte sich mit dem Rücken gegen den Tresen, leerte das Glas zur Hälfte und starrte den Eingang an. Nach dem dritten Bier tat sich noch immer nichts. Offenbar waren sie ihm nicht gefolgt. Er blickte auf die Uhr. Es war bereits halb neun – gut zwei Stunden hatte er in der Kneipe zugebracht.
»Noch eins?«, quäkte Candy ihn Kaugummi kauend an.
Er schüttelte den Kopf, zog eine Zwanzigdollarnote aus der Hosentasche und schob sie über die Theke.
»Stimmt so.«
Candy nickte nur.
Jeremiah ging nach draußen. Die kühle Abendluft stellte eine willkommene Abwechslung zum rauchgeschwängerten Klima der Kneipe dar. Er blickte sich kurz um. Es herrschte wenig Verkehr auf der Straße. Nicht ungewöhnlich für eine Kleinstadt wie Golden, Colorado – zumal die Touristensaison noch lange nicht begonnen hatte. Er bog rechts in die Washington Avenue ein, die sich von den nördlichen City Limits bis fast zur Stadtmitte über zwei Kilometer erstreckte. In der Höhe des einzigen 7-Eleven der Stadt sah Jeremiah einen Reflex in der Fensterscheibe.
Eine silberne Limousine!
Er verharrte kurz vor dem Eingang. Noch zögerte er, den Laden zu betreten, der sieben Tage in der Woche, rund um die Uhr geöffnet hatte. Der schwarze Verkäufer hinter der Theke sah zu ihm nach draußen. Außer ihm hielten sich nur noch zwei Frauen in dem Shop auf, die sich angeregt in der Nähe der Kühlregale unterhielten.
Jeremiah betrat den Laden, ging auf die Verkaufstheke mit der Kasse zu und deutete auf den Hotdog-Grill hinter dem Schwarzen.
»Ich nehme einen mit Ketchup«, sagte Jeremiah heiser und lugte über die Schulter des Verkäufers hinweg nach draußen. Die Limousine hatte auf der anderen Straßenseite gehalten. Seinen ursprünglichen Plan, als Anhalter über den Highway 58 nach Denver zu gelangen, hakte er in Gedanken ab.
Jeremiah zahlte den Hotdog, biss zweimal ab und warf den Rest in einen Müllbehälter. Das entgeisterte Kopfschütteln des Verkäufers ignorierte er. Stattdessen nahm er seinen Mut zusammen und verließ den 7-Eleven wieder.
Kaum dass er den Gehweg betreten hatte, fuhr die Limousine mit quietschenden Reifen an und hielt direkt neben ihm. Die Fondtür sprang auf und zwei fleischige Hände zerrten ihn so plötzlich auf die Rückbank, dass an Gegenwehr gar nicht zu denken war. Jeremiah glaubte auch nicht, dass er eine reelle Chance gegen diese Bulldogge gehabt hätte. Die Hände drückten ihm beinahe die Luft ab und pressten ihn in die Polster der Rückbank.
Jeremiah krächzte hilflos, aber je mehr er versuchte, sich loszureißen, desto enger umschlang ihn der Kleiderschrank von einem Mann.
»Keinen Mucks, Hurley!«, schnappte die Bulldogge.
Der Wagen fuhr an. Es ging über die US-40 auf den Highway 74 nach Evergreen, südlich der beiden Routen, die Jeremiah in Betracht gezogen hatte. Ehe sie den Ort erreichten, bogen sie in einen schmalen Waldweg ein. Es war zu dunkel, um etwas erkennen zu können. Irgendwann hielt der Wagen an. Die Tür flog auf und Jeremiah wurde unsanft hinausgestoßen. Er landete auf halb gefrorenem, matschigem Boden. Seine Verfolger stiegen aus und kamen langsam um den Wagen herum.
»Soso«, meinte Bulldogge. »Ein Zwölfjähriger, wie?«
»Ich weiß nicht, was Sie meinen«, behauptete Jeremiah, obwohl er schon ahnte, worauf der andere hinauswollte. »Was wollen Sie von mir?«
»Wie wäre es mit Simon McLaird?«, donnerte ihm die Bulldogge entgegen.
Jeremiah versuchte, seine Stimme fest klingen zu lassen. »Wen? Was soll das hier? Ich hab nichts getan. Wisst ihr Typen überhaupt, was auf Kidnapping steht?«
Der harte Schlag ins Gesicht ließ ihn abrupt verstummen. Seine Wange brannte.
»Pass mal auf, Freundchen«, grunzte Bulldogge. »Wir können es auf die harte oder die sanfte Tour versuchen. Den E-Mail-Verkehr zwischen dir und McLaird kennen wir. Also noch einmal: Wo steckt er?«
Jeremiah reagierte nicht.
»Schön, dann eben auf die harte Tour«, sagte der zweite Mann und gab Bulldogge einen Wink. »John, bring ihn rein.«
Der Angesprochene packte Jeremiah und riss ihn aus dem Matsch hoch. Er drehte ihm dabei mit einem schnellen Griff die rechte Hand auf den Rücken und schob ihn so vor sich her auf einen alten Schuppen zu. Die Hütte lag zwischen den Bäumen und im Schutz der Dunkelheit verborgen und war von Weitem nur schwer zu erkennen. Das Innere bestand lediglich aus einem großen, fast leeren Raum und einer Art Hinterzimmer. In der Mitte des vorderen Bereichs standen zwei Holzstühle. Jeremiah wurde in Richtung des einen gestoßen.
Little John – Jeremiah hatte Bulldogge inzwischen einen anderen Namen verpasst – band ihm die Hände hinter dem Rücken an der Stuhllehne fest. Dann baute er sich zusammen mit dem zweiten Verfolger direkt vor ihm auf. Bevor ihm jedoch einer der beiden eine Frage stellte, schmetterte ein gut platzierter Haken gegen Jeremiahs Kinn. Er schmeckte Blut im Mund.
Little John holte zum zweiten Mal aus und schlug zu. Jeremiahs Kopf flog nach hinten. Jetzt schmerzte auch sein Nacken.
»Wssss«, presste er zischend hervor. »Was soll denn das, ihr verdammten …«
Der Schmerz des dritten Schlags schoss ihm bis ins Gehirn. Er zerbiss einen Fluch auf den Lippen.
»Nun wollen wir uns noch einmal der Frage widmen«, sagte der Schmalere der beiden mit zuckersüßer Stimme. »Wo befindet sich Simon McLaird?«
»Ich kenne … niemanden, der … McLaird heißt«, stieß Jeremiah hervor und spuckte Blut.
Der Schmale schnalzte mit der Zunge und zauberte ein gekünsteltes Bedauern in seine Miene. »Wie kann man nur so unvernünftig sein? – John.«
Die Bulldogge schlug noch mehrmals zu, in den Magen, ins Gesicht, allerdings mit deutlich weniger Kraft als bei den ersten Hieben.
Sein Kollege wandte sich ab und schlenderte, als ginge das alles ihn nichts an, ins Nebenzimmer. Zwischen zwei Schlägen hörte Jeremiah, wie drüben ein Fernseher eingeschaltet wurde. Der CNN-Wetterbericht kündigte eine Kaltfront an.
Irgendwann hatte Little John aufgehört, ihn zu malträtieren. Jeremiah hing halb bewusstlos, halb vor sich hin dösend auf dem Stuhl und hatte jegliches Zeitgefühl verloren, als er den ersten bewussten Gedanken fassen konnte. Wie lange war er schon hier? Zwei Stunden oder gar drei? Seine Kehle war ausgetrocknet und rau. Der Schweiß auf seiner Stirn war kalt geworden und ließ ihn frösteln. Sein Körper fühlte sich schlaff und ausgelaugt an. Nebenan lief der Fernseher weiter. Auch Little John war jetzt drüben bei Schmalhans. Jeremiah versuchte nachzudenken, was ihm mehr schlecht als recht gelang. Sein Kopf dröhnte noch immer, als hätte ihn ein Schmiedehammer getroffen. Dennoch ging er einige Möglichkeiten für eine Flucht durch, doch das führte zu nichts. Solange er gefesselt auf dem Stuhl festsaß, blieb ihm keine Alternative, als auszuharren. Und auf Hilfe von außen konnte er nicht hoffen. Niemand wusste, dass er hier festhing.
Jeremiah verrenkte sich fast den Hals, um nach hinten in den Nebenraum zu blicken. Little John glotzte mit stumpfem Blick den Fernseher an, während Schmalhans wie gelangweilt die Tasten seines Mobiltelefons drückte. Offenbar spielte er eines der im Gerät eingebauten Spiele.
»Ich muss mal aufs Klo«, sagte Jeremiah leise.
»Hat der Kleine etwas gesagt?«, brummte John.
»Geh du mit ihm!«, befahl Schmalhans, ohne vom Telefondisplay aufzusehen.
»Wieso bin ich dran? Du kannst auch mal gehen, Thompson!«
Der Schmale blickte nun doch auf und warf John einen bösen Blick zu. Schließlich legte er das Telefon beiseite, erhob sich schwerfällig und kam zu Jeremiah herüber.
»Thompson also«, nuschelte dieser zwischen den geschwollenen Lippen hervor.
Der Mann sagte nichts, löste ihm die Fesseln und legte ihm stattdessen Handschellen um. Er packte ihn grob bei der Schulter und stieß ihn nach draußen. Der Wetterbericht hatte nicht untertrieben, es war merklich kälter geworden. Vielleicht würde es sogar schneien.
»Was ist? Wollen Sie zusehen oder hätten Sie die Güte, sich umzudrehen?«, fragte Jeremiah gereizt. Er blickte sich hastig um und suchte nach einer Fluchtmöglichkeit.
»Keine Angst, Freundchen, ich werde dir schon nichts weggucken. Brauchst dich nicht zu genieren, ich hab schon so ziemlich alles gesehen, auch so kleine Schwän…«
Er kam nicht weiter. Jeremiahs Fuß stieß vor, genau in die Genitalien des anderen. Während Thompson sich vor Schmerz krümmte, sprang Jeremiah hinter ihn und schlang die Handschellen um den Hals des anderen. Ruckartig riss er seinen Kopf zurück und trat ihm gleichzeitig in die Kniekehle. Der Mann röchelte und ächzte, versuchte, sich aus dem Griff zu befreien, doch ein zweiter Tritt ließ ihn endlich in die Knie brechen. Jeremiah zerrte heftiger, lockerte dann plötzlich die Umklammerung und versetzte Thompson einen gezielten Schlag gegen die Schläfe. Der Mann kippte zur Seite weg in den Matsch.
Rasch beugte sich Jeremiah über ihn und durchsuchte seine Taschen, während er sich immer wieder zur Hütte umblickte. Er wusste nicht, ob John etwas gehört hatte, und sollte zusehen, dass er schleunigst von hier fortkam. Jeremiah fand eine Pistole und eine Brieftasche mit Geld, Führerschein und einem Ausweis der Central Intelligence Agency. Die Tatsache, dass der Mann derartige Papiere bei sich trug, verriet zumindest, dass dies ein offizieller Einsatz und keine Undercover-Aktion war. Aber warum hatten die beiden sich nicht vorgestellt? Hatten sie gar nicht vor, ihn wieder lebend zurückzubringen?
Jeremiah griff nach den Schlüsseln für die Handschellen. Er schlug dem ohnehin schon Bewusstlosen mit dem Griff der Pistole gegen den Kopf und tauchte dann im Unterholz des Waldes ab.
Tiefes Schwarz zeigte sich sowohl auf den Bildschirmen als auch draußen vor den Sichtfenstern. Dunkelheit von einer Art, die einem die Kehle zuschnüren konnte, wenn man sie länger betrachtete.
Das scardeenische Schlachtschiff, das nun unter der Flagge Shadow Commands flog, durchquerte den pechschwarzen Raum zwischen den Galaxien. Mit dem Sprung durch den Hyperraum hatte die Freedom die heimatliche Milchstraße weit hinter sich gelassen und war in einem Meer der Finsternis wieder aus dem übergeordneten Kontinuum ausgetreten.
Hin und wieder ließ Sherilyn Stone die Daten der Achtersensoren auf die Schirme schalten, um der Brückencrew nicht ständig das eher deprimierende Bild des dunklen Ozeans zeigen zu müssen. Dann offenbarte sich die einsame Welteninsel, die wie ein winziges Eiland durch die finstere Unendlichkeit zu treiben schien. Im Moment jedoch zeigten die Monitore und der große Panoramaschirm wieder das Nichts, das vor ihnen lag.
»Die Dunkelheit da draußen macht einen ja ganz verrückt«, murrte Simon McLaird. »Wenn Sie nicht gleich wieder das Bild umschalten, Major, dann suche ich mir ein nettes Plätzchen bei den Triebwerken und werfe meine Angel nach hinten aus.«
»Viel Spaß, Lieutenant«, konterte Sherilyn Stone, ohne aufzusehen. Sie studierte schon seit gut einer Stunde die technischen Berichte des Schiffes aus den einzelnen Abteilungen und hatte dabei nicht einmal hochgeschaut, als sie nach ihrem Kaffeebecher tastete, den eine Ordonanz bereits zum fünften Mal auffüllte.
»Wenn ich gewusst hätte, dass unser Flug die Langeweile in Person ist, hätte ich den ollen Vertrag nicht unterschrieben«, brummelte McLaird in sich hinein. Er ließ Stone im Kommandosessel sitzen und ging zu einer der Steuer- und Navigationskonsolen hinüber, um sich auf einen freien Stuhl neben einem schwarzen Sergeant niederzulassen.
»Los, schalten Sie auf Heckansicht, sonst werde ich ungemütlich«, raunte Simon dem Mann zu. »Tennard, richtig?«
Der Angesprochene nickte und drückte eine Taste am Pult. Der Hauptschirm verwandelte sich schlagartig in eine Lichtflut, als die als Milchstraße bekannte Spiralgalaxie darauf erschien. Im Zentrum gleißten aufgrund der dichten Ansammlung Abermillionen Sterne, deren Leuchten zum Rand in ihren Spiralarmen schwächer wurde. Im äußeren Bereich einer dieser Arme trieb eine schwach leuchtende gelbe Sonne, der man in der galaktischen Bezeichnung den Namen Sol gegeben hatte. Simon dachte wehmütig an die Erde, auch wenn es schon einige Monate her war, seit er sie das letzte Mal betreten hatte.
»Na bitte, sieht doch gleich wesentlich interessanter aus«, meinte er, um sich von den Gedanken des Heimwehs, die sich bei ihm einschleichen wollten, abzulenken. Obwohl er sein ganzes Leben lang davon geträumt hatte, einmal die Erde verlassen und den Weltraum erforschen zu können, vermochte der bloße Wunsch, wenn er erst einmal Realität geworden war, nicht mit dem Gefühl der Wehmut zu konkurrieren. Manche Dinge ließen sich nicht einfach abstellen.
»Sir?«, fragte Sergeant Luis Tennard. »Eine Sache habe ich nicht ganz verstanden. Warum springen wir diesen Planeten Cloudgarden nicht direkt an?«
»Haben Sie bei der Einsatzbesprechung geschlafen?«
»Äh … ich war doch gar nicht dabei«, verteidigte sich Tennard.
»Ach, dann könnte ich Sie jetzt gewissermaßen dumm sterben lassen.«
Ein Räuspern ließ Simon sich fast den Hals verrenken, als er nach hinten blickte. Es war Ken Dra, der gerade die Brücke der Freedom betreten und ihr Gespräch mitbekommen hatte.
»Wieder einen Clown gefrühstückt, Simon?«, fragte er grinsend.
»Frühstück? Was ist das?«
Ken Dra wandte sich an Tennard. »Sie wissen, was Doktor Quire zum Schutz der Erde zurückgelassen hat?«
Der Sergeant nickte. »Ein Gerät, das die Erde unsichtbar macht.«
»Nicht ganz«, sagte Ken. »Der Hyperverzerrer krümmt das Raum-Zeit-Kontinuum um einen Planeten und lässt dadurch jedes Schiff, das die direkten Koordinaten anfliegt, an einem anderen Punkt aus dem Hyperraum treten, nur nicht am Zielpunkt selbst. Laut Doktor Quire schützt ein ähnliches Feld das gesamte Cloudgarden-System.«
Tennard deutete an, dass er verstanden hatte, und widmete seine Aufmerksamkeit wieder den Kontrollen.
Simon überlegte, ob er die Freizeiteinrichtungen der Freedom aufsuchen oder sich lieber ins Bett legen sollte, als einer der Ortungsoffiziere einen visuellen Kontakt meldete.
Stone blickte auf und ließ das Bild auf den Hauptschirm projizieren. Inmitten der Schwärze des Leerraums war ein winziger Punkt auszumachen. Er wuchs unaufhaltsam, doch selbst bei voller Fahrt des Schlachtschiffs, war erst nach drei Stunden und mit maximaler Vergrößerung zu erkennen, dass es sich bei dem Fleck auf dem Schirm um einen blauen Stern handelte. Erst eine Stunde darauf erfassten die Scanner ein weiteres Objekt, das um das erste kreiste.
»Das dürfte Cloudgarden sein«, sagte Ken Dra.
»Haben unsere Sensoren schon Daten?«, fragte Sherilyn. Sie hatte sich vom Kommandosessel erhoben und zu Simon, Ken und Luis Tennard gesellt.
»Wir bekommen nur unzureichende Messungen herein«, sagte der Sergeant an der Sensorstation. »Für genauere Daten sind wir noch zu weit entfernt.«
Simon lugte Tennard über die Schulter. »Zumindest scheint der Planet das zu sein, was wir von Doc Quire erfahren haben: eine kalte Schneewelt mit atembarer Atmosphäre.«
Sie warteten weitere dreißig Minuten, bis die Daten exakter waren. Der Planet war mit seinen 8342 Kilometern Durchmesser kleiner als die Erde. Bei einer Umlaufzeit von 702 Tagen um die blaue Sonne dauerte das Cloudgardenjahr jedoch fast doppelt so lang wie das irdische. Dafür glich der Tag mit etwas über 26 Stunden der gewohnten Länge.
»Der Planet besitzt einen festen, erkalteten Kern«, las Tennard die Daten von den Displays ab. »Die Oberfläche ist mit Eiskrusten und Schnee bedeckt. Und in der Atmosphäre orten wir große Objekte.«
»Was ist mit den Sturmtiefs, von denen Quire gesprochen hat?«, fragte Sherilyn.
»Alles ruhig.«
»Was?«, riefen Simon und Ken Dra fast synchron.
Sherilyn Stone blickte auf die Messergebnisse, um sich von Tennards Meldung selbst zu überzeugen. Simon sah sie erwartungsvoll an.
»Er hat recht. Keine Stürme … auf dem ganzen Planeten nicht.«
»Quire hat uns angelogen«, folgerte Simon. »Und was sind das für Objekte in der Atmosphäre? Schiffe?«
Sein Blick traf den Sherilyns. Er las in ihren Augen, dass sie im Moment das Gleiche dachte wie er selbst.
»Sie glauben, Doktor Quire hat uns in eine Falle gelockt?«
»Das ist doch hirnrissig«, fuhr Ken Dra auf. »Warum sollte er das tun? Sie haben ihn doch mit Ihren Lügendetektoren überprüft. Und wenn jemand die Freedom in seine Gewalt bringen wollte, hätte er das auch einfacher haben können.«
Sherilyn verschränkte die Arme vor der Brust und presste die Lippen aufeinander. Sie schien nachzudenken. Ihr Blick wanderte abwechselnd von den Sensordisplays zum Hauptschirm und blieb schließlich an Simon McLaird haften, der ihre Entscheidung bereits im Voraus ahnte.
»Wir geben Alarm für alle Decks«, sagte sie. »Kampfstationen besetzen und Schutzschirme aktivieren.«
»Das kann nicht Ihr Ernst sein, Major!«, schnaubte Ken Dra.
»Oh doch, Schwertträger. Wir haben dieses Schiff gerade erst erobert. Ich bin nicht bereit, es schon wieder abzugeben.«
Sie wandte sich zum Steuermann um. »Berechnen Sie einen Fluchtkurs, der uns in die Milchstraße zurückbringt, falls wir schnell verschwinden müssen.«
»Tut mir leid, Ma’am«, sagte der Navigator kopfschüttelnd. »Hier draußen finden sich keine Bezugspunkte für die Computer. Zu wenig Sternenkonstellationen, um nicht zu sagen, überhaupt keine.«
»Dann benutzen Sie die Erdkoordinaten über die wir hergelangt sind!«
»Ja, Ma’am. – Äh, Ma’am?«
»Was?«
»Die sind aus dem System gelöscht!«
Simon horchte alarmiert auf. Er brauchte sich nicht davon zu überzeugen, dass der Navigator die Wahrheit sprach. Der Verdacht, in eine wohlplatzierte Falle zu geraten, verdichtete sich.
»Sergeant Tennard«, sagte er zu dem Afroamerikaner. »Suchen Sie Doktor Quire und bringen Sie ihn sofort auf die Brücke.«
»Aye, Sir!« Tennard stand auf und ging.
Kaum dass er die Brücke verlassen hatte, verkündete einer der Ortungsspezialisten eine neue Hiobsbotschaft. »Mehrere nicht identifizierte Objekte kommen aus Cloudgardens Atmosphäre direkt auf uns zu.«
»Unser Empfangskomitee«, stöhnte Ken Dra.
Auf dem Panoramaschirm waren in der Vergrößerung vier pfeilförmige Raumschiffe zu sehen, die direkt auf die Freedom zuhielten. Den eingehenden Werten nach besaßen sie eine Rumpflänge von knapp 580 Metern und waren etwa 70 Meter breit. Die Sensoren meldeten aktive Waffensysteme, bestehend aus sechzehn Laserbatterien und acht Torpedoschächten. Dazu ein Dutzend Plasmaflaks und ein Energiewerfer, der die halbe Leistung der ähnlichen Waffen an Bord der Freedom erzeugte.
»Kleiner als scardeenische Zerstörer«, meldete sich ein Sensoroffizier. Der Mann trug zwar die Uniform Shadow Commands, aber Simon wusste von Stone, dass sich die Hälfte der Brückencrew aus Scardeenern zusammensetzte. Der Mann wusste offensichtlich, wovon er sprach.
»Dafür aber besser bewaffnet«, meinte Ken Dra, als er sich die Daten des Empfangskomitees ansah. »Der Energiewerfer ist zweimal stärker als die der scardeenischen Zerstörer.«
Sherilyn wandte sich an die Komstation. »Funken Sie den Verband an und teilen Sie ihnen mit, dass wir nur friedliche Absichten und Doktor Quire an Bord haben.«
Die vier Zerstörer lösten sich aus dem Formationsflug und kreisten die Freedom ein. Auf dem Schirm konnte Simon erkennen, wie zwei Dutzend kleinerer Objekte aus den Hangars der Raumer schossen: Abfangjäger, die entfernt an die Rochenform von Tanyas Raumjacht erinnerten. Die Maschinen umschwirrten den zwei Kilometer langen Rumpf des Schlachtschiffs wie lästige Insekten. Sie hatten ebenfalls ihre Waffen- und Verteidigungssysteme aktiviert, eröffneten jedoch noch nicht das Feuer.
»Sollten wir nicht unsere Jäger ausschleusen?«, fragte Simon.
»Das wäre glatter Selbstmord«, antwortete Sherilyn. »Unsere Piloten können zwar die Maschinen fliegen, aber sie haben noch keine Kampferfahrung damit. Sie sind einfach noch nicht so weit.«
»Major Stone!«, rief der Mann an der Funkstation. »Ich komme nicht zu denen durch. Entweder empfangen sie auf unbekannten Frequenzen oder sie ignorieren unsere Anrufe absichtlich.«
»Versuchen Sie es weiter«, befahl Sherilyn. »Verflixt … wo bleibt nur Quire?«
In dem Moment erreichte sie ein Anruf über Interkom von einem der unteren Decks. Es war Sergeant Tennard, der atemlos berichtete, er habe Doktor Quire nirgends finden können. Niemand schien zu wissen, wo sich der Wissenschaftler momentan aufhielt. Zu allem Übel bestätigte die Ortungsstation endgültig, dass hier etwas grundsätzlich schiefgelaufen war.
»Ma’am, einer unserer Jäger hat unautorisiert das Startdeck verlassen und fliegt in Richtung der feindlichen Zerstörer.«
Simon lief es eiskalt den Rücken herunter, als er die Bezeichnung feindlich hörte. Er wollte den Mann an der Station zurechtweisen, doch Sherilyn fiel ihm unabsichtlich ins Wort.
»Mel Quire! Er setzt sich ab!«
»Also doch eine Falle!«, ächzte Simon.
Auf dem Panoramaschirm sahen sie, wie der scardeenische Raumjäger von einem der vier Zerstörer an Bord genommen wurde.
»Wirklich sehr schlau von ihm«, kommentierte Ken Dra. »Nur, was bezweckt er damit? Warum musste er uns erst herlocken, wenn er die Freedom in seine Gewalt bekommen will? Er hätte genauso gut mit seinen Zerstörern zur Erde fliegen können.«
»Ich denke, wir werden es eher herausfinden, als uns lieb ist«, meinte Simon, der wie gebannt auf den großen Schirm starrte.
Sherilyn gab Befehl, alle fünf Energiewerfer auf die Ziele auszurichten und das Feuer zu eröffnen, sobald der Gegner den ersten Schuss abgab. Kurz nach der Anordnung zogen die mantaförmigen Raumjäger wieder ab und kehrten zu den Mutterschiffen zurück.
»Was zum Teufel haben die vor?«, fragte Simon.
Die Ortungsstation meldete ein neues Objekt, das aus der Atmosphäre des Planeten aufstieg und in ihre Richtung flog. Wenn sie den Massewerten Glauben schenken konnten, dann war der neue Ankömmling größer als die vier Zerstörer und die Freedom zusammen. Ein paar Minuten später hatte das fünfte Schiff zum ersten Verband aufgeschlossen und war in voller Größe auf den Schirmen und Monitoren des Shadow-Command-Schlachtschiffs zu erkennen.
Ein Gigant ohnegleichen. Die eingehenden Daten verschlugen der Brückenbesatzung der Freedom schier den Atem. Niemand von ihnen hätte gedacht, dass etwas Größeres als die scardeenischen Schlachtschiffe draußen im Weltraum existieren könnte. Das Schiff glich in seiner Form einem titanenhaften, flachen Kreisel, besaß eine Höhe von knapp drei und einen Durchmesser von über sieben Kilometern! Majestätisch und bedrohlich zugleich schwebte der Koloss auf das Schiff Shadow Commands zu.
»Das … das darf doch nicht wahr sein!«, stöhnte Simon auf. »Ortung, sagt mir, dass das eine Projektion oder so was ist, Leute.«
»Negativ, Lieutenant. Das Biest ist tatsächlich so riesig – und wenn wir den Energiesignaturen Glauben schenken können, dann hat es genug Feuerkraft, um einen halben Planeten ins Universum zu pusten.«
Simon schnürte alleine der Gedanke daran, was ein solches Schiff in einem Sonnensystem anrichten konnte, die Kehle zu.
»Es kommt noch schlimmer!«, stieß Tennard plötzlich mit sich überschlagener Stimme hervor. »Die Objekte, die wir in der Atmosphäre Cloudgardens geortet haben, weisen die gleichen Spezifikationen wie dieses Riesenschiff auf. Unsere Sensoren zeigen mindestens neunundvierzig weitere dieser Riesen an!«
Eine ganze Flotte, dachte Simon und hielt sich an der Konsole vor ihm fest, als er glaubte, vor Schwindel seitwärts vom Sitz zu rutschen. Sie waren Mel Quire auf den Leim gegangen. Jetzt rächte sich ihre Leichtgläubigkeit. Statt einen Verbündeten im Kampf gegen das Scardeenische Reich zu finden, waren sie vom Regen in die Traufe geraten.
»Eingehende Nachricht von dem Riesenschiff, Major!«, rief der Funkoffizier.
Stone nickte nur. Kurz darauf flackerte das Bild auf dem Hauptschirm einmal auf, dann war das Gesicht Mel Quires in Übergröße darauf zu sehen. Niemand stellte sich in dem Moment die Frage, wie der Wissenschaftler von dem Zerstörer zu dem Giganten gelangt war. Im Hintergrund war eine Frau in dunkelblauem, eng anliegendem Overall und mit langem, rotem Haar zu sehen. Der Doktor schien sichtlich vergnügt zu sein und sein Grinsen zog sich von einem Ohr bis zum anderen. Doch jedermann starrte auf sein zuckendes Augenlid, als erwarte man, dort Quires wahre Absichten zu erkennen.
»Hallöchen!«, grüßte er. Sein Lächeln schien dabei noch eine Spur breiter zu werden, obwohl das anatomisch gar nicht mehr möglich war. »Ich hoffe, wir haben euch keinen Schreck eingejagt.«
»Mich laust der …«, begann Simon kopfschüttelnd. »Sind Sie von allen guten Geistern verlassen, Doc?«
»Lieutenant!«, rief Stone Simon zur Räson. Als sie zum Bildschirm sah, gab sie ihm allerdings mit ihren Worten recht. »Würden Sie uns bitte erklären, was das zu bedeuten hat, Doktor Quire?«
Der Wissenschaftler grinste noch immer, als er antwortete: »Oh … eine kleine Machtdemonstration, die sich sehen lassen kann, oder? Ich habe Ihnen ein wenig über meine Vergangenheit erzählt, aber wirklich verstanden, was ich hier aufgebaut habe, hat doch im Grunde genommen niemand von Ihnen, hm? Vielleicht haben Sie sich gedacht, der alte Quire hat ein paar Schiffe, die sich für Guerillataktiken im Weltraum eignen, um Scardeen hier und dort ein paar Wunden zuzufügen, aber seien Sie ehrlich, mit so einem Baby wie diesem hier haben Sie nicht gerechnet. Neben unseren Raumern der Stadtschiff-Klasse wirken die scardeenischen Schlachtschiffe wie Zwerge, nicht wahr?«
»Ihre Demonstration hat etwas für sich«, sagte Sherilyn.
Simon sah, wie sich der Major ein wenig entspannte.
»Aber wir hätten Ihnen auch geglaubt, wenn Sie es uns ganz normal gezeigt hätten.«
»Ich bin ein Freund von Effekten und Kinkerlitzchen, Major Stone«, erwiderte Quire. »Aber als Entschädigung lade ich Sie und Ihre Offiziere gerne heute Abend an Bord meines Flaggschiffes Saber zu einer Dinnerparty ein. Sie können die Freedom an der Unterseite der Saber bei den externen Dockbuchten festmachen. Sobald Sie angedockt haben, fliegen wir direkt nach Cloudgarden. Quire Ende.«
Sein Gesicht verschwand vom Schirm. Kurz war das scardeenische Kommunikationssymbol zu sehen, dann wieder der Blick hinaus in den Weltraum und auf die vier Zerstörer und den Riesen, den Mel Quire als Stadtschiff bezeichnet hatte.
Er war mehrmals gestolpert und einen Abhang heruntergerutscht. Am Fuß der Straße hatte er sich aufgerappelt und hoffte, dass es nicht dieselbe war, von der sie gekommen waren. Sicherlich gab es hier in den Bergen genügend Möglichkeiten, sich zu verstecken, aber er würde nicht ewig aushalten können. Nicht in seinem Zustand. Er kämpfte sich die Straße entlang und fragte sich, wie er diesmal wieder aus dem Schlamassel herauskommen sollte. So, wie er aussah, würde ihn bestimmt niemand mitnehmen: das Gesicht aufgedunsen und geschwollen, blutig, sein Hemd mit Dreck verschmiert, die Hose teilweise zerrissen und nass. Er wünschte, er wäre in der Kneipe geblieben.
Aber er hatte Glück im Unglück, als er nach knapp zweihundert Metern auf eine Telefonzelle am Straßenrand stieß. Gott sei Dank hatten sie ihm sein Geld gelassen. Er förderte zwei Quarter aus der Hosentasche hervor, warf sie in den Münzschlitz und wählte die erstbeste Nummer, die ihm einfiel. Erst als am anderen Ende der Leitung abgehoben wurde, wurde er sich überhaupt bewusst, wen er angerufen hatte.
»Ja?«, klang Toms verschlafene Stimme aus dem Hörer.
Verdammt, außer dem Barbesitzer kannte er doch kaum jemanden in Golden. Obwohl er seit mittlerweile vier Jahren dort wohnte, lebte er stets zurückgezogen und unauffällig. Die einzigen intensiveren Kontakte, die er geknüpft hatte, bestanden aus dem Mailwechsel mit McLaird.
»Tom? Ich bin’s, Jeremiah. Ich … ich hab Ärger und brauche Hilfe.«
»Mann, Junge! Weißt du, wie spät es ist?«
»Tut mir leid, aber es ist dringend.« Jeremiahs Stimme zitterte vor Kälte.
Am anderen Ende war ein tiefes Seufzen zu hören. Dann: »Schon okay, wo steckst du?«
»Zwischen Golden und Evergreen in der Nähe der 74.« Er beschrieb die Umgebung und Tom sagte nach einiger Zeit, er wisse, wo Jeremiah sich befinde. In der Nähe gebe es eine Blockhütte, in der sich im Sommer die Billard spielenden Jungs aus Tom’s Inn mit ihren Harleys treffen, um sich gemütlichen Besäufnissen hinzugeben.
Eine knappe Stunde nach dem Telefonat hörte Jeremiah das lautstarke Geräusch eines Motorrads.
»Grundgütiger, wie siehst du denn aus?«, fragte Tom, als er ihn erblickte. Spontan reichte er ihm seine Lederjacke und half ihm auf den Rücksitz der Harley.
»Wohin fahren wir?«, wollte Jeremiah wissen, als der Barbesitzer die Maschine weiter in den Wald hineinlenkte, anstatt umzukehren und nach Golden zu fahren.
»Erst mal zur Hütte rauf. Da wirst du mir hübsch erzählen, was passiert ist.«
Sie fuhren auf der Ausfallstraße Richtung Westen, ließen die fernen Lichter Goldens und Evergreens endgültig hinter sich und bogen dann in einen Waldweg ein, der dem, den Jeremiah zusammen mit den CIA-Leuten entlanggefahren war, nicht unähnlich sah. Die Blockhütte lag an einem kleinen See. Jeremiah befand, dass die Harleyfreaks Geschmack besaßen.
Im Wald lag bereits Schnee und Tom hatte einige Mühe, die schwere Maschine im Stockdunkeln den Weg hinaufzumanövrieren. Schließlich erreichten sie das Häuschen – eine Zuflucht, zumindest für die nächsten zwei oder drei Tage, bis sie ihm nicht mehr auf den Fersen waren.
Die CIA also, dachte Jeremiah, während er zusammen mit Tom in die Hütte ging. Irgendwie war der Gedanke nicht … richtig. Er fühlte sich verkehrt an, als wäre da noch etwas, das Jeremiah nicht greifen konnte. Die CIA hatte schon mal versucht, über ihn an Simon McLaird heranzukommen, und war gescheitert. Er wusste instinktiv, da war noch mehr.
Als Tom ihn zur Hütte führte, spürte Jeremiah seine Beine kaum noch. Sein Körper schien unterkühlt zu sein und er hustete unentwegt. Umstände, die er sicherlich beheben konnte, doch dazu musste er an seinen Rucksack – und er war nicht erpicht darauf, Tom einen Blick dort hineinwerfen zu lassen.
Der Barbesitzer stützte ihn, als er taumelte. Er bugsierte ihn sicher in die Hütte und kramte von irgendwoher ein paar Decken hervor. Nachdem er im Kamin ein Feuer entfacht hatte, begann er, den mit Zähnen klappernden Jungen auszuziehen.
»So, mein Freund, jetzt wird’s gleich warm. Hier, trink das!«
Der Whiskey schmeckte schal und bitter, durchdrang Jeremiahs Körper aber mit wohliger Wärme. Seine Augenlider wurden schwer.
»Schlaf dich erst mal aus. Ich werde morgen nach dir sehen und dir ein paar neue Klamotten mitbringen.«
Die schwere Tür fiel ins Schloss und Jeremiah war allein. Er hörte gerade noch, wie das Motorengeräusch von Toms Maschine immer leiser wurde, als er endlich in einen traumlosen Schlaf glitt.
Ein Geräusch weckte ihn schneller, als ihm lieb war. Jeremiah blinzelte auf seine Armbanduhr. Acht Uhr vierzig. Draußen war es bereits hell, das Feuer im Kamin längst erloschen. Nur die Decken hielten noch die Körperwärme und ließen ihn nicht frieren. Er streckte sich und stöhnte laut auf. Sämtliche Glieder taten ihm weh. Die Prügel, die er gestern bezogen hatte, hatte deutliche Spuren hinterlassen.
Jeremiah blieb in die Decken gehüllt und dachte krampfhaft über den gestrigen Abend nach. Er hatte nicht mit der CIA gerechnet, als er sich vornahm, die Stadt zu verlassen. Die Verfolger, die er erwartete, waren andere … Leute von der Sorte, die nicht an Simon McLaird interessiert waren, sondern an ihm selbst. Hatte sein Gefühl ihn getäuscht? Waren sie ihm doch noch nicht so nah gekommen?
Jeremiah machte eine Bestandsaufnahme seiner Verletzungen, indem er die Decken beiseiteschlug und fröstelnd seinen Leib begutachtete und vorsichtig abtastete. Die Prellungen im Gesicht schmerzten höllisch, aber er trug zumindest keine dauerhaften Schäden davon. In ein paar Tagen konnte er sich wieder unter Menschen trauen, wenn die blauen Flecke langsam verblasst waren. Pochender Kopfschmerz rührte aus dem Nackenbereich her, den er sich gezerrt hatte, als Little John ihn mit einer Reihe Kinnhaken eingedeckt hatte.
Nach einiger Zeit stand er mühselig auf und schlurfte durch die Hütte, um sich nach etwas Essbarem umzuschauen. Sein leerer Magen knurrte bohrend. Das Häuschen verfügte weder über eine Küche noch über ein Bad. Die Toilette fand er draußen in einem angrenzenden Verschlag. Nachdem er seine Notdurft verrichtet hatte, suchte er in der Hütte den einzigen, niedrigen Schrank ab. Verschiedene Konserven waren darin deponiert: Nudeln in undefinierbaren Saucen, weiße Bohnen, zwei Dosen mit Sardinen, etwas Speck, Kaffee und eine Packung Zwieback. Es schien fast so, als wäre er nicht der Erste, der sich hier versteckte, wenn es in der Stadt brenzlig wurde.
Jeremiah entschied sich für Bohnen und Speck. Er öffnete die Dose mit einem Taschenmesser, das in einer der beiden Schubladen des Schranks lag, und leerte den Inhalt in einen kleinen Topf, den er über der Feuerstelle an einem dafür vorgesehenen Haken aufhängte. Danach holte er von draußen Holz und machte Feuer mit den Streichhölzern, die Tom beim Kamin liegen gelassen hatte.
»Na bitte, wenigstens ein ordentliches Frühstück haben wir«, brummelte er, während er sich wieder in die Decken hüllte und auf einem Holzschemel vor dem Kamin das Essen umrührte. »Fehlen nur noch Eier, dann gebe ich dem Laden hier drei Sterne.«
Nach dem Essen legte er die Beine hoch und döste beim Knistern des Feuers vor sich hin. Draußen hatte es inzwischen wieder zu schneien begonnen.
Plötzlich schreckte er hoch. Er musste eingeschlafen sein, aber etwas hatte ihn abrupt geweckt. Da war kein Motorengeräusch, das vielleicht Tom angekündigt hätte, dennoch glaubte er, etwas anderes gehört zu haben. Jeremiah schlüpfte in seine Schuhe und ging zum Fenster.
Nichts. Nur Schneeflocken, die federleicht zu Boden rieselten. Die kleinen Glasscheiben waren beschlagen und teilweise zugefroren. Draußen erblickte Jeremiah nur das bleiche Weiß des einbrechenden Winters.
Das Gefühl, dass jemand oder etwas draußen auf ihn wartete, beschlich ihn von Sekunde zu Sekunde stärker. Seine Nackenhaare stellten sich auf und er spürte sein Herz unwillkürlich schneller schlagen. Rasch kehrte er zum Stuhl zurück, klaubte seinen Rucksack auf und warf sich die mittlerweile getrocknete Jacke über. Mit fast panischem Blick suchte er nach etwas, das er notfalls als Waffe benutzen konnte, da erinnerte er sich an die Pistole Thompsons, die sich noch immer in seiner Jackentasche befand.
Ein Klopfen an der Tür ließ ihn vor Schreck erstarren. Das Szenario kam ihm bekannt vor! Erst gestern war er auf ähnliche Weise aus seiner Wohnung vertrieben worden. Jeremiah drehte sich um. Sein Atem setzte für mehrere Züge aus. Als er sah, wie der Türriegel von außen langsam herumgedreht wurde, stellte er sich abwartend neben den Eingang, die Hand am Griff der Pistole. Die Tür öffnete sich einen Spaltbreit …
Jeremiah wartete erst gar nicht ab, bis der Eindringling ganz im Raum war. Er trat ihm in den Weg und verpasste ihm einen Schlag in den Magen und stieß ihn von sich. Sofort sprang er mit einem Satz an dem überraschten Mann vorbei und rannte durch den Schnee in den Wald hinaus. Aus den Augenwinkeln machte er eine zweite Person aus, die gerade um die Hütte gelaufen kam.
»Stopp!«
Die Stimme schnitt durch die Kälte. Gleich darauf peitschte ein Schuss auf. Direkt neben ihm schlug ein Projektil in den Boden ein. Schnee spritzte hoch. Jeremiah ließ sich fallen und rollte sich zur Seite. Die Schmerzen schienen für den Moment wie weggeblasen. Momentan zählte nur das nackte Überleben.
»Er ist in den Wald gelaufen!«, rief jemand. Jeremiah horchte alarmiert auf. Er kannte die Stimme!
Er stemmte sich hoch, rutschte im Schnee aus und rollte einen kleinen Abhang hinunter. Ein Baum bremste seinen Fall. Die Luft wurde ihm schlagartig aus den Lungen getrieben, als er mit dem Rücken gegen den Stamm stieß. Jeremiah unterdrückte einen Aufschrei, biss die Zähne zusammen und kam auf die Beine. Halb hinkend lief er weiter, mühte sich durch das tiefer werdende, winterliche Weiß. Er wusste später nicht mehr, wie lange und in welche Richtung er gerannt war, sicher war nur, dass er langsamer wurde – und die Stimmen hinter ihm lauter!
Jeremiah versuchte, an Tempo zu gewinnen, blieb aber jäh an einer Wurzel hängen. Ein Knacks in seinem linken Knie, und er schlug der Länge nach hin.
»Scheiße!«
Er robbte weiter, wollte aufzustehen, kam jedoch nur gebückt hoch und musste das Gewicht auf das rechte Bein verlagern. Sein verletztes Knie gab bereits nach einigen Metern auf. Die Glieder rebellierten nach der Anstrengung. Jeremiah versteckte sich hinter dem nächstbesten Baum. Schwer atmend ließ er sich fallen. Die Stimmen waren verstummt.
Vielleicht hab ich sie doch abgehängt, dachte er.
Während er angestrengt lauschte, mühte er sich, wieder zu Atem zu kommen. Es war nichts zu hören. Er wandte den Kopf nach rechts …
Wie aus dem Nichts stand plötzlich eine Frau mit schulterlangem, brünettem Haar und gezogener Waffe neben ihm. Wenn sie gerannt war, so merkte man es ihr nicht an. Jeremiah starrte sie mit weit aufgerissenen Augen an. Er kannte sie. Sein Gefühl hatte ihn nicht getäuscht, als er ahnte, dass sie hinter ihm her waren.
»Hallo, Jem!«, raunte Marshal Liz ihm zu und neigte dann den Kopf in die Richtung, aus der Jeremiah gekommen war. Von dort kämpften sich zwei weitere Personen durch das verschneite Unterholz. Jeremiah sah einen anderen alten Bekannten: Marshal Ian mit Tom im Schlepptau.
»Tom!«, stieß er aus. »Warum?«
Der Barbesitzer zuckte die Achseln und schaute unglücklich drein. »Es sind US Marshals, was sollte ich tun?«
»Sind sie nicht«, sagte Jeremiah tonlos und ließ die Schultern hängen. Sein verwundetes Knie schmerzte jetzt höllisch.
»Was …?« Tom kam nicht dazu, seine Frage zu beenden. Mit einer schnellen Bewegung schlug ihm Ian den Kolben seiner Waffe in den Nacken. Der Barbesitzer fiel in den Schnee. Ian beugte sich über ihn und setzte einen zylinderförmigen Gegenstand an seinen Hals. Kurz darauf war das Zischen von Druckluft zu hören. Jeremiah wusste, dass Tom die nächsten drei Stunden nicht aufwachen würde und sich anschließend an nichts mehr würde erinnern können. Wenn er im Schnee überhaupt überlebte.
»Jetzt ist Schluss mit den Kindereien, Jem!«, sagte Ian. »Du hast uns lange genug auf Trab gehalten.«
Jeremiah grinste schief. »Ach, tatsächlich?«
Der Marshal im Holzfällerhemd, der es nicht mal für nötig befunden hatte, sich in der Kälte eine Jacke überzustreifen, trat an ihn heran. Eine Weile sahen sich die beiden einfach nur an. Jeremiah verlor das Blickduell und schaute nervös von Ian zu Liz.
»Bist du auch der Meinung?«
Die Frau runzelte die Stirn. »Die Frage kannst du dir sparen. Du hast uns den ganzen Schlamassel eingebrockt.«
»Nur weil ich mit McLaird in Kontakt stand?«
Ian lachte rau auf. »Wenn es das nur wäre. Versuch nicht, uns weiter an der Nase herumzuführen. Wir haben deine Sendungen abgefangen. Du bist verantwortlich dafür, dass das Forschungsschiff der Drahusem hier notgelandet ist. Sie wären Lichtjahre entfernt aus dem Hyperraum gefallen, wenn du sie nicht hierher direkt zu deinem sogenannten Freund McLaird geführt hättest. Mit ihnen hast du auch die Scardeener zur Erde gelockt – und das ist jetzt unser Problem.«
»Ich konnte doch nicht ahnen …«
»Ursache und Wirkung!«, schnitt ihm Ian das Wort ab. »Schon vergessen, was du an der Akademie gelernt hast? Das Letzte, was wir gebrauchen konnten, ist eine Organisation wie Shadow Command. Aber das Problem hätte ich noch mit Thorne und der NSA in den Griff bekommen – doch Shadow Command im Besitz eines scardeenischen Schlachtschiffes, dazu eine Flotte Scardeener direkt vor der Haustür, beim Naulokahr, du hast die Konsequenzen nicht abgewogen und einfach nur dein Spiel gespielt.«
Jeremiah presste die Lippen aufeinander. Ian hatte recht mit der Aufzählung der Kausalkette – aber abzusehen war diese Entwicklung nicht gewesen. Im Gegenteil: Jeremiah hatte nie vorgehabt, die Scardeener hierher zu locken, sondern war nur darauf erpicht gewesen, die Menschen vor der Gefahr durch seine eigenen Leute zu warnen. Der Schuss war nach hinten losgegangen. Jetzt hatten sie eine andere Plage am Hals, statt die erste loszuwerden.
»Was geschieht jetzt mit mir?«
»Deine Cowboyspiele sind jetzt vorbei«, sagte Ian bestimmt. »Wir bringen dich nach Hause zurück, wo du keinen Schaden mehr anrichten wirst.«
Etwas fiepte leise auf. Jeremiah sah, wie Liz ihren Armbandkommunikator an den Mund hob und leise Worte sprach. Ihre Miene verfinsterte sich bei dem Gespräch zunehmend.
»Probleme?«, fragte Ian nach.
»Hyperraumaktivitäten in der Nähe des Sonnensystems«, teilte Liz mit. »Die Scardeener!«
Das Raum-Zeit-Kontinuum im Bereich der galaktischen Erdkoordinaten krümmte sich, als dreizehn Raumschiffe aus dem übergeordneten Hyperraum fielen. Eine unüberschaubare Anzahl von Angriffsjägern schwirrte aus. Die acht Zerstörer lösten sich aus dem Flottenverband und nahmen eine Verteidigungsposition ein, um die Schlachtschiffe vor einem eventuellen Überraschungsangriff zu schützen. Natürlich rechnete niemand damit, dass sie hier auf Gegenwehr stießen, denn das Solsystem galt nach Sealdrics Angaben als rückständig und besaß nicht einmal eine eigene interstellare Raumfahrt.
An Bord des Flaggschiffs Torgut herrschte dennoch Gefechtsalarm. Auf den Decks bereiteten sich die Crewmitglieder auf den Angriff vor. Unzählige Ingenieure, Techniker, Kanoniere und Sanitäter nahmen ebenso ihre Stationen ein, wie Piloten zu den Hangardecks eilten und Infanteristen der Legion ihre Waffen überprüften. Auch auf der Hauptbrücke bot sich ein Bild geschäftigen Treibens. Kaum eine Station war unbesetzt, selbst die Wachtposten an den Zugängen zur Kommandozentrale waren verstärkt worden, geradeso als erwarte man ein feindliches Enterkommando an Bord.
Helen Dryer hielt sich in der Nähe von Sealdrics Sessel auf und warf abwechselnd einen Blick zum leeren Hauptschirm, dann zum scardeenischen Bewahrer. Im selben Augenblick bestätigten die Offiziere der Ortungsstation ihren Verdacht, dass etwas nicht so lief, wie es laufen sollte.
»Rasarah Sealdric! Unsere Scanner sind leer. Hier ist kein Planet!«
»Was?« Der Bewahrer sprang von dem Sessel auf und ging mit energischen Schritten auf die Sitzreihe seiner Leute zu, um sich selbst von der Richtigkeit der Meldung zu überzeugen.
Helen folgte ihm einfach und warf einen Blick auf die Displays. Die Sensoren hatten nicht das Geringste übertragen.
»Langstreckenabtaster!«, befahl Sealdric mit einer Spur von Zorn in der Stimme.
»Nichts, Rasarah. Die Erde ist nicht da!«
»Das kann nicht sein«, fuhr Helen dazwischen. »Es sind eindeutig die richtigen Koordinaten, oder?«
»Natürlich!«, fauchte Sealdric nun wütender. »Es sind immer noch die gleichen, die wir benutzt haben, als wir mit der Sensor