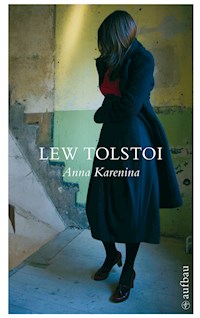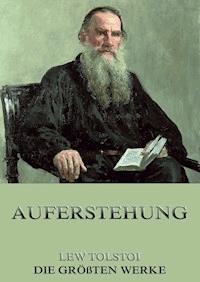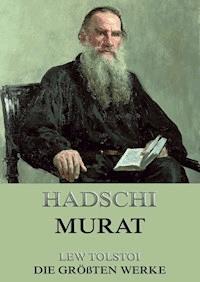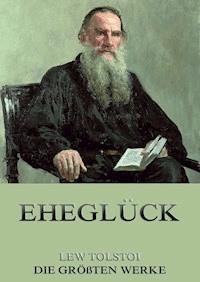
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Eine Novelle des großen russischen Schriftstellers. Die junge Mascha heiratet den deutlich älteren Sergej, ihren Vormund. Die beiden führen eine glückliche Beziehung bis es Mascha immer mehr weg vom Landleben und in die Stadt drängt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eheglück
Lew Tolstoi
Inhalt:
Lew Nikolajewitsch Tolstoi – Biografie und Bibliografie
Eheglück
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
VIII. Kapitel
IX. Kapitel
Eheglück, L. Tolstoi
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849624491
www.jazzybee-verlag.de
Lew Nikolajewitsch Tolstoi – Biografie und Bibliografie
Berühmter russ. Schriftsteller, geb. 9. Sept. (28. Aug.) 1828 im Gouv. Tula auf seines Vaters Besitzung Jasnaja Poljana, erhielt daselbst eine gute häusliche Erziehung und bezog 1843 die Universität Kasan, wo er ein Jahr orientalische Sprachen und zwei Jahre die Rechte studierte. 1848 machte er in Petersburg das juristische Kandidatenexamen und begab sich dann wieder nach Jasnaja Poljana in die Einsamkeit und Stille des Dorfs zurück. Bei einer Reise in den Kaukasus (1851) fand er am militärischen Leben Gefallen und trat in das Heer ein. Man nahm ihn als Junker in die 4. Batterie der 20. Artilleriebrigade am Terek auf, wo er bis zum Beginn des türkischen Krieges blieb. Während des Krieges befand er sich bei der Donauarmee des Fürsten Gortschakow, beteiligte sich am Gefecht an der Tschernaja (16. Aug. 1855) und war beim Sturm auf Sebastopol 8. Sept. (27. Aug.). Nach Beendigung des Krieges nahm er seinen Abschied, hielt sich mehrere Jahre abwechselnd in St. Petersburg und Moskau auf, reiste zweimal ins Ausland und zog sich endlich 1861 wieder auf sein väterliches Gut Jasnaja Poljana zurück, wo er, nachdem er 1862 Sophie Behr, die Tochter eines Moskauer Arztes, geheiratet, in größter Zurückgezogenheit und Einfachheit lebte. Durch seine beiden großartigen Romane: »Krieg und Frieden« (1865–69, 4 Bde.; deutsch von Strenge, 2. Aufl., Berl. 1888; von Roskoschny, das. 1891; ferner von L. A. Hauff, das. 1893, 2. Aufl. 1905, und in Reclams Universal-Bibliothek; franz., Par. 1879) und »Anna Karenin« (1874–76, 3 Bde.; deutsch von Graff, Berl. 1890; von Hauff, das. 1892; von Helene Mordaunt, das. 1896; auch in Reclams Universal-Bibliothek; franz., Par. 1885), von denen der erstere die Zeit der Napoleonischen Kriege behandelt, der andre in der russischen Gegenwart spielt, hat sich T. einen Ehrenplatz in der modernen russischen Literatur erworben. Er ist ein vortrefflicher Erzähler, der die echte epische Ruhe besitzt und die Sprache meisterhaft handhabt. Schon vor Abfassung des erstern der beiden genannten Romane schrieb er eine Reihe bedeutsamer Erzählungen und Novellen, und zwar: »Kindheit« (1852), mit den Fortsetzungen »Knabenzeit« (1854) und »Jünglingsjahre« (1855–57); ferner 1852: »Der Morgen des Gutsbesitzers«, »Die Kosaken« und »Der Überfall«; sodann während des Krimkriegs die Trilogie »Sewastopol im Dezember 1854, im Mai 1855, im August 1855« und »Der Holzschlag« (1855); 1856: »Aufzeichnungen eines Marqueurs«, »Zwei Husaren«, »Der Schneesturm« und »Die Begegnung im Detachement«; 1857: »Luzern« und »Albert«; 1859: »Drei Todesarten«, »Das Familienglück«; 1860: »Polikuschka«; 1861: »Der Leinwandmesser«. Bis zum Beginn der Abfassung des Romans »Krieg und Frieden« 1864 und dann wiederum nach dessen Vollendung beschäftigte sich T. vorzugsweise mit Volkspädagogik; er errichtete auf seinem Gut eine »freie Schule«, veröffentlichte in seiner Zeitschrift »Jasnaja Poljana« zahlreiche volkserzieherische Abhandlungen (»Über Volksbildung« etc.), die zum Teil eine lebhafte Polemik hervorriefen, und schrieb unter anderm ein Lesebuch in 4 Teilen (1870), das 1904 bereits die 23. und 26. Auflage erlebte. In die Jahre 1873–76 fällt die Abfassung seines zweiten Hauptwerks: »Anna Karenin«, worauf er, von dichterischen Arbeiten sich mehr abwendend, theologische Studien trieb und sich an die Übersetzung und Auslegung der Evangelien machte (vollständig nur als Manuskript; daraus: »Kurze Auslegung des Evangeliums«, Genf 1890; »Vereinigung und Übersetzung der vier Evangelien«, das. 1892 bis 1894, 3 Tle.; ferner Lond. 1892–94, 2 Tle.). In den 1880er Jahren schrieb er dann außer einer Anzahl für das Volk bestimmter kleinerer, tief humaner, von christlichem Geist getragener Erzählungen (fast sämtlich deutsch von W. Goldschmidt in »Volkserzählungen des Grafen Leo T.« in Reclams Universal-Bibliothek) verschiedene theologische, moralphilosophische und soziologische Abhandlungen: »Meine Beichte« (in Rußland nur als Manuskript zirkulierend; Lond. o. J., Genf 1889); »Worin besteht mein Glaube?« (in Rußland nur als Manuskript zirkulierend; Genf [2. Aufl.] 1892; Lond. 1892); »Worin besteht das Glück« (1882), »Was sollen wir also tun?« (1884–1885) etc. sowie die psychologisch meisterhafte Novelle »Der Tod Iwan Iljitschs« (1885) und das auch auf deutschen Bühnen mehrfach ausgeführte dramatische Sittengemälde »Die Macht der Finsternis« (1887). Bedürfnislosigkeit und Nächstenliebe vom Menschen fordernd, betätigt T. seine Lehren dadurch, daß er, unter Bauern lebend, selber wie ein Bauer arbeitet und jeden nach Kräften mit Rat und Tat unterstützt. Von neuern Werken nennen wir: die Novelle »Die Kreuzersonate« (mit Epilog, 1890 u. ö.), auf die als eine Entgegnung sein Sohn Lew Lwowitsch »Ein Präludium Chopins« veröffentlichte (Stuttg. 1898, Berl. 1899), das satirische Lustspiel »Früchte der Bildung« (letzte Ausg., Berl. 1896), die Erzählung »Herr und Arbeiter« (1895), »Politik und Religion« (Berl. 1894), »Das Himmelreich« (das. 1894, 2 Bde.), »Christentum und Patriotismus« (Genf 1895, Berl. 1896), »Briefe an einen Polen« (das. 1896), »Patriotismus oder Friede« (das. 1896), »Was ist die Kunst?« (1897, und die Fortsetzung »Über die Kunst«) und endlich den Roman »Auferstehung« (1897), der den Heiligen Synod veranlaßte, T. 21. (6.) März 1901 aus der griechisch-orthodoxen Kirche zu exkommunizieren. Von Tolstojs »Antwort an den Synod« wurde die deutsche Übersetzung (Anhang zu Tolstojs Broschüre »Der Sinn des Lebens«) im Oktober 1901 in Leipzig beschlagnahmt. Von seinen neuesten Schriften seien genannt: »Besinnet Euch! (Tut Buße.) Ein Wort zum russisch-japanischen Krieg« (deutsch von Löwenfeld, Jena 1904), »Shakespeare. Eine kritische Studie« (deutsch von M. Enckhausen, Hannov. 1906), worin er die Größe und Bedeutung Shakespeares zu erschüttern sucht, und »Die Bedeutung der russischen Revolution« (deutsch von A. Heß, Oldenb. 1907), in der er seinen Ansichten über die jüngsten Ereignisse in seinem Vaterland Ausdruck verleiht. Von den Gesamtausgaben von Tolstojs Werken ist die vollständigste 1889–1900 in Moskau in 16 Bänden erschienen. Eine neue Ausgabe, die auch die von der russischen Zensur verbotenen Schriften enthält, erscheint seit 1901 in Christchurch (England, bis jetzt Bd. 1–2, 6–10). Übersetzt worden sind die einzelnen Schriften Tolstojs in alle Kultursprachen, außerdem sogar ins Chinesische; seine »Gesammelten Werke« wurden in deutscher Übersetzung herausgegeben von R. Löwenfeld (Berl. 1891, Jena 1907) und von H. Roskoschny (Tolstojs »Gesammelte Schriften«, das. 1891 ff.). Ungemein zahlreich sind die Schriften über T. und seine Werke, sowohl die von Russen (Strachow, Drushinin, A. Grigorjew, D. Pissarew, Gromeka, Obolenskij, Bulgakow, Skabitschewskij, Mereschkowskij [deutsch, Leipz. 1903], Sergejenko [deutsch, Berl. 1900] etc.) als auch die von Nichtrussen: de Vogüé (»Le roman russe«, Par. 1886), Lion, Badin, Dupuis, Ralston, G. Dumas, Laart de la Faille, Steiner (Lond. 1904); von Deutschen: J. Schmidt, W. Henckel, Löwenfeld (Berl. 1892), Glogau (Kiel 1893), Anna Seuron (Berl. 1895), Ettlinger (das. 1899), E. Zabel (Leipz. 1901), E. H. Schmitt (das. 1901), Esther Axelrod (Stuttg. 1901), J. Hart (Berl. 1904) u. a. Vgl. seine »Biographie und Memoiren«, herausgegeben von P. Birukow, durchgesehen von L. Tolstoj (Bd. 1: Kindheit und frühes Mannesalter, Wien 1906). Sein Bildnis s. Tafel »Klassiker der Weltliteratur IV« (Bd. 12).
Eheglück
I. Kapitel
Wir trauerten damals um meine Mutter, die im Herbst gestorben war, und lebten – Katja, Sonja und ich – den ganzen Winter zurückgezogen auf dem Lande.
Katja war eine alte Freundin unseres Hauses, unsere Gouvernante, die uns großgezogen hatte und die ich kannte und liebte, solange ich zurückzudenken vermag. Sonja war meine jüngere Schwester.
Der Winter, den wir in Pokrowskoje, unserem alten Gutshause zubrachten, war düster und traurig. Es war kalt, der Wind fegte den Schnee in dichten Haufen hoch an den Fenstern hinauf; die Scheiben blieben gewöhnlich dicht zugefroren, und wir gingen und fuhren fast nirgends hin. Besuche kamen selten, und die wenigen, die sich einfanden, brachten weder Heiterkeit noch Unterhaltung in unser Haus. Alle hatten traurige Gesichter, alle sprachen so leise, als ob sie jemand zu wecken fürchteten, sie lachten nie, seufzten und weinten oft, wenn sie mich und besonders die kleine Sonja in ihrem schwarzen Kleidchen ansahen. Es war, als ob noch immer der Tod im Hause zu spüren sei, als ob seine Schrecknisse noch immer die Luft erfüllten. Das Zimmer der Mutter war geschlossen, aber sooft ich daran vorüberging, um mich schlafen zu legen, war mir zumute, als ob mich etwas in das öde, kalte Gemach hineinzöge.
Ich war damals siebzehn Jahre alt, und die Mutter wollte gerade in dem Jahre, in dem sie starb, in die Stadt übersiedeln, um mich in die Gesellschaft einzuführen. Der Verlust der Mutter war ein großes Unglück für mich, aber ich muß bekennen, daß ich in allem Kummer um sie auch das schmerzliche Gefühl hatte, jung und – wie alle sagten – hübsch zu sein und nun schon den zweiten Winter in tödlicher Einsamkeit auf dem Lande zubringen zu müssen. Nach und nach erreichte die aus Gram, Einsamkeit und Langeweile gemischte Empfindung einen solchen Grad, daß ich das Zimmer nicht mehr verließ, das Klavier nicht mehr öffnete und kein Buch mehr zur Hand nahm. Wenn mir Katja zuredete, mich mit diesem oder jenem zu beschäftigen, gab ich zur Antwort: »Ich habe keine Lust – ich mag nicht!« – und im Herzen fragte eine Stimme: Warum denn? Warum etwas tun, wenn meine beste Lebenszeit so nutzlos vorübergeht? Warum? Und auf dies »Warum« hatte ich keine andere Antwort als Tränen.
Ich hörte sagen, daß ich mager würde und mich zu meinem Nachteil verändere, aber auch das ließ mich gleichgültig. Was lag daran? Wer kümmerte sich darum? Mir war zumute, als ob mein ganzes Leben in dieser trostlosen Öde, dieser rettungslosen Langeweile verfließen müßte, und dem zu entfliehen, hatte ich für mich allein nicht die Kraft, ja nicht einmal den Wunsch.
Zu Ende des Winters fing Katja an, für mich zu fürchten, und beschloß, mich so bald als möglich ins Ausland zu bringen. Dazu war Geld erforderlich, wir aber wußten kaum, was uns nach dem Tode der Mutter geblieben war, und warteten von Tag zu Tag auf den Vormund, der unsere Angelegenheiten ordnen sollte.
Im März kam der Vormund endlich.
»Gott sei Dank!« sagte Katja eines Tages, als ich wieder ohne Beschäftigung, ohne Gedanken, ohne Wünsche wie ein Schatten aus einer Ecke in die andere schlich. »Sergej Michailowitsch ist angekommen. Er hat hergeschickt, sich nach uns erkundigen zu lassen, und wird zum Mittagessen hier sein. Nimm dich zusammen, liebe Maschetschka«, fügte sie hinzu. »Was soll er denn von dir denken? Er hat euch so lieb! Er hat alle so liebgehabt.«
Sergej Michailowitsch war einer unserer Nachbarn und ein Freund meines verstorbenen Vaters, obwohl viel jünger als dieser. Abgesehen davon, daß seine Ankunft unser Leben anders gestaltete und uns vielleicht die Möglichkeit gab, das Landgut zu verlassen, war ich von Kindheit an gewohnt, ihn zu lieben und zu achten, und Katja wünschte, daß ich mich zusammennähme, weil sie erriet, daß es mir unter allen meinen Bekannten am schmerzlichsten gewesen wäre, Sergej Michailowitsch gegenüber in ungünstigem Lichte zu erscheinen.
Und nicht allein, daß ich ihn – wie alle im Hause, von Katja und seinem Patchen Sonja an bis zum letzten Pferdeknecht – liebhatte, er besaß für mich noch eine besondere Bedeutung wegen einer Äußerung, die meine Mutter einst in meiner Gegenwart getan hatte. Sie sagte: einen solchen Mann hätte sie mir gewünscht. Damals fand ich das sonderbar, ja sogar unangenehm, denn mein Ideal sah ganz anders aus. Mein Ideal war jung, hager, blaß und schwermütig. Sergej Michailowitsch dagegen war kein Jüngling mehr, war groß, stark und, wie mir schien, immer vergnügt. Trotzdem aber kamen mir die Worte der Mutter häufig in den Sinn, und schon sechs Jahre früher, als ich elf Jahre alt war, er noch du zu mir sagte, mit mir spielte und mich »Veilchen-Kind« zu nennen pflegte, fragte ich mich zuweilen mit einer gewissen Angst: Was soll ich tun, wenn er mich plötzlich heiraten will?
Kurz vor dem Mittagessen, dem Katja eine Mehlspeise, Creme und Spinatsauce zugefügt hatte, kam Sergej Michailowitsch. Ich sah ihn durchs Fenster, als er sich in einem kleinen Schlitten dem Hause näherte, eilte, sobald er um die Ecke bog, in den Salon und wollte mich stellen, als ob ich nicht auf ihn gewartet hätte. Als ich aber im Vorzimmer das Stampfen seiner Füße, seine laute Stimme und Katjas Schritte hörte, hielt ich's nicht aus und ging ihm entgegen.
Er hielt Katjas Hand, sprach laut und lächelte. Sobald er mich sah, verstummte er, blieb stehen und blickte mich eine Weile an, ohne mich zu grüßen. Mir wurde unbehaglich zumute, und ich fühlte, daß ich errötete.
»Ach! Ist's möglich? Sie sind's!« sagte er dann in seiner einfachen, herzlichen Weise, indem er mit ausgestreckten Händen auf mich zukam. »Ist's möglich, sich so zu verändern? Wie Sie gewachsen sind! Das soll unser Veilchen sein? Es ist eine volle Rose geworden.«
Mit seiner großen Hand ergriff er die meinige und drückte sie fest, beinahe schmerzhaft. Ich glaubte, er würde mir die Hand küssen, und hatte mich schon zu ihm geneigt, aber er drückte mir nur noch einmal die Hand und sah mir mit seinem festen, heiteren Blick gerade in die Augen.
Ich hatte ihn seit sechs Jahren nicht gesehen und fand ihn sehr verändert. Er war älter, dunkler geworden und trug einen starken Bart, der ihm nicht gut stand; aber er hatte dasselbe einfache, offene, ehrliche Wesen wie früher und dasselbe Gesicht mit den kräftigen Zügen, den klugen, blitzenden Augen und einem freundlichen, beinahe kindlichen Lächeln.
Nach fünf Minuten hatte er aufgehört, unser Gast zu sein, und war für uns alle ein Familienglied, selbst für unsere Leute, deren Diensteifer bewies, wie sehr sie sich über seine Ankunft freuten.
Er benahm sich nicht wie unsere anderen Nachbarn, die, wenn sie nach dem Tode unserer Mutter kamen, für nötig hielten, zu schweigen und zu weinen, solange sie bei uns blieben; er war im Gegenteil gesprächig, heiter und erwähnte die Mutter mit keinem Wort, so daß ich diese Gleichgültigkeit anfangs sonderbar und von einem so nahestehenden Freunde sogar unpassend fand. Später aber sah ich ein, daß es nicht Gleichgültigkeit, sondern Aufrichtigkeit war, und dankte ihm dafür.
Abends setzte sich Katja zum Tee-Einschenken auf den alten Platz im Salon, wie es bei Mama der Fall gewesen war. Ich und Sonja setzten uns neben sie, der alte Grigorij brachte Sergej Michailowitsch eine von des Vaters Pfeifen, und wie in früheren Zeiten fing er an, im Zimmer hin und her zu gehen.
»Wie viele traurige Veränderungen hier im Hause – wenn ich bedenke!« sagte er plötzlich, indem er stehenblieb.
»Ja!« antwortete Katja mit einem Seufzer, deckte den Samowar zu und machte ein Gesicht, als ob sie weinen wollte.
»Sie erinnern sich wohl Ihres Vaters?« fragte er, zu mir gewandt.
»Wenig!« gab ich zur Antwort.
»Wie gut wäre es jetzt für Sie, wenn Sie ihn hätten!« sagte er leise und nachdenklich, indem er auf meine Stirn niedersah. »Ich habe Ihren Vater sehr liebgehabt«, fügte er noch leiser hinzu, und ein feuchter Glanz kam in seine Augen.
»Der liebe Gott hat ihn uns genommen!« rief Katja, legte die Serviette auf die Teekanne und fing an zu weinen.
»Ja, traurige Veränderungen sind hier vorgegangen!« wiederholte er und wandte sich ab. »Sonja, zeige mir deine Spielsachen«, sagte er nach einer Pause und ging in den Saal hinaus. Mit Augen voll Tränen sah ich Katja an, als er hinausging.
»Das ist ein treuer Freund!« sagte sie.
»Ja, gewiß!« antwortete ich, und es wurde mir eigentümlich wohl und warm zumute bei dem Mitgefühl dieses fremden, guten Menschen.
Aus dem Saale klangen Sonjas Stimmchen und sein Scherzen mit ihr zu uns herein. Ich schickte ihm den Tee, und dann hörten wir, daß er sich ans Klavier setzte und mit Sonjas Händen auf die Tasten schlug.
»Maria Alexandrowna!« rief er nach einer Weile. »Bitte kommen Sie her, spielen Sie etwas.«
Es freute mich, daß er so einfach, freundschaftlich-befehlerisch mit mir sprach. Ich stand auf und ging zu ihm.
»Spielen Sie dies«, sagte er, indem er in einem Heft das Adagio der Beethovenschen Sonate quasi una fantasia aufschlug. »Lassen Sie sehen, wie Sie spielen«, fügte er hinzu und begab sich mit seinem Teeglas an das andere Ende des weiten Saales.
Ich fühlte – ich weiß nicht aus welchem Grunde –, daß es unmöglich war, sein Verlangen abzuschlagen oder Vorbemerkungen über schlechtes Spiel zu machen.
Gehorsam setzte ich mich ans Klavier und fing an zu spielen, so gut ich konnte; übrigens fürchtete ich sein Urteil, denn ich wußte, daß er ein Musikfreund und -kenner war.
Das Adagio sprach dieselben Gefühle der Erinnerung aus, die durch das Gespräch am Teetisch in mir wachgerufen waren, und mein Vortrag schien ihm zu genügen. Das Scherzo dagegen ließ er mich nicht spielen.
»Nein, das spielen Sie nicht gut«, sagte er herantretend. »Lassen Sie's lieber. Das erste war nicht schlecht. Sie scheinen Verständnis für Musik zu haben.«
Dieses maßvolle Lob erfreute mich so sehr, daß ich errötete. Es war mir neu und angenehm, daß Sergej Michailowitsch, der Freund meines Vaters, ernsthaft und wie ein Gleichgestellter mit mir sprach, statt mich wie früher als Kind zu behandeln.
Katja ging hinauf, Sonja zu Bett zu bringen, und wir beide blieben allein im Saale.
Er erzählte mir von meinem Vater, wie er ihn kennengelernt und wie heiter sie miteinander verkehrt hatten, während ich noch bei meinen Schulbüchern und Spielsachen gesessen hatte. In seinen Erzählungen trat mir mein Vater zum ersten Male einfach als liebenswürdiger Mensch entgegen, wie ich ihn anzusehen bis jetzt noch nicht gelernt hatte. Später befragte er mich über meine Liebhabereien, meine Lektüre, wollte wissen, was ich jetzt vorzunehmen gedächte, und gab mir verschiedene Ratschläge. Er war nicht mehr mein heiterer, scherzender Spielkamerad, sondern ein ernster, einfacher, warmherziger Mann, der mir Achtung und Zuneigung einflößte. Mir war leicht und angenehm zumute, und doch fühlte ich einen gewissen Zwang, wenn ich mit ihm sprach. Ich fürchtete für jedes meiner Worte und wollte die Neigung, die ich jetzt nur dadurch erworben hatte, daß ich meines Vaters Tochter war, durch eigene Kraft verdienen.
Nachdem Katja mein Schwesterchen Sonja schlafen gelegt hatte, gesellte sie sich wieder zu uns und beklagte sich bei Sergej Michailowitsch über meine fast krankhafte Teilnahmslosigkeit, von der ich ihm nichts gesagt hatte.
»Die Hauptsache hat sie mir also nicht erzählt!« sagte er und schüttelte halb lächelnd, halb vorwurfsvoll den Kopf.
»Was ist davon zu erzählen?« antwortete ich. »Das ist sehr langweilig, und es geht vorüber.« – Mir schien es wirklich, als ob mein Trübsinn nicht nur vergehen würde, sondern als ob er schon verginge oder nie vorhanden gewesen sei.
»Es ist schlimm, die Einsamkeit nicht ertragen zu können«, sagte er. »Sind Sie denn ein wohlerzogenes Fräulein?«
»Freilich bin ich ein solches Fräulein«, gab ich lächelnd zur Antwort.
»Nein! Ein schlechtes Fräulein, das nur lebt, solange man ihm huldigt, und zusammensinkt und an nichts mehr Freude hat, alles nur für andere, nichts für sich selbst.«
»Sie haben eine schöne Meinung von mir«, antwortete ich, nur um etwas zu sagen.
»Nein«, sagte er nach kurzem Schweigen, »nicht umsonst sind Sie Ihrem Vater so ähnlich! Es steckt etwas in Ihnen ...«, und sein guter, aufmerksamer Blick tat mir wohl und versetzte mich in freudige Verwirrung.
Erst jetzt bemerkte ich diesen nur ihm eigentümlichen Blick, der anfangs so heiter schien und dann immer forschender und selbst etwas traurig wurde.
»Sie sollen und Sie können sich nicht langweilen«, sagte er. »Sie haben die Musik, für die Sie Verständnis haben, Bücher, Studien aller Art – vor Ihnen liegt das ganze Leben, auf das Sie sich nur jetzt vorbereiten können, wenn Sie später nichts zu bereuen haben wollen. In einem Jahr schon ist es zu spät.«
Er sprach mit mir wie ein Vater oder Onkel. Ich fühlte, wie er sich Mühe gab, sich mit mir auf gleichen Fuß zu stellen. Es kränkte mich, daß er glaubte, sich zu mir herablassen zu müssen, und es war mir auch wieder schmeichelhaft, daß er für nötig hielt, um meinetwillen anders zu sein als sonst.
Den Rest des Abends sprach er mit Katja über Geschäftssachen.
»Und nun leben Sie wohl, meine lieben Freundinnen«, sagte er schließlich, indem er aufstand, zu mir trat und meine Hand faßte.
»Wann sehen wir uns wieder?« fragte Katja.
»Im Frühling«, antwortete er und hielt noch immer meine Hand. »Jetzt gehe ich nach Danilowka (unser zweites Landgut), sehe zu, wie es dort steht, richte ein, was ich kann, und begebe mich dann – auch wegen meiner eigenen Angelegenheiten – nach Moskau. Im Sommer sehen wir uns öfter.«