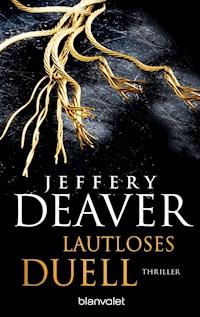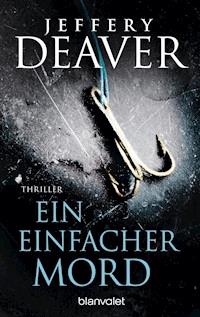
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: John-Pellam-Thriller
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Eigentlich ist John Pellam nur nach Maddox gefahren, um Bier und Chips für eine gemütliche Pokerrunde zu besorgen. Doch dann wird der Filmemacher aus Hollywood unvermutet Zeuge eines eiskalten Doppelmords. Und damit fangen seine Schwierigkeiten erst so richtig an: Die Staatsanwaltschaft setzt John mächtig unter Druck, weil sie glaubt, er könne den Auftraggeber des brutalen Verbrechens identifizieren. Und als John aus demselben Grund ins Visier der Mafia gerät, sieht er sich in einer scheinbar ausweglosen Klemme: Schweigen ist bestimmt nicht immer Gold, aber Reden wäre sein sicherer Tod …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 435
Ähnliche
Buch
Eigentlich ist John Pellam nur nach Maddox gefahren, um Bier und Chips für eine gemütliche Pokerrunde zu besorgen. Doch dann wird der Filmemacher aus Hollywood unvermutet Zeuge eines eiskalten Doppelmords. Und damit fangen seine Schwierigkeiten erst so richtig an: Die Staatsanwaltschaft setzt John mächtig unter Druck, weil sie glaubt, er könne den Auftraggeber des brutalen Verbrechens identifizieren. Und als John aus demselben Grund ins Visier der Mafia gerät, sieht er sich in einer scheinbar ausweglosen Klemme: Schweigen ist bestimmt nicht immer Gold, aber Reden wäre sein sicherer Tod …
Autor
Jeffery Deaver gilt als einer der weltweit besten Autoren intelligenter psychologischer Thriller. Seit seinem ersten großen Erfolg als Schriftsteller hat der von seinen Fans und den Kritikern gleichermaßen geliebte Jeffrey Deaver sich aus seinem Beruf als Rechtsanwalt zurückgezogen und lebt nun abwechselnd in Virginia und Kalifornien. Seine Bücher, die in 25 Sprachen übersetzt werden und in 150 Ländern erscheinen, haben ihm zahlreiche renommierte Auszeichnungen eingebracht.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Jeffery Deaver
Ein einfacher Mord
Roman
Deutsch von Helmut Splinter
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 1993 unter dem Titel »Bloody River Blues« bei Pocket Books, Simon & Schuster, Inc., New York.
E-Book-Ausgabe 2016
Copyright der Originalausgabe © 1993 by Jeffery Deaver
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2004 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright dieser Ausgabe © 2016 by Blanvalet in derPenguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: © www.buerosued.de
Umschlagmotiv: © plainpicture/Anja Weber-Decker
ISBN 978-3-641-19621-9V002
www.blanvalet-verlag.de
Für Monica Derham
»Für einen Film braucht man nur eine Waffe und eine Frau.«
Jean-Luc Godard
Inhaltsverzeichnis
… Eins
Alles, was er wollte, war ein Kasten Bier.
Aber es sah so aus, als müsste er ihn selbst besorgen.
»Ich kann wohl kaum einen Kasten Labatts hinten auf einer Yamaha transportieren«, erklärte Stile.
»Schon in Ordnung«, erwiderte Pellam ins Mobiltelefon.
»Wenn du einen Sechserpack willst, das würde gehen. Aber der Gepäckträger ist locker. Den bin ich dir ja wohl schuldig. Den Gepäckträger, meine ich. Tut mir Leid.«
Das Motorrad gehörte der Filmgesellschaft, war aber Pellam zur Benutzung überlassen worden, der es wiederum Stile geliehen hatte. Stile war Stuntman. Pellam dachte lieber nicht darüber nach, was Stile getan hatte, um den Gepäckträger zu demolieren.
»Ist schon in Ordnung«, wiederholte Pellam. »Ich werde selbst einen Kasten besorgen.«
Er drückte auf die Austaste und holte seine braune Bomberjacke aus dem vorderen Schrank des Winnebago, während er überlegte, wo er den Getränkeladen gesehen hatte. Bis zum Riverfront Deli war es nicht weit, anders als das Datum seines nächsten Gehaltsschecks, so dass Pellam keine Lust hatte, 26,50 Dollar für einen Kasten zu bezahlen, auch wenn er von Kanada importiert und bis hierher transportiert worden war.
Er ging in die Kochnische seines Wohnwagens, rührte das Chili um und legte das Brot zum Aufbacken in den kleinen Herd. Er hatte überlegt, zur Abwechslung mal etwas anderes zu kochen. Niemand schien bemerkt zu haben, dass es immer Chili gab, wenn sich die Poker-Runde bei ihm traf. Mal servierte er es mit Hot Dogs, mal auf Reis, aber es war und blieb Chili. Und Austern-Cracker. Viel mehr konnte er nicht kochen.
Er überlegte, auf einen ganzen Kasten Bier zu verzichten und Stile noch einmal anzurufen und zu sagen: Ja, bring einfach ein Sechserpack mit. Aber er rechnete schnell nach und wusste, dass sie einen ganzen Kasten brauchten. Zu fünft würden sie sechs Stunden lang spielen, was bedeutete, dass sogar ein ganzer Kasten fast zu knapp war. Er würde, wenn es so weit war, den Mescal und den Wild Turkey rausrücken müssen.
Pellam trat nach draußen, schloss die Wohnwagentür ab und ging die Straße am grauen Missouri River entlang. Es war gerade erst dunkel geworden, ein trüber Wochentag im Herbst, und eigentlich müsste jetzt Stoßverkehr herrschen. Aber die Straße hob und senkte sich vor ihm, ohne dass irgendwo ein Auto zu sehen war. Er zog den Reißverschluss seiner Jacke bis oben hin zu. Pellam war groß und dünn. An diesem Abend trug er Jeans und ein Arbeiterhemd, das früher schwarz gewesen, jetzt aber grau gefleckt war. Die Absätze seiner Cowboy-Stiefel kratzten laut über den nassen Asphalt. Hätte er doch nur seine Lakers-Mütze oder seinen Stetson aufgesetzt. Vom Fluss wehte ein kalter Wind herüber, und mit ihm der Geruch nach Salz und Fisch. Pellams Augen brannten, und seine Ohren taten weh.
Er ging schnell. Er befürchtete, dass Danny, der Drehbuchautor des Films, der gerade gedreht wurde, zu früh kommen könnte. Pellam hatte neulich einen fünf Kilo schweren Wels in der Badewanne von Dannys Hotelzimmer zurückgelassen, und Danny hatte gedroht, zur Vergeltung die Winnebago-Tür zuzuschweißen.
Der vierte Poker-Spieler war aus San Diego und ein Helfer des Kameramanns, der immer noch aussah wie der Matrose von der Handelsmarine, was er früher tatsächlich einmal gewesen war. Auch die Tätowierungen fehlten nicht. Der Fünfte im Bunde war ein Anwalt aus St. Louis, ein Kerl mit Adlernase und Hängebacken. Die Filmgesellschaft in L.A. hatte ihn engagiert, um vor Ort die Eigentumsrechte und Verträge mit den Ortsansässigen auszuhandeln. Er redete ununterbrochen über die Politik in Washington, als hätte er sich als Präsidentschaftskandidat beworben, wäre aber abgelehnt worden, weil er der einzige ehrliche Kandidat im Rennen war. Sein Gequassel war eine Qual, aber beim Pokern war er einfach klasse – er setzte hoch und wusste zu verlieren.
Die Hände in den Taschen, bog Pellam in die Adams Street ein und entfernte sich vom Fluss, während er das gespenstische, verlassene Gebäude aus rotem Backstein von Maddox Ironworks betrachtete.
Ganz schön feuchte Luft, dachte er. Könnte noch regnen.
Würde der Zeitplan für die Dreharbeiten in dieser verdammten Stadt sehr überzogen werden?
Würde das Chili anbrennen, oder hatte er die Flamme heruntergedreht?
Und über allem schwebte der Gedanke an einen Kasten Bier.
»In Ordnung, Gaudia geht die Third Street runter, okay? Er arbeitet meistens bis sechs oder halb sieben, aber heute Abend geht er mit einer Frau was trinken, ich weiß aber nicht, mit welcher.«
»Warum ist er in Maddox?«, wollte Philip Lombro von Ralph Bales wissen.
»Das habe ich doch gerade gesagt. Er geht ins Jolly Rogue, um da was zu trinken. Kennst du das Jolly Rogue? Dann geht er ins Callaghan, ein Steak essen.«
Während Philip Lombro zuhörte, senkte er den Kopf und berührte seine Wange mit zwei zu einem V gespreizten Fingern. Sein Gesicht hatte schon viel Sonne gesehen, aber bronzefarben war es deswegen noch lange nicht; Lombros Gesichtsfarbe tendierte eher in Richtung Silber oder Platin, was zu seiner weißen Haarpracht passte, die sorgfältig in Form gesprüht war. »Was ist mit Gaudias Leibwächter?«, fragte er.
»Er wird nicht mitkommen. Gaudia glaubt, Maddox sei ein sicheres Pflaster. Gut, er hat also für halb acht reserviert. Es sind fünf Minuten zu Fuß – ich hab’s überprüft –, und sie werden um Viertel nach sieben losgehen.«
Ralph Bales saß auf dem Vordersitz des marineblauen Lincoln und schaute geradeaus, während er mit Lombro sprach. Ralph Bales war neununddreißig, muskulös und überall behaart außer auf dem Kopf. Sein Gesicht war unverhältnismäßig dick, als würde er eine Latexmaske für Spezialeffekte tragen. Er war nicht hässlich, hatte aber ein Mondgesicht. An diesem Abend trug er ein schwarz-rot gestreiftes Rugby-Hemd, blaue Jeans und eine Lederjacke. »Er ist auf der Third, ja? Von dort geht eine Gasse Richtung Westen. Da ist es richtig dunkel. Stevie wird da sein und den Stadtstreicher mimen.«
»Stadtstreicher? In Maddox gibt es keine Stadtstreicher.«
»Dann eben einen Gammler. Gammler gibt’s in Maddox«, entgegnete Ralph Bales.
»In Ordnung.«
»Er hat eine kleine Beretta, eine.22, bei der ein Schalldämpfer nicht nötig ist. Ich habe die Ruger. Stevie ruft ihn, er bleibt stehen und dreht sich um. Stevie pustet ihn aus der Nähe um. Ich bin hinter ihm, nur für den Notfall. Zack, schon sind wir in Stevies Wagen, über den Fluss rüber und nicht mehr zu sehen.«
»Ich werde vorne an der Gasse sein«, meinte Lombro. »Auf der Third.«
Ralph Bales schwieg einen Moment, hielt seinen Blick aber auf Lombro gerichtet. Er sah eine Hakennase, freundliche Augen und einen schicken Anzug mit Paisley-Krawatte. Es war komisch, aber mehr als das konnte man nicht sehen. Man würde meinen, sein silbergraues Haar, die auf Hochglanz polierten, ochsenblutfarbenen Mokassins mit Troddeln und die abgenutzte Rolex würden alles über Philip Lombro sagen. Nein, mehr war nicht. Nur die Einzelteile und nichts als die Einzelteile. Wie auf einem Foto im Peoples Magazine.
Lombro erwiderte gelassen Ralph Bales Blick. »Ja?«, fragte er. »Hast du ein Problem damit?«
Ralph Bales dachte, er könnte den Blickwettbewerb gewinnen, wenn er nur wollte, und betrachtete den üppigen Haarwuchs auf seinem Handrücken. »Gut, ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, wenn du da bist. Aber das habe ich dir ja schon gesagt.«
»Ja, das hast du.«
»Gut, ich glaube immer noch, dass es keine gute Idee ist.«
»Ich will sehen, wie er stirbt.«
»Du wirst die Fotos sehen. Im Post-Dispatch werden Bilder sein. Im Reporter werden Fotos sein. In Farbe.«
»Ich werde ab Viertel nach sieben da sein.«
Ralph Bales trommelte mit den Fingern auf den Ledersitz des Lincoln. »Es geht auch um meinen Arsch.«
Lombro blickte auf seine Uhr. Das Glas war zerkratzt und vergilbt. Zehn vor sieben. »Ich kann mir jemand anderen suchen, der die Arbeit erledigt.«
Ralph Bales wartete einen Moment. »Das ist nicht nötig. Wenn du dabei sein willst, ist das deine Sache.«
»Genau, das ist meine Sache.«
Ohne weiter darauf einzugehen, öffnete Ralph Bales die Wagentür.
In diesem Augenblick passierte es.
Verdammt …
Ein Schlag, das Geräusch von Glas, das auf Glas trifft, und ein paar dumpfe Explosionen. Ralph Bales sah zu diesem Mann auf – einem dünnen Kerl in brauner Lederjacke. Er stand einfach da, blickte ihn an, ein Lächeln auf den Lippen, das sagte, ich wusste, dass so was in der Art passieren würde. Bier schäumte aus dem Boden des Pappkartons, der auf dem Bürgersteig stand.
Der Mann blickte Ralph Bales an und dann an ihm vorbei in den Wagen. Ralph Bales knallte die Wagentür zu und ging fort.
»Hey, mein Bier«, sagte der Mann mit dem wehmütigen Lächeln.
Ralph Bales beachtete ihn nicht und ging die Adams Street weiter.
»Hey, mein Bier!«
Ralph Bales beachtete ihn immer noch nicht.
Der Mann ging hinter ihm her. »Ich rede mit Ihnen. Hallo!«
»Leck mich«, erwiderte Ralph Bales und bog um die Ecke.
Der große Mann starrte ihm entrüstet und mit verzerrtem Mund einen Moment hinterher, dann beugte er sich hinunter und blickte durchs Fenster des Lincoln. Er wölbte seine Hände und klopfte ans Fenster. »Hallo, euer Kumpel … hallo.« Wieder klopfte er. Lombro legte den Gang ein und fuhr los. Der Mann sprang zurück und blickte dem Lincoln hinterher. Er kniete sich neben seinen ramponierten Karton, aus dem das Bier in den Rinnstein floss wie aus einem undichten Hydranten.
Donald Buffett vom Maddox Police Department beobachtete, wie der letzte Rest des Biers auf die Straße sickerte, und dachte, wenn das in den Cabrini-Projekten im Westen der Stadt passiert wäre, würde es ein Dutzend Typen auflecken oder sich wegen der nicht zerbrochenen Flaschen gegenseitig abstechen.
Buffett lehnte an einer Backsteinmauer und beobachtete den Kerl – Buffett dachte, er sehe aus wie ein Cowboy –, der den Karton aufriss und rettete, was noch zu retten war. Wie ein Kind, das in seinen Spielsachen kramt. Der Cowboy stand auf und zählte die vielleicht unbeschädigten Flaschen. Der Karton war durchgeweicht und löste sich auf.
Buffett hatte erwartet, dass der Kerl auf den Mann losgehen würde, der aus dem Lincoln gestiegen war. Es gab eine Zeit, noch vor der Akademie und vor dem Polizeidienst, in der Buffett in so einem Fall seinem Gegenüber das Fell über die Ohren gezogen hätte. Aber der Cowboy hier reihte nur die unbeschädigten Flaschen im Schatten des Neuman-Möbelladens auf, um sie dort zu verstecken. Er schien noch einmal in den Getränkeladen gehen zu wollen. Den Karton stopfte er in einen Müllcontainer und wischte seine Hände an der Hose ab.
Buffett stieß sich von der Wand ab und überquerte die Straße.
»n’Abend, Sir«, grüßte er.
Der Cowboy blickte auf und schüttelte den Kopf. »Haben Sie das gesehen?«, fragte er. »Nicht zu glauben, oder?«
»Ich behalte sie im Auge, wenn Sie sich eine Tasche oder so was besorgen wollen«, bot Buffett an.
»Echt?«
»Klar.«
»Danke.« Er verschwand die leere Straße hinunter.
Zehn Minuten später kam der Cowboy mit einer Plastiktüte mit zwei Sixpack zurück. Die kleine Papiertüte, die er noch dabei hatte, reichte er Buffett.
»Ich würde Ihnen ja ein Labatts anbieten, aber ich denke, es gibt Vorschriften bei Polizisten im Dienst. Deswegen kriegen Sie einen Kaffee und einen Doughnut. Zucker ist auch in der Tüte.«
»Vielen Dank, Sir.« Buffett war peinlich berührt und fragte sich, warum eigentlich. »Das wäre nicht nötig gewesen.«
Der Cowboy hob die Bierflaschen auf und packte sie in die Einkaufstüte. Buffett bot ihm nicht an zu helfen. Schließlich erhob sich der Cowboy wieder und stellte sich vor. »John Pellam.«
»Donnie Buffett.«
Sie nickten einander zu, reichten sich aber nicht die Hände.
Buffett hob den Kaffeebecher hoch, als würde er Pellam zuprosten, und ging. Hinter ihm klimperten Bierflaschen, als sich der Mann auf den Weg Richtung Fluss machte.
Um zwanzig nach sieben an diesem Abend blickte Vincent Gaudia an dem kurzen, weißen Kleid seiner blonden Begleiterin hinunter. »Es ist Zeit, zu essen«, sagte er.
»Und woran hast du gedacht?« Sie atmete tief durch, und bei ihrem Lächeln bildeten sich kleine Krähenfüße in ihrem Make-up, das sie ein wenig zu dick aufgetragen hatte.
Gaudia stand auf solche Frauen. Auch wenn sie für ihn ein Gebrauchsartikel waren, versuchte er, nicht herablassend zu sein. Einige seiner Begleiterinnen waren sehr intelligent, einige spirituell veranlagt, andere opferten freiwillig viele Stunden im Dienste irgendeiner guten Sache. Und obwohl ihm ihre Gedanken, ihre Seelen und ihr Bewusstsein egal waren, hörte er ihnen begeistert und mit echter Neugier zu, wenn sie von ihren Interessen erzählten.
Aber eigentlich war er nur darauf aus, diese Frau hier mit in seinen Laden zu nehmen, wo er ihr sagen könnte, dass sie endlich mit ihren geistigen Führern aufhören und sich hinknien sollte, damit er sich an ihren Strapsen wie an Zügeln festhalten konnte. Er drückte seinen Ellbogen zwischen ihre Brüste. »Im Moment rede ich vom Abendessen«, sagte er.
Sie kicherte.
Sie verließen das Jolly Rogue, überquerten die River Road und gingen die Third Street Richtung Innenstadt von Maddox entlang, vorbei an Büros, schmuddeligen Stehcafés und düsteren Läden, die voll gestellt waren mit fleckigen, abgenutzten Gebrauchtmöbeln. Die Frau drückte sich an ihn, um sich zu wärmen. Die kalte Luft erinnerte Gaudia an seine Kindheit in Cape Girardeau, als er von der Schule nach Hause gegangen war und das Laub mit seinen zweifarbigen Schuhen aufwirbelte, in dem er einen Apfel mit aufgeweichter Zuckerglasur oder eine Süßigkeit von Halloween vor sich hergekickt hatte.
An Halloween hatte er ein paar wahnsinnige Dinger gedreht, und immer, wenn er kalte Herbstluft roch, wurden die angenehmen Erinnerungen daran in ihm wach. »Was hast du an Halloween gemacht?«, fragte Gaudia. »Als Kind, meine ich.«
Sie blinzelte, dann dachte sie nach. »Na ja, wir hatten viel Spaß, weißt du. Ich habe mich meistens als Prinzessin oder so was verkleidet. Einmal war ich auch eine Hexe.«
»Eine Hexe? Unmöglich. Selbst wenn du es versuchen würdest, wärst du keine.«
»Du bist lieb. Dann haben wir tonnenweise Süßigkeiten gesammelt. Ich meine wirklich tonnenweise. Ich mochte Babe Ruths, ach nein, ha, ha, Baby Ruths am liebsten, und manchmal habe ich extra ein Haus gesucht, in dem es die Dinger gab. Dann bin ich immer wieder hingegangen. Einmal habe ich zwölf Baby Ruths bekommen. Aber ich musste aufpassen. Als Kind hatte ich eine Menge Pickel.«
»Heute ziehen die Kinder an Halloween nicht mehr los. Es ist gefährlich. Hast du von dem Typen gehört, der Nadeln in Äpfel gesteckt hat?«
»Äpfel mochte ich nie. Nur Schokoriegel.«
»Baby Ruths«, erinnerte sich Gaudia.
»Wohin gehen wir? Hier ist’s ja richtig gruselig.«
»Wir sind in einer gruseligen Stadt. Aber hier gibt’s das beste Steakhaus im Staat außerhalb von Kansas City. Das Callaghan’s. Magst du Steak?«
»Ja, Steak mag ich. Und Steak mit Fisch … aber das ist teuer«, fügte sie bescheiden hinzu.
»Ich glaube, dort gibt es Steak mit Fisch. Wenn du das willst, bestelle ich es dir. Du kannst alles haben, was du willst.«
Ralph Bales stand an der Straßenecke in der Nische der Missouri National Bank und beobachtete das Paar im schwachen Schein der Straßenlaterne, bei der drei von vier Birnen durchgebrannt waren. Das Mädchen schien an seinem Arm zu kleben, was wahrscheinlich eher ein Vorteil war, weil sie Gaudias Schießhand blockierte, falls er eine Waffe dabei hatte.
Philip Lombros dunkler Lincoln Town Car, kastenförmig wie ein Flugzeugträger, stand auf der anderen Straßenseite. Auspuffgas stieg in die kalte Luft. Ralph Bales betrachtete die perfekte Karosserie mit dem makellosen Chrom, dann Lombros Silhouette hinter dem Steuer. Dieser Mann war wahnsinnig. Ralph Bales konnte nicht verstehen, warum er bei der Schießerei zuschauen wollte. Er wusste, dass manchen Typen einer abgeht, wenn sie Leute umlegen. Und das schon fast im sexuellen Sinn. Allerdings hatte Ralph Bales den Eindruck, dass dies etwas war, was Lombro glaubte, tun zu müssen, aber nicht unbedingt tun wollte.
Eine Stimme ertönte in der kühlen Luft – Stevie Flom, Ralph Bales Partner, spielte den Stadtstreicher. »O Mann, ja genau, ja, das war’s! Ich hab’s in der Zeitung gelesen … in der Zeitung, ich hab’s gelesen, vergesst, was ihr gelesen habt, vergesst, was ihr gelesen habt …«
Dann dachte Ralph Bales, er hätte gehört, wie Stevie den Schlitten auf der Beretta zurückzog, auch wenn er sich das vielleicht nur eingebildet hatte. In solchen Momenten hört man Geräusche und sieht Dinge, die eigentlich nicht da sind. Seine Nerven vibrierten wie ein Dragster, der ungeduldig an einer roten Ampel wartete. Er wünschte, er wäre nicht so nervös.
Klappernde Ledersohlen auf Beton. Das Geräusch wirkte übertrieben laut. Klappernde und schlurfende Schritte auf dem nassen, leeren Bürgersteig.
Kichern.
Klappern.
Licht spiegelte sich in Gaudias Schuhen. Ralph Bales kannte Gaudias Schwäche für Mode. Vermutlich trug er gerade Schuhe für fünfhundert Dollar. Auf Ralph Bales Schuhe stand »Kunstleder«, und die Menschen, die diese Kunst beherrschten, wohnten in Taiwan.
Aus sieben Metern Entfernung hallten Schritte.
Der Auspuff des Lincoln brummte vor sich hin.
Ralph Bales Herz pochte.
Stevie redete wie ein durchgeknallter Säufer. Stritt mit sich selbst.
Die Blonde kicherte.
»Hätten Sie vielleicht ein bisschen Kleingeld, Mister?«, fragte Stevie schließlich.
Gaudia wäre ein Dreckskerl, wenn er nicht stehen bleiben und einen Geldschein aus der Tasche ziehen würde.
Ralph Bales rannte mit der geladenen Ruger über die Straße. Die Waffe lag schwer in seiner Hand. Dann der schrille Schrei der Frau, eine rasche Bewegung, als Gaudia sie herumwirbelte und als Schutzschild zwischen sich und Stevie benutzte. Ein Schuss, dann ein zweiter. Die Blonde sackte zusammen.
Gaudia rannte weg. Schnell. Versuchte zu fliehen.
Heilige Mutter Gottes …
Ralph Bales hob die schwere Waffe und schoss zwei Mal. Er traf Gaudia mindestens ein Mal. Im Genick, dachte er. Gaudia fiel auf den Bürgersteig, hob kurz eine Hand und blieb reglos liegen.
Lombro ließ den Motor des Lincoln laut aufheulen, dann jagte er davon.
Einen Moment herrschte Stille.
Ralph Bales ging auf Gaudia zu.
»Stehen bleiben!«
Der Schrei kam aus einer Entfernung von nur eineinhalb Metern hinter ihm. Bales musste vor Schreck fast kotzen, und so, wie sein Herz raste, fragte er sich, ob er einen Infarkt bekommen würde.
»Ja, Sie meine ich, Mister.«
Ralph Bales Hand senkte sich, die Waffe zeigte nach unten. Er keuchte abgehackt und schluckte.
»Waffe fallen lassen!« Die Stimme schnappte über vor kaum zu bändigender Hysterie.
»Ich lasse sie fallen.« Das tat Ralph Bales dann auch. Er schielte, als die Waffe auf den Boden fiel. Sie ging nicht los.
»Und jetzt auf den Boden legen!« Der Polizist sank in die Hocke, hielt aber seine Waffe immer auf Ralph Bales’ Kopf gerichtet.
»In Ordnung!«, sagte Ralph Bales. »Tun Sie nichts. Ich lege mich jetzt hin.«
»Sofort!«
»Ich mach ja schon! Ich lege mich ja schon hin!« Ralph Bales sank auf die Knie, dann legte er sich auf den Bauch. Die Straße roch nach Öl und Hundepisse.
Der Polizist ging um ihn herum, kickte die Ruger zur Seite und sprach in sein Funksprechgerät. »Hier ist Buffett. Ich bin in der Innenstadt von Maddox. Code 10–13. Es wurden Schüsse abgegeben, zwei Personen getroffen. Ich brauche einen Krankenwagen und Verstärkung in der …«
Genauer konnte der Mitarbeiter in der Funkzentrale der Polizei und Feuerwehr von Maddox nicht in Erfahrung bringen, wohin Donnie Buffett die Verstärkung und den Krankenwagen bestellen wollte – zumindest im Moment noch nicht. Der Funkspruch des Beamten wurde abrupt unterbrochen, als Stevie Flom aus der Gasse trat und das Magazin seiner Beretta in dessen Rücken entlud.
Buffett stöhnte, fiel auf die Knie und versuchte, hinter sich zu greifen. Dann stürzte er nach vorne.
Ralph Bales stand auf, griff zu seiner Ruger, ging zum bewusstlosen Polizisten und hielt die Mündung seiner Pistole an dessen Kopf. Er spannte den Hahn.
Langsam wühlte sich der schwere, blaue Lauf durch das schweißnasse Haar des Polizisten. Ralph Bales legte seine linke Hand über seine Augen. Sein Herz schlug acht Mal. Seine Hand erstarrte und entspannte sich wieder. Er trat zurück, wandte sich von dem Polizisten ab und begnügte sich damit, Gaudia und der Blondine jeweils einen Kopfschuss zu verpassen.
Dann gingen Ralph Bales und Stevie Flom forsch wie zwei Fans, die gerade von einem Basketballspiel kamen und sich ein paar Bier genehmigen wollten, auf einen gestohlenen schwarzen Trans Am mit einem sportlichen roten Streifen auf der Seite zu. Stevie startete den Motor, während sich Ralph Bales in den bequemen Schalensitz sinken ließ. Er hob seinen tauben Zeigefinger an die Oberlippe und roch Schießpulver und den Rauch vom Zündhütchen. Während sie langsam Richtung Fluss fuhren, blickte Ralph Bales in das im Süden schimmernde Licht von St. Louis und dachte, dass er sich jetzt nur noch um den Zeugen kümmern müsste – den Typen mit dem Bier –, dann wäre alles erledigt.
… Zwei
Gelbes Licht leuchtet auf und verblasst wieder, wird schwarz und wieder gelb, es bewegt sich was, jemand ruft, dann wird wieder alles schwarz, der Schmerz ist kaum auszuhalten, zu atmen und zu schlucken ist nicht möglich … Flackerndes gelbes Licht. Da gehen sie, schleichen sich fort … Lasst mich nicht allein, lasst mich nicht allein …
Donnie Buffett blickte kurz in Pennys entsetztes, blasses und von schwarzem Haar umrahmtes Gesicht. Die Angst, die er darin sah, erschreckte ihn. Er griff nach Pennys Hand und verlor das Bewusstsein.
Als er die Augen wieder öffnete, war seine Frau fort, und das Zimmer lag im Dunkeln. Noch nie war er so erschöpft gewesen.
Oder so durstig.
Nach ein paar Minuten wurde ihm langsam klar, dass auf ihn geschossen worden war. Und im gleichen Augenblick, in dem er das dachte, vergaß er alles – Penny, das widerliche Gefühl in seinem Rücken und seinen Eingeweiden, seinen Durst – und strengte sich an, um sich zu erinnern. An ein Wort. Ein kurzes Wort. Dieses eine Wort, das seinem ganzen Leben einen Sinn gab.
Das Wort. Wie hieß das Wort? Wieder wurde er ohnmächtig. Als er aufwachte, sah er eine philippinische Krankenschwester.
»Wasser«, flüsterte er.
»Mund ausspülen und wieder ausspucken«, sagte sie.
»Durst.«
»Spülen und ausspucken.« Sie ließ Wasser aus einer Plastikflasche in seinen Mund laufen. »Nicht schlucken.«
Er schluckte. Und kotzte.
Die Krankenschwester seufzte laut und wischte ihn ab.
»Ich spüre meine Beine nicht. Hat man mir die Beine abgeschnitten?«
»Nein. Sie sind müde.«
»Oh.«
Das Wort. Verdammt, wie hieß das Wort doch nur? Bitte, Heilige Mutter Gottes, mach, dass es mir wieder einfällt …
Er schlief ein bei dem Versuch, sich an das Wort zu erinnern, und als er kurz darauf wieder aufwachte, überlegte er immer noch. Seitlich des Bettes standen zwei Männer in zerknitterten Anzügen. Als er sie ansah, musste er lächeln.
»Hey, er lächelt.« Der Mann, der das gesagt hatte, war blond und hatte einen kantigen Unterkiefer.
»Na, Donnie?«, meinte der andere. »Ich will gar nicht fragen, wie’s dir geht, weil ich die Antwort schon weiß: ›Was für eine Scheiß-Frage, mir geht’s beschissen.‹« Er war dunkel im Gesicht und hatte kurzes, glänzendes Haar. Sein Blick, der auf Buffett lag, war voller Zuneigung, als er nach dessen Hand griff.
»Sie haben mich von hinten angeschossen. Hinter mir war noch einer.«
»Der Bürgermeister kommt dich besuchen«, fuhr Bob Gianno fort, der Detective mit dem dunklen Teint. »Er will dir viel Glück wünschen.«
Glück? Wozu brauche ich Glück? Ich habe doch schon Glück gehabt. Ich brauche keines mehr. Ich will nur raus aus diesem Bett.
Buffetts Lippen öffneten und schlossen sich.
»Was ist das?« Richard Hagedorn, der blonde Detective, beugte sich vor.
»Warum kann ich …« Er schüttelte den Kopf. »Ich hatte doch meine kugelsichere Weste an«, sagte er entrüstet.
»Er hat dich weiter unten erwischt. Das hat man zumindest auf der Pressekonferenz gesagt.«
»Oh.« Pressekonferenz? Es gab eine Pressekonferenz über mich?
»Wir haben deine Frau kennen gelernt, Donnie«, meinte Gianno. »Sie ist echt hübsch.«
Buffett nickte ausdruckslos.
»Ich denke, du weißt, warum wir hier sind«, fuhr Gianno fort. »Was kannst du uns über den Vorfall sagen?«
Der äußere Rand seines Blickfeldes verschwamm wieder, löste sich zu einer Million schwarzer Punkte auf. Gelbes und weißes Licht. Seine Organe schienen sich zu bewegen. Zu fließen. Er spürte einen starken Schmerz, der um so erschreckender war, weil er nicht weh zu tun schien. Er versuchte, sich an das Wort zu erinnern. Das Wort. Das WORT. Die Antwort liegt in dem Wort.
»Ich …« Seine Stimme erstickte in einem Röcheln, als er nach Luft schnappen musste.
»Vielleicht sollten wir …«, begann Hagedorn, doch Buffett wischte sich mit dem Laken den Schweiß aus dem Gesicht und sagte: »Ah, ich habe nur einen Gauner gesehen. Ein Weißer, angehende Glatze, dunkles Haar. Mit dem Rücken zu mir, Gesicht habe ich nicht gesehen. Vielleicht fünfunddreißig.« Pause. Luft zischte über seine trockenen Lippen und brannte wie Alkohol auf einer Wunde. »Einsachtundsiebzig, einsachtzig groß. Fünfundachtzig Kilo. Dunkle Jacke, Hemd und Jeans, glaube ich. Ich erinnere mich nicht. Hatte eine große Waffe.«
»Eine.44.«
»Eine Vierundvierziger«, wiederholte Buffett langsam. »Der andere, der mich angeschossen hat …«
»Hast du ihn erkannt?«
Buffett schüttelte den Kopf. »Wer war das Opfer?«, fragte er.
»Vince Gaudia und irgendein Aufriss.«
»Mann«, flüsterte Buffett ehrfurchtsvoll. »Gaudia.« Er schloss die Augen und schüttelte den Kopf. »Peterson wird Blut spucken.«
»Zum Teufel mit Peterson«, schimpfte Hagedorn. »Wir werden uns den Arsch schnappen, der dich fertig machen wollte, Donnie.«
»Den Dritten habe ich auch nicht gesehen«, meinte Buffett.
»Den Dritten?«, vergewisserte sich Hagedorn. Er sah zu Gianno hinüber.
»Den Typen im Lincoln.«
»Was für ein Lincoln?« Gianno machte sich Notizen.
»Dunkler Lincoln. Er stand auf der anderen Straßenseite. Autonummer oder Modell habe ich nicht erkannt.« Buffett hustete. »Ich möchte etwas Wasser.«
Hagedorn ging zur Toilette und holte ein Glas, das er Buffett reichte.
Buffett zögerte. »Könnte sein, dass es wieder rauskommt«, entschuldigte er sich.
»Ich habe schon Schlimmeres als kotzende Polizisten gesehen.«
Buffett musste aber nicht kotzen, sondern gab Hagedorn triumphierend das leere Glas zurück. »Das Beste, was ich je in meinem Mund hatte.«
Die Männer lachten; es war nicht nötig, irgendeine der drei Pointen laut auszusprechen, die sich gleichzeitig in drei verschiedenen Köpfen gebildet hatten.
»Der Typ im Lincoln – hat er sich aus dem Staub gemacht?«, wollte Gianno wissen.
»Nein, er ist einfach weggefahren. Vielleicht musste er das Opfer nur dem anderen Typen zeigen.«
»Nein«, widersprach Gianno. »Jeder weiß, wie Gaudia aussieht. Er ist ein Titelheld. Hm, zumindest war er das.«
»Vielleicht war der Typ im Lincoln derjenige, der den Glatzkopf engagiert hat«, überlegte Buffett.
»Irgendein großer Fisch? Könnte sein. Donnie, hast du eine Ahnung, wer im Wagen saß?«
»Nein, aber ich habe einen Mann gesehen.«
»Es gibt einen Zeugen?«
Buffett erzählte ihnen von dem Vorfall mit dem Bier. »Dieser Kerl hat mit dem Fahrer geredet.«
»Phantastisch.« Hagedorn lächelte.
Gianno blätterte zu einer leeren Seite in seinem Notizbuch um. »Wie sieht er aus?«
Als Buffett ihnen die Beschreibung geben wollte, fiel ihm das Wort plötzlich wieder ein. Das magische Wort.
Buffetts Augen funkelten. »Pellam«, flüsterte er.
»Bitte?« Gianno blickte stirnrunzelnd zu Hagedorn.
»Er heißt Pellam.« Buffets Lächeln wurde immer breiter.
»Du weißt seinen Namen?« Gianno nickte begeistert. »Wohnt er hier in der Gegend?«
»Weiß nicht.« Buffett zuckte mit den Schultern, was einen stechenden Schmerz in seinem Genick verursachte. Einen Moment blieb er stocksteif liegen, bis der Schmerz langsam nachließ.
»Wir werden ihn finden«, meinte Gianno ehrfurchtsvoll.
Das Lächeln auf Buffetts Gesicht verblasste, als er vergeblich versuchte, sein Bein zu bewegen. Das Laken hatte sich wohl zu fest herumgewickelt, dachte er. Geistesabwesend zog er daran und klopfte auf seine Hüfte. »Ich muss den Kreislauf in Schwung bringen. Liege schon zu lange hier rum.«
»Wir werden diesen Kerl finden, Donnie.« Gianno schlug sein Notizbuch zu.
»Eine Sache noch«, hielt Buffett sie auf. »Ihr wisst, wie das bei einer solchen Schießerei mit Zeugen ist. Er wird unter Gedächtnisschwund leiden. Darauf wette ich.«
Gianno schnaubte. »Oh, keine Sorge, Donnie. Er wird schon reden.«
Offenbar stimmte was mit dem Chili nicht.
Bier und Whiskey waren vollständig aufgebraucht, aber der Topf mit dem Chili war kaum angerührt worden.
Danny und Stile waren noch im Wohnwagen geblieben, um Pellam beim Aufräumen zu helfen, nachdem die anderen Pokerspieler gegangen waren. Danny war neunundzwanzig Jahre alt und ähnelte mit der dicken Nase, dem glatten Gesicht und dem schulterlangen, schwarzen Haar einem Navajo-Krieger.
»Was hast du nur mit dem Chili gemacht?«, fragte er Pellam und rümpfte die Nase, bevor er die Aschenbecher leerte. Obwohl er seinen Mitmenschen auch unangenehme Wahrheiten ins Gesicht sagte, waren sie selten beleidigt.
Das Chili?
Stile packte die leeren Labatt-Flaschen in eine andere Tüte und zwirbelte seinen buschigen Schnurrbart. Auch wenn Pellam der Nachfahre eines echten Revolverhelden war, wie die Familienlegende erzählte, dachte er, dass eher Stile wie ein Doppelgänger seines Vorfahren Wild Bill Hickok aussah. Stile war schlaksig, und sein hängender Vietnam-Veteranen-Schnurrbart war genauso dunkelblond wie sein Haar. »Da fällt mir doch dieser Western ein, an dem ich einmal gearbeitet habe«, erinnerte er sich. »Hab aber vergessen, von wem der war. Ich bin eine Klippe runtergestürzt. Ich glaube, es ging fünfundzwanzig Meter runter … und der Kompressor war ausgefallen, so dass man den Luftsack nicht so dick aufpumpen konnte, wie es der Regisseur wollte.«
»Hm«, machte Pellam und ging in die Kochnische, um sich sein Chili anzuschauen. Er hatte zwei Schüsseln voll gegessen und noch Zwiebeln und amerikanischen Käse darüber gestreut. War doch ganz in Ordnung.
»Nein«, überlegte Stile weiter. »Die Klippe war über vierzig Meter hoch.«
»Komm zum Punkt«, verlangte Danny, der sich langweilte. Danny, ein für den Oskar nominierter Drehbuchautor, saß gewöhnlich in Luxushotelsuiten vor einem Laptop und schrieb Szenen, in denen er Leute wie Stile vierzig Meter hohe Klippen hinunterstürzen ließ. Er war nicht beeindruckt.
»O Mann, wir waren mitten in der Wüste und kamen uns wie echte Indianer vor, wenn ihr wisst, was ich meine«, fuhr Stile fort.
Was stimmte mit dem Chili nicht?
Pellam probierte einen Löffel voll. Oh, war das scharf. Erinnerte ihn an Scotch, den rauchigen. Aber falsch war daran noch lange nichts. Könnte fast Absicht gewesen sein, als hätte er ein neues Rezept ausprobiert. Würde es zum Beispiel nach Mesquite schmecken, hätte niemand was gesagt, außer vielleicht »Hmm, verdammt lecker, dein Chili, Pellam«.
Er stapelte die Teller in das winzige Waschbecken und spülte sie unter dem schwachen Wasserstrahl ab.
»Als ich unten angekommen bin, gab der Luftsack so schnell nach, dass meine Gürtelschlaufen einen Abdruck in der Erde unter dem Luftsack hinterlassen haben.«
»Puh. So was passiert manchmal«, meinte Danny lethargisch.
Um den Wohnwagen zu lüften, öffnete Pellam die Tür. Der Chili-Geruch hatte nur zum Teil für die schlechte Luft gesorgt. Den Rest hatte der Anwalt aus St. Louis besorgt, der sich eine Zigarette nach der anderen angesteckt hatte. Pellam hatte festgestellt, dass die Leute aus dem mittleren Westen offenbar noch nicht mitbekommen haben, dass diese Angewohnheit ungesund war.
Danny und Stile stritten darüber, wer den riskanteren Beruf hatte – Stile, der sich hohe Klippen hinunterstürzen musste, oder Danny, der seine Geschichten bei Produzenten und den Leuten von der Projektentwicklung durchdrücken musste. Stile meinte, das sei ein blöder Witz, und versuchte Danny davon zu überzeugen, einmal mit ihm zum Springtraining zu gehen.
»Leben und Sterben in L.A.«, flüsterte Stile ehrfurchtsvoll. »Wahnsinnige Szene, dieser Sprung von der Brücke.«
Pellam, der immer noch an der Tür stand, kniff die Augen zusammen. Er sah einen großen, kastenförmigen Schatten im Gras, nicht weit von seinem Wohnwagen entfernt. Was war das? Er kniff die Augen noch einmal zusammen, was aber nichts half. Er hatte dieses Feld schon bei Tageslicht gesehen – es wuchs nur Unkraut darauf. Was konnte das sein, das sich so spät in der Nacht mitten in diesem kümmerlichen Feld befand? Komisch, der Schatten sah aus wie …
Der Schatten begann zu brummen.
… ein Wagen.
Er beschleunigte schnell, wirbelte Erde und Steine auf, schob die Schnauze aus dem Gras und kratzte mit dem Unterboden über die Erde, als er den steilen Abhang hinauf zum Highway fuhr.
Vielleicht ein Liebespaar, dachte Pellam. Beim Knutschen. Er konnte sich nicht daran erinnern, wann er das letzte Mal geknutscht hatte. Tat man das immer noch? Vielleicht im mittleren Westen. Pellam lebte in Los Angeles, und dort hatte noch nie eine Frau, mit der er verabredet war, mit ihm geknutscht.
Erst als sich Pellam wieder umdrehte, wurde ihm klar, dass der Wagen ein ganzes Stück die River Road entlang ohne Licht gefahren war. Deswegen war auch das Nummernschild nicht beleuchtet, solange es noch zu erkennen gewesen wäre. Eigenartig …
»Den hätte ich gerne gesehen«, meinte Danny mitfühlend. »War nur ein Auto«, murmelte Pellam und blickte den immer kleiner werdenden Rücklichtern hinterher.
Die anderen beiden starrten ihn an.
»Ich meinte den Sprung von der Brücke«, erklärte Danny.
»Oh.«
Danny dankte Pellam für das Spiel und die Gesellschaft, aber nicht für das Chili. Nachdem er gegangen war, kam Stile in die Küche zurück und begann abzuwaschen.
»Das brauchst du nicht zu tun.«
»Kein Problem.«
Er wusch alles ab – außer den Chili-Topf.
»O Mann, angebranntes Chili. Darauf bleibst du jetzt sitzen, Junge.«
»Ich wurde auf dem Rückweg vom Laden aufgehalten.«
»Wie lange wirst du noch in diesem Kaff bleiben?«, fragte Stile.
»Bis die Dreharbeiten vorbei sind. Tony dreht jede zweite Szene noch einmal.«
»Ja, genau, das macht er. Also, wenn wir nächste Woche hier sind, kommst du ins Quality Inn zum Spielen. Ich habe eine Herdplatte, auf der mache ich dann Philly Cheese Steaks. Mit Zwiebeln. Ach, übrigens kriege ich morgen den Wagen von Hertz. Dann kannst du dein Motorrad wieder haben.«
Stile war seit drei Wochen in der Stadt und hatte schon die Antriebswelle seines Mietwagens zerbrochen. Autovermietungen sollten sich nach dem Beruf erkundigen und keine Fahrzeuge an einen Stuntman rausrücken.
Pellam brachte ihn zur Tür. »Als du hergekommen bist, hast du da hinten einen Wagen stehen sehen?«
»Wo? Da hinten? Da ist doch bloß Unkraut, Pellam. Warum sollte da jemand parken?«
Stile ging nach draußen und atmete tief ein. Er pfiff ein Lied von Stevie Wonder durch seinen Revolverhelden-Schnurrbart, während er mit langen Schritten zu der verbeulten Yamaha ging, auf der der Gepäckträger gefährlich vom hinteren Schutzblech herunterhing.
»War er es?«
»Kann ich nicht sagen.«
»Hat er den Wagen gesehen?«
»Wenn ich nicht sagen kann, ob er es war, wie soll ich dann wissen, ob er den Wagen gesehen hat? Und wenn durch dich das Getriebe kaputt gegangen ist, Junge, musst du es bezahlen. Verstanden?« Ralph Bales redete mit Stevie Flom. Sie hatten den Pontiac stehen lassen und saßen in Ralph Bales’ Cadillac. Stevie fuhr.
Flom war fünfundzwanzig Jahre alt. Er war blond wie ein Norditaliener und hatte prächtige Muskeln und babyglatte Haut. Sein rundes Gesicht war nie von einem Pickel entstellt gewesen. Er hatte mit 338 Frauen geschlafen. Er war Umschlagarbeiter am Hafen, wo er aber oft krank feierte. Um richtiges Geld zu verdienen, schloss er illegale Wetten ab und erledigte seltsame Aufträge für Männer, die seltsame Aufträge vergaben, die nur wenige erledigen wollten. Er war verheiratet und hatte drei Freundinnen. Er verdiente etwa sechzigtausend Dollar im Jahr, von denen er etwa dreißigtausend in Reno und beim Pokern in East St. Louis und Memphis verlor.
»Fahr los«, befahl Ralph Bales, der zum Wohnwagen schaute. »Ich glaube, er sieht zu uns her.«
»Hm, tut er das?«
»Was?«
»Zu uns hersehen?«
»Fahr einfach.«
Die Nacht war klar. Links von ihnen floss der Missouri River langsam Richtung Südosten. Gestern, als sie den Mord geplant hatten, hatte das Wasser schlammig und schwarz ausgesehen. Heute leuchtete es goldfarben von den Sicherheitsscheinwerfern einer kleinen Fabrik am Südufer.
Ralph Bales hatte gedacht, es würde einfach sein, den Zeugen ausfindig zu machen. Er müsste nur den Laden suchen, in dem er das Bier gekauft hatte, und von dort aus die Spur verfolgen.
Aber er hatte vergessen, dass er sich in Maddox in Missouri befand, wo die Einheimischen nicht viel zu tun hatten, außer zur Arbeit zu gehen und den lieben, langen Tag zu trinken, die Muskeln für Maddox Riverfront Services zu stählen oder mit krummem Rücken für Farmer zu arbeiten und die ganze Nacht zu trinken. In den Gelben Seiten hatte Ralph Bales zwei Dutzend Getränkeläden ausfindig gemacht, die von der Stelle aus, wo er beim Aussteigen aus dem Wagen mit dem Zeugen zusammengestoßen war, zu Fuß zu erreichen waren.
Also hatten sie den Trans Am irgendwo abgestellt und die Ruger fünfzehn Meter tief unter die aufgewühlte Oberfläche des Missouri zu ihrer letzten Ruhestätte versenkt. Dann waren sie nach Hause geeilt, um sich umzuziehen und mit Ralph Bales’ eigenem Wagen zurückzukommen. Er hatte sich den Schnurrbart abrasiert, eine Brille mit Fensterglas aufgesetzt und eine verknitterte irische Tweedmütze aufgesetzt und ein blaues, gebügeltes und am Kragen offenes Hemd und eine Jacke im Fischgrätmuster angezogen. Indem er vorgab, der Anwalt einer Versicherungsgesellschaft zu sein und den Polizisten zu vertreten, der erschossen worden war, ging er von einem Laden zum anderen, bis er schließlich einen Verkäufer fand, der sich daran erinnerte, gegen sieben Uhr an diesem Abend einen Kasten Bier an einen dünnen Mann in Bomberjacke verkauft zu haben.
»Er hat gesagt, er würde mit seinem Wohnwagen drüben am Bide-A-Wee stehen.«
»Ist es … Was ist das?«, fragte Ralph Bales.
»Der Campingplatz – kennen Sie den nicht? Neben dem Betonwerk? Eines kann ich Ihnen aber sagen«, hatte ihn der Verkäufer mit ernster Stimme noch gewarnt. »Fragen Sie ihn nicht nach einer Rolle im Film. Darauf steht er nicht.«
Film?
Ralph Bales und Stevie waren zum Fluss hinuntergefahren und hatten im Unkrautfeld vor Bell’s Bide-A-Wee geparkt. Sie hatten durch die kleinen Fenster des Wohnwagens gespäht, aber Ralph Bales hatte nicht eindeutig erkennen können, ob es der Biermann war oder nicht. Dann war die Tür geöffnet worden. Stevie hatte Angst gehabt, dass der Typ die Polizei anruft und die Beschreibung des Wagens durchgibt, weswegen er sich aus dem Staub machen wollte. Ralph Bales hatte geschrien: »Pass auf das Getriebegehäuse auf!«, was Stevie Flom aber nicht beeindruckt hatte.
Jetzt fuhren sie mit gleichmäßigen neunzig Stundenkilometern raus aus Maddox.
»Morgen früh statten wir ihm einen Besuch ab.«
»Aber vielleicht gibt er heute Nacht noch eine Beschreibung von dir an die Polizei.«
Ralph Bales dachte darüber nach und schüttelte den Kopf. »Er weiß doch gar nichts von dem Mord. Er hat heute Nacht gefeiert. Jemand, der Zeuge eines Mordes wird, feiert keine Party. Oder was denkst du?«
Stevie meinte, Ralph habe wohl Recht, und legte eine Metallica-Kassette ein.
Um sieben Uhr am nächsten Morgen pochte jemand mit dem Vorschlaghammer gegen die Wohnwagentür.
Pellam wurde aus einem Traum gerissen, in dem altmodische Autos langsam um ein Filmset herumkreisten. Immer wieder fragte jemand Pellam, ob er mitfahren wolle, aber derjenige, der ihn fragte, hielt nie lange genug an, um ihn einsteigen zu lassen. Pellam fand es auf Dauer langweilig, auf einen Wagen zu warten, der ihn mitnahm.
Es war kein toller Traum, aber zumindest hatte er geschlafen, solange er geträumt hatte, und als die Sache mit dem Vorschlaghammer losging, wachte er auf. Pellam kam hoch und schwang die Beine über die Bettkante. Er suchte nach der Uhr. Er war schon oft um sieben Uhr wach gewesen, aber nur selten geweckt worden. Das war ein großer Unterschied.
Der Hammer pochte.
Pellam stand auf und zog sich seine Jeans und ein schwarzes T-Shirt an. Ein Blick in den Spiegel: Er hatte die ganze Nacht in einer Position geschlafen – auf dem Bauch wie ein Baby –, und sein schwarzes Haar stand in alle Richtungen ab. Er glättete es und rieb über die Falten, die das zerknitterte Laken auf seinem Gesicht hinterlassen hatte. Dann ging er zur Tür, um zu sehen, wer dort mit dem Hammer zugange war.
»He, Kumpel«, grüßte Stile und ging an Pellam vorbei in die Küche. »Ich soll dich abholen.«
Pellam stellte den Wasserkessel auf. Stile stand neben dem winzigen Esstisch, auf dem immer noch die Karten und Pellams magerer Gewinn lagen. Er blickte in den Chili-Topf und klopfte mit dem Fingernagel auf die schwarze Kruste am Boden. Dann öffnete er den Minikühlschrank. »Da ist ja absolut nichts zu essen drin.«
»Warum bist du hier?«, murmelte Pellam.
»Dein Telefon. Es ist nicht eingeschaltet.« Stile fand einen alten Bagel und teilte ihn in zwei Hälften. Eine davon hielt er Pellam hin, der nur den Kopf schüttelte und zwei Löffel löslichen Kaffee in einen Styroporbecher schaufelte. »Kaffee?«, fragte er Stile.
»Nein. Ich habe meine Karre dabei. Du kannst dein Motorrad haben. Es steht auf der Ladefläche. Auf dem Schutzblech ist eine winzige Beule. Ansonsten ist es in perfektem Zustand. Ach ja, es ist voller Matsch. Äh, und der Gepäckträger natürlich.«
Pellam goss Wasser in den Becher und ließ sich auf die Bank fallen. Stile sagte, sein Haar stehe in alle Richtungen ab.
»Was machst du hier?«, fragte Pellam noch einmal, während er versuchte, sein Haar zu glätten.
»Tony braucht dich. Er kriegt schon fast einen Schlaganfall, und du schaltest dein Telefon aus.«
»Weil ich ein bisschen länger als bis sieben Uhr schlafen wollte.«
»Ich bin schon eine Stunde auf.« Stile machte im Morgengrauen Tai-Chi. In Gedanken versunken, aß er seinen Bagel. »Weißt du, John, ich muss zugeben, dass ich ein bisschen neugierig war, warum du für Tony arbeitest.«
Pellam nahm drei Schlucke von dem kochend heißen Kaffee. Das war das Gute an löslichem Kaffee – er schmeckte zwar furchtbar, aber er war von Anfang an heiß und blieb es auch. Pellam rieb Daumen und Zeigefinger aneinander – das Zeichen für Geld und seine Antwort auf Stiles Frage.
Stile deutete ein Schulterzucken an, als vermutete er, dass noch mehr dahinter steckte. Andererseits war Stile ein erfahrener, gewerkschaftlich organisierter Stuntman, und selbst mit dem vertraglichen Mindestsatz der Screen Actors Guild würde man ihn gut bezahlen. Aber er war auch das Double für einen der Hauptdarsteller, und deswegen – und aufgrund seiner Erfahrung – hatte sein Agent dafür gesorgt, dass er übertariflich bezahlt wurde. Er wusste über die Gründe Bescheid, wegen derer man für ein Projekt mit großem Budget engagiert wurde.
»Nun, mein lieber Herr Eisenstein hat dich zu sich bestellt, und ich bin hier, um dir das auszurichten.« Er schob das letzte Stück des Bagels in den Mund.
»Hat er gesagt, was er will?«
»Er will eine Ölraffinerie in die Luft sprengen. Für die Schlussszene.«
»Was?« Pellam rieb sich die Augen.
»Ich schwör’s. Er will eine alte DC-7 nachbauen und sie hinten an einen Hubschrauber binden, dann« – Stile mimte ein Flugzeug, das in den Herd stürzte – »wumm.«
Pellam schüttelte den Kopf. »Der ist doch total … He, du Mistkerl. Du isst meinen letzten Bagel und verarschst mich die ganze Zeit, während draußen noch nicht mal die Sonne aufgegangen ist.«
Stile lachte. »Du bist aber auch verdammt leicht reinzulegen, Pellam. Und jetzt hopp. Mache dich auf und werde Licht. Unser Herr und Gebieter ruft.«
Auf dem Bell’s Bide-A-Wee standen zwei Zelte, der Winnebago, der in der Reihe direkt an der Straße abgestellt war, und ein Ford Taurus, aus dessen Laderaum ein gelbes Motorrad herausschaute.
Die Plätze rund um den Wohnwagen waren leer. Die verzinkten Stahlrohre und elektrischen Anschlüsse, die sich Richtung Fluss zogen, sahen aus wie die Miniaturversion eines Autokinos.
Stevie Flom war von der River Road abgebogen und einen halben Straßenblock weit an mit Brettern vernagelten ein- und zweistöckigen Häusern und Geschäften vorbeigefahren. Zwischen zwei verlassenen Geschäften hatte er geparkt. Ralph Bales hatte ihm gesagt, er solle ja nicht auffallen – nur einfach den Wagen bei laufendem Motor auf der Straße parken und Zeitung lesen oder so was.
Ralph Bales ging die River Road entlang. Es war vormittags, aber im Wohnwagen brannte Licht. Dann sah er die Silhouette des Mannes, der im Innern herumlief. Ralph Bales betrat das Telefonhäuschen, dessen Boden mit winzigen Glassplittern von den vier zerschlagenen Scheiben übersät war. Zwischen den Scherben wuchs Unkraut. Mit einem Papiertaschentuch griff er nach dem Hörer und tat so, als würde er telefonieren, während er den Wohnwagen beobachtete.
Er blickte am Winnebago vorbei zum Fluss. An diesem Morgen sah er erneut anders aus – er war weder silbergrau, noch schimmerte er bronzefarben wie in der Nacht zuvor. Die Oberfläche wirkte rostig, und der rötliche Himmel spiegelte sich darin, dessen Farbe, wie Ralph Bales glaubte, von den Abgasen aus den Raffinerien stammten, die außerhalb von Wood River auf der anderen Seite des Mississippi standen. Der Wind wehte gleichmäßig und drückte das Gras und Unkraut an der Uferböschung nach unten, schaffte es aber kaum, die Oberfläche des Flusses, der sich Richtung Süden wälzte, zum Kräuseln zu bringen.
Ralph Bales erinnerte sich an ein Lied, an das er jahrelang nicht gedacht hatte, das letzte Lied der Filmmusik des fünfundzwanzig Jahre alten Films Easy Rider. In seinen Gedanken konnte er die Musik deutlich hören, aber er erinnerte sich nicht an den Text, nur an Wortfetzen über einen Mann, der frei sein wollte, und über einen Fluss, der von irgendwoher zum Meer floss …
Die Tür vom Wohnwagen wurde geöffnet.
Ja, das war er. Der Biermann, der Zeuge. Hinter ihm kam ein großer, schlaksiger Mann mit hängendem Schnurrbart heraus. Die beiden gingen zur Rückseite des Taurus und zerrten das Motorrad von der Ladefläche.
Ralph Bales zog den Colt unter seinem Mantel hervor und blickte sich langsam um. Eineinhalb Kilometer entfernt stiegen Auspuffgase auf, als ein Sattelschlepper einen Gang herunterschaltete. Ein Schwarm grauer Vögel zog vorbei, und in der Mitte des schlammigen Flusses kämpfte ein verkratzter, fleckiger Schlepper gegen die schwache Strömung an.
Die beiden Männer hatten sich über das Motorrad gebeugt und redeten miteinander. Der mit dem Schnurrbart zeigte auf etwas, das wie eine Beule auf dem Spritzschutz aussah, dann rüttelte er am Gepäckträger. Der Biermann zuckte mit den Schultern und schob das Motorrad schließlich in Richtung Straße.
Ralph Bales wollte warten, bis der Freund in seinen Taurus gestiegen und fortgefahren war, dann aber beschloss er, beide zu töten. Er hob den Colt und richtete den Lauf auf den Oberkörper des Biermannes. Der silberfarbene Lastwagen kam näher. Ralph Bales ließ die Waffe sinken. Der Laster donnerte vorbei und hüllte die Männer in eine Wolke aus Papierabfall und Staub.
Und wieder hob Ralph Bales die Waffe. Die Straße war frei. Keine Laster oder Autos waren zu sehen. Nichts, was sich ihm auf den zehn Metern zwischen seinem Ziel und dem mit Glassplittern übersäten Boden der Telefonzelle als Hindernis in den Weg stellte.
… Drei
Er stieg auf das zerbeulte, schmutzige, gelbe Motorrad, startete den Motor und jagte ihn mehrmals hoch. Dann setzte er einen schwarzen Helm auf und ließ plötzlich die Kupplung kommen, so dass das Motorrad vorne hochstieg und er auf dem Hinterrad drei Meter vor schoss, bevor das Vorderrad wieder die Straße berührte. Rutschend kam er zum Stehen und kehrte dann zu seinem Freund mit dem Schnurrbart zurück.
Ralph Bales stützte die Waffe mit der linken Hand ab und begann, mit dem Druck von vier Kilo den Abzug zu ziehen, die nötig waren, um den Hammer zu lösen.
Der Biermann setzte eine Sonnenbrille mit dunklem Gestell auf und zog den Reißverschluss seiner Jacke hoch – einen Moment lang saß er völlig aufrecht und im rechten Winkel zu Ralph Bales, ein Ziel, das man kaum verfehlen konnte.
In diesem Moment senkte Ralph Bales den Lauf der Waffe wieder.
Er kniff die Augen zusammen, beobachtete, wie sich der Mann nach vorne beugte und mit dem Zeh den ersten Gang einlegte. Rutschend und mit dem Heulen einer Kettensäge schoss er über die River Road. Sein Freund rief ihm etwas hinterher und schüttelte die Faust, bevor er in seinen Taurus sprang, über den Bordstein rumpelte und, Staub und Kies aufwirbelnd, dem Motorrad hinterherraste. Er hinterließ eine dicke Reifenspur auf dem Asphalt.
Ralph Bales ließ den Hammer langsam wieder auf den leeren Zylinder zurückschnappen und schob die Waffe in seine Tasche. Er blickte die Straße auf und ab, dann drehte er sich um und rannte in die düsteren Schatten der Uferstraßen zurück. Als er am Cadillac war, klopfte er ans Fenster auf der Fahrerseite.
»Meine Güte, ich hab ja gar nichts gehört!«, rief Stevie und warf die Zeitung nach hinten, so dass sich die Blätter voneinander lösten und über den ganzen Rücksitz verteilten. Dann legte er den Gang ein. »Ich habe gar keinen Schuss gehört, Mann!« Er blickte in den Rückspiegel. »Ich habe nichts gehört!«
Ralph Bales schnippte beiläufig mit den Fingern in Stevies Richtung.
»Hör auf!«, rief Stevie wieder. »Was soll das heißen? Was machst du da?«
»Rutsch rüber«, formte Ralph Bales mit den Lippen.
»Was?«, rief Stevie.
»Ich werde fahren.«
Stevie blickte nach hinten, als würde er von einem halben Dutzend Autos der Missouri Highway Patrol verfolgt werden.
»Stell ihn auf Parken«, verlangte Ralph Bales.
»Was?«
»Stell den Wagen auf Parken und rutsch rüber«, antwortete er wütend. »Ich werde fahren.« Er stieg ein, blinkte und wendete vorsichtig und langsam auf der Straße.
»Was ist passiert?«
»Sie müssen warten.«
»Du hast es nicht getan?«
»Bitte?«, fragte Ralph Bales mit gespieltem Erstaunen. »Du hast doch gerade gesagt, du hast keine Schüsse gehört.«
»Mann! Du hast mir einen totalen Schrecken eingejagt. Ich meine mit dem Peng, Peng, Peng an der Scheibe. Ich dachte, du wärst ein Bulle. Was ist denn passiert?«
Ralph Bales schwieg eine Weile. »Da waren eine Menge Leute drum herum.«
»Tatsächlich?« Sie fuhren gerade an dem verlassenen Campinggelände vorbei. »Ich sehe niemanden«, protestierte Stevie.
»Denkst du, dass ich es vor den Augen von einem Dutzend Zeugen mache?«
Stevie wirbelte herum. »Was war’s denn, so was wie ein Bus, der vorbeigefahren ist?«
»Ja. So was wie ein Bus.«
Samuel Clemens war einmal in Maddox in Missouri gewesen, wo er angeblich einen Teil von Tom Sawyer geschrieben hatte. Die Historische Gesellschaft von Maddox gab zu verstehen, dass die Höhlen außerhalb der Stadt das Vorbild für Injun Joes Höhle gewesen seien, obwohl ein glaubwürdiger Fremdenverkehrsverein, der in Hannibal, Missouri, das Gegenteil bewiesen hatte. Weitere Ansprüche an irgendwelchen Ruhm gab es kaum. 1908 hatte William Jennings Bryan hier auf einer Seifenkiste eine Rede gehalten, und von Franklin D. Roosevelt wurde Maddox in einem »Kamingespräch« als Beispiel für diejenigen Städte erwähnt, deren Einwohnerzahl durch die Depression immer mehr abnahm. In einer der mittlerweile stillgelegten Metallfabriken in der Stadt war angeblich ein Teil des Gehäuses der Atombombe gebaut worden, die, wäre sie abgeworfen worden, die dritte im zweiten Weltkrieg gewesen wäre.
Ließ man diese Verdienste einmal beiseite, war Maddox im Wesentlichen ein tot geborenes Detroit.
Anders als Jefferson City, das elegant und majestätisch auf zerklüfteten Klippen oberhalb des Missouri lag, kauerte Maddox am schlammigen Ufer nördlich derjenigen Stelle, wo der breite Fluss von dem noch breiteren Mississippi verschluckt wurde. Keine Einkaufsstraßen, keine sanierten Häuser in der Innenstadt, keine Eigentumswohnungen, die sich elegant in die Landschaft schmiegten.