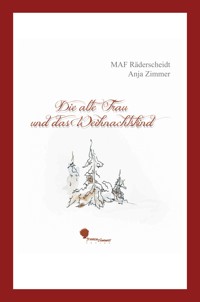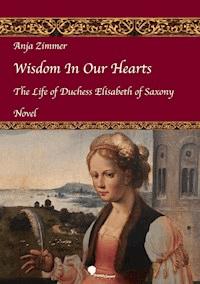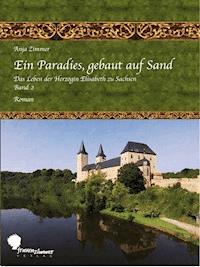
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frauenzimmer
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Das Leben der Herzogin Elisabeth zu Sachsen
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Sachsen, 1537: Nach langen Jahren der Intrigen und Anfeindungen am Dresdner Hof kann Herzogin Elisabeth auf ihrem Witwensitz herrschen wie eine Königin. Schloss Rochlitz, das auf einem Felsen ruht, erscheint ihr wie das Paradies, weil sie endlich ihren protestantischen Glauben leben darf. Dass Herzog Georg, ihr Schwiegervater und Fürst, sie deshalb mit der Inquisition bedroht, erschreckt die Herzogin kaum, denn sie steht unter dem Schutz ihres Bruders, Landgraf Philipps von Hessen, einem Hauptmann des mächtigen Schmalkaldischen Bundes. Doch Philipp setzt alles aufs Spiel, was er und seine Bündnispartner geschaffen haben: Neben seiner Ehefrau, für die er nur Abneigung empfindet, nimmt er heimlich die junge Margarete von der Saale zu seiner Zweitfrau. Als dies wie ein Lauffeuer durch das deutsche Reich geht, hat der katholische Kaiser Karl V. ihn in der Hand, da auf Bigamie die Todesstrafe steht. Der Kaiser lässt sich gnädig stimmen, doch Philipp bezahlt einen hohen Preis. Er wird politisch und militärisch kalt gestellt, und nun sieht der Kaiser die Zeit gekommen, die deutsche Reformation durch einen Krieg zu vernichten. Elisabeth riskiert ihre Freiheit und ihr Leben, indem sie den Schmalkaldischen Bund mit geheimen Informationen versorgt. Verzweifelt muss sie zusehen, wie der Krieg auch auf Rochlitz zurollt... Deutsche Geschichte, wie sie spannender nicht sein könnte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1050
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anja Zimmer
Ein Paradies, gebaut auf Sand
Das Leben der Herzogin Elisabeth zu Sachsen
Teil II
Roman
© Anja Zimmer, Frauenzimmer Verlag, Laubach - Lauter, 2014.Erste Auflage.
Alle Rechte vorbehalten.Nachdruck und Vervielfältigung jeder Art, Verwertung in anderen Medienund anderen Sprachen, elektronische Speicherung,Bearbeitung oder Aufbereitung - auch in Auszügen - nur mitGenehmigung der Autorin.
Umschlagbild: Schloss Rochlitz, Sachsensiehe www.schloss-rochlitz.de
Umschlagfoto: Frank GlabianBildbearbeitung: Ralf Neitzert, Anja ZimmerSatz und Layout: Anja Zimmer
Print-ISBN: 978-3-937013-11-4Ebook-ISBN: 978-3-937013-21-3PDF-ISBN: 978-3-937013-20-6
WWW.FRAUENZIMMER-VERLAG.DE
Inhalt
Ein Paradies, gebaut auf Sand
Bibliographie
Personenregister
Verlagsprogramm
Hinweis:
Auf der Webseite des Frauenzimmer Verlags (www.Frauenzimmer-Verlag.de) finden Sie Bilder der Schauplätze,weitere Informationen zur Recherche und Hintergründe.Außerdem ist eine englische Version des ersten Bandesals Ebook erhältlich unter dem Titel: „Wisdom In Our Hearts“.
Auch die deutsche Version ist als Ebook erhältlich.
Für meine Großeltern
Emilie und Otto
Frieda und Emil
Mai 1537, auf der Zapfenburg1 bei Kassel
Landgraf Philipp von Hessen erwartete Besuch, der ebenso hoch wie lästig war. Sein Schwiegervater, Herzog Georg von Sachsen, hatte sich mit seinem Hofstaat angedroht, und Philipp hatte seinen abgrundtiefen Groll, den er gegen den Alten hegte, hinuntergeschluckt und ihn auf die Zapfenburg eingeladen. Vom Turmfester aus versuchte Philipp den Herzog zu erspähen, doch keine ferne Staubwolke, keine aufflatternden Krähen kündigten die Reisenden an. Der Landgraf ließ seinen Blick über den Wald schweifen, hier und dort leuchtete ein wilder Kirschbaum weiß aus dem zarten Frühlingsgrün der Buchen hervor. Die Burg war der ideale Ausgangspunkt für Jagden aller Art. So hoffte der Landgraf einerseits, seinem Schwiegervater bei der Jagd aus dem Weg gehen zu können, andererseits fürchtete er, der Alte könnte ihm seine Lieblingsbeschäftigung vergällen.
Eine Jagd der ganz besonderen Art veranstaltete Herzog Georg gerade in Sachsen: Philipps Schwester Elisabeth, die im März ihren Witwensitz in Rochlitz bezogen hatte, wollte dort selbstverständlich die Reformation einführen. Schließlich war sie wie Philipp selbst seit langem protestantisch, doch dies war dem katholischen Herzog von jeher ein Dorn im Auge gewesen. Unendliche Jahre hatten sie zugebracht im Kampf, sich gegenseitig zu überzeugen, dass ihre Lehre die allein seligmachende sei, aber wo so sture Köpfe aufeinander prallten, konnte es keinen Frieden geben.
Gerüchten zufolge beabsichtigte Herzog Georg, die Inquisition nach Rochlitz zu schicken, wie er es vor Jahren schon einmal getan hatte - offensichtlich wollte er um jeden Preis verhindern, dass das beschauliche Rochlitz der Reformation anheim fiel. Wenn sich diese Gerüchte bestätigten, dann wollte Philipp nicht zögern, seiner Schwester beizustehen, mitsamt all seinen verfügbaren Söldnern, denn noch eisiger konnte das Klima zwischen ihm und seinem Schwiegervater kaum werden. Zu viel war in den vergangenen Jahren zwischen ihnen geschehen.
„Und - sehen Sie meinen Vater schon?“ Christine war leise hinter ihn getreten und hatte ihm eine Hand auf die Schulter gelegt, doch Philipp entzog sich ihr unwillig.
„Ich weiß, Herr, Sie sind nicht erpicht darauf, meinen Vater zu sehen, aber bedenken Sie, er ist ein gebrochener Mann. Mein Bruder Friedrich und ich sind die letzten, die ihm von zehn Kindern geblieben sind. Dass auch noch sein Thronfolger Johann sterben musste, hat ihn vollends zerbrochen. Nun gibt es nur noch Friedrich, der in seiner ganz eigenen Welt lebt, den er nicht verheiraten kann und der erst recht nicht zur Regierung taugt. Bitte, seien Sie nachsichtig mit dem alten Mann.“
„Wie kann ich mit einem Mann nachsichtig sein, der selbst keine Nachsicht kennt? Soll ich zusehen, wie er das Glück meiner Schwester zerstört? Er bringt Elisabeth in Gefahr - nicht zum ersten Mal! Bedenken Sie, er wollte sie einmauern lassen! Meine Schwester! Seine eigene Schwiegertochter!“2 Christine sah mit Sorge, dass Philipp sich jetzt schon in Rage redete. Wie sollte das nur werden, wenn Herzog Georg erst hier war?
„Wird Moritz denn auch mitkommen?“ versuchte sie die Gedanken ihres Ehemannes nun auf ein angenehmeres Thema zu lenken.
„Ja, unser kleiner Cousin wird sicher auch dabei sein. Wie alt ist er jetzt? Dreizehn? Vierzehn?“
„Er ist am 21. März sechzehn Jahre alt geworden. Wir haben ihn lange nicht gesehen, er wird sich sehr verändert haben.“
„Habt Ihr den Großvater schon gesehen?“ Die zehnjährige Agnes war mit ihrer Schwester Anna und dem kleinen Bruder Wilhelm ebenfalls im Turm erschienen. Die Eltern wechselten einen kurzen Blick. „Ah, Sie wissen schon, dass Ihr Großvater, seine Gnaden Herzog Georg, kommt?“
„Natürlich wissen wir das. Ihr redet ja seit Tagen von nichts anderem“, verkündete der vierjährige Wilhelm, worauf Christine kurz und heftig die Luft einzog. Hoffentlich hatten die Kinder nicht zu viel mitbekommen.
„Ja, und wir werden auf die Jagd gehen, und ich werde mit Moritz das Kämpfen üben. Das habe ich ihm versprochen, als er nicht viel älter war als Sie, mein Kleiner!“
Philipp hatte seinen ältesten Sohn auf den Arm genommen und wirbelte mit ihm durch das Turmzimmer. „Dabei dürft ihr alle zusehen.“
„Ich mag dabei nicht zusehen. Das ist mir zu laut und zu wild!“ sagte Agnes.
„Ich mag auch nicht beim Kämpfen zusehen“, echote nun natürlich auch Anna und drückte ihre Puppe an sich.
„Das sollten Sie aber, liebe Agnes, denn es wäre sehr unhöflich, dem Turnier fernzubleiben. Außerdem werden Sie in wenigen Jahren einen Ritter heiraten; da ist es ratsam, sich schon einmal an den Anblick zu gewöhnen“, sagte Philipp. Dass er diesen Ritter bereits in Braunschweig ausgesucht hatte, verriet er seiner Tochter jedoch nicht.
Es dauerte keine zwei Stunden mehr und der Besuch war in Sicht. Ein langer Zug aus Pferden, Wagen und Fußsoldaten kam den steilen Berg herauf. Die Peitschen knallten, als die Pferde die ungewöhnliche Steigung kaum bewältigten, Soldaten sprangen herzu, schoben einige der Wagen von hinten an, und schließlich standen alle wohlbehalten und erschöpft im Innenhof der Burg.
Auf der Treppe stand die fürstliche Familie zum Empfang bereit: Landgraf Philipp, seine Gemahlin Christine, dann die Kinder, aufgereiht nach Alter: Agnes, Anna, Wilhelm und schließlich die Amme, die die einjährige Barbara auf dem Arm hielt. Christines Hofdamen hielten sich im Hintergrund.
Vom Pferd stieg nicht der stolze Herzog Georg, der in einigen Schlachten seine Armee befehligt hatte, sondern ein Greis, der sich vergeblich bemühte, seine Hinfälligkeit zu verbergen. Christine eilte ihm entgegen, als er mit der Hilfe Moritzens und eines Priesters auf dem Pflaster des Schlosshofes stand.
„Vater!“ Christine hatte ihn lange nicht gesehen und war nun erschrocken bei seinem Anblick. Moritz reichte ihm seinen Stock, auf den er die Last seiner Jahre stützte. Christine wollte ihrem Vater den Arm reichen, doch da ergriff der alte Herzog mit der anderen Hand den Arm seines Priester und ließ sich von ihm die Treppe hinaufführen, dicht gefolgt von Moritz und Christine. Bei diesem Anblick verfinsterte sich Philipps Gesicht bereits erheblich, und Christine begrub die Hoffnung auf friedliche Tage.
„Euer Gnaden!“ Philipp reichte seinem Schwiegervater die Hand, wobei er feststellte, dass der Händedruck des Alten noch immer kräftig war. Sein Bart reichte ihm mittlerweile bis über die Brust.
Dann fiel sein Blick auf die Enkelkinder, die gehorsam knicksten und sich verneigten, wie Christine es ihnen beigebracht hatte. Mit großen Augen schauten sie ihren Großvater und den Priester an. Letzterer übte sich in stoischem Schweigen, grüßte niemanden und wurde geflissentlich übersehen. „Und wie ich höre, haben Sie auch einem weiteren Sohn das Leben geschenkt?“
„Ja, Vater“, erwiderte Christine. „Der kleine Ludwig ist mit seiner Amme in Kassel geblieben, aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, Euch zu treffen.“
„Braves Mädchen!“ sagte der Alte, was wohl die höchste Auszeichnung war, die er einer Frau zuteil werden ließ.
„Herzog Moritz, seid uns willkommen. Wir freuen uns sehr, Euch zu sehen“. Landgraf Philipp nahm seinen jungen Cousin in Augenschein. Moritz war in der Zwischenzeit zwar deutlich gewachsen, aber hatte an Kraft offenbar kaum zugenommen, denn er war schlaksig und schien nicht genau zu wissen, was er mit seinen langen Gliedmaßen anfangen sollte. Seine Haut war sehr hell - Philipp schloss daraus, dass er mit dem alten Herzog mehr Zeit als ihm lieb war in der Schreibstube verbracht hatte, um sich in eine gewissenhafte Verwaltung einzuarbeiten. Rötliches Haar fiel ihm lockig über die Schultern und bildete wenig Kontrast zu seiner Haut und den hellblauen Augen, die sehr kühl auf die Welt zu blicken schienen. Oder war es Verträumtheit? Nun - Philipp wollte seine Aufmerksamkeit schon fesseln!
„Der Wald quillt nur so über von Wild. Ich hoffe, Ihr werdet mir helfen, ein paar Hirsche zu schießen“, sagte er mit einem Zwinkern, was Moritzens Augen tatsächlich aufleuchten ließ. Sicher war er auch stolz, dass der Landgraf ihn mit „Ihr“ angesprochen hatte, anstatt ihn zu siezen, wie man es mit Kindern und niedrigen Dienern tat; wie es aber auch zwischen Eheleuten üblich war.
„Ich danke Euer Gnaden für die freundliche Einladung und werde mein Bestes geben.“
Philipp lächelte, denn offensichtlich sah Moritz in ihm noch immer ein großes Vorbild, wie damals vor vielen Jahren bei einer Hochzeit in Torgau, als er dem Kleinen versprechen musste, ihn zum Ritter auszubilden und ihm das Kämpfen beizubringen. Aus dem kleinen Jungen war nun ein Jüngling geworden, doch sein brennender Eifer und seine Bewunderung für Philipp waren geblieben.
„Nun kommt alle herein. Ihr seid sicher müde und hungrig von der langen Reise. Wo seid Ihr heute früh aufgebrochen?“ fragte Christine, indem sie mit einer Geste die beiden Herzöge mit ihren Leibdienern ins Innere des Schlosses bat. Unterdessen schafften die Knechte das Gepäck der Herren über einen Seiteneingang ins Schloss; anschließend würden sie sich ihre Schlafplätze im Gesindehaus und in den Marställen suchen.
„Ein prächtiges Jagdschloss habt Ihr, das muss ich Euch lassen!“ sagte der Alte, indem er sich mit Hilfe seines Stockes ein wenig aufrichtete und sich in der Eingangshalle umschaute.
„Ja, wir haben das Schloss wieder aufgebaut und mit allem Komfort ausgestattet, den unsere Handwerker zu bieten haben. Im Winter wärt Ihr sicher begeistert von den Kaminöfen - kalt sind sie immerhin eine Augenweide.“ Philipp war sichtlich stolz auf sein Schloss.
„Vater, bitte hier entlang. Ich bringe Euch selbst in Eure Gemächer. Dann könnt Ihr für einen Augenblick ausruhen; dort steht auch eine Kleinigkeit zur Stärkung, bevor wir um vier Uhr alle zusammenkommen und im großen Saal gemeinsam speisen.“
Es war noch früh am Abend, als Philipp und Christine allein am Feuer saßen. Christines Hofdamen und auch Philipps Diener hatten bereits die Erlaubnis erhalten, sich zurückzuziehen, die Amme hatte die Kinder längst ins Bett gebracht, sogar Agnes war gehorsam aufgestanden und der Amme gefolgt, auch wenn sie ganz offensichtlich gerne noch länger bei den Erwachsenen geblieben wäre und sich mit ihren elf Jahren nicht mehr zu den Kindern zählte. Auch Moritz, der alte Herzog und der Priester hatten sich bald zurückgezogen - schließlich war die Reise anstrengend genug gewesen. Vorsichtig beobachtete Christine ihren Gemahl, der mit verbissenem Gesicht ins Feuer starrte. Der Abend war kühl, Philipps Stimmung dagegen hitziger denn je.
„Es ist doch sehr schön, dass Moritz hier ist. Ich bin sicher, Sie werden morgen bei der Jagd viel Freude mit dem Jungen haben.“
„Auf den Priester hätte ich allerdings verzichten können. Wie kann er es wagen, uns einen katholischen Priester ins Haus zu bringen? Dass er auch noch geglaubt hat, ich würde erlauben, dass dieser Mann an meiner Tafel das Tischgebet spricht! Er hat immer wieder davon gesprochen, dass er die Kinderschuhe ausgetan hätte, wenn wir ihm vorsichtige Ratschläge erteilen wollten, aber er kann nicht erkennen, dass wir auch nicht mehr in Kinderschuhen gehen. - Danke, dass Sie die Wogen geglättet haben, Herrin“, sagte Philipp dann etwas ruhiger. Tatsächlich hatte Christine dafür gesorgt, dass kein Streit ausgebrochen war, und so hatte man das Mahl eingenommen, ohne das leidige Thema der Religion auch nur zu streifen.
Glücklicherweise hatte sich auch der Priester zurückgehalten, sodass eine Stimmung herrschte, als stehe mitten auf der Tafel ein riesiger Hirsch, den keiner übersehen kann, den aber trotzdem niemand mit einem einzigen Wort erwähnt. Selbst der Narr war in eine Ecke verbannt worden und hatte geschwiegen.
„Ach, Herr, es ist doch kaum noch etwas übrig von meinem Vater, was zu bekämpfen sich lohnen würde.“
„Er hat noch immer Räte bei sich, die ihm altgläubigen Unsinn einblasen und ihn aufhetzen gegen meine Schwester. Er soll nicht wagen, sie zu bedrängen.“
„Wie sollte er sie denn bedrängen? Er ist der letzte Fürst in Sachsen, der noch katholisch ist. Er weiß genau, was er sich erlauben kann und was nicht. - Was man von Ihnen, lieber Gemahl, nicht behaupten kann“, fügte Christine in Gedanken hinzu, als Philipp sich wortlos erhob und davonging. Sie wusste nur zu gut, wo er hinwollte, denn noch am kommenden Morgen würde er nach Schenke riechen, nach Wein und Bier und liederlichen Frauen.
Kurz darauf hörte sie die Hufe seines Pferdes auf dem Pflaster und hoffte inständig, dass ihr Vater es nicht bemerkt hatte und keine Fragen stellen würde, doch der alte Herzog hatte am Fenster gestanden und gesehen, wie sein Schwiegersohn davongeritten war. Herzog Georg lehnte jegliche Hilfe ab und machte sich allein auf den Weg zu seiner Tochter - und er hatte einige Fragen!
Sie hörte seine Schritte und das tap tap seines Stockes schon auf der Treppe. Mit einer fahrigen Geste rieb sie ihr Gesicht und fühlte dabei, dass sich Tränen hervorgestohlen hatten. Nein, ihr Vater sollte nichts merken!
„Christine!“ Ein gebückter, schwarzer Schatten stand in der Tür.
„Vater! Ich dachte, Ihr schlaft schon längst. Seid Ihr denn nicht vollkommen erschöpft von der langen Reise?“ Christine hatte sich erhoben und war ihm entgegengegangen, um ihn zu dem Stuhl zu führen, den Philipp eben verlassen hatte.
„Ach, mein Kind, der Schlaf flieht mich. Im Alter muss man nicht mehr so viel schlafen - ganz so als wüsste der Leib, dass er in der Gruft noch genug schlafen kann.“
„Vater, bitte sprecht nicht so! Ich bin so glücklich, Euch zu sehen und endlich wieder einmal bei mir zu haben.“ Mit einem Seufzer ließ er sich in den Lehnstuhl fallen und stützte seine Hände auf den Stock, den er vor sich hingestellt hatte. Im Schein des Feuers konnte Christine erkennen, wie sehr auch die Hände ihres Vaters gealtert waren.
„Diese Freude teilt Ihr Gemahl nicht. - Und sagen Sie mir jetzt bitte nicht, dass er nur nicht zeigen kann, wie sehr er sich freut!“ sagte der Alte, als Christine schon zu einem leisen Widerspruch angesetzt hatte. „Ich mache mir Sorgen, mein Kind.“
„Vater, ich bitte Euch, Ihr müsst Euch wirklich keine Sorgen machen, nur weil wir lutherisch sind. Wir haben unser Seelenheil nicht verspielt und Ihr müsst uns nicht retten.“ Am Klang ihrer Stimme konnte man eindeutig erkennen, dass sie diesen Satz ihrem Vater beileibe nicht zum ersten Mal sagte.
„Das sind meine geringsten Sorgen, Kind. Ich sorge mich um Ihre Gesundheit. Der Lebenswandel Ihres Gemahls ist kein Geheimnis. Wahrscheinlich hat er die Franzosenkrankheit“, knurrte der Alte verächtlich.
„Ja, Vater, ich weiß das alles...“
„Ist er denn in Behandlung?“
„Nun ja, er hat einen Leibarzt, aber er konnte ihm bisher nicht wirklich helfen.“
„Ich will nicht, dass er Sie ansteckt! Das sind meine Sorgen. Warum hat er nicht eine Mätresse - oder meinetwegen auch zwei oder drei - wie jeder anständige Fürst? Wieso muss er sich immer wieder in jeder Stadt, in der ein Reichstag stattfindet, mit jeder Hure vergnügen, die ihm über den Weg läuft? Was ist mit dem Personal, mit der Dienerschaft? Die lässt er ja auch nicht in Frieden. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie sehr ich es bereue, diesem Mann meine Tochter gegeben zu haben.“
„Vater, Ihr quält mich!“ flüsterte Christine, doch der Alte hatte sie nicht gehört und fuhr fort: „Meine Lieblingstochter! Sie waren immer meine Lieblingstochter.“
„Ach, Vater!“ Christine legte ihre Hand auf die Hände ihres Vaters. „Das sind auch meine Sorgen. Ich habe auch Angst, dass er mich ansteckt. Nun ist ja wieder ein Sohn geboren - da wird er mich vorerst verschonen.“
„Wenn er Sie ansteckt, dann wir er sich nicht nur vor mir verantworten müssen, sondern auch vor Gott. - Ist es wahr, dass er schon seit Jahren nicht mehr beim Abendmahl war?“
Christine sah ihren Vater nicht an, als sie kaum merklich nickte.
„Wegen seiner Hurerei?“ Herzog Georg meinte es gut, wenn es auch nicht gerade einfühlsam war, wie er nun seinen Stock auf den Boden aufstieß. Wieder gelang Christine nur ein Nicken.
„Du liebe Güte! Da lob ich es mir doch, katholisch zu sein. Man geht beichten, und die Welt ist wieder in Ordnung, aber ihr Lutheraner habt immer gleich den Weltuntergang.“
„Vater, bitte, lasst uns nicht streiten!“
„Ich streite doch gar nicht. Ich sage nur, was ich denke, und ich frage nach den Dingen, die ich gerne wissen möchte. Das kann man einem alten Mann nicht verdenken. Und Philipps Schwester Elisabeth? Wie steht es mit ihr? Sie will auf ihrem Witwensitz in Rochlitz die Reformation einführen, damit alle die Predigten auf deutsch hören und womöglich die Bibel auf deutsch lesen.“
„Aber Vater, es ist doch nicht verwerflich, wenn man den Menschen in ihrer Sprache das Wort Gottes verkündet. Sie sollen es doch verstehen.“
„Sind Sie sicher, dass jeder es verstehen wird? Ich halte es nicht für richtig, wenn jeder Narr die Bibel lesen und sich seinen eigenen Reim darauf machen kann. Aber dem werde ich einen Riegel vorschieben, denn wohin das führt, haben Wir in den Bauernkriegen gesehen.“
Längst war Philipp in der Schenke angelangt, in der man ihn sehnsüchtig erwartet hatte, seit die landgräfliche Reisegesellschaft vor Tagen gesichtet worden war. Drei Frauen, die Christine nicht einmal mit einer Beißzange angefasst hätte, kümmerten sich in einem Gemach von höchst mangelhafter Sauberkeit dergestalt untertänigst um ihren Landesherrn, dass diesem die Sinne vergingen. Das Bier tat ein Übriges, um den Fürsten vollends seines Verstandes zu berauben. Ein flackerndes Talglicht warf die Schatten der Huren an die Wand, wo sie sich für den betrunkenen Philipp in riesige, schwarze Dämonen verwandelten, die ihre zottigen Mähnen schüttelten und ihre Schlünde aufrissen, um ihn zu verschlingen. In seinen Ohren klirrte ihr Geschrei und Gestöhne. Entsetzt starrte er an die Wand, wo die gräulichen Bestien nun, umringt von immer höher lodernden Flammen, reihum aus dem heiligen Abendmahlskelch tranken, so gierig, dass ihnen der heilige Wein, das Blut Christi, über die Gesichter und Brüste lief. Entweiht und besudelt war der Kelch, auf ewig verloren für ihn, den armen Sünder, der in der Hölle schmoren würde. Er hob die Hände, um ihnen Einhalt zu gebieten, aber in rasender Wollust setzten sie ihm nur noch ärger zu, bis er sich ergeben wollte, um die brennende Hitze in seinen Lenden zu stillen, die ihn niemals zur Ruhe kommen ließ. Wieder ließen sie den Kelch kreisen und drückten ihn auch Philipp an die Lippen. Nun hatte er Gemeinschaft mit diesen Kreaturen! Oh, welche Pein! Sie würden ihn in die unterste Hölle entführen, auf ewig würde er brennen, in einem Feuer, gegen das die Glut in seinen Lenden sicherlich nur ein laues Lüftchen war. In namenlosem Schmerz schrie Philipp auf, schlug die Hände vors Gesicht und brach schluchzend auf dem schmutzigen Bett zusammen.
„Um Himmels Willen, was hat er denn?“ fragte eine der Damen ängstlich ihre Kolleginnen, und wischte sich mit dem Handrücken nicht nur Bierschaum vom Mund. Mit panisch aufgerissenen Augen starrte sie ihren Fürsten an, der vor Schmerz offenbar nicht mehr bei sich war.
„Hast du ihn etwa gebissen?“ schrie die zweite.
„Nein! Natürlich nicht!“
„Wenn du den Fürsten seiner Manneskraft beraubt hast, sehen wir im besten Fall nie wieder Tageslicht. Wir sollten abhauen, bevor der Wirt kommt. Sicher hat er das Schreien seiner Gnaden gehört.“
„Der Wirt wird einen Teufel tun, die Lustschreie seiner Gnaden zu unterbrechen. Lass mal sehen!“ sagte die dritte und nahm die Kerze vom Tisch. Gemeinsam neigten sich diese drei Spitzenkönnerinnen über die Leibesmitte des Landgrafen, um den kleinen Philipp zu inspizieren.
„Du liebe Güte! Wie sieht das denn aus? So viele kleine Knubbel und Dellen. Du hast ihn doch gebissen! Na warte! Dich werd ich...“ knurrte die zweite und holte aus.
„Ich hab nix gemacht, das war schon. Ich schwör!“ rief die erste mit der ganzen Empörung fälschlich angeklagter Unschuld, während Philipp sich nunmehr leise wimmernd und um Gnade flehend auf dem Bett wälzte.
„Auf dem Scheiterhaufen werden wir landen, alle drei!“ Und schon war die erste aus dem Fenster, dicht gefolgt von der zweiten, die ebenfalls nicht auf dem Scheiterhaufen landen wollte.
Die dritte sah den beiden nach, die eilig im Wald verschwanden und zuckte nur mit den Schultern. Es war nicht ihre Sache, wenn diese beiden Hühner zum ersten Mal beim Landgrafen waren. Sie selbst wusste, was folgen würde: Der Fürst würde bald wieder zu sich kommen, einen Becher Bier in einem Zug austrinken und dann würde es weitergehen. Niemand würde sie anklagen und in den Kerker werfen, sondern der Fürst würde sie am nächsten Morgen reichlich belohnen.
Und so geschah es tatsächlich.
Dadurch erschien Philipp begreiflicherweise nicht zum Morgenimbiss. Christine saß da mit versteinertem Gesicht, Herzog Georg hatte sich geweigert, überhaupt zum Essen zu erscheinen. Als Philipp endlich auf der Burg ankam, nahm er nicht den Umweg über die privaten Gemächer, um seine Familie zu begrüßen, sondern ließ sich gleich sein Jagdgewehr bringen. Auch Moritz ließ er holen und ihm ein besonders schönes Pferd satteln. Der Junge strahlte ihn glücklich an, als er aufsaß, denn er hatte wohl nicht damit gerechnet, gleich am ersten Tag mit dem Landgrafen zur Jagd auszureiten.
„Heute jagen wir und wenn Ihr wollt, können wir uns morgen im Zweikampf üben. Das hatte ich Euch schließlich versprochen, damals in Torgau.“
„Danke, Euer Gnaden. Das ist überaus freundlich von Euch. Dass Ihr Euch daran erinnert!“
Nun wusste Moritz, dass Tage voller Abenteuer und Jagdlust vor ihm lagen - an der Seite des von ihm so hoch verehrten Landgrafen. Wie gerne würde er bei ihm seine Ausbildung fortsetzen, doch er wusste, dass die Mutter andere Pläne mit ihm hatte, die sie ihm bald zu Hause in Freiberg mitteilen würde.
Freiberg, im Juni 1537
Im Schloss zu Freiberg führte Herzogin Katharina zu Sachsen ein ebenso strenges wie freudloses Regiment. Als jüngste Tochter des Herzogs zu Mecklenburg hatte sie von jeher erlebt, dass man sich behaupten musste, wollte man nicht untergehen. Ihr Vater hatte gegen aufständische Untertanen gekämpft, ihre älteste Schwester Dorothea wehrte sich als Äbtissin hartnäckig gegen die Reformation; ihrer Schwester Anna war es gelungen, sich nach dem Tod ihres Gemahls Wilhelm von Hessen gegen die Ritterschaft zu behaupten, die mit der Witwe keineswegs ritterlich umgesprungen war. Nur Sophie, die schon als Kind so brav und sittsam gewesen war, hatte die Geburt ihres ersten Kindes, des jetzigen Kurfürsten Johann Friedrich, der in Torgau residierte, nicht überlebt.
Anno 1512 war sie als fünfundzwanzigjährige Schönheit in das beschauliche, von Festgelagen, Lustbarkeiten und Jagdgesellschaften geprägte Leben des damals neununddreißigjährigen Hagestolzes eingebrochen und hatte gründlich Ordnung geschaffen. Herzog Heinrich hatte damals zunächst mit Belustigung das Treiben seiner hübschen, jungen Frau beobachtet, die sein gemütliches, aber wenig repräsentatives Schloss von innen nach außen gewendet hatte. Als sie das oberste zuunterst kehrte, hatte er noch versucht einzuschreiten, doch hatte er bald vor so viel jungendlichem Eifer kapitulieren müssen. Katharina war ausgesprochen ambitioniert und keineswegs gewillt, das Dasein einer unbedeutenden Provinzfürstin zu führen, doch ihr Handlungsspielraum war begrenzt. Glücklicherweise bekam sie Kinder. Mit den Töchtern Sibylla, Aemilia und Sidonia war zumindest ein Anfang gemacht - Töchter konnte man immerhin verheiraten, um Verbindungen mit wichtigen Familien zu knüpfen, die nützlich sein konnten. 1521 kam Moritz zur Welt. Der Stammhalter. Endlich! Zur Sicherheit gebar Herzogin Katharina außerdem einen Severin und einen August. Mit drei Töchtern und drei Söhnen sollte sich doch einiges bewerkstelligen lassen, indem man für jedes einzelne Kind einen geeigneten Lebensplan erstellte.
Leider war durch den reichen Kindersegen das Geld knapp geworden und so musste Herzog Heinrich notgedrungen bei seinem Bruder Georg in Dresden vorsprechen, um eine Aufstockung der Finanzausstattung auszuhandeln. Herzog Georg verwies auf längst ausgehandelte Verträge und lehnte die Bitte seines Bruders ab, erklärte sich aber immerhin bereit, für die Ausbildung seiner Freiberger Neffen zu sorgen. Für Severin und Moritz hatte er gut-katholische Höfe gewählt, an die die beiden Knaben geschickt worden waren. Severin war nach wenigen Monaten am Hofe König Ferdinands, des Bruders Kaiser Karls V., in Innsbruck an einem Fieber gestorben. Moritz hatte ein Jahr in Halle bei Erzbischof Albrecht verbracht; dann hatte auch ihn ein Fieber gepackt und er hatte nach Hause zurückkehren müssen. Kaum genesen, hatte ihn die Mutter nach Dresden geschickt, wo er die letzten drei Jahre unter den Fittichen seines Onkels selbst verbracht hatte. Herzog Georg hatte den jungen Moritz lieb gewonnen, ihm alles beigebracht, was ein zukünftiger Landesherr über eine gewissenhafte und sparsame Verwaltung wissen musste und überdies noch Ausschau gehalten nach einer geeigneten katholischen Heiratskandidatin.
Dies alles hatte der gute Herzog Georg nicht ohne Grund getan, denn als streng gläubiger Katholik war es für ihn nur naheliegend, seine beiden Neffen an katholische Höfe zu vermitteln und zu hoffen, dass eine katholische Ehefrau den verbliebenen Neffen im rechten Glauben hielt. Seit 1529 bot Herzogin Katharina ihrem Schwager Gründe zu ernsthafter Sorge: Katharina hatte sich die lutherische Krankheit eingefangen und war auf dem besten Wege, ihren Gemahl damit anzustecken. Es hieß, dass Herzog Heinrich seit Neujahr einem gewissen Herrn Jacob Schenk erlaubte, sonntags im Dom zu predigen, weil die über dreitausend Zuhörer, die alle den Schüler Martin Luthers hören wollten, nicht in die kleine Schlosskapelle passten.
Herzog Moritz von Sachsen stand nun mit gesenktem Haupt vor seiner Mutter Katharina und beantwortete gehorsam alle ihre Fragen. Es hätte eine behagliche Familienszene sein können: Vater und Mutter hatten es sich in Sesseln bequem gemacht, im Schoß der Mutter lag ein Stickrahmen, der Vater nippte ab und zu an einem Weinkelch; doch verriet die Haltung des Jünglings selbst einem unbedarften Betrachter, dass diese Eltern sich nicht einfach nur von ihrem Sohn berichten ließen, wie es denn in Dresden gewesen sei. Moritz hatte seine Schultern nach oben gezogen, seine Knie waren ganz leicht gebeugt, wobei er von einem Bein aufs andere trat. Seine Augen lagen bemüht fest auf dem Gesicht seiner Mutter, doch huschten sie immer wieder hinüber zum Vater, als wolle er sich dessen Gunst und Hilfe vergewissern.
Obwohl seine Mutter während des ganzen Gespräches durchaus wohlwollend genickt und nur ganz selten ihre Oberlippe in ordentliche Falten gelegt hatte, spürte Moritz, wie seine Hände heiß und feucht wurden. So unauffällig wie möglich versuchte er, sie an seiner Hose abzuwischen.
„Was tun Sie da?“ fragte die Mutter, deren Augen nichts entging.
„Vergebt mir, Frau Mutter, ich dachte, es seien Falten in meiner Hose und ich wollte auf keinen Fall unordentlich vor Euch stehen.“ Nun stand auch Schweiß auf seiner Stirne. Mit einer fahrigen Bewegung nahm er die Hände auf den Rücken.
Nachdem die Mutter überprüft hatte, dass Moritz ausreichend in Verwaltungsdingen ausgebildet worden war, fühlte sie ihrem ältesten Sohn etwas genauer auf den Zahn: „Hat Herzog Georg darauf bestanden, dass Sie mit in den katholischen Gottesdienst kommen und dass Sie das Abendmahl in altgläubiger Weise empfangen?“
„Das hat er, Frau Mutter. Ich habe zwar versucht, mit ihm darüber zu reden, ihm die Dinge zu erklären, die Ihr mir erklärt habt, aber er…“
„Sie wollten Herzog Georg reformieren? Wohl nur, um dann triumphierend sagen zu können, dass Sie etwas erreicht haben, was nicht einmal Martin Luther selbst erreicht hat!“ rief Herzogin Katharina aus in einer Mischung aus Ärger und Amüsement. „Sie sind ein unverbesserlicher Narr! Ein Narr, wie ich es Ihnen schon seit Jahren sage. Unverbesserlich!“ Sie schüttelte den Kopf, nahm ihren Stickrahmen, ließ ihn aber sogleich wieder sinken und schaute ihren Gemahl an, der betreten aus dem Fenster schaute. „Nun sagen Sie doch etwas, Herr! Er wollte Herzog Georg reformieren!“ Wenn Moritz ihr erzählt hätte, er wolle die Sonne vom Himmel holen, hätte sie kaum anders reagieren können.
„Nein, Frau Mutter, Ihr irrt“, erwiderte Moritz und biss sich sofort auf die Lippen, aber es war zu spät.
„Ich irre?“ sämtliche Falten in ihrem Gesicht vertieften sich, besonders die tiefen Furchen um ihre Lippen. „Ein Narr! Aber das sagte ich ja bereits.“ Sie musterte ihn spöttisch. „Und? Möchten Sie mich jetzt um Vergebung bitten?“
„Mutter, ich bitte Sie um Vergebung, Ihr hattet natürlich recht.“ Moritz klang zutiefst zerknirscht, sogar Tränen schwangen in seiner geflehten Bitte um Vergebung mit. Wie gut, dass er die Hände bereits auf dem Rücken hatte, denn so konnte er ganz unauffällig die Finger kreuzen.
„Natürlich hatte ich Recht. - Heiratspläne? Hat Herzog Georg mit Ihnen über irgendwelche Heiratspläne gesprochen?“ Und zu ihrem Gemahl gewandt sagte sie: „Es würde mich nicht wundern, wenn der Alte versuchte, unseren Sohn mit einer Katholikin zu verbinden, damit Sachsens Zukunft katholisch ist. Aber da hat er die Rechnung ohne mich gemacht.“
„Frau Mutter, seine Gnaden, Herzog Georg würde niemals erlauben, dass ich gegen meine Eltern anders handle, denn als Euer gehorsamer Sohn.“ Die letzten beiden Worte sprach Moritz mit einem gewissen Nachdruck.
„Sie wissen, dass für uns nur eine Verbindung mit einer lutherischen Braut in Frage kommt!“ Zum Zeichen seines bedingungslosen Gehorsams verneigte er sich besonders tief.
„Es ist damit zu rechnen, dass Herzog Georg seinen blöden Sohn Friedrich noch verheiratet und auf den Thron setzt, damit das Herzogtum Sachsen altgläubig bleibt. Wenn ihm das tatsächlich gelänge, wäre Ihre Erbschaft zunichte gemacht. Um das Erbe zu sichern, ist Ihr Vater nun dem Schmalkaldischen Bund beigetreten - Sie wissen, dem Bündnis der lutherischen Fürsten. Kurfürst Johann Friedrich verlangt aber nun, dass wir uns vollkommen von Herzog Georg distanzieren; deshalb sollen Sie als Unterpfand an den Hof zu Torgau gehen und dort weiter ausgebildet werden3. Haben Sie das alles verstanden?“
„Ja, Mutter.“
„Es ist gut, mein Junge. Sie dürfen gehen.“ Moritz verneigte sich noch tiefer und ging erleichtert davon.
Vor der Tür traf er auf Sidonie, die jüngste seiner drei großen Schwestern. Sie war neunzehn Jahre alt und noch immer unverheiratet, was ihrer Mutter ein Dorn im Auge war, doch Sidonie nahm es gelassen. Sie und die älteste Schwester wussten, dass sie wenig Mitgift hatten, die Fürstensöhne wussten es auch, und nur wegen ihrer hübschen Gesichter würde sie kaum jemand nehmen.
„Na, kleiner Bruder? Hast du es überlebt?“ flüsterte sie, dann nahm sie ihn an der Hand und zog ihn mit sich. „Ich hab in der Küche dein Lieblingsessen bestellt.“
Auf ihrem Weg dorthin lief ihnen der kleine Bruder August über den Weg, der ängstlich zusammenzuckte, als Moritz laut seinen Namen rief.
„He, mein Kleiner, hab ich dich erschreckt?“ Moritz nahm den Jungen auf die Arme, wofür dieser mit seinen zehn Jahren eigentlich schon zu groß war, aber Moritz wollte und musste beweisen, dass er kräftig geworden war und den kleinen Kerl tragen konnte. August ließ es geschehen, denn umarmt wurde er zu selten. Die Schwestern hatten alle ihre eigenen Probleme und die Mutter tat es ohnehin niemals; sie hielt sogar die Erzieher an, das Kind mit Strenge zu erziehen, was bei dem äußerlich und innerlich weichen Kind vollkommen fehl am Platze war. August schaute seinen großen Bruder aus ängstlichen Augen an.
„Nein, August, Sie müssen uns jetzt alleine lassen. Gehen Sie!“ sagte Sidonie, als Moritz ihn wieder auf die Erde stellte. Der Junge trollte sich augenblicklich.
„Aber er hätte doch bei uns bleiben können.“
„Nein! Er könnte reden, und du weißt, was passiert, wenn die Mutter erfährt, dass wir in der Küche genascht haben.“
„Er war nicht besonders gesprächig, er hätte doch…“
„Was er nicht weiß, kann er auch nicht der Mutter berichten. Du kannst dir kaum vorstellen, wie gehorsam er ist“, schimpfte Sidonie, schaute aber gleich darauf ängstlich um sich.
„Gehorsam!“ Moritz spuckte das Wort aus, als habe es ihm den Mund zerstochen.
Als die Geschwister in einer kleinen Nebenkammer der Küche saßen und sich den heimischen Wein schmecken ließen, wurde Moritz wieder ruhiger. Er betrachtete seine Hand, die nun nicht mehr zitterte, als sei sie ihm ganz fremd. Eine der Mägde kam mit Tellern, auf denen sie kaltes Hühnchen mit frischen Kräutern angerichtet hatte. Auf ihrem hochroten Gesicht stand ganz deutlich die Furcht, die Herzogin könnte herausfinden, dass sie die jungen Herrschaften außerhalb der Essenszeiten bewirtet hatte, und der Zorn der Herrin war berüchtigt. Auch Messer legte sie den Geschwistern auf den Tisch, die Moritz gleich wieder beiseite schob.
„Wir brauchen doch keine Messer - ich denke, das Huhn ist schon tot!“
„Ein Scherz? Von Dir?“ Sidonie lachte ungläubig und schaute ihren kleinen Bruder belustigt an.
„Das hat Elisabeth mal gesagt. Ich dachte mir, dass dir das auch gefällt.“ Moritz grinste sogar.
„Die Zeit in Dresden hat Dir gut getan, wie ich sehe. Wie…“
„Nein, bitte, erzähl mir zuerst wie es Aemilia geht.“
„Wie soll es einer jungen Frau gehen, die mit einem steinalten Mann verheiratet ist? Das dritte Kind ist unterwegs. Glücklicherweise hat sie bisher Töchter geboren. Wenn sie ihrem Gemahl Söhne geschenkt hätte, dann hätten die heiratswilligen Herren bei Sibylla und mir Schlange gestanden, und irgendein Greis mit genügend Talern in seinen Truhen und Verbindungen zu den wichtigsten Fürstenhöfen wäre sicher dabei gewesen.“ Sidonie drehte gedankenverloren den Kelch in ihrer Hand, dann fuhr sie fort: „Aemilia beklagt sich nicht. Ihr Gemahl ist in den letzen Monaten sehr zusammengefallen, dann wird das wohl ihre letzte Schwangerschaft sein. Sie kümmert sich um ihren Mann, wie eine Frau sich um ihren Großvater kümmern könnte.“ Als wolle sie die Sorgen um ihre Schwester verbannen, straffte sie sich plötzlich, beugte sich leicht über den Tisch und sagte: „Aber nun erzähl! Wie war es in Dresden?“
„Soll ich dir jetzt die ganzen letzten drei Jahre schildern?“
„So viel Zeit wird uns die Frau Mutter wohl kaum lassen. Wir können schon froh sein, wenn sie uns hier nicht erwischt; hattest du denn eine schöne Zeit?“
„Ja“, sagte Moritz leise und nickte. „Ich hatte eine schöne Zeit, meistens zumindest. Herzog Georg war sehr freundlich zu mir, ich schätze ihn sehr - wenn ich ihn auch nicht so sehr verehre wie Landgraf Philipp von Hessen. Seine Schwester Elisabeth war in Dresden wie eine Mutter für mich. Sie war…“ Moritzens Augen huschten über die Regale, auf denen der Koch Krüge mit allerlei Zutaten aufbewahrte, als suche er nach einem Wort „… liebevoll. Ja, sie war liebevoll“, sagte er langsam und nachdenklich. „Bei ihr hatte ich das Gefühl, gesehen zu werden. Weißt du was ich meine?“
Nein, Sidonie sah nicht so aus, als wisse sie, was ihr kleiner Bruder meinte, aber sie nickte ein wenig und stopfte sich noch etwas Fleisch in den Mund, während Moritz eingehend die Frühlingskräuter zu untersuchen schien.
„Weißt du, Sidonie, Elisabeth hat im Januar ihren Gemahl verloren. Das hat mir sehr leid getan. Das war für sie ein schrecklicher Schlag - zumal sie keinen Sohn hat. Ich hatte oft das Gefühl, dass sie sich einen Sohn wie mich wünscht. Ich hab ihr mal als kleiner Junge eine Schleife geschenkt. Die bewahrt sie noch immer auf. Sie hat sie sogar mitgenommen, als sie im März auf ihr Wittum nach Rochlitz gezogen ist.“ Man konnte an seinem verwirrten Lachen deutlich hören, dass Frauen für ihn vollkommen fremde, sonderbare Wesen waren und er wenig Hoffnung hatte, sie jemals zu verstehen. „Bei Herzog Georg habe ich sehr viel gelernt. Ihm liegt vor allem die Ordnung in allen Dingen am Herzen. Er schickt seine Räte in die Klöster, damit sie dort nach dem rechten sehen und seine maßvollen Reformen umsetzen. Er ist der Ansicht, dass es Reformen geben muss, aber von oben und nicht von unten. Reformen müssen in geregelten Bahnen verlaufen und vom Fürsten angeordnet und kontrolliert werden. Deswegen ist er auch gegen das Luthertum. Er bemüht sich selbst um Reformen, aber er verabscheut Aufruhr und Unruhen, wie Luther sie ausgelöst hat.“
„Lass das nicht die Mutter hören!“
„Nein, ganz sicher nicht - auch wenn sie selbst mich zu ihm geschickt hat, damit ich bei ihm lerne. Aber du weißt doch, dass mir diese Religionssdinge nicht wichtig sind. Ich habe mich in den altgläubigen Tagesablauf in Dresden eingefügt, aber Herzog Georg hat mich niemals zu religiösen Dingen befragt, geschweige denn bedrängt, mich zum alten Glauben zu bekennen. Was mich nur ärgert, ist, dass ich bei ihm unbedingt Latein lernen soll. Ich sehe ja ein, dass ich mich mit dem Verwaltungswesen eines Staates auseinandersetzen muss, aber was soll ich mit Latein? Weißt du, Sidonie, Herzog Georg hat in Sachsen ein dreistufiges Verwaltungssystem eingeführt.“ Nun sprach Moritz ganz eifrig, denn er wollte seiner Schwester zeigen, was er gelernt hatte: „Ihm als Fürsten unterstehen direkt der Hofrat und die Räte, die immer am Hof anwesend sind. Darunter stehen die Landkreise, deren Beamte den Räten Rechenschaft ablegen. Den Landkreisen wiederum unterstehen die Ämter, das sind einzelne Ortschaften. Man muss sich treue Beamte heranziehen und alles kontrollieren, damit man nicht zum Narren gehalten wird.“
Sidonie schaute aus dem Fenster und stöhnte.
„Gut, gut, ich erzähle dir kein langweiliges Verwaltungszeug mehr. - Im Mai war ich mit Herzog Georg in Hessen bei Landgraf Philipp auf einem Jagdschloss. In meinem ganzen Leben hatte ich noch nicht solche Freude wie bei der Jagd mit diesem Mann. Wenn ich doch nur so reiten und schießen und kämpfen könnte wie dieser Mann! Du solltest sehen, wie alle Menschen, die ihm begegnen, ihn respektieren und zu ihm aufschauen. Ich wollte, ich könnte bei ihm meine Ausbildung fortsetzen, aber die Frau Mutter wird mich bald nach Torgau schicken zu Kurfürst Johann Friedrich. Lange wird sie mich hier nicht bleiben lassen. Aber was kann ich bei dem Kurfürsten anderes lernen als das Essen und Trinken? Sein Lieblingsspruch ist: ‚Ich geh lieber auf die Jagd - da kann ich hinterher wenigstens essen, was ich geschossen habe!’ Das geziemt sich doch nicht für einen Fürsten! Er braucht eine kleine Treppe, die ihm seine Diener hinstellen müssen, damit er auf sein Pferd kommt. Mir tut jeder Gaul leid, auf den er sich setzt. Landgraf Philipp dagegen ist mit einem Schwung im Sattel - so elegant, das solltest du sehen!“
„Und - hat Landgraf Philipp dich auch gesehen?“ fragte Sidonie spöttisch.
„Was grinst du so?“ rief Moritz ärgerlich. „Ich dachte, du freust dich wirklich, mich nach drei Jahren wiederzusehen. Aber für dich bin ich auch nichts weiter als der Narr, der ich für unsere Mutter bin.“
Moritz erhob sich so heftig, dass der Schemel umfiel und stürmte hinaus.
„Moritz, komm zurück. So hab ich das nicht gemeint“, rief sie ihm noch hinterher, doch er war schon fort. „Narr!“ murmelte sie und aß auch seine Portion auf.
Rochlitz, im Juli 1537
Die sommerliche Hitze hatte Herzogin Elisabeths Hofdamen ins Innere des Schlosses getrieben, wo es noch immer angenehm kühl war. Während Elisabeth in ihrer Schreibstube saß, um ihrem Bruder die letzten Neuigkeiten mitzuteilen, widmete man sich in der Hofstube verschiedenen Handarbeiten, Gertrud spielte leise Töne auf der Laute, und die Närrin hatte sich unbemerkt die Bibel stibitzt, saß quer in Elisabeths hohem Lehnstuhl und ließ die Beine baumeln. Hie und da blickte Gertrud auf, wenn die Närrin leise vor sich hingluckste, aber als sie in schallendes Gelächter ausbrach, schreckte auch die Hofmeisterin Anna von der Saale4 auf und schaute sie an. „Närrin, was liest du da?“ fragte sie, empört über so viel Heiterkeit.
„Ihr werdet es kaum glauben, werte Hofmeisterin, aber ich lese die Bibel“, erwiderte sie, noch immer lachend.
„Und was steht so Lustiges in der Bibel?“ Anna von der Saales Stimme wurde streng.
„Das Hohelied Salomos. Da beschreibt einer seine Angebetete… Also, wenn man das alles wörtlich nimmt und sich diese Frau bildlich vorstellt…“
„Was dann?“ Anna von der Saales Strenge bekam einen leicht bedrohlichen Unterton, der von der Närrin jedoch geflissentlich überhört wurde.
„Hier heißt es: Deine Lippen sind wie eine scharlachfarbene Schnur. Das lass ich mir ja noch gefallen, aber es heißt auch: Deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe, die aus der Schwemme kommen. Donnerwetter! Das nenn’ ich mal ein gesundes Gebiss! Aber es kommt noch besser: Deine Brüste sind wie zwei junge Zwillinge von Rehkitzen, die unter den Rosenbüschen weiden. Wenn ich nicht völlig daneben liege, haben Rehkitze ein Fell. Hat seine Geliebte also Haare auf der Brust? Und dieses Rosengestrüpp - hängt das auch an der Frau dran?“
Hier wagte Margarete, die fünfzehnjährige Tochter der Hofmeisterin, zu kichern, doch es genügte ein einziger Blick ihrer Mutter und sie beugte sich gleich wieder tief über ihre Handarbeit. Die Närrin fuhr fort: „Von deinen Lippen, meine Braut, träufelt Honigseim. Sabbern tut sie also auch! Und weiter heißt es: Deine Nase ist wie der Turm auf dem Libanon, der nach Damaskus sieht. Stellt Euch doch mal diesen riesigen Zinken vor! Ich bin gespannt, was noch alles kommt! Was sagst du dazu, Elfriede?“
Elfriede war der Narrenstab, ein kleines Konterfei seiner Besitzerin, das einen ebensolchen Kragen mit kleinen Glöckchen trug wie die Närrin selbst. Die Närrin ließ nun Elfriede empor schnellen und mit schnarrender Stimme sagen: „Was soll ich dazu sagen? Bin ich doch ebenso gespannt wie ihr alle! Aber, ihr werten Jungfern,“ rief Elfriede aus und schaute sich herausfordernd um, „wir sollten uns aufs Äußerste gefasst machen. Wahrscheinlich thront auf dieser riesigen Nase eine Warze, hoch wie der Berg Sinai und auf der Warze stehen die Haare so groß und fest wie die Zedern des Libanon!“
„Närrin!“ Anna von der Saale erhob sich.
„Elfriede!“ rief die Närrin empört und hielt ihren Narrenstab auf Armeslänge von sich. „Werte Hofmeisterin, ich hab doch gar nichts gemacht! Elfriede war’s!“ Damit zeigte sie auf ihren Narrenstab, was der Hofmeisterin wie immer die letzten Reserven an Geduld abnötigte.
„Ach!“ schnarrte Elfriede. „Immer bin ich’s gewesen, wenn du dich mit deinem großen Mundwerk um Kopf und Kragen redest.“ Als Anna von der Saale vor dem Lehnstuhl stand, hielt die Närrin die Bibel wie einen Schild vor sich.
„Gib mir die Bibel!“
Doch die Närrin sank noch tiefer und rief mit einer Fistelstimme, die sie für größte Gefahren reserviert hatte: „Herr, siehe, meine Feinde lagern sich um mich und wollen mich bedrängen. Sei du mir ein Schild gegen meine Widersacher! Psalm 185, Vers 17a.“
Die Hofmeisterin ließ sich nicht beeindrucken und versuchte, der Närrin die Bibel gewaltsam abzunehmen. Es gab ein hässliches Geräusch von zerreißendem Papier, worauf Hofmeisterin und Närrin betroffen schauten. Die Närrin fasste sich als erste wieder: „Seht Ihr, Frau Hofmeisterin, da habt Ihr nun die Bibel zerrissen. Wenn Ihr dafür mal nicht in die Hölle kommt!“
„Das wird die Herrin erfahren!“ rief die Hofmeisterin zornbebend.
„Wetten, ich sag’s ihr eher?“ Und damit schlängelte sich die Närrin geschickt vom Lehnstuhl und rannte die Treppe hinauf. Die Hofdamen hörten nur noch ihr Schreien: „Herrin! Herrin, die Hofmeisterin wird in die Hölle kommen! Wahrscheinlich steht der Teufel schon vor der Tür! Schnell die Zugbrücke hochgezogen! Alles hört auf mein Kommando!“ Dies veranlasste Carlotta, eine kleine Königsspanieldame, aus ihrem Körbchen aufzuschrecken und laut bellend der Närrin zu folgen, während die beiden Kater Paul und Karl sich hinter der nächsten Truhe in Sicherheit brachten.
Als Margarete von der Saale erbleichend um das Schicksal ihrer Mutter fürchtete, schüttelte Gertrud den Kopf und machte dabei ein Gesicht, das eindeutig besagte, dass man mit dem Leibhaftigen so bald nicht zu rechnen habe und spielte weiter auf der Laute.
Indessen war die Närrin in der herzoglichen Schreibstube angekommen, wo Elisabeth am geöffneten Fenster saß und gerade ihren Brief versiegelte. „Was? Närrin, was redest du da?“ Herzogin Elisabeth wandte sich zu ihrer Närrin um, die vollkommen aufgelöst in der Schreibstube stand.
„Aaahhh, da kommt er schon, der Leibhaftige, hoch zu Ross auf einem schwarzen Hengst!“ rief die Närrin, als sie einen Blick aus dem geöffneten Fenster warf, das einen weiten Ausblick über das Tal, die Zugbrücke und den Schlossweg bot, doch dann fasste sie sich, legte der Hofmeisterin, die keuchend ihre matronenhafte Statur die Treppe heraufgewuchtet hatte, eine Hand auf die Schulter und sagte ganz ernst: „Werte Frau Hofmeisterin, es war mir immer eine besondere Ehre, Euch... beinahe zum Lachen zu bringen!“
„Närrin, das ist nicht der Leibhaftige, sondern der Bote des Herzogs von Sachsen. Jetzt schweig bitte für einen Augenblick und lass mich einen klaren Gedanken fassen.“
„Ach, tatsächlich? Ein Bote des Herzogs? Und ich hab mich schon gewundert, warum der Leibhaftige ein Wams mit dem herzoglichen Wappen trägt.“
Es dauerte nicht lange und Elisabeth saß wieder in Ruhe mit dem Brief in ihrer Schreibstube. Carlotta hatte sich auch wieder beruhigt und lag auf ihrem Kissen unter Elisabeths Schreibtisch. Die Schale mit Himbeeren, die Gertrud für Elisabeth hingestellt hatte, war noch unberührt. Herzog Georgs Bote hatte seinen Auftrag erfüllt und durfte sich in der Küche stärken; Närrin und Hofmeisterin hatten wieder einmal einen sehr fragilen Frieden geschlossen, und Gertrud saß still bei ihrer Herrin, die leise murmelnd den Brief des Herzogs überflog, wobei sie ab und an missbilligend mit der Zunge schnalzte.
„Was schreibt er denn?“ fragte Gertrud, als Elisabeth leise knurrte.
„Der Brief fängt recht harmlos an. Da gibt er mir noch Ratschläge, dass ich die Forellen, die die Bauern für mich fangen, jemandem geben soll, der sich aufs Braten versteht, damit die Bauern sie nicht verderben.
Dann bedankt er sich für mein Mitgefühl bezüglich seiner Krankheiten. Er hat die Arzneien aber nicht genommen, weil er schon krank ist, sondern zur Vorbeugung. Da schreibt er: Diese Praktiken sollen mir ein langes Leben tun. Ich will mit Gottes Willen damit verfahren, wie es mir die Gevatterin Herzogin Katharina tut. Je mehr ich hoffe, dass sie stirbt, desto länger lebt sie. Denn ich achte mich und meinesgleichen nicht so sehr verdient um Gott, dass ER immer tue, was wir gerne sehen. Die mich bei lebendem Leibe beerben wollen, die verlängern mir nur mein Leben, so lange es Gott gefällt.
Das ist wohl ein Wink mit dem Zaunpfahl. Mir gegenüber hat er freundliche Worte gewählt, aber ich habe den Eindruck, die Tinte ist vergiftet. Ich mag meine Tante Kathrine zwar auch nicht besonders, aber den Tod würde ich ihr denn doch nicht wünschen. Sie ist lutherisch - da kennt sein Hass kein Maß. Und da er genau weiß, dass ich auch lutherisch bin und hier die Reformation einführen will, wird er mir wohl mindestens die Pest an den Hals wünschen. Aber jetzt pass auf, jetzt schreibt er über die Verzeichnisse, die ich ihn gebeten habe, mir zu schicken: Wenn ich Euer Lieben die Verzeichnisse, in denen all Eure Wittumsgüter aufgelistet sind, zuschickte, würde ich Euer Lieben nur damit unnötig belasten, denn wenn Euer Lieben nicht einen gründlichen, mündlichen Bericht dazu hat, der Euer Lieben alles erklärt, so könnten Euer Lieben doch rein gar nichts damit anfangen. Wenn aber Euer Bruder, mein freundlicher, lieber Sohn, einen Bericht davon haben will, so will ich ihm gerne einen schicken, der ihm von allem einen Bericht geben soll.
Wieso spricht er mich überhaupt noch mit Euer Lieben an? Da kann er doch gleich Euer Hasilein schreiben. Als könnte ich nicht lesen! Und mein Bruder ist wohl kaum sein freundlicher, lieber Sohn, denn er ist nicht nur lutherisch, sondern hat mit der martinischen Pest, wie mein lieber Herr Schwiegervater die Reformation zu nennen beliebt, mich und seine Gemahlin Christine angesteckt. Und sie war immer die Lieblingstochter des alten Herzogs, wie er mir mehrfach versichert hat, daher hat ihn das wahrscheinlich besonders schwer angegangen.
In meinem letzten Brief habe ich gewagt, Zweifel anzumelden, ob die Idee, Herzog Friedrich, - der zwar ein sehr lieber, netter Kerl ist, und der ganz passabel erscheint, solange er nur den Mund hält, wie mein Herr Schwiegervater selbst zugegeben hat, - nun, ob es eine gute Idee ist, diesen Friedrich zum Regenten zu küren.“
„Was? Friedrich den Blöden?“ Gertrud war fassungslos.
„Das ist zwar nicht freundlich, aber leider die Wahrheit. Dazu schreibt der alte Herzog jetzt...“ Sie überflog die Zeilen murmelnd und sagte dann laut: „Ach, ich fasse diesen ganzen Sermon zusammen, denn seine gedrechselten Sätze sind unerträglich. Er wundert sich doch tatsächlich, dass man unwirsch geworden ist darüber, dass er seinen eigenen Sohn als seinen Nachfolger vorgeschlagen hat. Das will er vor Gott und der Welt verantworten. Wenn die Landschaft und die Vertreter der Stände schon einen neuen Herrn zu wählen hätten, dann könnten sie auch seinen Sohn wählen. Ihm hat er zehn Regenten von der Landschaft und den Ständen zugeordnet.“
Elisabeth schaute auf. „Ich denke, diese zehn Mitregenten würden alles schön unter sich aufteilen. Friedrich hat keinerlei Autorität. Was stellt der Alte sich vor? Dass diese Mitregenten lauter selbstlose Menschen sind, die ausschließlich das Wohl Sachsens und Friedrichs im Blick haben? Aber dazu schreibt Herzog Georg:
Denn ich hab zu meiner Zeit mehr Könige und Fürsten von Land und Leuten sehen kommen, die nach ihrem Haupt regiert haben, als die, die mit dem Rat ihrer getreuen Untertanen regiert haben.
Wenn ich keinen Sohn gehabt hätte und ich gewusst hätte, dass den Leuten der Luther sehr am Herzen liegt, so hätte es mir leid getan, da ich mein Land und meine Leute, die mir treu geblieben sind, niemandem lieber gönne als dem, der der christlichen Kirche und der Kaiserlichen Majestät treu geblieben ist. Sollte es anders geschehen, täte es mir sehr leid.
„Was für ein Blödsinn, von der christlichen Kirche zu reden, wenn er ausschließlich die katholische Kirche meint; als wären wir Protestanten Heiden.“
Wenn Euer Lieben Hauptmann zu mir kommt, so will ich ihn gerne anhören. Er wird mich vor Johannis noch hier in Dresden antreffen. All dies wollte ich Euer Lieben nicht vorenthalten, denn ich bin Euer Lieben in väterlichem Willen zugeneigt.
Gegeben eilends am Donnerstag, den 14. Juni 1537.
Euer Lieben Brief habe ich vertilgt.5
Mich dauert niemand mehr als mein Bruder Heinrich und seine Kinder, die man zu ihrem besten wohl auf andere Wege geführt hätte.6
„Den letzten Satz konnte er sich nicht verkneifen. Das kann er einfach nicht verwinden, dass sein eigener Bruder auf lutherischen Pfaden wandelt.“
„Hoffentlich hört er wenigstens den Hauptmann gnädig an, denn Eure Bitten werden ihm sicher nicht behagen - schließlich sind sie mit Geld verbunden“, sagte Gertrud und schob sich noch eine Himbeere in den Mund.
„Aber die Tür der Küche und die Tür zu der Wendeltreppe im Hof waren vollkommen baufällig - da hätte jeder hereinkommen können. Mein Schloss muss doch in einem guten Zustand sein! Außerdem müssen hier und dort die Dächer ausgebessert werden. Auf den ersten Blick haben wir das gar nicht gesehen, als wir eingezogen sind, aber nun, bei genauerem Hinsehen fällt es auf, dass einige Jahre nichts getan wurde. Ausgerechnet ein so schludriger Amtmann wie dieser Ernst von Spohr war für mein Wittum zuständig! Ich darf gar nicht darüber nachdenken, was dieser Mann mir alles veruntreut hat. Er soll mir nicht noch einmal in die Finger fallen!“7
Gertrud hielt ihrer Herrin die Schale mit den Himbeeren hin, doch Elisabeth nahm sie gar nicht wahr.
„Ich will, dass Rochlitz aufblüht. Ich will, dass noch viel mehr Hofdamen an meinen Hof kommen, ich will Feste feiern, zu denen ich den Kurfürsten und meinen Bruder einlade. Turniere sollen auf dem Marktplatz abgehalten werden und wir wollen tanzen. - Und ganz nebenbei will ich auch noch die Reformation einführen“, fügte sie scherzhaft hinzu und nahm sich jetzt doch eine Himbeere.
„Ich habe Herzog Georg schon um neue Prediger gebeten. Auf diesem Ohr ist er taub, aber wenn ich diese Sache selbst in die Hand nehme und eigenhändig Prediger einstelle, werden sie ihm nicht recht sein. Immerhin hat mir mein Bruder schon unseren Prediger Johann Schütz aus Kassel geschickt. Er soll bald das Evangelium in der Stadtkirche predigen.“
„Und was machen wir mit unserem guten alten Pfarrer Georg Thierbach? Freiwillig wird er seine Kanzel nicht hergeben für einen Grünschnabel, der die martinische Pest in Rochlitz verbreiten will.“
„Herzog Georg könnte das nicht besser gesagt haben, Gertrud. Ich denke, wir werden Pfarrer Thierbach nach seiner etwa zweihundertjährigen Amtszeit in einen wohlverdienten, ruhigen, bequemen Lebensabend schicken können.“
„Was ist mit Doctor Luther selbst? Er wäre sicher gerne bereit, Euch zu unterstützen.“
„Das mag sein, aber erstens will ich Herzog Georg nicht brüskieren, denn gerade ihm hat Luther in vielen Schriften zugesetzt. Außerdem ist Doctor Luther auch nur ein Mensch und nicht Gott. Wenn er wie ein Evangelist schreibt, lob ich ihn, aber wo er schilt wie ein altes Weib, halte ich nichts von ihm.“8
So geschah es denn, dass der hessische Prediger Johann Schütz am elften September Anno 1537 zum ersten Mal öffentlich in der Petrikirche das Evangelium predigte. Dies ging reibungslos und mit der gebührenden Feierlichkeit vonstatten. Fortan mussten die Rochlitzer Lutheraner nicht mehr ins kursächsische Colditz pilgern, das immerhin drei Wegestunden zu Fuß entfernt war, sondern konnten in ihrer Rochlitzer Petrikirche die lutherische Predigt hören.
Für Elisabeth war es eine innige Freude, endlich die Predigt in deutscher Sprache zu hören und danach das Abendmahl in beiderlei Gestalt zu empfangen - ohne Angst, entdeckt und bestraft zu werden. Zum ersten Mal fühlte sie sich tatsächlich eins mit Jesus, als säße sie an seiner Tafel wie eine geliebte Schwester und nicht wie ein Stiefkind, dem man die besten Dinge vorenthält.
Es war in etwa zu dieser Zeit, dass hier und dort im Schloss einige bauliche Arbeiten verrichtet wurden. So wurde auch die Amtsstube mit einem neuen Putz versehen. Meister Alfons, ein guter Handwerker aus Rochlitz, hatte sich sehr geehrt gefühlt, als die Herzogin ihm diesen Auftrag erteilt hatte. Nun hatte sich der Meister mitsamt seinem Gesellen Hans ins Schloss verfügt, hatte sämtliche Materialien und Arbeitswerkzeuge mitgeführt, ausgebreitet und war höchst selbst dabei, feine Wandmalereien nachzumalen, die mit der Zeit verblasst waren. Seinen Gesellen hatte er derweil beauftragt, den Putz in der Amtsstube zu erneuern.
„Meister, ich glaube, ich habe die Kelle vergessen!“ rief Hans ins Nebenzimmer. Meister Alfons knurrte einen Fluch. Wieso hatte er diesen Kerl überhaupt als Gesellen behalten? Er war der Patensohn seiner Frau, und diese hatte so viele gute Worte für ihn eingelegt, dass er nicht anders gekonnt hatte. Seine Mutter war zur allgemeinen Belustigung so überaus stolz auf ihren Sohn, dass sie immer wieder ihrer Verwunderung über seine Kenntnisse und Fertigkeiten Ausdruck verlieh.
„Ich muss mich wundern über meinen gescheiten Hans!“ konnte sie morgens beim Bäcker sagen und abends beim Fleischer. Meister Alfons konnte darüber nur stöhnen. Er hielt den Jungen für ebenso faul wie dumm und war überzeugt, dass er sich Schätze im Himmel hortete, da er diesen Tölpel täglich ertrug.
„Die Kelle ist in dem anderen Eimer“, erwiderte er. „Ich habe sie natürlich mitgenommen.“
Im Laufe der nächsten viertel Stunde fehlten noch mancherlei Dinge, bis Meister Alfons richtig wütend wurde. Er ballte die Faust und hätte den Kerl am liebsten geohrfeigt, doch beherrschte er sich. Seine Frau würde ihn tagelang schelten, wenn er ihrem Liebling zu nahe trat. Endlich hatte Hans alles beisammen, was er brauchte und machte sich an die Arbeit. Meister Alfons hörte das gleichmäßige Streichen der Kelle auf dem Putz. Gerade, als er erleichtert aufatmen wollte, setzte das Streichen aus. Der Meister ahnte Schlimmes. Und tatsächlich, nach einigen Augenblicken ertönte wieder ein „Meister!“ aus der Amtsstube. Der Meister betete um Fassung. Was mochte denn jetzt schon wieder sein?
„Meister, kommt und seht, das müsst Ihr Euch anschauen!“ Hans klang aufgeregt, als habe er etwas Außergewöhnliches entdeckt. „Meister, wirklich, das müsst Ihr gesehen haben!“
„Hier sind Bilder. Die kann ich doch nicht überputzen. Vielleicht sind sie wichtig und wertvoll? Da war ein Künstler am Werk!“
Meister Alfons seufzte. Er konnte sich nicht erinnern, in der Amtsstube die Werke eines Künstlers gesehen zu haben, es sei denn, Hans putzte oben an der Wand, wo tatsächlich Wandmalereien den ganzen Raum umsäumten.
Na warte, wenn er diese Malereien ruinierte...
„Wo?“ fragte der Meister nur sehr kurz und ungehalten, als Hans in einem der Fenster stand und aufgeregt auf eine völlig weiße Wand zeigte.
„Hier, Meister! Wenn Ihr Euch so stellt, dass das Licht schräg auf die Wand fällt, könnt Ihr sehen, dass jemand Figuren in den Putz geritzt hat. Hier sind Häuser und Zelte, Ritter beim Turnier und sogar ein nackter König.“
Meister Alfons schaute, kniff die Augen zusammen und schaute wieder, dann sah er tatsächlich die Kritzeleien, die jemand mit einem kleinen Holzstöckchen in den Putz geritzt haben musste. Zweifellos ein Kind, denn die Zeichnungen entbehrten nach Ansicht des Meisters jeglichen künstlerischen Wertes. Lächerliche Strichmännchen mit dürren Beinen und ein Ritter mit einem Geweih auf dem Helm. Ein Turm, eine Kanone, ein Fachwerkhaus, das nicht vollendet war, ein vollkommen verkorkstes Pferd und dergleichen Unsinn mehr.
Als der Blick des Meisters bei dem nackten König angekommen war, platzte ihm endgültig der Kragen: Hans bekam seine Ohrfeige.
„Bilder! Ja!“ schrie ihn der Meister an. „Du glaubst doch nicht im Ernst, dass sich für diese Kritzeleien wirklich jemand interessiert. Da waren Kinder am Werk oder Narren wie du!“
„Aber wer weiß denn schon, wie die Menschen in vielen Jahren über diese Bilder denken!“ greinte Hans und rieb sich seine Wange.
„Wie viel hundert Jahre sollen denn vergehen, bis es Menschen gibt, die sich für das Gekritzel interessieren? Wer weiß schon, ob das Schloss in fünfhundert Jahren noch steht. Und selbst wenn es dann noch steht, wird wahrscheinlich der Putz von den Wänden gebröckelt sein, weil es durch die Dächer regnet. Aber wir werden jetzt unsere Arbeit ordentlich machen und diesen Unfug überputzen!“ Und leise fügte er hinzu: „Ein nackter König! Lass das bloß niemanden sehen, sonst sehen wir nie mehr Tageslicht. Ich glaube, von allen Zeichnungen ist diese die schlimmste. Aufruhr könnte man dem Schmierfink unterstellen. Ich möchte gar nicht wissen, welcher Galgenvogel hier am Werk war. Das wird niemand lustig finden. Niemals! Und den nackten König, den putzt du zu aller erst zu!“9
Ende Oktober kam ein Brief von Herzog Moritz aus Torgau, den Gertrud ihrer Herrin in die Schreibstube brachte. Der Ofen war schon früh angefeuert worden und füllt die Stube mit behaglicher Wärme, während der Wind draußen an den Bäumen zerrte. Das Wasser der Mulde schimmerte tiefschwarz unter dem grauen Himmel.
Euer Lieben,
seit vier Monaten bin ich nun schon in Torgau und fühle mich doch recht wohl. Mein Hofmeister hier ist der Erbmarschall Hans Löser; außer mir unterrichtet er noch Herzog Johann Ernst, den Stiefbruder des Kurfürsten, Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg und Wolfgang II., Graf von Barby. Mit allen verstehe ich mich sehr gut. Der Erbmarschall ist zwar schon recht alt, aber wir Jungen haben großen Respekt vor ihm, weil er einerseits sehr streng, andererseits aber auch sehr gut zu uns ist. Manchmal lachen wir sogar miteinander.
Der Kurfürst selbst kümmert sich wenig um uns. Nicht einmal an der Tafel haben wir Gelegenheit, mit ihm zu sprechen, denn wir sitzen alle sehr weit weg von ihm.
„Aber wie kann der Kurfürst ausgerechnet Herzog Moritz so gering achten, dass er ihn ganz unten an die Tafel setzt?“ rief Elisabeth ärgerlich.
„Da will er ihm wohl klarmachen, dass er gar nicht auf den sächsischen Thron zu spekulieren braucht“, sagte Gertrud, was Elisabeth keineswegs besänftigte.
„Ich kenne doch meinen Moritz! Sicher geht er zu jeder Mahlzeit zähneknirschend. Natürlich sieht er sich als Thronfolger im Herzogtum Sachsen, denn schließlich ist Herzog Georg 66 Jahre alt und Herzog Heinrich zählt ganze 64 Jahre. Es ist doch eine Frage der Zeit, wann Moritz die Regierung antritt. Glaubt der Kurfürst denn wirklich, er könnte Moritz so klein halten, dass er seinen Einfluss auf sein Gebiet ausdehnen könnte? Er soll mir meinen Moritz nicht unterschätzen!“
Elisabeths Tonfall und Miene gaben Gertrud einen Stich. Aus Elisabeth sprach eindeutig Mutterstolz. In ihrer gemeinsamen Dresdener Zeit hatte sich zwischen den beiden ein enges Vertauensverhältnis entwickelt. Elisabeth liebte den Jungen wie einen Sohn und verfolgte seine Laufbahn mit dem Interesse und dem Stolz einer Mutter. Der kindliche Brief des Jungen zeigte, dass er in ihr auch wesentlich mehr sah als eine wesentlich ältere Cousine. Offensichtlich fand er bei Elisabeth die Liebe und Anerkennung, die er bei seiner Mutter so schmerzlich vermisste.
„Was schreibt er denn außerdem?“ fragte Gertrud.
Das Schloss ist noch immer eine große Baustelle.
„Du liebe Güte! Wird das denn jemals fertig?“