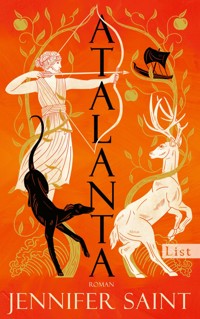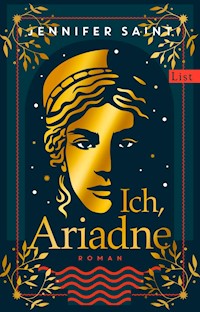10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Griechische Mythologie feministisch erzählt Sehnsüchtig wartet Elektra, Prinzessin von Mykene, auf die Rückkehr ihres Vaters Agamemnon. Nur von ihm hat sie Zuneigung erfahren. Seit er in den trojanischen Krieg zog, leidet sie unter ihrer Mutter, Klytaimnestra. Die liebte ihren Mann, bis er für sein Kriegsglück ihre älteste Tochter Iphigenie opferte. Bei seiner Rückkehr bringt Agamemnon als Beute die Priesterin Kassandra mit. Sie kann vorhersehen, welche Tragödie den Mykenern bevorsteht, aber niemand glaubt ihr. Die Schicksale der drei Frauen – Elektra, Klytaimnestra, Kassandra – sind durch die Launen der Götter und die Untaten der Männer unentrinnbar verbunden. Elektra jedoch beginnt, sich aufzulehnen und ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Auf dem Weg zur Selbstbestimmung muss sie die Götter herausfordern. »Erzählt auf brillante Weise die starken Emotionen und die Komplexität der Frauen« Leipziger Volkszeitung »Ebenbürtig mit Madeline Millers Romanen.« Waterstones.com
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Elektra, die hell Leuchtende
Die Autorin
JENNIFER SAINT begeisterte sich schon als Kind für die griechische Mythologie. Während ihres Studiums der Altphilologie am King‘s College in London hat sie ihre Liebe zu den antiken Sagen vertieft. Als Englischlehrerin versucht sie die Faszination für Geschichten aller Art und die reiche Erzähltradition seit Homer zu vermitteln. Jeder Erzähler hat die antiken Stoffe für sich neu interpretiert. Jennifer Saint stellt die weibliche Heldin in den Mittelpunkt. Mit ihrem Debütroman Ich, Ariadne gelang ihr der Durchbruch, auch ihr neuer Roman Elektra, die hell Leuchtende war in England ein großer Bestseller.
Das Buch
Sehnsüchtig wartet Elektra, Prinzessin von Mykene, auf die Rückkehr ihres Vaters Agamemnon. Nur von ihm hat sie Zuneigung erfahren. Seit er in den trojanischen Krieg zog, leidet sie unter ihrer lieblosen Mutter, Klytämnestra.Die hat Agamemnon Rache geschworen. Als junge Frau liebte sie ihren Mann abgöttisch, bis er für sein Kriegsglück die älteste Tochter Iphigenie opferte. Agamemnon bringt aus Troja die Priesterin Kassandra mit nach Mykene. Sie ist Apoll geweiht und kann die Zukunft vorhersehen. Sie weiß, welche Tragödie ihnen allen bevorsteht. Aber niemand glaubt ihr.
Die Schicksale der drei Frauen – Elektra, Klytämnestra, Kassandra – sind durch die Launen der Götter und die Untaten der Männer unentrinnbar miteinander verbunden. Elektra jedoch beginnt, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.Auf dem Weg zur Selbst bestimmung muss sie die Götter herausfordern.
Jennifer Saint
Elektra, die hell Leuchtende
Roman
Aus dem Englischen von Simone Jakob
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel Elektra bei Wildfire, Headline Publishing Group Ltd., London
Das Zitat von Sophokles ist aus:Elektra, übersetzt von Kurt Steinmann, Reclams Universal-Bibliothek, Ditzingen, 2021.© 2022 by Jennifer Saint© der deutschsprachigen Ausgabe2022 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinAlle Rechte vorbehaltenUmschlagabbildungen: © Shutterstock / Dalhazz (Kopf), © Shutterstock / Svetolk (Blätter), © Shutterstock / Isaac Zakar (Rahmen)Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, MünchenAutorenfoto: © Katie ByramE-Book Konvertierung powered by pepyrus
ISBN: 978-3-8437-2810-2
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Teil 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Teil 2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Teil 3
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Teil 4
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Epilog
Anhang
Danksagung
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Widmung
Für Alex
Motto
Ich weiß es wohl, nicht ist mir verborgen mein hitziges Wesen … Doch nie, ja nie, lass ich ab von Totenklagen und düsteren Trauerweisen, solang ich das hell erstrahlende Funkeln der Sterne sehe … Denn wenn der Tote, Erde bloß, ein Nichts, erbärmlich liegen soll, sie hingegen nicht, ihrerseits ermordet, büßen, dann wäre aus es mit dem menschlichen Respekt und der Ehrfurcht unter allen Sterblichen.
Elektra von Sophokles
Prolog
Elektra
Es ist still in Mykene, und doch kann ich heute Nacht nicht schlafen. Ich weiß, dass mein Bruder in seiner Kammer den Flur hinunter sein Laken von sich gestrampelt hat. Jeden Morgen, wenn ich ihn wecke, hat es sich wild um seine Beine gewickelt, als wäre er im Schlaf gerannt. Vielleicht verfolgt er unseren Vater, einen Mann, den er nie kennengelernt hat.
Als ich geboren wurde, gab mein Vater mir meinen Namen. Er benannte mich nach der Sonne: die hell Leuchtende. So hatte er es mir erklärt, als ich noch klein war – ich sei das Licht unserer Familie. »Die Schönheit deiner Tante ist legendär, aber du überstrahlst sie schon jetzt. Du wirst dem Haus der Atriden noch mehr Ehre einbringen, meine Tochter.« Und dann hob er mich hoch, küsste mich auf die Stirn und setzte mich wieder auf den Boden ab. Es störte mich nicht, dass sein Bart mich kitzelte. Ich glaubte ihm jedes Wort.
Es kümmert mich nicht, dass, anders als bei Helena, keine Freier im Thronsaal um meine Hand buhlen. Ich hatte die Geschichten über sie gehört und beneidete sie nicht. Man brauchte sich nur anzuschauen, wohin ihre Schönheit sie geführt hatte. Den weiten Weg in eine fremde Stadt, die unsere Männer seit zehn Jahren in ihrem Bann hält. Zehn Jahre, in denen ich ohne meinen Vater leben musste, in denen wir uns an jeden Sieg klammerten, von dem uns durch Mykene reisende Boten berichteten. Die Nachricht jedes einzelnen Triumphes macht mich stolz und froh, dass Agamemnon mein Vater ist – Agamemnon, der so lange gekämpft hat und der seine Männer unermüdlich anspornt weiterzukämpfen, bis Trojas mächtige Mauern unter ihren erobernden Füßen in Schutt und Asche zerfallen sind.
Ich sehe oft vor meinem inneren Auge, wie er die Tore der Stadt erstürmt; wie sie sich ihm endlich ergeben, vor ihm niederwerfen. Dann wird er nach Hause kommen, zu mir zurückkehren. Zu mir, seiner ergebenen Tochter, die hier jahrein, jahraus ausgeharrt, auf ihn gewartet hat.
Ich weiß, manche werden behaupten, er hätte seine Kinder nie geliebt, hätte sie – in Anbetracht der Dinge, die er getan hatte – nicht lieben können. Aber ich erinnere mich an das Gefühl, wenn er mich in seinen Armen hielt und ich seinen gleichmäßigen Herzschlag hörte, dann gab es für mich keinen sichereren Ort auf dieser Welt.
Ich habe mir immer gewünscht, zu der Frau heranzuwachsen, die er vor seinem inneren Auge gesehen hat, der Frau, die ich hätte sein können, hätte er nur bleiben können. Um dem Namen gerecht zu werden, den er mir gab.
Mehr als alles andere wünsche ich mir, ihn mit Stolz zu erfüllen.
Zweifellos streift meine Mutter heute Nacht wieder rastlos durch den Palast und starrt in die dunkle Ferne. Sie bewegt sich fast lautlos, ihre zarten Füße in zierlichen Sandalen, ihr Haar mit scharlachroten Bändern zurückgebunden, nach zerstoßenen Blütenblättern und parfümiertem Öl duftend, schimmert ihre glänzende Haut im Mondlicht. Um ihr nicht über den Weg zu laufen, bleibe ich in meiner Kammer. Ich erhebe mich und gehe zu dem schmalen, in das Gestein gehauenen Fenster, stütze die Ellbogen auf das Sims und beuge mich vor. Ich erwarte nichts zu sehen als ein paar vereinzelte Sterne. Doch als ich hinausspähe, sehe ich auf einem fernen Berggipfel ein Leuchtfeuer aufgehen, dann noch eins und noch eins – eine Feuerkette, die auf Mykene zuläuft. Das Herz hämmert in meiner Brust. Irgendjemand dort draußen schickt uns ein Zeichen. Und es gibt nur eine Botschaft, auf die wir alle warten.
Orangefarbene Funken stieben spiralförmig zum Himmel auf, als ein weiteres Feuer aufleuchtet, noch näher als das letzte. Tränen treten in meine Augen. Während ich ungläubig hinausblicke, spüre ich, wie auch in meinem Inneren ein Funke entflammt, als ich begreife, was das bedeutet.
Troja ist gefallen.
Mein Vater kommt nach Hause.
Teil 1
1
Klytämnestra
Auf dem Haus der Atriden liegt ein Fluch. Und zwar ein besonders grausamer, selbst an den Maßstäben göttlicher Torturen gemessen. Die Familiengeschichte strotzt nur so von brutalen Morden, Ehebruch, monströsem Ehrgeiz und mehr Kannibalismus, als man erwarten würde. Jeder wusste es, doch als die Atriden Agamemnon und Menelaos vor einer halben Ewigkeit in Sparta vor mir und meiner Zwillingsschwester standen, schienen sich die albernen Ammenmärchen, die man uns aufgetischt hatte, zu zerstreuen wie im Sonnenlicht aufglimmende Staubkörner.
Die beiden Brüder strotzten nur so vor Lebenskraft und Elan – sie waren zwar nicht unbedingt gut aussehend, aber auf ihre Art unwiderstehlich. Menelaos’ Bart hatte einen rötlichen Schimmer, während Agamemnons dunkel war wie die dichten Locken auf seinem Kopf. Weit attraktivere Verehrer warben um meine Schwester – tatsächlich barst die große Halle fast vor Männern mit hohen, wie gemeißelten Wangenknochen, feinen Schultern, vorstehenden Kieferknochen und blitzenden Augen. Helena konnte zwischen den besten Männern Griechenlands wählen, doch sie hatte nur Augen für den ungelenken Menelaos, der nicht wusste wohin mit seinem mächtigen Körper und sie nur stumm anstarrte.
Es hieß, Helena sei die Tochter von Zeus. Während ich angesichts der Gewöhnlichkeit und Würdelosigkeit der Geburt schreiend und mit hochrotem Kopf zur Welt kam, war meine Schwester wunderschön und vollkommen aus einem makellosen weißen Ei geschlüpft. Die Legende wurde mit fantastischen Details ausgeschmückt – so war bekannt, dass Zeus viele Gestalten annehmen konnte, und unserer Mutter soll er sich im schneeweißen Federkleid genähert haben und mit unmissverständlicher Zielstrebigkeit über den Fluss auf sie zu geschwommen sein.
So von Zeus gesegnet zu werden war eine Ehre. Das sagten alle. Wenn Leda, unsere Mutter, vom Herrscher der Götter als so liebreizend angesehen wurde, war das eine große Auszeichnung für unsere Familie. Für unseren Vater war es keine Schande, den Spross einer solchen Verbindung großzuziehen.
Und Helenas Schönheit war in der Tat legendär.
Ihre Verehrer kamen in Scharen. Und wie sie einander anrempelten, um sich vorzudrängen und ihren flatternden Schleier zu beäugen, begierig, einen Blick auf die Frau darunter zu werfen, die als die schönste der Welt galt. Doch irgendwann schlug die Stimmung um, wurde gereizt, angespannt; mir fiel auf, wie sie die Hände nach den Schwertern an ihren Hüften ausstreckten. Auch Helena bemerkte es, und wir warfen uns einen flüchtigen, besorgten Blick zu.
Am Rand der Halle strafften unsere Wachen die Schultern und umklammerten ihre Speere fester. Ich fragte mich, wie schnell die brodelnde Menge uns erreichen würde und wie lange unsere Männer brauchen würden, um sich einen Weg durch den Tumult zu bahnen.
Unser Vater Tyndareos rang die Hände. Der Tag hatte so vielversprechend begonnen; unsere Lagerräume quollen über von prächtigen Geschenken, die die jungen Männer mitgebracht hatten, um ihre Brautwerbung zu unterstützen. Ich hatte gesehen, wie er sich mit den kostbaren Gaben und dem Zugewinn an Status, den ihm dieser Tag einbrachte, gebrüstet hatte. Unbekümmert hatte er all sein Vertrauen in die Fähigkeiten unserer starken Brüder gesetzt, uns zu beschützen, so wie sie es immer getan hatten, aber ich bezweifelte, dass sie genug gegen all die Männer ausrichten konnten, die gekommen waren, um meine Schwester für sich zu gewinnen.
Ich schaute zu Penelope hinüber. Bei unserer stillen, grauäugigen Cousine konnte man sicher sein, dass sie einen kühlen Kopf bewahren würde. Doch Penelope bemerkte meinen panischen Blick nicht, denn sie hatte nur Augen für Odysseus. Die beiden sahen sich an, als würden sie allein über eine duftende Blumenwiese spazieren, statt mit hundert Freiern, deren Temperament mit ihnen durchzugehen drohte, in einer Halle eingesperrt zu sein, in der schon ein Funke genügt hätte, um alles in Flammen aufgehen zu lassen.
Ich verdrehte die Augen. Odysseus war ebenso wie die anderen als Verehrer Helenas gekommen, aber natürlich war nichts, was er tat, das, was es zu sein schien. Wir könnten seine viel gerühmte Klugheit in dieser Situation wirklich gut gebrauchen, dachte ich, frustriert darüber, dass er es stattdessen anscheinend vorzog, sich in romantischen Tagträumen zu verlieren.
Doch was ich für einen verliebten Blickwechsel zwischen meiner Cousine und ihrem Angebeteten gehalten hatte, war in Wirklichkeit das wortlose Ausklügeln eines Plans, denn kurz darauf sprang Odysseus auf das Podest, auf dem wir saßen, und verlangte nach Ruhe. Obwohl er klein und krummbeinig war, besaß er eine natürliche Autorität, und alle im Saal verstummten.
»Bevor die edle Helena ihre Wahl trifft«, rief er mit weithin hörbarerer Stimme, »sollten wir alle einen Eid schwören.«
Sie hörten ihm zu. Er besaß die Gabe, andere seinem Willen zu unterwerfen. Selbst meine kluge Cousine war von ihm bezaubert; ich hätte nie gedacht, dass der Intellekt eines Mannes dem ihren ebenbürtig sein könnte.
»Wir alle sind heute mit demselben Ziel hier«, fuhr er fort. »Wir alle wünschen, die schöne Helena zur Frau zu nehmen, und wir alle haben gute Gründe zu glauben, dass wir ihr ein würdiger Ehemann wären. Sie ist ein Schatz, der jegliche Vorstellungskraft übersteigt, und der Mann, der sie sein Eigen nennen darf, wird große Anstrengungen unternehmen müssen, um sie vor jenen zu beschützen, die sie ihm wieder wegnehmen wollen.«
Ich konnte sehen, wie sich das jeder einzelne Mann ausmalte. Sie alle hatten geglaubt, derjenige zu sein, der sie für sich gewinnen würde, doch Odysseus hatte ihnen den Traum vergällt. Sie blickten ihn wie gebannt an, warteten darauf, dass er ihnen die Lösung des Problems enthüllte.
»Deshalb schlage ich vor, wir alle schwören, jenen Mann, den sie erwählt – wer immer es auch sein mag –, gemeinsam zu beschützen. Wir legen einen feierlichen Eid ab, dass wir sein Recht, sie zu bekommen – und zu behalten –, mit unserem Leben verteidigen.«
Unser Vater sprang auf, außer sich vor Freude, dass Odysseus seinen Tag des Triumphes vor der sicheren Katastrophe gerettet hatte. »Und ich opfere mein schönstes Pferd!«, erklärte er. »Und Ihr alle sollt es mir vor den Göttern auf sein Blut schwören.«
So geschah es, dass mein Vater an jenem Tag nur ein Pferd verlor. Nun ja, ein Pferd und eine Tochter, sollte ich sagen, und natürlich eine Nichte, aber es war ein durchaus vorteilhaftes Arrangement. Alle drei wurden ihm auf einen Schlag genommen, denn Helena hatte kaum den Namen »Menelaos« gehaucht, als er schon bei ihr war, ihre Hand nahm und seine Dankbarkeit und Hingabe herausstammelte; im nächsten Atemzug wurde Penelope Odysseus angeboten – doch ich konnte den Blick nicht von dem dunkelhaarigen Bruder wenden, der grüblerisch die Steinfliesen anstarrte. Agamemnon.
»Wieso hast du dich für Menelaos entschieden?«, fragte ich Helena später. Ein Schwarm von Dienerinnen umschwirrte sie, drapierte ihr Gewand, formte ihr Haar zu kunstvollen Locken und schmückte sie mit allem möglichen Tand, der gänzlich überflüssig war.
Helena dachte über meine Frage nach, ehe sie antwortete. Die Menschen sprachen immer nur von ihrer strahlenden Schönheit, fühlten sich manchmal sogar dazu inspiriert, sie in Gedichten oder Liedern zu preisen. Doch niemand erwähnte je, dass sie auch nachdenklich und freundlich war. Ich konnte den einen oder anderen Anflug von Neid nicht leugnen, der sich manchmal kalt und giftig in mir erhob, als ich mit einer Zwillingsschwester heranwuchs, deren Liebreiz mich immer in den Schatten stellen würde. Aber Helena war nie grausam zu mir und schikanierte mich nicht. Sie prahlte noch nicht einmal mit ihrer Schönheit oder machte sich über ihre unterlegene Schwester lustig. Ebenso wenig wie sie die Gezeiten lenken konnte, hatte sie Einfluss darauf, dass sich, wohin sie auch ging, alle nach ihr umdrehten. Ich hatte meinen Frieden damit gemacht, und um ehrlich zu sein, sehnte ich mich nicht danach, die Bürde ihrer legendären Reize zu tragen.
»Menelaos …«, sagte Helena nachdenklich, nahm sich Zeit, um jede einzelne Silbe seines Namens auszusprechen. Sie zuckte die Schultern, wickelte sich eine ihrer glatten Haarsträhnen um den Finger, sichtlich zum Missfallen einer ihrer Dienerinnen, deren hektische Bemühungen nicht annähernd die gleichen glänzenden, schwungvollen Locken hervorbrachten wie Helenas müheloses Geschick. »Die anderen sahen vielleicht besser aus und waren wohlhabender«, sagte sie. »Auf jeden Fall kühner.« Sie verzog leicht die Lippe, vielleicht weil sie sich an die unterschwellige Gewalt erinnerte, die unsichtbar durch den Saal gewogt war, als die Freier einander misstrauisch beäugten. »Aber Menelaos … er war anders.«
Sie brauchte keine Reichtümer; Sparta war wohlhabend genug. Sie brauchte niemanden, der gut aussah; sie selbst brachte alle Schönheit der Welt mit in die Ehe. Jeder Mann war erpicht darauf, sie zur Frau zu bekommen, wie wir gesehen hatten. Wonach also hatte meine Schwester gesucht? Ich fragte mich, woher sie diese fast magische Gewissheit nahm, was genau eine Frau so sicher machte, dass ein bestimmter Mann der richtige war. Ich richtete mich auf, begierig, mehr zu erfahren.
»Ich vermute …« Sie seufzte, als ein Mädchen ihr einen Spiegel mit Elfenbeineinfassung reichte, auf dessen Rückseite ein kunstvoll geschnitztes winziges Abbild der Aphrodite prangte, die einer großen Muschel entstieg. Helena musterte kurz ihr Spiegelbild, warf ihr Haar nach hinten und rückte das goldene Diadem auf ihren Locken zurecht. Die Mädchen um sie herum, die gespannt auf das Urteil über ihre unnötigen Bemühungen warteten, hielten den Atem an. »Ich vermute«, wiederholte sie und schenkte ihnen ein Lächeln, »es lag daran, dass er so dankbar war.«
Ich schwieg; die Worte, nach denen ich suchte, entzogen sich mir.
Helena bemerkte mein Schweigen und hielt es womöglich für vorwurfsvoll, denn sie straffte ihre Schultern und sah mich eindringlich an. »Du weißt, dass unsere Mutter von Zeus auserwählt wurde«, sagte sie. »Eine Sterbliche, die so schön war, dass sie sogar Zeus auf dem Olymp ins Auge fiel. Wenn unser Vater kein so ruhiger, friedliebender Mensch wäre … Wer weiß, wie er empfunden hätte? Wäre er eher wie Agamemnon als wie Menelaos, zum Beispiel.«
Ich erstarrte. Wie meinte sie das?
»Ein Mann wie er würde eine solche Kränkung nicht widerstandslos hinnehmen«, fuhr sie fort. »Würde er es als Ehre betrachten, dass seine Frau auserwählt wurde, oder es doch anders bewerten? Ich weiß nicht, was das Schicksal für mich bereithält, aber ich weiß, dass ich nicht geboren wurde, um nichts zu erreichen. Ich weiß nicht, was die Moiren für mich bereithalten, aber es erschien mir« – sie suchte nach dem richtigen Wort – »vernünftig, meine Wahl mit Bedacht zu treffen.«
Ich dachte an die Bewunderung in Menelaos’ Augen, als er Helena angeblickt hatte. Ich fragte mich, ob sie recht hatte, ob er die Dinge so sehen würde, wie unser Vater sie gesehen hatte. Ob es ihm Sieg genug wäre, den Konkurrenzkampf in unseren Hallen zu gewinnen, was auch immer danach kommen würde.
»Dann kann ich in Sparta bleiben«, fügte sie hinzu.
Ich war sehr dankbar dafür. »Also ist es beschlossen? Ihr werdet hier leben?«
»Menelaos kann Vater helfen, Sparta zu regieren«, sagte Helena. »Und gewiss, so kann auch Vater ihm unter die Arme greifen.«
»Wie?«
»Was weißt du über ihn und Agamemnon? Und über Mykene?«, fragte Helena.
Ich schüttelte den Kopf. »Ich habe dieselben Geschichten über die Familie gehört wie du. Über den Fluch, der auf ihren Vorfahren lastet, Väter, die ihre Söhne töten, Brüder, die zu Todfeinden werden. Aber das gehört alles der Vergangenheit an, nicht wahr?«
»Nicht ganz.« Helena bedeutete den Mädchen um sie herum, sich zurückzuziehen, und beugte sich vertrauensvoll vor. Ich verspürte einen Anflug von Aufregung. »Du weißt, dass sie aus Kalydon hierhergekommen sind?«
Ich nickte.
»Aber das ist nicht ihre wahre Heimat; sie haben beim dortigen König gelebt. Er hat ihnen Gastfreundschaft gewährt, konnte ihnen aber nicht geben, was sie brauchten – Vater dagegen kann es.«
»Und was ist das?«
Sie lächelte, genoss es, diejenige zu sein, die so Spannendes berichtete. »Ein Heer.«
»Tatsächlich? Wofür?«
»Um Mykene zurückzuerobern.« Helena warf den Kopf zurück. »Sich zurückzuholen, was ihnen gehört. Ihr Onkel hat ihren Vater getötet und sie verbannt, als sie noch Kinder waren. Jetzt sind sie zu Männern herangewachsen, und sie haben die Unterstützung Spartas.«
Diesen Teil der Geschichte kannte ich. Menelaos und Agamemnon waren die Söhne des Atreus. Dessen Bruder Thyestes hatte ihn ermordet, um den Thron an sich zu reißen; die beiden Jungen hatte er verstoßen. Zumindest hatte er so viel Erbarmen gezeigt, sich die Hände nicht mit dem Blut von Kindern zu besudeln. Das war das Vergehen gewesen, für das seine Familie schon vor Generationen von den Göttern verflucht worden war: das Verbrechen des Tantalos.
Vielleicht ist es kein Wunder, dass Helena von Menelaos fasziniert ist, dachte ich. Wir hatten die alten Legenden über ihre Familie schon viele Male gehört; eine grässliche Geschichte, die das Blut in den Adern gefrieren ließ, aber gleichzeitig fast unwirklich schien. Jetzt war sie uns einen Schritt näher – zwei Brüder, die in einem letzten Akt Gerechtigkeit walten lassen wollten, um die Wunden ihrer gequälten Familie zu heilen.
»Wird Menelaos nicht in Mykene leben?«, fragte ich.
»Nein, Agamemnon will Mykene zurückerobern«, sagte Helena. »Aber Menelaos ist froh, hier zu bleiben.«
Also würde Menelaos Helena bekommen und Agamemnon die Stadt Mykene. Das schien beiden zweifellos ein gerechter Tausch zu sein.
»Bleibt die Frage, was sie mit dem Jungen vorhaben«, sagte Helena.
»Mit welchem Jungen?«
»Ägisth«, erwiderte sie. »Der Sohn des Thyestes – er ist noch ein Kind, genau wie sie, als Thyestes ihren Vater getötet hat.«
»Wollen sie ihn nicht auch verbannen?«
Helena zog eine Augenbraue hoch. »Damit er zum Mann heranwächst so wie sie? Damit er von denselben Dingen träumt wie sie? Das würde Agamemnon nicht riskieren.«
Ich schauderte. »Er wird den Kleinen doch sicher nicht umbringen, oder?« Ich verstand die brutale Logik dahinter, aber ich brachte es nicht über mich, mir vorzustellen, wie die beiden jungen Männer, die ich in der Halle gesehen hatte, einem weinenden Kind das Schwert in den Leib stießen.
»Vielleicht nicht.« Helena erhob sich und strich ihr Gewand glatt. »Aber sprechen wir nicht mehr von Krieg. Heute ist schließlich mein Hochzeitstag.«
Am späteren Abend verließ ich heimlich die Feierlichkeiten. Sie würden die ganze Nacht dauern, und es würde noch stundenlang getafelt und getrunken werden, doch ich war müde und fühlte mich seltsam leer. Ich war nicht in der Stimmung, den zunehmend betrunkenen spartanischen Adligen weiter aus dem Weg zu gehen; die sonst so streng und ernst dreinblickenden Feldherren hatten rote Gesichter und lockere Zungen bekommen, und ihre klobigen Hände waren überall wie Tintenfische. Alle platzten fast vor selbstgefälligem Stolz über das neue Bündnis und den Eid, den die wichtigsten Männer Griechenlands geschworen hatten, um Menelaos’ Schatz zu verteidigen. Ihre Loyalität war nun an Sparta gebunden.
Ich ging zum Flussufer. Der breite, träge Eurotas mäanderte durch unsere Stadt bis zum fernen südlichen Hafen, der einzige Weg für fremde Eroberer, zu uns zu gelangen. Im Westen und Osten erhoben sich das Taygetos- und das Parnon-Gebirge. Das nördliche Hochland war für Armeen ebenso unüberwindlich. Wir saßen behaglich in unserem Tal, gewappnet und geschützt vor jedem, der in der Absicht kam, uns unseres Wohlstands oder der schönen Frauen zu berauben, für die wir berühmt waren. Aber nun hatte die Schönste von allen ein Heer zur Verfügung, bereit, ihre Ehre gegen jeden Feind der Welt zu verteidigen. Kein Wunder, dass die Männer sich in dieser Nacht gehen ließen und dem Wein reichlich zusprachen.
Leuchtfeuer brannten im ganzen Tal, helle Flammen in der Dunkelheit, die von der Bedeutsamkeit des Tages kündeten. Von jedem Schrein stieg Rauch auf, trug den Fleischgeruch der geopferten, makellos weißen Ochsen in den schwarzen Himmel bis zu den Olympiern hinauf.
Ich hatte bemerkt, dass auch Agamemnon sich von den Feiernden entfernt hatte. Ohne jeden Zweifel war er in Gedanken bei der bevorstehenden Rückeroberung Mykenes. Und auch Helenas junger Ehemann würde innerhalb weniger Tage aufbrechen, um an der Seite seines Bruders zu kämpfen. Sie hatten ein Heer, und ich wusste, dass die spartanischen Soldaten für ihre Geschicklichkeit im Kampf und ihre Gnadenlosigkeit berühmt waren. Es bestand kaum ein Anlass zur Sorge. Und doch konnte ich einen schleichenden, verräterischen Gedanken nicht abschütteln. Wenn der Kampf zuungunsten der Brüder ausging, wenn sie nicht zurückkehrten, dann würde sich nichts ändern. Helena und ich konnten noch eine Weile so weiterleben wie bisher.
Ich schüttelte den Kopf, als könnte ich die Vorstellung dadurch loswerden. Es würde sich trotzdem alles ändern, vielleicht sogar noch mehr als zuvor. Einhundert Männer waren gekommen, um sie zu heiraten, und der nächste würde in einem Wimpernschlag Menelaos’ Platz einnehmen.
Und da sah ich ihn, halb verborgen in den Schatten.
Er drehte im gleichen Moment den Kopf, und unsere Blicke trafen sich. Sein überraschter, verwirrter Gesichtsausdruck war ein Spiegelbild meines eigenen.
»Ich wusste nicht, dass noch jemand hier draußen ist«, sagte er und machte Anstalten, sich zurückzuziehen.
»Wieso seid Ihr nicht bei den anderen?«, fragte ich. Ich hatte bislang kein Wort mit Agamemnon gewechselt, und ich durfte unbeaufsichtigt in der Dunkelheit, weit weg von den anderen, kein Gespräch unter vier Augen mit ihm führen. Aber etwas an der Stille der Nacht, an dem Gelächter, das aus dem Palast zu uns schallte, an dem Gefühl, dass alles, was wir bis jetzt gekannt hatten, zu einem Ende kommen würde, machte mich kühn.
Er zögerte.
»Wollt Ihr nicht mit Eurem Bruder feiern?«
Er zog die dichten Brauen zusammen. Sein Blick war misstrauisch, und er schien unwillig zu antworten.
Ich seufzte, plötzlich ungeduldig. »Oder wollt Ihr damit warten, bis Ihr Mykene zurückerobert habt?«
»Was wisst Ihr darüber?«
Ich verspürte einen Anflug von Triumph, weil ich ihn zum Sprechen gebracht hatte. Die Brise kräuselte die Wasseroberfläche, und plötzlich überkam mich Sehnsucht nach etwas, was ich nicht benennen konnte. So vieles geschah – eine Hochzeit, ein Krieg – und nichts davon betraf mich. »Ich weiß, was Thyestes Eurem Vater und Euch angetan hat«, antwortete ich. »Dass er Euch Euer Königreich gestohlen hat.«
Er nickte knapp. Ich sah, dass er im Begriff war, in den Palast zurückzukehren.
»Aber was werdet Ihr mit dem Jungen machen?«, fragte ich.
Agamemnon sah mich fragend an. »Dem Jungen?«
»Thyestes’ Sohn«, sagte ich. »Werdet Ihr ihn ziehen lassen?«
»Was geht das Euch an?«
Ich fragte mich, ob ich zu weit gegangen war, ob ich ihn tatsächlich brüskiert hatte. Diese Unterhaltung war gänzlich unpassend. Aber nun hatte ich einmal angefangen. »Ihr nehmt das spartanische Heer mit. Was auch immer Ihr tut, geschieht auch in Spartas Namen.«
»Es ist das Heer Eures Vaters. Menelaos’ Heer.«
»Es erscheint mir einfach nicht richtig.«
»Euch vielleicht. Doch es könnte gefährlich sein, einen Sohn mit Rachegelüsten im Herzen aufwachsen zu lassen.« Er sah auf den Fluss hinaus, und seine ganze Haltung verriet Unbehagen. Er warf mir einen kurzen Blick zu. »Auf meiner Familie liegt ein Fluch; er muss gebrochen werden.«
»Aber kann man ihn auf diese Art brechen? Was, wenn es die Götter noch mehr erzürnt?«
Er tat meine Worte mit einem Kopfschütteln ab. »Ihr möchtet gnädig sein«, sagte er. »Aber Ihr seid eine Frau. Und Krieg ist Männersache.«
Es ärgerte mich. »Ihr habt Sparta«, sagte ich. »Ihr werdet Mykene zurückerobern. Und all diese Männer in der Halle, all die Kämpfer, Regenten und Prinzen, die wegen meiner Schwester gekommen sind, haben Eurem Bruder die Treue geschworen. Ihr habt die Chance, viele Königreiche hinter Euch zu vereinen. Die Macht wird Euch gehören – wie könnte ein kleiner Junge da eine Bedrohung für Euch darstellen, ganz gleich, mit wie viel Rachedurst im Herzen er aufwächst? Was kann er Euch schon antun? Mit so vielen Männern unter Eurem Befehl könntet Ihr der Größte unter den Griechen werden.«
Das schien seine Aufmerksamkeit zu wecken. »Ein interessanter Punkt«, sagte er nachdenklich. »Der Größte unter den Griechen. Danke, Klytämnestra.«
Und da, als er sich hinter die Säulen zurückzog, in Richtung des Lärms der Feierlichkeiten, sah ich es. Am Ende hatte sich sein strenger Mund doch noch zum Anflug eines Lächelns verzogen.
2
Kassandra
Jedes Wort, das mir über die Lippen kommt, ist unwillkommen. Meine Kehle ist rau von all den Worten, die sich mir entringen, wenn ich jemanden berühre, ihm in die Augen blicke, die weiß glühende Wahrheit sehe. Meine Prophezeiungen zerreißen mich innerlich, und doch sprudeln sie weiter ungebeten aus mir heraus, auch wenn ich vor den Folgen erzittere. Die, die sie hören, verfluchen mich, jagen mich davon, nennen mich verrückt oder lachen mich aus.
Als ich noch klein war, konnte ich die Zukunft noch nicht vorhersagen. Ich lebte ganz im gegenwärtigen Augenblick, war nur damit beschäftigt, wie ich meine Lieblingspuppe ausstaffieren sollte – denn selbst sie konnte ich in die teuersten Stoffe hüllen und mit winzigen Juwelen schmücken. Meine Eltern waren Priamos und Hekabe, König und Königin von Troja, und ihr Reichtum war unermesslich.
Aber meine Mutter hatte Visionen. Ein blendend heller Geistesblitz, der ihr mit Sicherheit von einem der vielen Götter geschenkt wurde, der uns seine Gunst gewährte und uns half, Unglück abzuwenden. Vielleicht kamen sie sogar von Apollon selbst, denn es hieß, er liebe meine Mutter, sie gehöre zu seinen Günstlingen. Sie gebar meinem Vater viele Kinder, und er hatte noch weitere von seinen Konkubinen. Als Hekabes Bauch eines Tages erneut anschwoll, bereiteten wir uns auf die vertrauten Freuden vor. Als die Zeit gekommen war, in der das Kind zur Welt kommen sollte, legte meine Mutter sich in der Erwartung schlafen, wie sonst auch angenehme Träume über das Kind zu genießen.
Diesmal jedoch kam es anders. Ich, damals sieben Jahre alt, wurde von ihren Schreien geweckt, die die Stille der Nacht zerrissen und mich bis ins Mark erschauern ließen. Ich eilte in ihre Kammer, in der sie auf dem Boden kauerte, und ihre Hebammen kamen durch den Flur gelaufen voller Furcht, dass mit dem Kind etwas Schreckliches geschehen war.
Obwohl Hekabe die Haare schweißnass an der Stirn klebten und sie keuchte wie ein gehetztes Tier, waren es nicht die Wehen, die sie quälten. Sie wehrte die helfenden Hände der Frauen ab, die ihr die Geburt erleichtern wollten, die noch nicht kommen sollte, und schrie so markerschütternd, wie ich es in meinem kurzen behüteten Leben noch nicht erlebt hatte.
Ich wich zurück. Frauen liefen geschäftig hin und her, und ich blieb unsicher in den Schatten stehen, die die hastig entzündeten schmalen Fackeln warfen. Die orangefarbenen Flammen zuckten und flackerten, sodass monströse dunkle Gestalten mit grotesken schlangengleichen Bewegungen über die Steinwände zu tanzen schienen.
»Das Kind«, rief meine Mutter keuchend, und die heftige Erregung, die sie anfangs in ihrem Griff gehabt hatte, flaute allmählich ab. Sie ließ nun zu, dass die Frauen ihr halfen. Aber als diese sie wieder auf ihre Liege betteten und ihr sanft versicherten, das Kind werde noch nicht kommen und alles werde gut, schüttelte sie den Kopf, das Gesicht tränenüberströmt. Mit den dunklen Ringen unter ihren Augen und den strähnigen Haaren sah sie kaum noch aus wie meine Mutter.
»Ich habe ihn gesehen – seine Geburt«, stammelte sie mit heiserer Stimme, doch die Frauen murmelten, es sei nur ein Traum gewesen, nichts, was sie fürchten müsste. Sie gewann ihre königliche Würde zurück und brachte sie mit einer Handbewegung zum Schweigen. »Meine Träume sind nicht nur Träume«, fuhr sie fort. »Das ist bekannt.«
Schweigen breitete sich in der Kammer aus. Ich rührte mich nicht. Die Steinmauer an meinem Rücken fühlte sich unangenehm kalt an, aber ich blieb erstarrt stehen. Im Zentrum des vom Feuer erleuchteten unheimlichen Kreises sprach meine Mutter weiter.
»Ich glaubte, ich würde ihn auf die Welt bringen wie die anderen Kinder vor ihm. Ich spürte das Brennen der Wehen, aber ich kannte den Schmerz und wusste, ich würde ihn auch dieses Mal ertragen. Doch etwas war anders – das Brennen, es …« Sie schwieg kurz, und ich sah, wie sich ihre Fingerknöchel anspannten, als sie die Hände zusammenzog. »Das Feuer der Geburt loderte länger, verheerender als alles, was ich mir vorstellen konnte. Ich spürte Brandblasen auf meiner Haut, roch mein eigenes versengtes, geschwärztes Fleisch.« Sie schluckte, ein unnatürlich lautes Geräusch in der Stille. »Ich gebar kein Kind, sondern eine Fackel – eine Fackel wie die, die ihr in Händen haltet, sein Kopf eine lodernde Flamme, um mich herum nichts als Rauch, der alles verschlang.«
Ich spürte die Anspannung, den Schrecken, der durch die Kammer wogte. Die Blicke der Frauen wanderten zu dem gewölbten Leib meiner Mutter.
»Vielleicht war es doch nur ein Traum«, bemerkte eine von ihnen. »Viele Frauen fürchten sich vor der Geburt; Albträume sind in dieser Zeit nicht ungewöhnlich.«
»Ich habe ein Dutzend Kinder zur Welt gebracht«, fuhr meine Mutter sie an, den Blick unverwandt auf die Unglückliche gerichtet. »Ich habe keine Angst vor einer weiteren Geburt. Aber das hier … Ich bin mir nicht einmal sicher, dass es wirklich ein Kind ist.«
Entsetzen breitete sich aus. Eilig suchten die Frauen Antworten in den Augen der anderen.
»Aisakos!«, rief eine der Frauen plötzlich so entschieden, dass ihre Stimme scharf von den steinernen Wänden widerhallte. »Der Seher. Wir werden den Seher bitten, Euren Traum zu deuten, Königin Hekabe. Vielleicht bleibt Euch in einer Zeit wie dieser die wahre Bedeutung Eures Traums verschlossen. Wir werden Aisakos zurate ziehen, er kann sie uns verraten.«
Nicken, zustimmendes Gemurmel schwelte im Raum. Die Frauen schienen nach etwas zu suchen, was den schreckerfüllten leeren Blick aus dem Gesicht der Königin vertrieb. In der Hoffnung, dass der Seher abwenden konnte, was diese in ihrer Vision gesehen hatte.
Aisakos wurde in die Thronhalle gerufen. Die Frauen hüllten Hekabes geschwollenen Körper in ein Gewand und führten sie aus ihrem Gemach. Da mich niemand beachtete, folgte ich ihnen und sah, wie sie auf dem Thron neben meinem Vater Platz nahm. Er war aus seinem Bett geholt worden, sein Gesicht in bekümmerte Sorgenfalten gelegt. Er hielt die Hände meiner Mutter in den seinen, als Aisakos vortrat.
Das Gesicht des Sehers war glatt und ausdruckslos. Sein Alter hätte mit Falten in seine Haut eingeschrieben sein müssen, doch stattdessen spannte sie sich papierdünn über seinem Schädel. Seine Augen waren mit einem milchigen Film überzogen, der ihre ursprüngliche Farbe nicht erkennen ließ. Wie konnte er nur durch eine solche Trübung sehen, fragte ich mich. Aber vielleicht spielte es für ihn keine Rolle, dass diese Welt verschwommen war, da er die Welt jenseits davon kristallklar sehen konnte.
Meine Mutter erzählte ihm von ihrem Traum. Sie beherrschte sich, sodass ihre Stimme die Anspannung kaum offenbarte.
Der Seher lauschte bis zum Ende. Als sie verstummte, schwieg er. Alle Augen waren auf Aisakos gerichtet, als er die große Halle durchquerte. Von einem Steinsims nahm er eine der bronzenen Feuerschalen, die den riesigen Saal erhellten, einen flackernden Schein auf die gemalten Szenen an der Wand dahinter warfen und die Wölfe, die das Fresko zierten, in lauernde Bestien verwandelten. Er stocherte mit seinem Stab in der Schale, schob die Holzstücke auseinander, bis die Flammen zischend erloschen und eine graue Rauchwolke aus der noch glimmenden Asche aufstieg. Sein Gesicht lag im Schatten. Eine Brise strich flüsternd durch die Steinsäulen, wirbelte die Glut in der Schale auf.
Die Asche setzte sich wieder ab. Ich dachte an den Traum meiner Mutter: das Kind mit dem Flammenkopf. Das Gesicht des Sehers verriet keine Regung, als er die übrige Glut zerstreute.
»Dieser Prinz wird die Stadt zerstören«, sagte er. Seine Stimme klang eisig und leise, wie ein Echo aus den Tiefen einer Höhle. »Wenn man ihm erlaubt, zum Mann heranzuwachsen, sehe ich Troja von einem Flammenmeer verschlungen, einem Feuer, das er entzünden wird. Das Kind darf nicht am Leben bleiben.«
Niemand stellte Fragen. Er schien nur zu bestätigen, was Hekabe schon wusste, als sie schreiend aus dem Albtraum erwacht war. Und schließlich war dieses Kind nur eines von vielen, die Priamos geboren werden würden. Eines von vielen zu verlieren mochte wie ein geringer Preis dafür erscheinen, dass seine Stadt vor dem Untergang bewahrt blieb.
Doch weder mein Vater noch meine Mutter brachten es über sich, ihn zu entrichten. Als mein Bruder Paris geboren wurde, konnten sie es nicht ertragen, den winzigen Säugling von den hohen Mauern Trojas zu werfen, ihn mit feinstem Tuch zu ersticken oder ihn auf einem einsamen Berg auszusetzen. Stattdessen gaben sie ihn einem Schäfer, sagten ihm, er solle das Kind der kalten Nachtluft oder den gierigen Zähnen und Klauen des nächsten Raubtiers überlassen.
Ob sie dem Schäfer erklärt hatten, warum er das tun sollte? Ob er wusste, dass die Zukunft Trojas davon abhing, dass er sein Herz vor dem wimmernden, mitleiderregenden Weinen des Kindes verschloss? Ich fragte mich weiter, ob er es zumindest versucht hatte; ob er das Kind auf einem verwilderten Hügel ablegte, einen Schritt machte, dann noch einen, bevor er sich noch einmal umdrehte. Hatte er Paris’ winzige Nase, seinen kahlen Kopf, die weichen Ärmchen gesehen, die sich hilfesuchend ausstreckten, und die Worte des Sehers als Aberglauben und Unsinn abgetan? Vielleicht fragte sich der Schäfer, wie ein so kleines Kind eine ganze Stadt zu Fall bringen sollte. Womöglich war seine Frau unfruchtbar, sein Heim nie mit Kindern gesegnet worden. Oder er dachte, wenn er dafür sorgte, dass Paris nie einen Fuß in die Stadt setzte, wenn er ihn zu einem schlichten Ziegenhirten erzog, sei Troja sicher. Troja mit seinen hohen Steintürmen, seinen mächtigen eisenbeschlagenen Eichentoren, seinem Reichtum und seiner Macht musste ihm uneinnehmbar erschienen sein.
Und so überlebte mein Bruder, wuchs vom hilflosen Säugling zum jungen Mann heran, und niemand von uns wäre auch nur im Traum darauf gekommen, dass er in den Bergen außerhalb Trojas wohnte. Keiner sprach je wieder von Hekabes Albtraum, und die ganze Nacht hätte selbst wie ein Traum anmuten können, hätte ich mich nicht daran erinnert, wie ich mir an der Steinmauer den Rücken aufgescheuert hatte, als ich vor Aisakos zurückgewichen war. Ich konnte den milchigen Film auf seinen Augen, den Rauchgestank nicht vergessen. Das Mitleid, das ich empfand, als ich Tage später das winzige Bündel sah, das von einer weinenden Sklavin aus Hekabes Kammer getragen wurde, war mit Erleichterung gemischt, dass meine Mutter keine derartigen Träume über mich gehabt hatte.
Viel später hatte ich versucht, mit ihr darüber zu sprechen. Meine Stimme klang ängstlich, und ich konnte sehen, dass meine Zögerlichkeit sie reizte. Ich war neugierig, wie der Traum gewesen war, warum sie dem Seher so bereitwillig geglaubt, welcher Zauber sie so sicher gemacht hatte, dass er die Wahrheit sagte. Rückblickend war es vermutlich verletzend, aber ich war so in der Selbstsucht der Jugend gefangen, dass ich es um jeden Preis wissen wollte.
»Du warst nicht dabei, Kassandra«, fuhr sie mich an. Ihre abrupte Zurückweisung traf mich, und das Blut schoss mir in die Wangen. Ich spürte nur meinen eigenen Schmerz, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, welche Erinnerungen es in ihr heraufbeschwor, als ich nachbohrte, begierig, endlich zu verstehen.
»War ich doch«, widersprach ich. »Ich erinnere mich an Aisakos und an das Feuer – und ich habe nicht vergessen, was er gesagt hat.«
»Was? Sprich lauter, Mädchen«, befahl sie. Sie konnte meine leise Stimme nicht ausstehen. Als Kind schaffte ich es selten, einen Satz zu beenden, ohne dass sie mich aufforderte, ihn noch einmal lauter, deutlicher zu wiederholen.
Heute bittet mich niemand mehr, meine Worte zu wiederholen.
Ich versuchte stockend, den Raum und das Ritual des Sehers zu beschreiben, doch sie schüttelte nur ungeduldig den Kopf. »Unsinn, Kassandra, das ist nur wieder eines deiner Hirngespinste«, sagte sie. Ihr Ton demütigte mich. Sie hatten den Schmerz, der über mein Gesicht huschte, beobachtet. Ihre Miene wurde sofort sanfter, sie legte mir den Arm um die Schultern und drückte sie kurz. Freundlicher fuhr sie fort: »Aber so war es nicht. Aisakos ging mit meinem Traum zum Orakel und hörte die Prophezeiung. Deine Fantasie ist wieder einmal mit dir durchgegangen. Du musst lernen, sie im Zaum zu halten. Wenn du nicht so viel Zeit allein verbringen würdest …«
»Zu dir kommt Apollon doch auch nur, wenn du allein bist.«
Sie trat einen Schritt zurück und sah mich prüfend an.
Ich zuckte, eine solche Unterredung nicht gewohnt, kurz zusammen.
»Ist es das, was du dir wünschst?«, fragte sie.
Der ungläubige Unterton in ihrer Stimme verwirrte mich. Wer würde sich das nicht wünschen? Wenn man in die Zukunft sehen konnte, wusste, was passieren würde, dann konnte man sich davor schützen – wieso klang es bei ihr so, als wäre es unsinnig, diese Gabe zu begehren? »Es ist nur – ich bin deine Tochter, und wenn die Götter dir Visionen schicken, frage ich mich, ob sie – ob ich vielleicht auch …« Ich verstummte, verunsichert von ihrem besorgten Gesichtsausdruck.
»Die Götter handeln aus Beweggründen, die wir nicht einmal ansatzweise erahnen können«, sagte sie. »Apollon liebt Troja, und ich bin Trojas Königin – jede Vision des Gottes ist gut für die Stadt. Für mich ist es kein Geschenk, nichts, was ich angestrebt habe. Es ist nicht an uns, um derlei Dinge zu bitten.«
Ich spürte, wie die Scham mich heiß überlief. Sie war die Königin von Troja; ich würde es nie sein. Einer meiner älteren Brüder würde eines Tages die Stadt regieren, seine Frau würde den Platz meiner Mutter einnehmen. Vermutlich würde diese Frau die Visionen der Königin erben, jene Träume, die Apollon Troja zum höheren Wohl schenkte. Ich kam mir so klein und dumm vor, dass ich mir wünschte, der Erdboden würde mich verschlucken. »Ich wollte nicht –«, begann ich, doch meine Mutter schüttelte den Kopf. Die Unterhaltung war beendet, ohne dass ich hätte ausdrücken können, was ich sagen wollte.
»Geh spielen, Kassandra«, sagte sie bestimmt, und ich gehorchte.
Aber eigentlich wollte mich niemand in seiner Nähe haben. All die anderen Mädchen schienen sich ihrer selbst so sicher zu sein. Ich fühlte mich wie ein im Wind schwankendes Schilfrohr, wagte nie auszusprechen, was ich dachte, um nicht zu riskieren, verhöhnt oder ausgelacht zu werden. Doch Hekabes Traum und der Seher – in dieser Sache war ich mir sicher. Sie mochte es vorziehen, es anders in Erinnerung zu behalten, aber ich würde jene Nacht nie vergessen; sie hatte sich mir tief ins Gedächtnis eingebrannt.
Ich konnte mich schon damals nicht verständlich machen, und meine Mutter war eine viel beschäftigte Frau. Sie hatte keine Zeit, auch nur zu versuchen, mich zu verstehen. Hätte sie vorausgesehen, was aus mir einmal würde, hätte sie auch eine Vision von mir gehabt statt nur von Paris, hätte sie meinen kindlichen Körpern eigenhändig auf den Felsen zerschmettert. Aber niemand hatte in die Asche gespäht, um meine Zukunft vorherzusagen. Niemand hatte eingegriffen, um zu verhindern, dass aus mir würde, was ich dann wurde.
3
Klytämnestra
Seit der Abreise der Atriden war ich rastlos. Die Tage, die ich bisher mühelos hatte ausfüllen können, schienen sich endlos hinzuziehen, besonders die Nachmittage.
Penelope war schon mit Odysseus nach Ithaka gereist, der Insel der Felsen und Ziegen. Helena war noch hier. Wir hatten die vorangegangenen sechzehn Jahre recht angenehm miteinander verbracht. Ich begriff nicht, was sich seitdem verändert hatte. Vermutlich lag es an der kurzen Zeit voller Vorfreude und Aufregung: die Ankunft der Atriden, die in unsere Gefilde gekommen waren, um unsere Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen, die Versammlung von Helenas Verehrern und natürlich die Hochzeit meiner Cousine und meiner Zwillingsschwester. Vielleicht musste mir danach alles ein wenig fad erscheinen.
Die Ehe hatte meine Schwester nicht verändert. Sie nahm die Abwesenheit ihres Mannes bemerkenswert ungerührt hin, und es entmutige mich, wie sehr es mir dagegen zu schaffen machte, dass die Brüder nach Mykene reisten, um ihren thronräuberischen Onkel zu stürzen.