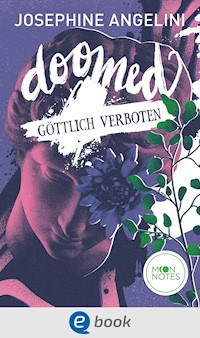8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dressler Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Everflame-Trilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Freund oder Feind, Zukunft oder Untergang. Lily hat ihre Macht angenommen und macht weit im Westen eine bedeutsame Entdeckung. Doch kann sie Außenländer, Hexenzirkel und Stadtrat gegen die Armee des Westens vereinen und gleichzeitig einen Bürgerkrieg mit den 13 Städten verhindern? Ein fast aussichtsloser Kampf. Welche ihrer Freunde werden ihr dabei treu zur Seite stehen und wer wird überleben? Lily muss lernen, ihren Verbündeten zu trauen und am Ende ihrem Herzen zu folgen. Das dramatische Finale der magischen Angelini-Trilogie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Sammlungen
Ähnliche
Über dieses Buch
Angst regiert.
Hoffnung leuchtet.
Liebe rettet.
Die 17-jährige Lily Proctor ist nicht mehr das Highschool-Mädchen, das sie einmal war, sondern eine mächtige Hexe. Sie hat geliebt, gelitten und verloren – und sie ist über sich hinausgewachsen. Nachdem sie und ihre Verbündeten dem Schwarm aus wilden Bienenwirkern nur knapp entkommen sind, macht Lily weit im Westen des Landes eine schreckliche Entdeckung. Sie weiß, dass sie handeln und kämpfen muss. Doch kann sie die Armeen des Ostens gegen einen übermächtigen Gegner vereinen? Wer wird ihr dabei zur Seite stehen und wer wird überleben? Um die Welt zu retten, geht Lily ein hohes Risiko ein. Sie muss ihren Kräften vertrauen und stark sein. Und sie muss lernen, ihrem Herzen zu folgen.
Für meinen Mann, mein Kind und für Nespresso
1
Lily Proctor schlief nicht. Sie war auch nicht bewusstlos oder träumte. Es hatte sie nicht versehentlich in ein anderes Universum verschlagen. Sie war am Leben, und – ob sie es wollte oder nicht – sie hatte das Kommando. Das musste sie sich immer wieder sagen, um nicht auszuflippen. Damit das nicht passierte, ging Lily in Gedanken durch, woran sie sich erinnerte. Sie hatten irgendwo in der Mitte des Kontinents gegen den Schwarm gekämpft, das wusste sie noch. In ihrer Version der USA musste der Kampf in der Prärie von Kansas stattgefunden haben. Aber in dieser Welt war die Mitte des Kontinents auf keiner Karte verzeichnet, weil dort eine kaum bekannte und beinahe mythische Unterart der Wirker lebte, die ›der Schwarm‹ genannt wurde.
Lily und ihr kleiner Kriegertrupp hatten die Schlacht verloren. Fast alle, die ihr nach Westen gefolgt waren, hatten mit ihrem Leben bezahlt. Die wenigen, die überlebt hatten, waren betäubt und zu einer riesigen Blumenwiese an der Westküste des Kontinents gebracht worden. In Sichtweite lag eine ummauerte Stadt. Über dem Haupttor befand sich ein großes Schild mit ihrem Namen: Bower City. Eine Stadt, die eigentlich nicht existieren sollte.
Lily wusste, dass Tristan, ihr Tristan, tot war. Er war beim Kampf gegen den Schwarm gestorben. Dieser Gedanke ließ sie nicht mehr los, und sie konnte nicht vor und nicht zurück. Tristan ist tot. Und das ist meine Schuld.
»Lily?«
Als sie ihren Namen hörte, drehte Lily sich um und versuchte herauszufinden, wer sie angesprochen hatte. Auf der Blumenwiese, die Bower City umgab, standen Juliet, Caleb, Breakfast, Una und der andere Tristan. Alle, die ihr geblieben waren. Die anderen hatten sie entweder im Stich gelassen oder waren auf dem Tränenpfad gestorben. Sogar Rowan hatte sie verraten und in einen Käfig gesperrt, in dem sie verhungern sollte. Einen Käfig, den Tristan – Lilys Tristan – irgendwie aufgebrochen hatte. Tristan hatte sie vor Rowan gerettet. Er hatte sie gerettet, und jetzt war er tot.
»Lily?«, wiederholte der andere Tristan.
Seine Kleidung hing in Fetzen, und seine Augen waren rot und voller Tränen. Der Verlust seines anderen Ichs hatte ihn tief getroffen, aber nicht so tief wie Lily. Er war nicht dafür verantwortlich – so wie sie.
»Was willst du jetzt tun?«, fragte Tristan, als sie ihn vollkommen ausdruckslos ansah.
Lily hielt die Schluchzer krampfhaft zurück. Sie konnte ihrer Trauer nicht freien Lauf lassen, nicht jetzt, und so schwebte sie darüber hinweg, und der Schmerz bohrte sich tiefer und tiefer in sie hinein, so grauenhaft, als hätte sie einen Splitter verschluckt.
Lily betrachtete die Bienen, die um die Blumen herumflogen, und versuchte, sich wieder in die Gegenwart zurückzukämpfen. Ihre Ohren summten, aber sie konnte nicht sagen, ob das Geräusch von innen oder von außen kam. Es gelang ihr nicht, den Blick von den Bienen abzuwenden, und sie fragte sich, ob es ganz normale Bienen oder Arbeiterinnen des Schwarms waren. Die sahen genauso aus wie normale Bienen und dieses scheinbar unauffällige Äußere machte sie noch unheimlicher als irgendwelche Monster.
»Er hat uns nicht umgebracht«, sagte Lily, ohne auf Tristans Frage einzugehen. »Der Schwarm.«
»Es heißt, dass die Kriegerschwestern manchmal Leute davontragen«, sagte Caleb und bezog sich dabei auf die schrecklichen Mitglieder des Schwarms, die halb Mensch und halb Biene waren. Kriegerschwestern waren über drei Meter groß, ihr Exoskelett war hart wie ein Panzer, und sie kämpften mit dornigen Peitschen, die sie mit ihrem tödlichen Gift tränkten. »Vielleicht ist dies der Ort, an den sie ihre Gefangenen bringen«, flüsterte Caleb, als würden die Kriegerschwestern zurückkommen, wenn man über sie sprach.
»Wir müssen tagelang bewusstlos gewesen sein«, stellte Una fest und suchte den Himmel ab. »Schneller können die uns unmöglich hierhergebracht haben.«
Lily nickte geistesabwesend. Ihr Mund war trocken, und sie spürte den bitteren Nachgeschmack eines Betäubungsmittels. Sie richtete ihren Hexensinn auf die Spuren der chemischen Verbindungen, die die Stiche des Schwarms in ihrem Körper hinterlassen hatten, und erkannte, dass sie tatsächlich für eine mehrtägige Bewusstlosigkeit verantwortlich waren. Es war eine raffinierte Mischung, und Lily fragte sich, ob so etwas einer natürlichen Quelle entspringen konnte. Außerdem dachte sie über die Intelligenz von Wesen nach, die entscheiden konnten, einige Menschen zu töten und andere zu entführen und dazu jeweils das passende Gift einzusetzen.
»Wohin gehst du?«, rief Juliet mit schriller Stimme. Sie rannte hinter Lily her und packte ihre Schwester am Arm. Erst da merkte Lily, dass sie auf das Stadttor zu getaumelt war.
»Da rein, schätze ich«, antwortete sie mit einem Schulterzucken. »Ist ja nicht so, als hätten wir eine andere Wahl.«
Juliet sah Caleb über Lilys Schulter hinweg an. »Sie steht unter Schock«, berichtete sie ihm.
»Das geht uns wohl allen so«, bemerkte Breakfast ruhig. »Aber lasst uns trotzdem kurz nachdenken, bevor wir da einfach so reinmarschieren.«
Lily nahm nur am Rande wahr, wie Juliet sie zu den anderen zurückführte. Ihre Hände schmerzten unter der Berührung, und sie befreite sich aus dem Griff ihrer Schwester. Lilys Verbrennungen waren erst zur Hälfte geheilt, schließlich hatte sie die Finger in den brennenden Boden gegraben. Sie fuhr mit der Zunge über ihre rissigen Lippen und glaubte immer noch den Rauch und die Erde der Prärie schmecken zu können, während das Grasfeuer um sie loderte. Sie wusste noch, wie sie sich festgekrallt hatte, um nicht vom Hexenwind fortgetragen zu werden, und wie sie sich vorwärtsgezogen hatte, als das Feuer über die Ebene wanderte. Eine grauenhaft schmerzende Handvoll brennender Erde nach der anderen.
»Hier«, sagte Tristan und griff in den Helferrucksack, den er immer noch auf dem Rücken trug. »Ich habe Salbe. Glaube ich zumindest.«
Lily konnte ihm nicht in die Augen sehen. Als er nach ihren Händen griff und die roten und verbrannten Stellen betupfte, musste sie gegen den Drang ankämpfen, die Hände wegzuziehen. Er ist nicht mein Tristan, sagte sie sich.
Auch die anderen rieben ihre Brandwunden mit Tristans Salbe ein, obwohl die Verletzungen bereits abheilten.
»Der Schwarm hat uns anscheinend irgendein Heilmittel verabreicht«, sagte Tristan. Etwas verwundert betrachtete er seine eigenen Arme und Hände, die nur leichte Verbrennungen aufwiesen. »Wenn man bedenkt, dass wir im Feuer gekämpft haben, sollte man meinen, dass wir viel schlimmere Verletzungen haben müssten.«
»Als Lilys Feuer uns erwischt hat, war ich sicher, dass wir erledigt sind«, fügte Caleb hinzu. »Stattdessen hat es nur die Bienen verbrannt. Wie ist so was möglich?«
»Ich war das«, gestand Lily. »Irgendwie habe ich eure Energie gebündelt. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie ich es getan habe.«
»Kannst du das noch mal machen?«, fragte Una und betupfte ihre Wunden mit Salbe. »Es war nämlich ganz praktisch. Hat massenweise Wirker gekillt und uns nur leicht angebraten.«
Lily versuchte, sich zu erinnern. Eines wusste sie jedenfalls mit Sicherheit: Sie hatte ihr Versprechen gebrochen. Sie hatte Besitz von ihren Helfern ergriffen. Dadurch waren sie alle irgendwie miteinander verschmolzen – zu einem Wesen geworden. Und als Tristan starb, war auch ein Teil von ihr gestorben. Lily spürte die Löcher in sich, die der Verlust gerissen hatte. Als hätte man ihr ein paar Zähne ausgeschlagen, und sie könnte einfach nicht aufhören, immer wieder mit der Zungenspitze über die blutenden Lücken zu fahren.
Er sollte jetzt seine Sachen packen, um nach Harvard zu gehen. Aber er ist tot.
»Ich weiß es nicht. Kann mich nicht genau erinnern«, murmelte Lily, die nicht näher darauf eingehen wollte. Entweder hatten die anderen im Eifer des Gefechts nicht gemerkt, dass sie ihre Körper übernommen hatte, oder dieser Gedanke war ihnen noch gar nicht gekommen. Lily hoffte sehr, dass es so blieb.
Ihr fiel auf, dass Juliet sie mit gerunzelter Stirn musterte. »Was?«, fragte Lily defensiv.
»Ich habe mein ganzes Leben mit Hexen verbracht und noch nie so etwas erlebt«, sagte Juliet. »Du sagtest, du hättest die Energie in ihnen gebündelt, statt sie ihnen nur zu geben. Als könntest du kontrollieren –« Juliet verstummte unsicher.
»Was kontrollieren?«, fragte Lily, aber Juliet schüttelte nur den Kopf und verfolgte den Gedanken nicht weiter. Lily hakte nicht nach, weil sie nicht wollte, dass Juliet oder die anderen zu sehr darüber nachdachten. Vor allem Caleb nicht. Lily wusste, dass er ihr nie verzeihen würde, wenn er erfuhr, dass sie Besitz von ihm ergriffen hatte, und sie wollte nicht auch noch ihn verlieren. Das würde sie nicht ertragen. Eine verzweifelte Panik schnürte ihr die Brust zusammen. Sie starrte nach oben und rang nach Luft.
Wie konnte ich das nur tun? Wie konnte ich sie dieser Gefahr aussetzen?
Du hattest keine andere Wahl, kam zur Antwort. Lillian war aufgetaucht und teilte die Einsamkeit in Lilys Kopf.
Hilf mir. Ich habe das Gefühl, zu ertrinken, sagte Lily. Sie sah sich um, so steif wie eine Statue. Wie lange bist du schon bei mir?
Seitdem du aufgewacht bist. Du hast nach mir gerufen, berichtete Lillian. Lily spürte, dass Lillian von dem Anblick, den sie teilten, genauso überrascht war wie sie selbst. Was wirst du jetzt tun?
Lily schaute auf die Stadt. »Wir haben zwei Möglichkeiten«, sagte sie. »Entweder gehen wir rein, oder wir lassen es. Ich habe keine Ahnung, wofür wir uns entscheiden sollen.«
Ihre Helfer sahen einander an und tauschten ganz offensichtlich ihre Gedanken aus.
»Du bist nicht du selbst«, sagte Caleb sanft. »Wir haben versucht, dich per Gedankenübertragung zu erreichen, aber wir sind abgeprallt wie an einer Steinmauer. Du hast uns ausgeschlossen.«
Lily wurde klar, dass sie tatsächlich gemerkt hatte, wie ihre Helfer um Zugang zu ihren Gedanken gebeten hatten, doch ihr Unterbewusstsein hatte sie abgewehrt. Sie wollte jetzt niemanden in ihrem Kopf haben, der nicht mindestens so schuldig war wie sie. Ihre Schuld schwebte wie ein Schwert über ihrem Kopf, und nur Lillian wusste, wie sich das anfühlte. Nur Lillian hatte geliebte Menschen in den Tod geschickt.
Wie verhinderst du, dass es dich auffrisst?
Gar nicht, antwortete Lillian. Lass es zu, und sei dankbar für den Schmerz. Wenn er weggeht, weißt du, dass du innerlich tot bist.
Lily fühlte keinen Schmerz. Sie fühlte gar nichts. Sie war wie betäubt, und ihr Kopf war von einem weißen Rauschen erfüllt, das die Schreie übertönte, die in ihrem Körper festsaßen. Sie hatte sich diese Taubheit kaum eingestanden, da verschwand sie auch schon, und Hass stieg in ihrer Kehle auf. Ein Hass auf sich selbst, so dick und schwarz wie Teer, in dem sie zu ertrinken drohte.
Ich halte das nicht aus.
Doch. Du kannst es, weil du es musst, sagte Lillian. Ich bin hier. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man als ein anderer Mensch aufwacht.
»Lily?«, sagte Juliet und kam mit der ausgestreckten Hand auf sie zu. »Sag doch was.«
Bei jeder Entscheidung, die ich treffe, stirbt jemand. Ich will nichts mehr entscheiden müssen, dachte Lily. Ich bin wie gelähmt.
Nichts zu tun ist keine Lösung, erwiderte Lillian. Du musstest rücksichtslos handeln, als euch der Schwarm angegriffen hat, auch Tristan gegenüber. Er ist gestorben, um dich und den Rest deines Zirkels zu beschützen.
Nein. Er ist gestorben, weil er noch nicht bereit für die Last war, die ich ihm aufgebürdet habe. Er hätte niemals in diese Welt kommen dürfen.
Vergiss das. Was geschehen ist, ist geschehen. Jetzt geht es um die Zukunft. Um die Stadt, die vor dir liegt, und was du als Nächstes tun wirst. Vergeude Tristans Opfer nicht. Sieh zu, dass du deine Schuldgefühle loswirst, und komm in die Gänge.
»Achtung. Da kommt jemand«, sagte Una warnend.
Tatsächlich, eine kleine Gruppe hatte die Stadt durch das große Tor verlassen und kam auf sie zu.
»Haben wir irgendwelche Waffen?«, fragte Caleb und griff nach der leeren Messerscheide, die an seinem Gürtel hing. Auch Tristan tastete nach seinem Messer und schüttelte beunruhigt den Kopf.
»Keine Panik, Jungs. Uns bleibt immer noch unsere Hexe«, sagte Una, nachdem auch sie erfolglos nach ihren Waffen gesucht hatte. Sie sah Lily an. »Wie viel Power hast du?«
Lily verzog das Gesicht. »Gar keine«, antwortete sie. »Ich brauche Salz.«
»Vielleicht sind sie freundlich«, sagte Juliet hoffnungsvoll.
»Weil wir ja so viel Freundlichkeit erfahren haben, seit wir in diese Welt gekommen sind«, spottete Breakfast.
»Kein Grund, zickig zu werden. Schließlich stürmen sie nicht mit gezogenen Waffen auf uns zu«, konterte Juliet und kniff die Augen zusammen, um die rasch näher kommende Gruppe genauer betrachten zu können.
Typisch Juliet. Aus jeder Situation macht sie das Beste, wisperte Lillian in Lilys Kopf.
Stimmt, bestätigte Lily, die plötzlich das Gefühl hatte, als würde in ihr etwas tauen, als sie diese andere Version ihrer Schwester betrachtete.
Juliet strich ihr angekohltes Leinenhemd glatt und steckte den ausgefransten Saum in den Bund ihrer Reithose aus Wearhyde. Dann nahm sie die schmalen Schultern zurück, was Lily lächeln ließ. Immer wenn Juliet besonders cool wirken wollte, sah man erst recht, was für ein zartes Persönchen sie war. »Ich übernehme das«, sagte sie selbstbewusst.
Caleb sah aus, als hätte er gern etwas dazu gesagt, und Lily wurde bewusst, dass sie allmählich wieder die Kontrolle übernehmen sollte, wenn sie diesen Zirkel leiten wollte – vor allem die Kontrolle über sich selbst.
Lillian, ich muss meinen Helfern Zugang gewähren, und deshalb solltest du jetzt verschwinden, sonst könnten sie dich in meinem Kopf spüren. Ich melde mich bei dir, sobald ich kann.
Ja, sagte Lillian. Wir haben beide jede Menge zu tun.
Lily spürte noch einen Hauch von Lillians finsterer Entschlossenheit, während sie beide das Empfangskomitee der fremden Stadt betrachteten. Dann brach der Kontakt ab. Lily richtete ihre Aufmerksamkeit auf ihre Helfer und tauschte ihre Gedanken mit Caleb aus.
Lass Juliet mit ihnen sprechen, Caleb. Sie wirkt nicht so bedrohlich wie du.
Schöne Untertreibung. Selbst ein Kätzchen wirkt bedrohlicher als sie.
Caleb schenkte Lily den Anflug eines Lächelns, und sie spürte, wie er sich ein wenig entspannte.
Als die Fremden näher kamen, war deutlich zu erkennen, dass sie nicht feindselig waren. Die beiden Frauen und Männer waren unbewaffnet. Sie trugen weite Kimonos oder Tuniken und viel Schmuck. Mit besorgten Mienen traten sie an Lilys Zirkel heran.
»Braucht einer von euch medizinische Versorgung?«, fragte die gut aussehende Frau, die offenbar das Sagen hatte.
Sie ist Außenländerin, wisperte Caleb in Lilys Kopf. Aber ihre Bemalung passt zu keinem der Stämme, die ich kenne.
Das Gesicht, die Hände und die nackten Schultern der Frau waren mit Streifen und Punkten bemalt. Sie war Ende zwanzig und hatte so ebenmäßige Gesichtszüge, dass sie mit zunehmendem Alter vermutlich nur noch besser aussehen würde. Strähnen ihrer glänzend schwarzen Haare waren mit bunten Schnüren geflochten, und in den Zöpfen steckten Adlerfedern. An den Handgelenken trug sie goldene Armreifen. Lily fiel auf, dass ihr kurzer Kimono aus Seide war. Sie konnte sich nicht erinnern, in dieser Welt jemals ein seidenes Kleidungsstück gesehen zu haben. Lilys Blick wanderte zu dem rauchgrauen Wunschstein am Hals der Frau. Er war nicht so groß wie ihr eigener, aber viel dunkler, fast schwarz. Sie spürte, wie Tristan ihr Bewusstsein streifte, und ließ ihn in ihre Gedanken.
So einen dunklen Wunschstein habe ich noch nie gesehen, Lily. Er ist sogar dunkler als Unas.
Kriegerschwarz.
Was meinst du damit?
Bleib einfach wachsam, Tristan. Vertrau mir – diese Hexe kann kämpfen.
Lily hatte eine Theorie über Wunschsteine, die nicht allgemein bekannt war. Auch gut ausgebildete Helfer wie Tristan wussten nichts darüber. Weil Lily drei Wunschsteine besaß, einen von jeder Farbe, hatte sie die einzigartige Chance, herauszufinden, wie sie funktionierten, und ihr war aufgefallen, dass sich jeder ihrer Steine für eine bestimmte Art Magie besonders eignete. Der mittelgroße rosa Stein begann bei Heilungszaubern zu glühen. Der kleine goldene eignete sich am besten für Küchenmagie. Doch der rauchfarbene, der größte und stärkste ihrer Wunschsteine, erwachte zum Leben, wenn ihre Kriegermagie gefordert war. Hastig verbarg Lily den hellroten und den goldenen Stein und ließ nur den größeren rauchfarbenen an der Kette baumeln.
»Keiner von uns ist schwer verletzt«, beantwortete Juliet die Frage höflich. Juliets Blick fiel auf den Stein der Frau, und sie runzelte die Stirn. Um es zu überspielen, lächelte sie. »Aber wir brauchen Wasser … und Salz für unsere Hexe.«
Juliet trat zur Seite, um der Gruppe einen guten Blick auf Lily zu gewähren, neben der sich Una, Breakfast und Tristan aufgebaut hatten, während der riesige Caleb hinter ihr Wache hielt.
Vielen Dank, Juliet.
Nur, damit sie merken, dass wir nicht vollkommen wehrlos sind, Lily. Ich hoffe, es stört dich nicht.
Natürlich nicht.
»Aber gern«, sagte die fremde Hexe, ohne eine Miene zu verziehen. Ihr Blick fiel auf Lilys Wunschstein, doch sie schaute sofort wieder weg, als sei der große Stein bedeutungslos. Sie winkte ihre Begleiter heran, die bunt glasierte Keramikbecher mit Wasser dabeihatten. »Mein Name ist Grace Bendingtree. Ich bin die Bürgermeisterin von Bower City. Willkommen.«
»Vielen Dank, Bürgermeisterin Bendingtree«, antwortete Juliet in einem Tonfall, um den sie selbst ein aalglatter Politiker beneidet hätte. »Es ist uns eine Ehre.«
»Bitte nennt mich Grace. Wir haben es hier nicht so mit Förmlichkeiten und duzen uns alle«, sagte sie mit einem strahlenden Lächeln und sah zu, wie Lilys Truppe das Wasser hinunterstürzte.
»Ich bin Juliet Proctor. Das sind meine Schwester Lily und ihre Helfer – Caleb, Tristan, Una und Stuart.«
Sie nickten grüßend mit dem Kopf, als ihre Namen genannt wurden. Grace sah jeden von ihnen freundlich an.
»Willkommen«, sagte sie. »Ihr seht aus, als könntet ihr etwas zu essen und ein wenig Schlaf brauchen.«
»Vielen Dank«, sagte Juliet und nahm damit die Einladung der Bürgermeisterin an. Einen Moment lang runzelte sie die Stirn, und wenn Lily sie nicht so gut gekannt hätte, wäre ihr das kurze Zögern wohl entgangen. »Ist es hier üblich, dass die Bürgermeisterin das Risiko eingeht, sich außerhalb der Stadtmauern aufzuhalten, um ein paar Fremde willkommen zu heißen?«
»Wenn sie so anreisen wie ihr, auf jeden Fall«, sagte Grace und lachte auf.
Ihre drei Begleiter nickten zögernd. Ihre verunsicherten Blicke ließen keinen Zweifel daran, dass dies eine so ungewöhnliche Situation war, dass sie keine Ahnung hatten, wie sie reagieren sollten.
»Es kommt selten vor, dass der Schwarm jemanden herbringt, und noch seltener, dass die Leute überleben«, fuhr Grace traurig fort. »Ihr müsst sehr stark sein.« Sie sprach zwar alle an, doch ihr Blick ruhte auf Lily und wurde schnell sanfter, als wüsste sie, dass Lily litt. »Und was das Risiko betrifft, die Stadt zu verlassen – ihr werdet schon sehen, dass die Dinge hier anders sind, als ihr es kennt.«
Grace lud Lily ein, neben ihr zu gehen, aber Lily ignorierte es und ließ Juliet den Vortritt. Lily wollte lieber nur beobachten, ohne eine Unterhaltung führen zu müssen.
»Sind das deine Helfer?«, fragte Juliet höflich und deutete mit dem Kinn auf Grace’ schweigendes Gefolge.
Grace runzelte die Stirn. »Wir haben hier keine Helfer«, antwortete sie kühl.
»Oh, Entschuldigung«, sagte Juliet betroffen. »Ich hoffe, ich habe dich nicht beleidigt?«
Grace lächelte gequält. »Ich weiß, dass ihr aus dem Osten kommt und die Dinge dort anders handhabt, aber hier in Bower City vereinnahmen wir keine Menschen.« Grace warf einen Blick auf Lilys Helfer, als würde sie sie bedauern. »Und es wäre vielleicht besser, nicht zu viel über eure … Situation … zu sprechen, solange ihr hier seid.«
Lily und Una tauschten einen Blick.
»Wir werden diskret sein, wenn du das möchtest«, versicherte ihr Juliet. »Darf ich fragen, wieso das ein Problem ist?«
»Ich kann es nicht taktvoll ausdrücken«, sagte Grace knallhart. »Wir betrachten das Vereinnahmen von Helfern als eine Form der Sklaverei, und hier bei uns gilt es als Verbrechen, eine andere Person zu besitzen.«
Lily wollte widersprechen, aber Juliet brachte sie mit einer Handbewegung zum Schweigen. Dies war nicht der richtige Zeitpunkt für eine Diskussion darüber, ob die Vereinnahmung eines Helfers automatisch bedeutete, dass man ihn in Besitz nahm.
»Aber wie können Hexen ohne Helfer arbeiten?«, fragte Caleb.
Grace blieb stehen und sah ihn an. »Hexen, Crucibles und, ja, sogar Helfer können heilen, Energie für den Betrieb der Stadt erzeugen und alle nötigen Produkte erschaffen, ohne jemanden vereinnahmen zu müssen. Es gibt nur eine Form der Magie, für die eine Hexe ein Gefäß braucht. Kriegermagie. Aber wir sind der Meinung, dass keine Menschen sterben dürfen, nur weil eine Hexe ihre Blutgier nicht kontrollieren kann.«
»Das ist sehr nobel von euch«, sagte Tristan und hob die Brauen, »aber wie verteidigt ihr euch ohne Krieger?«
»Gar nicht«, antwortete Grace gelassen. »Etwas anderes übernimmt das für uns.«
Sie waren jetzt dicht genug an der Stadtmauer, um durchs Haupttor sehen zu können. Grace ging voraus und lenkte ihre Aufmerksamkeit auf die Stadt, die sich vor ihnen erstreckte. Doch bevor Lily einen gründlichen Blick durchs Tor werfen konnte, schoss Tristans Arm vor und hinderte sie am Weitergehen. Als er sie an sich riss und herumwirbelte, um mit ihr in den Armen loszurennen, konnte sie die Angst und die Verwirrung von Una, Caleb und Breakfast spüren; ihre Gedanken kamen als wildes Durcheinander bei ihr an.
Lauf!
Das ergibt keinen Sinn …
Schaff sie hier weg, Tristan!
Über Tristans Schulter konnte Lily die Kriegerschwestern sehen, die über dem Stadttor schwebten. Ihre Peitschen hingen griffbereit an der Seite.
2
Der Himmel und die Blumen verschwammen vor Lilys Augen, als Tristan auf etwas zurannte, das aussah wie eine Baumgruppe am Horizont. Doch sosehr Tristan sich auch anstrengte, die Bäume schienen nicht näher zu kommen.
»Das ist zu weit weg!«, brüllte Lily. Tristan senkte nur den Kopf und rannte schneller.
Lily warf einen Blick über seine Schulter und sah, dass ihnen einer der Stadtbewohner folgte. Er schwenkte die Arme und schrie: »Wartet!«
Tristan wartete nicht. Aber ihr Verfolger strahlte etwas aus, das Lily veranlasste, auf Tristans Brust zu hämmern. Es war eine Mischung aus Verblüffung und Offenheit, die sie vermuten ließ, dass von den Stadtleuten vielleicht doch keine Gefahr ausging.
»Halt an, Tristan«, rief sie. »Lass uns wenigstens mit ihnen reden.«
Tristan kam zögernd zum Stehen. Lily befreite sich aus seinen Armen, konnte ihm aber nicht in die Augen sehen. Sie betrachtete stattdessen den Stadtbewohner.
Er war ungefähr so groß wie Tristan, aber weniger kräftig gebaut. Er hatte schwarze Haare und dunkle Augen und sah asiatisch aus, doch Lily hätte ihn keinem Herkunftsland zuordnen können. Sie schätzte, dass er nur ein paar Jahre älter war als sie. Er war klug genug, ein paar Meter von Tristan entfernt stehen zu bleiben.
»Ich weiß, dass es ein Schock für euch ist, aber bitte kommt zurück, damit wir euch erklären können, was es mit dem Schwarm auf sich hat«, sagte er in einem ganz vernünftigen Tonfall. »Ich verspreche, dass euch nichts geschieht.«
Tristan zögerte, aber Lily trat vor. »Hören wir uns an, was sie zu sagen haben«, entschied sie und vermied immer noch jeden Augenkontakt. »Wir haben ohnehin keine andere Wahl.«
Sie folgten dem jungen Mann zurück zum Rest der Abordnung, und Grace erklärte ihnen das merkwürdige Abkommen, das zwischen Bower City und dem Schwarm bestand. Seit mehr als hundert Jahren hatte der Schwarm Menschen ausgewählt, sie an die Küste geflogen wie Lily und ihre Helfer und sie dort abgesetzt. Der Schwarm hatte den Auserwählten erlaubt, eine Stadt zu bauen und ihr Leben zu leben, vorausgesetzt, sie taten es auf eine zivilisierte und ordentliche Weise.
»Das ist alles, was sie verlangen?«, fragte Caleb und verzog abschätzig das Gesicht. »Ordnung?«
»Ich schwöre es«, bestätigte Grace. Sie zeigte auf die bunten Blumen zu ihren Füßen. »Sie verlangen nicht einmal, dass wir die Blumenwiese pflegen, damit sie hier Nahrung finden. Wir machen es freiwillig. Das ist unser Geschenk an sie, weil sie uns so viel gegeben haben.«
Lily sah ihre Helfer an und fragte sie lautlos, was sie davon hielten.
»Sie schwirren direkt vor unserer Nase herum«, sagte Una und zeigte auf die Kriegerschwestern, die über dem Tor hockten. »Sie hätten uns jederzeit töten können.«
»Das stimmt«, wurde sie von Breakfast unterstützt.
Tristan nickte zögernd, aber Caleb war schwerer zu überzeugen. Lily konnte seinen Hass auf den Schwarm und alle anderen Wirker fühlen wie einen harten Klumpen – eine Infektion, die sich in ihm verkapselt hatte wie ein Eiterherd. Das konnte sie gut verstehen. Die Wirker hatten fast alle Leute getötet, die er jemals gekannt hatte.
Wohin sollen wir sonst gehen?, fragte Lily ihn in der Gedankensprache.
Das gefällt mir nicht. Hier ist irgendwas faul, antwortete Caleb.
Mir gefällt es auch nicht, bemerkte Lily. Doch dann zuckte sie mit den Schultern und folgte Grace, die sie und ihre Helfer zum Stadttor führte.
Um Bower City betreten zu können, mussten Lily und ihr Zirkel unter einem Bogen aus fliegenden Kriegerschwestern hindurchgehen, was sie ziemlich nervös machte.
Das Summen der Flügel verursachte ihnen eine Gänsehaut und weiche Knie. Lily schaute auf. Die schwarzen Facettenaugen glitzerten wie ölige Regenbögen, und die wulstigen Köpfe bewegten sich blitzschnell auf den langen, dünnen Hälsen. Die Kriegerschwestern sahen auf Lily herab. Lily hätte nicht sagen können, was sie dachten oder fühlten – falls sie überhaupt etwas dachten oder fühlten.
»Es ist okay. Ehrlich«, beruhigte Grace die Gruppe. »Dem Schwarm geht Ordnung über alles, und wenn ihr euch friedlich verhaltet, tun sie euch nichts. Um in Harmonie mit ihnen zu leben, müssen wir nur in Harmonie miteinander leben.«
Caleb beschwerte sich nicht darüber, dass sie die Stadt betraten, aber als sie durch das Tor gingen, konnte er sich eine Bemerkung nicht verkneifen. »Harmonie«, flüsterte er und duckte sich unter dem herabhängenden Ende einer Peitsche hindurch. »Was verstehen die Mistviecher schon von Harmonie?« Ein Lächeln umspielte Lilys Mundwinkel, und sie stellte fest, dass Caleb sie darauf gestoßen hatte, was sie an den Kriegerschwestern am meisten störte. Sie hatten ein paar menschliche Merkmale, aber auch etwas Fremdartiges. Lily konnte keine Emotionen wahrnehmen und sich auch nicht vorstellen, dass sie etwas so durch und durch Menschliches wie Harmonie begriffen.
Als Lily den ersten richtigen Blick auf die Stadt werfen konnte, hatte sie das merkwürdige Gefühl, schon einmal dort gewesen zu sein. Die tadellos gestrichenen Häuser waren mit terrakottafarbenen Schindeln gedeckt, und auf jeder Fensterbank und an jedem Rankgitter wucherten Blumen. Blüten hingen von den Dächern, und an den Rändern der perfekt gepflegten Straßen wuchs kein Gras, sondern ein Teppich aus Wildblumen. Sogar die Straßenbäume – die in riesigen Töpfen standen – blühten, und es roch überall bittersüß nach ihrem Pollen.
»Gefällt euch unsere Stadt?«, fragte Grace nach einer angemessen langen Zeit.
»Sie ist so –«, Una sah sich fassungslos um, »sauber.«
Grace lachte ein kehliges, warmes Lachen und ließ ihre perfekten weißen Zähne aufblitzen. »Ich sagte es doch schon: Ordnung, Symmetrie, Frieden. Der Schwarm besteht darauf, dass es hier nett und ordentlich ist, denn davon haben alle etwas.«
Lily betrachtete die Straße, deren Kopfsteinpflaster so sauber war, dass man vermutlich davon essen konnte. Nirgendwo war etwas zu beanstanden. Kein Rostfleck am Scharnier eines Fensterladens. Keine abblätternde Farbe, keine verrutschten Dachziegel auf den Häusern, die entfernt an italienische Villen erinnerten. Alles war absolut perfekt.
»Wie Disneyland«, murmelte Breakfast.
»Stimmt«, bestätigte Lily mit einem Nicken. Deswegen war ihr die Stadt so bekannt vorgekommen. Hastig vertrieb sie die Erinnerung an die singende Mickymaus, bevor sich der nervige Song in ihrem Kopf festsetzte. Sie hasste Disneyland.
»Abgesehen vom leicht mediterranen Flair anstelle des Schweizer Chalet-Looks«, fügte Breakfast hinzu.
»Ich frage mich, wo genau wir gelandet sind.«
Breakfast zuckte mit den Schultern. »Vermutlich irgendwo zwischen San Francisco und L. A. Wo all die Farmen und Weingüter sind.«
Tristan sah Lily und Breakfast verwundert an, aber Lily wendete den Blick ab und schüttelte den Kopf, als spielte es keine Rolle. Ihm schien Bower City zu gefallen, und auch Lily musste zugeben, dass es eine schöne Stadt war. Sogar die Sonne schien irgendwie strahlender als im Osten.
Auf ihrem Weg durch die rasterförmig angelegten Straßen bemerkte Lily offene Bahnen, die lautlos durch die Stadt fuhren. Leute in bunt gefärbten Tuniken und Kimonos sprangen mühelos während der Fahrt auf, und die weiten Umhänge der Männer und die Seidenroben der Frauen wehten im Fahrtwind. Falls sich die wunderschön gekleideten und aufdringlich parfümierten Bürger dieser Stadt über das abgekämpfte Aussehen Lilys und ihres Zirkels wunderten, verbargen sie es gut.
Natürlich gab es neugierige Blicke, doch die Leute schauten schnell wieder weg und kümmerten sich um ihre eigenen Angelegenheiten. Gelegentlich konnte Lily einen Blick auf eine Kriegerschwester erhaschen, die auf dem Dach eines Gebäudes saß, doch von den Straßen schienen sie sich fernzuhalten. Trotzdem waren sie da. Lily fühlte ihre Anwesenheit in den makellosen Straßen, wie man ein Gewitter fühlt, das sich ankündigt, aber noch nicht ausgebrochen ist.
Lily fragte sich, wie groß die Stadt wohl sein mochte. Sie schaute die Straße hinunter, konnte ihr Ende aber nicht sehen. Das Raster wies eine leichte Biegung auf, was irgendwie angenehmer war als eine komplett rechtwinklige Anlage. Es wirkte etwas natürlicher, aber trotzdem sehr konstruiert, als hätten die Erbauer Honigwaben zum Vorbild gehabt.
»Seid ihr müde? Braucht ihr eine Pause?«, fragte Grace.
Lily schüttelte den Kopf. Sie wollte ihr ungewisses Ziel einfach nur erreichen, um ein paar Minuten allein sein zu können. Juliet spürte ihre Frustration.
Ich glaube, sie führt uns absichtlich durch die schönsten Ecken, sagte Juliet lautlos.
Ich denke eher, die ganze Stadt besteht nur aus schönsten Ecken, antwortete Lily. Sie gingen noch ein paar Minuten an gepflegten Häusern und makellosen Straßen vorbei und kamen endlich auf einen großen Platz mit einem prunkvollen Springbrunnen. Rund um den Platz standen großartige Gebäude mit auffallenden Säulen. Zum größten führte eine breite Treppe hinauf, auf der Leute in kleinen Grüppchen zusammenstanden und sich unterhielten.
»Das ist unser Forum«, erklärte Grace. »Sozusagen unser Regierungssitz. Zumindest versuchen wir, hier Politik zu machen. Meistens diskutieren wir nur.«
Alle Blicke fielen auf die Neuankömmlinge, und die Gespräche verstummten. Grace führte sie die breite Treppe hinauf, und als sie vorbeigingen, setzten die Unterhaltungen wieder ein, diesmal allerdings mit einem hektischen Unterton. Lily nickte leicht, denn jetzt begriff sie, wieso Grace einen Trupp abgekämpfter, unter Schock stehender und trauernder Menschen durch die Stadt führte. Sie und ihr Zirkel wurden präsentiert. Es ging nicht um sie. Das geschah für die Menschen von Bower City.
Lily versuchte, Blickkontakt zu den Leuten aufzunehmen, aber alle schauten nervös weg. Sie zogen eine Show ab und taten so, als wäre dies ein ganz normaler Tag, doch ihre erzwungene Gleichgültigkeit verriet eine größere Anspannung, als wenn sie offen hingesehen und mit dem Finger auf Lily und die anderen gezeigt hätten.
Grace und ihre Begleiter führten den Zirkel an einer langen Reihe von Marmorsäulen vorbei in einen riesigen Raum mit einer Kuppeldecke. Das Gebäude war wirklich imposant und hätte prima auf einen Hügel in Italien oder Griechenland gepasst.
Lily legte den Kopf in den Nacken, um zu der runden Öffnung in der Kuppel aufzuschauen, durch die Luft und Sonnenlicht hereinströmten. Etwas Großes flog draußen vorbei und warf für einen Moment seinen Schatten auf den glänzenden Marmorboden. Darauf folgte ein kaum wahrnehmbares Summen, bei dem sich Lilys Nackenhaare aufstellten.
Die beobachten uns, stellte Una in Gedankensprache fest.
Lily nickte und warf einen Blick auf Caleb, der die Dachöffnung misstrauisch musterte.
»Das ist unser Anhörungssaal«, erklärte Grace.
»Nettes Büro, Gracie«, murmelte Breakfast kaum hörbar. Doch die Akustik im Saal verstärkte seine Stimme, und seine Bemerkung war laut und klar zu verstehen. Breakfast wand sich vor Verlegenheit.
»Wir nennen ihn übrigens den Anhörungssaal, weil man auch das leiseste Flüstern gut hören kann«, fuhr sie fort und lächelte ihn an. »Hier hat auch die kleinste Stimme Gewicht.«
Sie durchquerten den runden Saal und gingen durch eine der drei Türen an der gebogenen Rückseite. Dann ging es einen langen Flur entlang, durch eine weitere Tür und in eine Privatwohnung.
Endlich, dachte Juliet. Die anderen waren ebenso erleichtert.
»Ihr dürft gern so lange bei mir wohnen, wie ihr wollt«, sagte Grace und begleitete sie in einen luxuriösen Wohnbereich. »Aber jetzt könnt ihr euch erst einmal frisch machen und euch ausruhen. Wir unterhalten uns dann später.«
»Vielen Dank«, sagte Lily und stellte sich neben ihre Schwester.
»Gern geschehen«, antwortete Grace und ließ sie mit einem ihrer Begleiter allein.
Es war der junge Mann, der hinter ihr und Tristan hergerannt war. Er trat vor und lächelte sie an. Jetzt, da sie nicht mehr um ihr Leben rannten, fiel Lily auf, wie gut er aussah.
»Wir haben zwei Räume für euch hergerichtet, wenn ihr mir folgen wollt«, sagte er höflich.
»Ich habe deinen Namen nicht mitbekommen«, sagte Lily und betrachtete seinen Wunschstein. Er war beinahe weinrot. Ein Heiler, dachte sie. Ein sehr mächtiger.
»Ich heiße Toshi Konishi«, stellte er sich vor. »Und ich bin hier oben«, fügte er hinzu und deutete auf sein Gesicht. Lily riss den Blick von seinem Wunschstein los, und sein amüsiertes Lächeln ließ sie erröten.
»Tut mir leid«, murmelte sie. »Mich fasziniert die Farbe deines Wunschsteins. Sind die rosa Steine hier alle so intensiv gefärbt?«
»Nein«, antwortete Toshi. Er sah Lily in die Augen, und ein Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. »Schlafzimmer«, sagte er und machte abrupt kehrt, »hier entlang. Wir haben eines für die Männer vorbereitet und eines für die Frauen, aber ihr könnt die Zimmer natürlich ganz nach Wunsch aufteilen.«
Toshi stieß die erste Tür auf, doch dahinter lag nicht nur ein Schlafzimmer, sondern eine komplette Wohnung mit protzigen Ledersesseln und Möbeln aus glänzendem dunklem Holz.
Lily und ihre Begleiter betrachteten diese Zurschaustellung von Reichtum, ohne eine Miene zu verziehen.
»Die beiden Wohnzimmer sind miteinander verbunden«, erklärte Toshi und führte die Mädchen zu einer Doppeltür.
Das Wohnzimmer der Mädchen war mit einer großen weißen Couch und einer samtbezogenen Liege ausgestattet. Es war hell und luftig, weil es einen großen Balkon gab, und überall standen frische Blumen.
»Eure Zimmer sind auf der anderen Seite«, sagte Toshi. Doch als er die Blicke seiner Gäste bemerkte, runzelte er beunruhigt die Stirn. »Seid ihr mit eurer Unterbringung nicht zufrieden? Wenn euch die Räume ungeeignet erscheinen, sagt mir einfach, was ihr braucht.«
»Sie sind wunderschön. Wir waren nur lange unterwegs«, versuchte Lily zu erklären. »Und wir haben … große Verluste erlitten.«
»Das tut mir leid«, sagte Toshi und wirkte betroffen. »Ihr könnt sicher etwas Ruhe brauchen. Was ihr geschafft habt – allein, wie ihr hergekommen seid –, ist unglaublich.«
Lily musste an die Berge und Flüsse denken, die sie auf ihrer Reise überwunden hatten, und an die Leben, die dabei verloren gegangen waren. Sie lächelte Toshi gequält an und trat hinaus auf den Balkon, während die anderen wortlos eigene Wege gingen, weil jeder eine Weile allein sein wollte. Lily holte tief Luft. Eine blühende Rankpflanze wand sich um das gusseiserne Balkongeländer und hing daran herunter wie lavendelfarbene Locken.
Toshi kam zu ihr auf den Balkon. »Das meine ich ernst«, beteuerte er. »Was ihr vollbracht habt, grenzt an ein Wunder. Die, die ihr verloren habt, wären sicher stolz, wenn sie wüssten, dass ihr es geschafft habt.«
Lily drehte sich nicht zu ihm um. Sie dachte an Tristans Körper, der irgendwo auf einer verbrannten Ebene lag und vermutlich schon in der Sonne verrottete.
Lily richtete ihren Blick auf die Stadt, deren gepflegte Wohnblocks sich wie eine Patchworkdecke vor ihr ausbreiteten. Das Ganze wirkte so ordentlich, dass keine Spur von Hektik aufkam. Jenseits von Bower City entdeckte Lily einen blau funkelnden Streifen.
»Der Ozean«, flüsterte sie.
»Ich kann dich gern hinbringen, wenn du willst«, bot er zögernd an.
Lily ging nicht auf sein Angebot ein. »Sind das Schiffe?«, fragte sie und starrte hinaus aufs Meer.
»Ja.«
Lily drehte sich zu ihm um. »Woher kommen sie?«
»Von überall«, antwortete er mit einem Schulterzucken. Und dann begriff er. »Der Osten ist wegen der Wirkerplage vom Rest der Welt abgeschnitten. Die anderen Länder wollen nicht riskieren, diese Pest einzuschleppen, und vermeiden den Kontakt mit euch, aber diese Gefahr besteht in Bower City nicht.« Er runzelte nachdenklich die Stirn. »Natürlich gibt es auch hier Beschränkungen, und die Einwanderung wird genau überwacht, aber wir handeln mit anderen Ländern.«
»Wer überwacht die Einwanderung?« Lily spürte, wie ihre Wangen zu glühen begannen. Sie biss die Zähne zusammen und kämpfte gegen den Drang, loszuschreien.
»Der Schwarm«, sagte er. »Der Schwarm wacht in Bower City über alles.« Toshis besorgtes Stirnrunzeln war wieder da. »Ich muss dich warnen – versuche, dich zu beherrschen. Sie reagieren heftig auf Gereiztheit.«
Lily betrachtete das lilafarbene Blütenmeer. Die Bienen, die darin herumsummten, schienen sich jetzt mehr für sie zu interessieren als für den Nektar. Immer mehr kamen angeflogen. Toshi merkte es nicht, aber eine war auf seinem Ärmel gelandet. Lily zeigte darauf.
»Pass auf«, warnte sie.
Toshi sah nicht einmal hin. »Man braucht keine Angst zu haben, dass sie einen versehentlich stechen. Solange man sie nicht angreift, tun sie einem nichts. Aber du musst dich um Ruhe und Gelassenheit bemühen.«
»Und wenn man auf eine drauftritt?«, fragte Lily.
»So dumm sind sie nicht«, versicherte er ihr. »Ich habe schon mein ganzes Leben hier verbracht und bin noch nie gestochen worden.«
Lily entspannte sich ein wenig, auch wenn es ihr schwerfiel. Zuzusehen, wie die Arbeiterinnen zwischen den Blütenblättern herumkrochen, war ganz und gar nicht beruhigend. Die Viecher waren immer da. Beobachteten sie. Nur zu gern hätte sie sich jetzt in ein Zimmer zurückgezogen, die Tür abgeschlossen, losgeheult und irgendwelche Gegenstände an die Wand geworfen, aber das ging nicht. Sie musste »gelassen« bleiben.
Trotz der frischen Luft droht man an diesem Ort zu ersticken. Es ist schlimmer als im Kerker, berichtete sie Lillian.
Als Lily wieder aufschaute, merkte sie, dass Toshi sehr dicht neben ihr stand. Auch ihm schien das erst jetzt aufzufallen, und er rückte hastig und etwas verlegen von ihr ab.
»Du bist bestimmt müde«, sagte er und verließ den Balkon. »Soll ich etwas zu essen heraufschicken lassen?«
»Ja, bitte«, sagte Lily und folgte ihm nach drinnen. »Vielen Dank, Toshi.«
Er öffnete die Tür, zögerte aber noch einen Moment. »Gern geschehen«, sagte er und lächelte Lily an. Dann verschwand er.
Lily blieb an der geschlossenen Tür stehen und ging die Unterhaltung in Gedanken noch einmal durch.
»Überlegst du, ihn deiner Sammlung hinzuzufügen?«, fragte Tristan. Seine Haare waren nass vom Baden, und er trug eine der Seidentuniken, die hier alle Männer anhatten, allerdings waren die Bänder an den Handgelenken noch offen. Er sah sehr wütend aus.
»Nein! Ich habe … er hat …«, stammelte Lily. »Das war nicht meine Schuld.«
»Vergiss es«, fuhr er sie an und machte kehrt, um hinauszustürmen.
»Außerdem habe ich keine Sammlung!«, rief Lily hinter ihm her.
Sie hörte ihn aus der anderen Wohnung »Ich sagte, vergiss es!« brüllen und seufzte.
Caleb kam durch die Zwischentür und zog angesichts der Brüllerei eine Grimasse. »Das hätte besser laufen können«, bemerkte er.
»Es war nicht meine Schuld«, beteuerte Lily noch einmal.
»Das ist so ein Hexen-Helfer-Ding. Ich weiß das«, sagte Caleb. »Genau wie Tristan. Er ärgert sich nur, dass die Schlange deiner Verehrer immer länger wird.«
»Es gibt keine Schlange«, widersprach Lily, aber Caleb fuhr fort, als hätte sie gar nichts gesagt.
»Mach dir um Tristan keine Sorgen. Er ist nur sauer auf dich, weil das eine willkommene Ablenkung ist. Es ist einfacher, wütend zu sein, als traurig wegen … nun, wegen allem.«
»Nicht hier«, sagte Lily und stellte fest, dass immer mehr Arbeiterinnen durchs Fenster hereinkamen. Sie machte Caleb darauf aufmerksam und erzählte ihm, wie der Schwarm reagiert hatte, als sie diesen Anflug von Gereiztheit verspürt hatte.
Die wissen, was wir fühlen? Caleb war beunruhigt.
Das bezweifle ich, aber irgendwie spüren sie es, antwortete sie. Und sie lassen keine Wut zu. Tristan hat mich ausgesperrt. Sag du ihm, dass er sich beruhigen soll, und zeig ihm, wieso.
Caleb nahm Gedankenverbindung zu Tristan auf und setzte einen Moment später die Unterhaltung mit Lily fort. Ich hasse diese Stadt.
Du wirst sie gleich noch viel mehr hassen.
Lily ging mit Caleb auf den Balkon und zeigte ihm die Schiffe im Hafen. Sie sagte ihm, dass sie aus aller Welt kämen, und beobachtete, wie er sie anstarrte, atemlos und mit offenem Mund. Sein Blick schweifte in die Ferne, als er sich andere Länder vorstellte, andere Kontinente – und alle frei von Wirkern.
»Wie verhindert Bower City, dass die Wirker auch andere Länder verseuchen?«, fragte er. »Es würde doch schon reichen, wenn sich einer von ihnen in einer Kiste versteckt, die an Bord gebracht wird.«
»Der Schwarm«, antwortete Lily. »Ich bin ziemlich sicher, dass es hier im Westen keine weiteren Wirker gibt. Vermutlich lassen sie einfach keine vorbei, jedenfalls ab dem Punkt, an dem sie uns weggetragen haben. Das war ungefähr auf halber Strecke.«
»Keine Wirker auf der Hälfte des Kontinents«, murmelte er. Das war schwer zu begreifen. »Wieso wussten wir das nicht?«
Die Arbeiterinnen hatten sich nach Tristans Ausbruch wieder beruhigt. Sie sammelten Nektar, summten herum, und die Blüten neigten sich unter der Last ihrer gestreiften Körper.
Toshi sagte, dass die Einwanderung »genau überwacht« wird, setzte Lily die Unterhaltung in Gedankensprache fort. Wenn der Schwarm nur wenige Leute in die Stadt hineinlässt, bezweifle ich, dass viele wieder herausdürfen.
Caleb warf einen Blick nach oben, wo sich gerade eine Kriegerschwester aus ihrem Sichtfeld entfernt hatte. Oder gar keine?, fragte er.
Das werden wir bald wissen.
Ein voll beladener Servierwagen wurde ins Zimmer geschoben, und der Duft des Essens lockte Lily und Caleb hinein. Auch die anderen tauchten aus den Betten und Bädern auf und kamen dazu. Während sie Teller herumreichten, berichtete Lily lautlos, was sie von Toshi erfahren hatte.
Una betrachtete misstrauisch einen Blumenstrauß und sah eine Arbeiterin aus einer Blüte herauskriechen. Sie verpasste Lily einen Stoß mit dem Ellbogen und deutete mit dem Kinn auf die Biene.
Lily nickte kaum merklich und stand auf. Sie hatten schon zu lange schweigend dagesessen. »Ich glaube, ich bin die Einzige, die noch nicht gebadet hat«, sagte sie.
Unterhaltet euch laut, aber seid vorsichtig, wies sie ihren Zirkel an. Ich weiß nicht, wie viel die Arbeiterinnen verstehen, und ich will nicht, dass der Schwarm irgendetwas Privates über uns erfährt, vor allem nicht, woher Breakfast, Una und ich kommen. Soweit es die Leute von Bower City angeht, stammen wir aus dieser Welt.
Gilt das auch für Toshi?, fragte Tristan.
Darauf antwortete Lily nicht. Ihr war klar, dass er nach einer Möglichkeit suchte, seine Trauer nicht spüren zu müssen, und er brauchte jemanden, dem er die Schuld geben konnte. Es half nicht gerade, dass Lily ihm nicht in die Augen sehen konnte. Noch nicht. Nicht so kurz danach.
Sie ging von einem Schlafzimmer ins andere und stellte fest, dass Una und Juliet ihr das größte Zimmer überlassen hatten. Als sie die Blumensträuße betrachtete, die überall herumstanden, erkannte sie auch den Grund dafür. Die Sträuße bestanden aus jeder nur denkbaren Lilienart. Die kurze Freude über Juliets und Unas nette Geste verschwand jedoch sofort, als sie sich fragte, ob ihre Gastgeberin diese Blumen absichtlich oder zufällig gewählt hatte. Lilien wurden gern für Sträuße verwendet, also konnte es durchaus Zufall sein. Ganz abgesehen davon, dass in Bower City niemand ihren Namen schon vor ihrer Ankunft gekannt haben konnte. Trotzdem ließ es ihr keine Ruhe.
Lily zog sich aus, während die große Badewanne volllief. Eines der Badezimmerfenster war ein Stück weit geöffnet und vor dem bodentiefen Spiegel stand eine hohe Glasvase mit langstieligen Tigerlilien. Lily konnte sie zwar nicht sehen, aber sie wusste, dass die Arbeiterinnen da waren und durch das offene Fenster ungehindert ein und aus fliegen konnten.
Der Badeschaum, den sie ins Wasser kippte, war so stark parfümiert, dass Lily niesen musste. Er duftete wundervoll, war aber so konzentriert, dass ihre Haut den Rest des Tages danach riechen würde.
Entweder mochten die Arbeiterinnen den Duft, oder er erleichterte es ihnen, den Menschen auf der Spur zu bleiben. Offensichtlich nahm Lily ihr Schaumbad für den Schwarm. Nachdem sie das erkannt hatte, konnte sie es nicht mehr genießen.
Während sie im Wasser lag, sah Lily zu, wie die letzten Verbrennungen an ihren Händen abheilten. Sie betrachtete die Flasche mit dem Badeschaum genauer und bemerkte, dass er eine Chemikalie enthielt, die ihrer Verbrennungssalbe ähnelte, die sie aber noch nie zuvor gesehen hatte. Das Wasser wurde kalt, denn Lily versuchte, die Zusammensetzung zu analysieren. Es faszinierte sie so sehr, dass sie beinahe Rowan gerufen hätte, damit er sich das Zeug ansah. Allein der Gedanke an ihn nahm ihr den Atem, und sie verscheuchte sein Bild aus ihrem Kopf, als hätte es ihr einen elektrischen Schlag versetzt.
Er hat mich verraten.
Lillian hörte zu. Die Erinnerung, wie Rowan ihr die Wunschsteine weggenommen und sie in einen Käfig gesperrt hatte, flog von Lilys Gedanken zu Lillians.
Er wollte nicht riskieren, dass du wirst wie ich, sagte Lillian. Das kannst du ihm nicht vorwerfen nach allem, was ich ihm angetan habe.
Lillian ließ sie an einer Erinnerung teilhaben …
… Ich höre Rowan auf dem Flur. Gavin versucht, ihn aufzuhalten, aber das ist, als wollte eine Maus einem Löwen den Weg versperren. Ich sehne mich nach ihm, fürchte mich aber auch. Ich wünsche mir so sehr, dass er mich in den Arm nimmt, tröstet und heilt. Aber er darf mich nie wieder berühren, sonst sieht er alles. Er weiß bereits, dass etwas nicht stimmt, denn er versucht, meine Gedanken zu lesen, aber ich lasse ihn nicht in meinen Kopf. Wenn ich ihm erlaube, mich zu berühren, wird er die Krankheit erkennen, die ich aus der verbrannten Welt mitgebracht habe, und dann kann ich ihm die Geschichte unmöglich verheimlichen. Ich werde auf keinen Fall für mich behalten können, was in der Scheune passiert ist.
Er stürmt durch die Tür. An seiner Reitkleidung klebt noch der Dreck des Außenlandes. Er hat mich gesucht, seit ich drei Wochen zuvor verschwand, und seine Augen blicken müde, und seine Haut ist ganz bleich vor Sorge. Er ist einfach umwerfend. Es schnürt mir die Kehle zu, und ich unterdrücke den Drang, ihn zu rufen. Ich will ihn anflehen, dass er zu mir kommt und alles wiedergutmacht, aber ich bin kein kleines Mädchen mehr und weiß, dass es nie wieder gut wird.
Ich kann jetzt nur noch eines tun: dafür sorgen, dass meine Welt nicht zu einer der Millionen verbrannten Welten wird, die uns zunehmend einkesseln. Ihre Zahl wächst, weil Versionen von Alaric die dreizehn Bomben in den dreizehn Städten zünden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das auch hier geschieht. Es sei denn, ich kämpfe dagegen an.
»Wo warst du?«, fragt Rowan. Seine Stimme bebt. Er weiß, dass etwas Schlimmes passiert ist. Und dass unsere Beziehung, alles, was wir füreinander empfunden haben, vorbei ist. Er hat es nur noch nicht richtig begriffen.
»Das kann ich dir nicht sagen«, antworte ich.
Er lacht, als wäre die Vorstellung, dass wir Geheimnisse voreinander haben, total abwegig. Ich sehe ihn an, bis sich sein Gesichtsausdruck verändert. »Du meinst das ernst?«, fragt er und kann es immer noch nicht glauben.
Er betritt den Raum und will zu mir kommen. Ich mache etwas, was ich nicht mehr getan habe, seit ich acht und er zehn Jahre alt war. Ich ergreife Besitz von seinem Körper und halte ihn auf.
»Das ist weit genug«, wispere ich. Ich lasse ihn frei, und er schnappt panisch nach Luft, nicht, weil ich ihm das Atmen nicht erlaubt hätte, sondern nur, um sich zu vergewissern, dass er es wieder eigenständig tun kann.
»Was ist los?« Er steht unter Schock. Jetzt weiß er es. Ich werde ihm das Herz brechen, und er hat keine Ahnung, wieso. Es ist, als würde man jemandem zusehen, der in die Tiefe stürzt – sein entsetztes Gesicht entfernt sich weiter und weiter, und er greift hektisch ins Leere. Ich bin Luft, weniger als Rauch, und er fällt glatt durch mich hindurch.
Auch wenn ich ihn mehr liebe als mich selbst, wird er es nie erfahren. Vor allem nicht, wenn er herausfindet, dass ich seinen Vater verhaften ließ und befohlen habe, ihn hinzurichten …
Das reicht, sagte Lily und beendete damit die Erinnerung. Ich will jetzt nicht an ihn denken. Sie verdrängte das Bild von Rowans Gesicht gewaltsam aus ihrem Kopf.
Du willst nie wieder an ihn denken. Richtig.
Lily hatte jeden Gedanken an ihn sofort verbannt, seit er sie so verletzt hatte. Auf ihrer gesamten Reise hatten ihre Emotionen sie jedes Mal überwältigt, wenn sie an Rowan dachte.
Lily stieg aus der Wanne und schlang sich ein dickes Handtuch um den Körper. Im Schrank fand sie drei leichte Kimonokleider zur Auswahl. Sie fuhr mit den Fingern über die gelbbraune Seide eines Kleides und stellte fest, dass die Farbe perfekt zu ihrem Hautton passte. Daneben hingen ein saphirblauer und ein jadegrüner Kimono. Sie nahm den grünen, schlüpfte hinein und stellte sich vor den Spiegel, um den Obi zu binden.
Sie rieb etwas Conditioner in ihre Locken und drehte sie zu einem Dutt, den sie mit einem der vielen verzierten Haarnadeln, Kämme und Clips feststeckte, die in einer Schale neben dem Waschbecken lagen. Wie merkwürdig, Gästen so etwas hinzustellen, dachte sie. Es sei denn, man weiß, dass dieser spezielle Gast Haare hat, die schwer zu bändigen sind.
Lily warf einen letzten Blick in den Spiegel und bekämpfte den Impuls, verächtlich das Gesicht zu verziehen. Ihr Anblick hatte nichts damit zu tun, was in ihr vorging, und das widerte sie an. Viel lieber hätte sie so schrecklich ausgesehen, wie sie sich fühlte.
Verbirg zwei deiner Wunschsteine, ermahnte Lillian sie.
Lily steckte den rosafarbenen und den goldenen Stein in eine Falte ihres Obi und rückte den rauchgrauen Stein so zurecht, dass er deutlich sichtbar auf ihrem Brustbein lag.
Auf dem Weg durchs Zimmer kam Lily am frisch bezogenen Bett vorbei und wunderte sich, wieso sie gar nicht müde war. Statt sich hinzulegen, ging sie zurück ins Wohnzimmer, wo ihr Zirkel saß, satt, gebadet und in die farbenfrohe Kleidung ihrer Gastgeberin gehüllt. Toshi war wieder da und hatte wohl gerade etwas Lustiges erzählt, weil alle lachten. Sogar Tristan, wie Lily bemerkte. Das Gelächter erschien ihr unpassend, und sie war sofort gereizt.
»Lily«, sagte Toshi. Er stand auf, lächelte, und sein Blick wanderte über ihren ganzen Körper. »Die Farbe steht dir.«
»Ich finde, man kann das nur tragen, wenn man rote Haare hat.« Sie beobachtete Toshi genau. »Gibt es viele Rothaarige in Bower City?«
»Nein«, sagte er. »Es gibt ein paar Blonde russischer Abstammung, aber die meisten von uns haben eher dunklere Haut und schwarze Haare.«
»Ein bemerkenswerter Zufall«, stellte Lily fest.
»Ja, bestimmt«, antwortete er. Er ließ sich nicht die Spur von Verlegenheit anmerken, und Lily fragte sich, ob es vielleicht wirklich nur Zufall gewesen war. »Ich habe den anderen gerade angeboten, euch etwas von der Stadt zu zeigen«, fuhr Toshi fort, als er merkte, dass Lily das Thema nicht weiterverfolgen würde. »Du hast dich doch für den Hafen interessiert.«
»Das geht mir genauso«, sagte Juliet.
Lily sah ihren Helfern an, dass auch sie gern mehr von der Stadt sehen würden. Eigentlich hätten sie müde sein müssen, aber sie waren hellwach. Sie bedeutete Toshi, dass es losgehen konnte. Er führte sie die prunkvolle Treppe hinunter, über die sie nach oben gelangt waren, doch in der hohen Eingangshalle schlug er eine neue Richtung ein und ging mit ihnen nicht durch den Anhörungssaal, sondern öffnete eine andere Tür. Sie führte hinaus auf eine breite Straße. Gegenüber befand sich ein gepflegter Park, umgeben von vornehmen Villen.
»Ist das der hübsche Teil der Stadt oder der hübschere?«, fragte Una.
»Der hübschere, vermute ich«, sagte Breakfast. Er wedelte sich Luft ins Gesicht und atmete tief ein. »Ich rieche Geld.«
»Ehrlich?« Toshi lächelte wieder einmal, und rund um seine Augen bildeten sich Lachfältchen. »Hier wohnen die meisten Senatoren, weil das nicht weit vom Forum entfernt liegt«, erklärte Toshi. »In der Gegend, aus der ich komme, wird diese Straße allerdings nur Palavergasse genannt.«
Das brachte ihm ein Kichern von Una und Breakfast ein.
»Wo bist du aufgewachsen?«, fragte Lily und unterbrach damit absichtlich den heiteren Augenblick. Sie konnte Gelächter im Moment nicht ertragen.
»Ich hatte eigentlich vor, euch mein Viertel zu zeigen«, sagte er und senkte den Blick. »Wir müssen aber die Bahn nehmen, weil es ein weiter Weg ist.«
Am Ende des Blocks überquerten sie eine Straße, auf der viele Fußgänger unterwegs waren, und warteten. Lily betrachtete das Gleis, das parallel zum Gehsteig verlief, konnte aber keine Stromschienen entdecken. Es waren auch keine Oberleitungen zu sehen.
»Wie werden die Züge angetrieben?«, fragte sie.
»Sie fahren elektrisch«, antwortete Toshi. »Die Akkus an der Unterseite halten zwölf Stunden, dann muss der Zug zum Aufladen ins Energiedepot.«
»Wie gewinnt ihr die Energie?«, fragte sie.
»Von Crucibles und Hexen, genau wie in eurer Stadt«, sagte er mit einem Schulterzucken.
»Und Helfern?«
»Da wir keine Energie umwandeln können, unterstützen wir sie, indem wir ihre Körperfunktionen überwachen, während sie arbeiten, aber überwiegend konzentrieren wir uns darauf, neue Materialien, Medikamente und andere Dinge zu erschaffen, die in der Stadt gebraucht werden. Wir sind zwar nicht vereinnahmt worden, leisten aber trotzdem unseren Beitrag.«
»Wie den Badeschaum«, bemerkte Lily.
»Interessantes Zeug«, bestätigte Tristan nachdenklich.
»Die Formel wurde von einem Helfer aufgestellt. Schon vor vielen Jahren«, sagte Toshi. Er schaute beim Sprechen die Straße hinunter und machte ein gelangweiltes und desinteressiertes Gesicht.
Dieser Trick brachte Lily zum Schmunzeln. Die beste Art, etwas langweilig erscheinen zu lassen, war, sich gelangweilt zu geben.
»Was kann er noch?«, hakte sie nach. »Abgesehen davon, dass er Wunden heilt und neue Energie verleiht?«
»Er verlangsamt den Alterungsprozess. Hilft bei der Abwehr von Krankheiten …« Er verstummte. »Alle Bürger Bower City’s benutzen diesen Schaum.«
Eine Bahn tauchte auf und Toshi deutete darauf. »Der Zug hält nur alle fünfzehn Blocks, aber wenn die Fahrer sehen, dass jemand wartet, werden sie so langsam, dass man auf- und abspringen kann. Ist das okay für euch?«
Alle nickten zustimmend. Als der Zug heranrollte, verlangsamte er sein Tempo so weit, dass sie mühelos aufspringen konnten. Trotzdem konnte es sich Toshi nicht verkneifen, beim Einsteigen Lilys Ellbogen zu halten.
»Greif nach der Haltestange«, sagte er und lenkte ihre Hand zu der in Kopfhöhe angebrachten Messingstange, die das Aufspringen erleichtern sollte.
»Was ist mit alten Leuten oder Menschen mit Behinderungen?«, fragte Juliet. »Wie steigen die ein oder aus?«
»Siehst du den inneren Schienenstrang?« Toshi zeigte auf eine zweite Strecke, die in der Straßenmitte verlief. Alle paar Blocks gab es überdachte Haltestellen mit Bänken und auf einer davon sah Lily eine Frau mit einem Baby und einem Haufen Tüten. »Diese Bahn hält alle fünf Blocks an. Sie fährt auch viel langsamer und eignet sich deshalb besonders für Leute, die nicht mehr so beweglich sind. Allerdings gibt es kaum jemanden, der wegen einer Erkrankung damit fahren muss. Unsere Medizin ist recht weit fortgeschritten.«
»Ihr habt den Badeschaum«, sagte Una.
»Wir haben den Badeschaum«, bestätigte er mit einem Kichern.
Lilys Blick fiel auf seinen dunkelrosa Wunschstein, und sie vermutete, dass er einen Beitrag zu diesem medizinischen Fortschritt geleistet hatte. Da war so viel Potenzial in seinem Stein, dass sie es in seinen Facetten schimmern sah, ähnlich einem Flüstern auf einem dunklen Flur. Der Zug wurde langsamer, damit weitere Fahrgäste aufspringen konnten, was die Passagiere an Bord ins Wanken brachte. Das Abbremsen ließ Lily dichter an Toshi heranstolpern, und sie hörte auf, seinen Stein anzustarren. Stattdessen sah sie ihm ins Gesicht. Seine Lippen verzogen sich zu einem Lächeln.
Sie schaute hastig weg, und um ihre Verlegenheit zu überspielen, suchte sie unter den Fahrgästen nach welchen, die man als weniger beweglich bezeichnen konnte. Da waren zwar ältere Leute, aber sie wirkten recht fit. Sogar die weißhaarigen Alten hatten den geraden Rücken, die rosige Haut und den energischen Schritt wesentlich jüngerer Menschen.
So etwas kann man also erreichen, wenn sich mehrere Generationen von Helfern aufs Heilen konzentrieren, statt in den Krieg zu ziehen, meldete sich Lillian zu Wort. Rowan würde es hier gefallen.
Lillian teilte eine weitere Erinnerung an Rowan mit ihr, bevor Lily sie blockieren konnte …
… Ich schleiche mich von hinten an. Das Zimmer ist dunkel. Rowan ist voll konzentriert, und das magische Licht seines Steins leuchtet dunkelrot. Er arbeitet an einem komplizierten Zauber, der seine ganze Aufmerksamkeit erfordert. Ich hasse es, dass er sich um andere Dinge kümmert und nicht um mich. Das gebe ich zu. Ich bin eifersüchtig auf alles, das ihn von mir ablenkt, und ich werde ihn dafür bestrafen.
Ich lasse die Luft um mich herum verstummen. Ich setze die Füße lautlos auf. Ich höre auf zu atmen und will mich auf ihn stürzen …
»Ich weiß, dass du da bist, Lillian«, murmelt er, ohne sich mir zuzuwenden.
»Wie machst du das?«, frage ich empört. Es ist mir noch nie gelungen, ihn zu überraschen.
»Du trampelst wie eine ganze Büffelherde«, neckt er mich und dreht seinen Stuhl zu mir um. Ich stürze mich trotzdem auf ihn. Er hält mich fest und fängt an zu protestieren, während ich sein Gesicht mit Küssen bedecke.
»Hör auf, Lillian«, knurrt er. »Ich muss arbeiten.«
»Es ist schon spät. Komm ins Bett«, erwidere ich und verziehe beleidigt das Gesicht, als er sich aus meiner Umarmung befreit.
»Ich habe tagsüber keine Zeit für diese Arbeit«, verteidigt er sich. »Wir hatten so viel damit zu tun, die anderen Zirkel unter Kontrolle zu halten. Ich musste in den letzten zwei Tagen drei Duelle beaufsichtigen.«
»Exeter und Richmond mal wieder«, bemerke ich mit einem Seufzer. »Wir können nur froh sein, dass sie sich damit zufriedengeben, sich nur zu duellieren, statt ihre Helfer in voller Bewaffnung aufeinanderzuhetzen.«
»Ich fürchte, dazu kommt es bald«, sagt er mit einem besorgten Stirnrunzeln. Dann verdreht er die Augen. »Hexen. Ständig auf der Suche nach einer Ausrede, ihre Helfer anzufeuern.«
»Wir kämpfen nun mal gern«, erwidere ich mit einem Achselzucken. Mein Blick fällt auf die Bechergläser auf seinem Tisch. »Woran arbeitest du überhaupt?«
»Das weiß ich noch nicht«, gesteht er mit einem verlegenen Grinsen. »Ich habe einen interessanten Bestandteil eines Tintenfischs isoliert –«
»Ein Tintenfisch?«, unterbreche ich ihn empört. »Du ignorierst mich wegen eines Tintenfischs?«
Jetzt muss er doch lachen und schüttelt den Kopf. »Gegen dich kann ich wohl nie gewinnen.«
»Natürlich kannst du das«, sage ich und ziehe ihn an einer Hand hinter mir her in Richtung Schlafzimmer. Mein Lächeln ist ein Versprechen. »Ich werde dich gleich jetzt gewinnen lassen.«
Sein Lachen klingt fast wie ein kehliges Schnurren. Er bleibt stehen, zieht mich an sich und drückt mich an seine Brust. »Du kriegst doch immer, was du willst«, flüstert er, und sein Mund nähert sich meinem …
Lily sprang wieder zurück in die Gegenwart. Ihre Wangen waren ganz rot. Das reicht, Lillian. Wieso zeigst du mir das?
Damit du merkst, wie sehr du ihn vermisst. Du solltest ihm vergeben.
Lily versperrte ihre Gedankenwelt vor ihrem anderen Ich.
Rowan. In Lillians Erinnerung war er jünger gewesen. Die beiden hatten so vieles miteinander geteilt, von dem Lily nichts wusste. Im Grunde hatten sie gemeinsam ein Land regiert. Diese Vorstellung löste ein Gefühlschaos in ihr aus, in dem sie sich zu verlieren glaubte. Sie wusste nicht, ob es Eifersucht war oder der Schock, Rowan in Lillians Erinnerung körperlich so nah gewesen zu sein, aber es traf sie vollkommen unvorbereitet und brachte sie aus dem Gleichgewicht. Sie schaute auf und musste feststellen, dass Toshi sie leicht amüsiert beobachtete. Lily drehte verlegen den Kopf weg und starrte aus dem Fenster.
Sie fuhren mehr als zwanzig Minuten mit der Bahn und kamen durch verschiedene Viertel. Der Baustil wechselte von italienischen Villen über Innenstadt-Lofts zu japanischen Holztempeln mit Felsengärten und Schiebewänden aus Papier anstelle von Mauern. Es gab sogar ein chinesisches Viertel, in dem unzählige Leute unterwegs waren. All diese Viertel waren sehr gepflegt, ordentlich und sauber. Überall wuchsen Blumen. Sie wucherten in Fenstern, auf Dächern und säumten die Straßen. Es gab auch viele Parks, und Lily fiel auf, dass in jedem von ihnen vier Türme standen, jeweils in den Ecken. Sie waren höher als alle Gebäude, aber nicht so hoch wie die Grüntürme im Osten, und sie waren auch nicht bewachsen. Es waren spindlige Bauwerke, leicht zu übersehen und mit einer Plattform am oberen Ende.
»Was hat es damit auf sich?«, fragte Lily Toshi und zeigte auf einen der Türme.
»Oh, die sind für den Schwarm«, antwortete er ganz selbstverständlich. »Die Kriegerschwestern kommen selten hinunter auf die Straße.« Er drehte sich in Richtung Ozean. »Nur noch ein paar Blocks.«